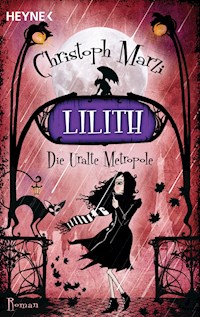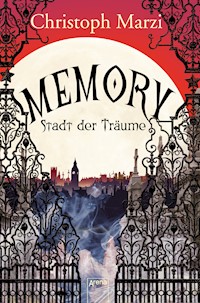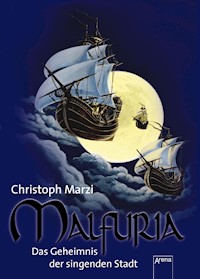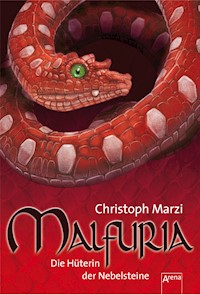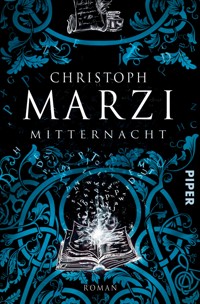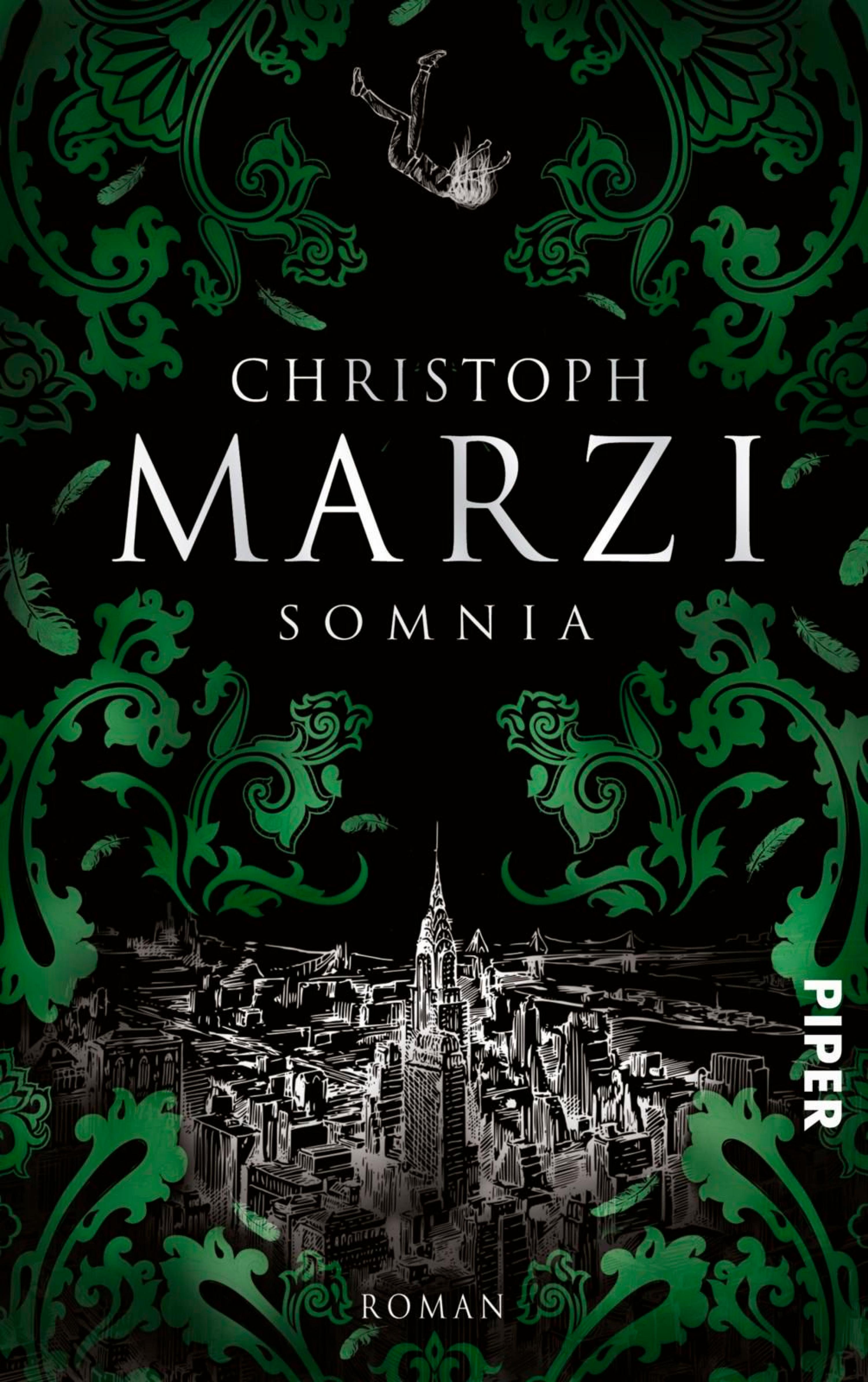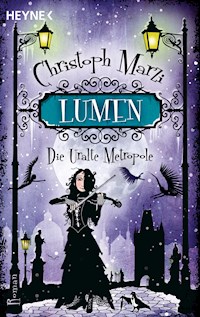
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die uralte Metropole-Reihe
- Sprache: Deutsch
Mysteriöse Gestalten huschen durch die Dunkelheit, Menschen verschwinden und fremde Nebel suchen die Stadt der Schornsteine heim. Erneut muss das Waisenmädchen Emily begleitet von ihrem Mentor, den mürrischen Alchemisten Wittgenstein, in die geheimnisvolle Welt unterhalb Londons hinabsteigen und der Spur eines dunklen Rätsels folgen.
Mit seinen preisgekrönten Erfolgsromanen „Lycidas“ und „Lilith“ eroberte Christoph Marzi in kürzester Zeit die Herzen zahlloser Leser. In „Lumen“ findet die märchenhafte Geschichte um Emily und ihre Gefährten nun ihren atemberaubenden Höhepunkt – einmal mehr verwebt der Autor die viktorianische Atmosphäre eines Charles Dickens mit dem Zauber von Harry Potter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 931
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Christoph Marzi
Lumen
Roman
Copyright
Originalausgabe 11/2006
PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © 2006 by Christoph Marzi
Copyright © 2006 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Umschlagillustration: Dirk Schulz
ISBN 978-3-89480-979-9
www.pep-ebooks.de
Inhaltsverzeichnis
Buch IKapitel 1Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Buch II Zwischenspiel Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Buch III Zwischenspiel Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Danksagung Über das Buch Über den AutorCopyright
Für Tamara
»come what may«
Everybody needs a place to rest
Everybody wants to have a home
Don’t make no difference what nobody says
Ain’t nobody like to be alone.
Bruce Springsteen, Hungry Heart
The stars are not wanted now: put out every one;
Pack up the moon and dismantle the sun;
Pour away the ocean and sweep up the wood.
For nothing now can ever come to any good.
W.H. Auden, Twelve Songs
Buch I
Lüge
Kapitel 1
Grosse Erwartungen
Die Welt ist gierig, und manchmal umschließen Nebel unsere Herzen, bis wir uns nicht einmal mehr daran erinnern können, wann unsere Träume zu sterben begannen. Emily Laing, die ihren Himmel gefunden zu haben glaubte, war achtzehn, als ihre Mutter starb und die Stadt der Schornsteine von fremden Nebeln heimgesucht wurde, die wie eine Krankheit durch die Straßen flossen und in deren trüber Schattenhaftigkeit sich Allerschlimmstes verbarg.
»Werden sie uns töten?«
Die Feuchtigkeit, die allgegenwärtig ist in den Verliesen tief unterhalb der City Thameslink, lässt mich husten. »Fragen Sie nicht«, antworte ich leise und lausche den Schritten, die sich der Zellentür nähern.
Das Mädchen, das mir einst am Fuße der Rolltreppe in der Tottenham Court Road anvertraut worden war, sieht müde und verängstigt aus. Struppiges rotes Haar fällt über das helle Mondsteinauge, in dem sich einst so große Erwartungen gespiegelt hatten. Erwartungen, die am Ende aber doch unerfüllt geblieben waren und dem Auge, das Emily insgeheim noch immer vor der Welt zu verbergen suchte, den einstigen Glanz genommen haben.
Dann flüstere ich dem Mädchen leise zu: »Treten Sie von der Tür zurück.«
»Was haben Sie vor?«
Ich werfe ihr hastig einen nervösen Blick zu.
»War bloß eine Frage«, murmelt sie beleidigt, schweigt dann aber und leistet meiner Anweisung Folge.
Jemand schiebt langsam einen Schlüssel in das Schloss, und ein rostiges Knirschen frisst sich in die Stille, die uns seit Stunden schon umgibt. Die uralten Eisenscharniere setzen sich in Bewegung, und das, was sich dahinter verbirgt, wird gleich sein Gesicht zeigen.
Doch sollte ich meiner Erzählung nicht vorgreifen. Lassen Sie uns die Geschichte dort beginnen, wo sie ihren Anfang genommen hat. Lauschen Sie still meinen Worten und folgen Sie mir nach London, der Stadt der Schornsteine am dunklen Fluss, hinüber zum alten Raritätenladen am Cecil Court, wo die hölzernen, bis hinauf zur Decke reichenden Regale und die dürftige, matte Beleuchtung allzeit den Eindruck erweckten, man befände sich in einer behaglichen Höhle, irgendwo ganz tief unter der Erde. Die labyrinthischen Gänge erfüllte eine wohlige Stille, die nur von den behutsamen Schritten auf den knarzenden Dielen und dem bei stürmischem Wetter gegen das milchige Glasfenster prasselnden Regen durchbrochen wurde. Wenn überhaupt, dann wurde hier nur äußerst leise gesprochen. Niemals hatte es laute Worte im Laden gegeben, bloß jenes dahingehauchte Flüstern, das sich mit dem wispernden Geräusch in Büchern blätternder Finger zu einem Bild voller staubiger Farben vermischte. Kaufte einer der wenigen Kunden, die sich hierher verirrten, etwas – Buch, Foliant oder gar Nippes –, dann spielte die mächtige Registrierkasse eine rostige Melodie.
An diesem Ort fühlte sich Emily Laing zu Hause.
Der alte Raritätenladen und das Haus in Marylebone, in dem sie eine kleine Dachkammer bewohnte, die so unordentlich und unaufgeräumt war wie sie selbst, waren die Orte, an denen sie Ruhe fand und sich sicher und geborgen fühlte, geschützt vor den kalten Winden und Schneestürmen, die draußen in London wüteten, und auch vor den seltsamen Nebeln, von denen immer häufiger berichtet wurde und die an den unterschiedlichsten Stellen in London und der uralten Metropole gesichtet worden waren.
Manchmal sprachen die Kunden über die Nebelerscheinungen, aber keiner wusste etwas Genaues.
»Nebula mala«, so nannten die Tunnelstreicher die Nebel, die, glaubte man den Berichten, schleichend aus dem Nichts auftauchten und ebenso schnell wieder verschwanden.
Wie dem auch sein mochte – an jenem Tag, als Emily von der Neuigkeit erfuhr, die ihr junges Leben erneut verändern sollte, hatte sich kaum Kundschaft in den Laden verirrt, und sie hatte den Nachmittag damit verbringen können, die restlichen Schulaufgaben zu erledigen und in einem Buch über die Geschichte der Grafschaft Kensington zu schmökern. Edward Dickens, der Eigentümer des alten Raritätenladens, war den ganzen Tag abwesend, und so saß Emily nun einfach nur da, beobachtete die Schneeflocken, die sich wie kleine, helle Sterne auf den Fensterscheiben niederließen, und fragte sich, ob sie sich bezüglich der sporadisch auftauchenden Nebel sorgen sollte oder nicht.
Ein wenig verloren sah sie aus in dem dunklen Rollkragenpullover und der schwarzen Jeans, die ihre bevorzugten Kleidungsstücke im Winter waren, weil sie sich mit ihnen, wie sie glaubte, unauffällig durch die Stadt bewegen konnte und kaum Blicke auf sich zog. Die roten Haare trug sie nun länger. Sie wirkten meist so, als sei sie gerade erst aufgestanden. Und noch immer fiel eine lange Strähne über ihr Mondsteinauge, das gegen ein sorgfältig modelliertes Auge aus Glas zu ersetzen sie sich immer noch beharrlich weigerte.
»Das Mondsteinauge ist ein Teil von mir und wird es immer sein«, pflegte sie trotzig zu bemerken, wenn andere Schüler es wagten, sie darauf anzusprechen. Zudem war es das erste richtige Geschenk in ihrem Leben gewesen.
»Der Mondstein«, hatte ich ihr erklärt, »nimmt die Angst vor der Zukunft. Er besitzt die Kraft der Jugend und schenkt Lebensfreude.«
Ganz zaghaft hatte sie damals das neue Auge berührt. »Es fühlt sich lebendig an, Wittgenstein.«
Ich hatte damals gehofft, dass ihr das Mondsteinauge einige der schlimmen Erinnerungen an Rotherhithe nehmen würde. Daran, dass sie im Alter von sechs Jahren infolge unglücklicher Verquickungen das Licht des linken Auges hatte einbüßen müssen.
Fremden Menschen war Emily meist mit Misstrauen und Argwohn begegnet.
»Ich weiß, dass die Menschen mich nur wegen des Auges anstarren.«
»Eines Tages«, hatte ich ihr versichert, »werden Sie jemandem begegnen, der Sie gerade wegen Ihres Mondsteinauges lieben wird.«
Damals hatte ich nur ein Achselzucken geerntet.
Nicht lange darauf jedoch war meine Schutzbefohlene einem Jungen begegnet, der den Blick gar nicht mehr hatte abwenden können von ihr. Der sie mit seinen dunklen Augen angeschaut und das verunsicherte Herz des jungen Waisenmädchens in eben jenem Augenblick erobert hatte, als sie einander zum ersten Mal über den Weg gelaufen waren.
Zwei Jahre schon lag dieser Augenblick zurück, und noch immer war er mehr Gegenwart als Vergangenheit für Emily. Noch immer waren Adam Stewart und sie ein Paar, und sie lächelte, das sei hier angemerkt, viel öfter, als sie es früher getan hatte.
Und wenn Emily allein im alten Raritätenladen saß, dann hing sie manchmal Tagträumen nach, die so angefüllt waren mit großen Erwartungen, dass sie mühelos den Werken der großen Romantiker das Wasser hätten reichen können. Endeten nicht all die Klassiker und Filme mit einem guten Ende? Doch wann erfuhr man schon, wie das Leben nach diesem Ende weiterging? Was geschah mit den Liebenden, nachdem sie ihren Himmel gefunden hatten? Immer führte dieser Gedanke sie auf Pfade, die zu beschreiten sie noch nicht bereit war. Zu viele Menschen, die einst ihren Himmel gefunden hatten, verloren sich irgendwann im Labyrinth des Lebens und blieben auf ewig Verirrte. Die Pfade, denen diese Gedanken folgten, führten zu Gesichtern, die Emily schon seit langer Zeit nicht mehr gesehen hatte.
Das Läuten der Klingel, die über der Tür baumelte, ließ Emily das Grübeln beenden.
»Adam!«
Der Junge, der eingetreten war, schüttelte den Schnee von seiner Jacke und aus den Haaren, stapfte kurz den Matsch von den Schuhen, lächelte und ging zu ihr.
»Emmy!« Er küsste sie sanft auf den Mund und strich ihr das Haar aus dem Gesicht.
»Was ist los?« Emily spürte, dass etwas anders war als sonst, und die unbeschwerte Fröhlichkeit, die er zur Schau trug, schien ihr unecht zu sein. Also reagierte sie misstrauisch, wie es nun einmal ihre Art war.
»Es hat sich etwas ergeben«, offenbarte ihr Adam. Zögerlich zwar, aber die Entschlossenheit in den dunklen Augen war etwas, was Emily zuvor noch nicht in ihnen erblickt hatte. »Etwas, was ich mir schon all die Jahre über gewünscht habe.«
Emily spürte, wie sie instinktiv auf Distanz ging.
Adam stand vor ihr und sah sie ernst an.
»Was ist los?«
Er umarmte sie ganz schnell und hob sie dabei hoch. »Etwas Wunderbares, Emmy.«
Das Mädchen mit dem roten Haar zog ein Gesicht. »Lass mich runter, Adam. Ich mag das nicht.« Und nachdem er ihrem Wunsch entsprochen hatte: »Los, raus mit der Sprache! Was ist das für eine Neuigkeit, die mir zu unterbreiten du nicht erwarten kannst.«
»Ich habe ein Engagement.«
Sie hatte es vage geahnt.
Die ganze Zeit schon.
»Wo?«
»In Paris.«
Emily starrte ihn an.
Stille wurde zwischen ihnen geboren.
So absolut, dass sie schon schmerzte.
Schließlich fragte er: »Und?«
»Und was?«
»Freust du dich nicht?«
Sie wollte nicht glauben, was sie da hörte. »Weshalb, in aller Welt, sollte ich mich freuen?«
»Es wäre mein erstes richtiges Engagement.« Die leuchtenden Augen ließen keinerlei Zweifel daran aufkommen, wie wichtig dies alles für ihn war. »Das Le Chat Noir nimmt mich für die gesamte Winterspielzeit als Solist, und wenn ich Glück habe, dann verlängern sie den Vertrag für einen Sommer. Sie planen eine Revue, etwas über Poe.« Ganz verträumt fügte er hinzu: »Und vielleicht lassen sie mich irgendwann einmal sogar ein eigenes Stück komponieren. Toulouse würde bestimmt gerne die Texte dazu schreiben. Etwas ganz Spektakuläres. Wäre das nicht toll?«
Ein Kunde betrat den Laden und steuerte zielstrebig ein Regal an.
Emily warf Adam einen bösen Blick zu und erkundigte sich bei dem Kunden, der, dem Abzeichen an seiner Jacke nach zu urteilen, zur Leyton-Gilde gehörte, ob sie ihm helfen könne. Der Kunde, der tatsächlich ein fahrender Händler war, verneinte und stöberte durch die Reihen alter Bücher.
Gut so.
Zurück zu Adam.
»Du wirst also ein halbes Jahr in Paris sein. Wenn nicht gar länger.«
Adam sah schuldbewusst aus. »Du kannst mitkommen.«
»Um was zu tun?«
Die Zeit totzuschlagen und darauf zu warten, dass ihr Freund Zeit für sie hatte?
»Du könntest mir helfen.«
»Wobei?«
Auch darauf wusste er nur eine dürftige Antwort. »Du könntest etwas schreiben. War das nicht einmal ein Teil deines Traums gewesen? Eine richtige Geschichte zu schreiben? Oder …«
»Was?«
»Emmy, wir könnten so viele Dinge tun.«
Der Kunde, der sich dazu entschieden hatte, nichts zu kaufen, verließ den Raritätenladen.
Endlich!
Emily hasste es, Gespräche dieser Art vor den neugierigen Ohren Fremder führen zu müssen, zudem, wenn sie sich noch kurz vor Ladenschluss hierher verirrten. »Sei kein Narr, Adam. Ich spreche kein Französisch, und außerdem mag ich Paris nicht sonderlich. Und das, was wir dort erlebt haben, war auch nicht unbedingt ein Anreiz, die Stadt auch nur einen Deut mehr zu mögen.«
»Du könntest es versuchen.«
»Nein!«
»Emmy, bitte.«
»Nein, verdammt noch mal!«
So ging es weiter.
Ein Wort ergab das andere.
Emily war gleichermaßen traurig und wütend, und ihre Antworten wurden immer schnippischer und verletzender, weil sie mit jedem von Adams Worten selbst ein wenig mehr verletzt wurde.
»Die Musik«, versuchte Adam ihr geduldig zu erklären, »ist mein Leben. Das weißt du doch.« Seine Ruhe und die gönnerhafte Geduld machten Emily in diesem Moment einfach rasend. Wie konnte er nur dermaßen gefasst sein in einem Augenblick, der so entscheidend war für ihrer beider gemeinsames Leben?
»Ich dachte, dass ich dein Leben wäre.«
»Das ist etwas anderes.«
»Ach, ist es das?«
»Es ist nur für kurze Zeit.«
»Ein halbes Jahr ist keine kurze Zeit, Adam. Es ist eine Ewigkeit.« Sie wollte nicht schwach wirken. Niemals! »Aber wenn die Musik dein Leben ist, dann will ich dich natürlich nicht aufhalten.« Sie musste schlucken und spürte, wie es ihr in den Augen brannte. »Geh nach Paris und tu, was du nicht lassen kannst.«
»Im Sommer werde ich wieder bei dir sein.«
Da!
War die Entscheidung also nicht längst gefallen?
»Im Sommer wird die Welt eine andere sein.« Sie war sich nicht einmal sicher, ob er verstanden hatte, was sie meinte. »Herzen hören auf zu schlagen, wenn ihrem Klang niemand mehr zuhört. Hast du auch daran gedacht?«
»So darfst du nicht reden.«
Er war so versöhnlich. Und die Ruhe, die sie sonst so an Adam schätzte, wirkte plötzlich gegenteilig auf sie. Er schien mit einem Mal so berechnend, und sie hatte das Gefühl, mit einem ganz anderen Menschen zu reden als demjenigen, dem sie einst ihr Herz geschenkt hatte.
»Ich rede«, schrie sie ihn an, »wie es mir passt!« Dann nahm sie eines der Bücher, die vor ihr lagen, und warf es mit aller Kraft auf den Boden, und die Stille im Raritätenladen zersplitterte in tausende stummer Aufschreie eines Mädchens, das geglaubt hatte, seinen Platz in der Welt gefunden zu haben.
»Wittgenstein hat Recht, wenn er sagt, dass man die Dinge beim Namen nennen soll. Worte können so viel verschleiern, Adam, das solltest du wissen. Wenn du nach Paris gehst, dann bist du fort. Ganz einfach. Du bist fort. Keine schönen Worte. Ich will jetzt nichts Besänftigendes hören, verstehst du?! Wenn du nach Paris gehst, dann bist du nicht mehr in London. Du bist fort. Auf und davon.« Sie machte eine Pause. »Du bist nicht mehr bei mir, und das ist genau das, was dann ist.«
Adam schwieg nachdenklich, wendete den Blick aber nicht von ihr ab.
»Und schau mich nicht so an!«, herrschte Emily ihn an.
Schweigen.
Lauter, als Emily Stille jemals empfunden hatte.
Dann, nach einer Weile, ergriff Adam ihre Hand. »Du musst das verstehen, Emmy. Wie oft haben wir schon darüber gesprochen.«
Sie seufzte. »Ich weiß, dass die Musik dein Leben ist.« Sie musste daran denken, wie sie den Jungen mit dem zerwuschelten Haar und den warmen dunklen Augen in der Metro kennen gelernt hatte. In Cluny La Sorbonne war sie vor einem Kontrolleur geflüchtet, und Adam Stewart, der dort musiziert hatte, war ihr zu Hilfe geeilt, hatte ihr einen Fahrschein in die Hand gedrückt und dem Kontrolleur das Blaue vom Himmel herunter gelogen, um dem jungen Mädchen den Kopf zu retten. Damals hatte er Stücke von Bob Dylan, Bruce Springsteen und Johnny Cash gespielt und sich genauso gegeben wie die mittlerweile ergrauten Helden von einst. Emily hatte sich auf der Stelle in den Jungen verliebt, der sich ihrer angenommen hatte in der fremden Stadt der Lichter. Und Adam Stewart war ihr bis in die Hölle und wieder zurück gefolgt.
Nach all den traurigen Erlebnissen, die sie die Hölle niemals würden vergessen lassen, waren sie dann nach London zurückgekehrt, und das normale Leben hatte Besitz von ihnen ergriffen. Soweit man von einem normalen Leben sprechen konnte. Emily hatte die Whitehall Schule für höhere Töchter und Söhne verlassen und besuchte nun das Mayfair College in der Duke Street – und Adam Stewart musizierte nach wie vor in den Straßen Londons und den U-Bahnhöfen und den Märkten und Grafschaften, die sich jenseits der Underground erstreckten.
Emily betrachtete die Hand, die ihre hielt.
Spürte den festen Griff.
Dachte an all die schönen Momente, die sie miteinander erlebt hatten während der vergangenen Jahre.
»Wenn ich nicht nach Paris gehe, dann werde ich es irgendwann einmal bereuen.«
Am Ende waren es diese Worte, die eine Entscheidung brachten.
Jedenfalls für Emily.
Noch viel später würde sie sich an diese Worte erinnern.
Ein einziger Satz nur, der ein Königreich zerstörte.
»Wenn ich nicht nach Paris gehe, dann werde ich es irgendwann einmal bereuen.«
Voller Wut zog sie ihre Hand zurück. »Du wirst es bereuen, wenn du nach Paris gehst!« Sie selbst, das war ihr klar, bereute seine Entscheidung schon jetzt und fragte sich, warum sie die Entschlossenheit in seinen Augen nicht schon früher bemerkt hatte. Vermutlich hatte er dem Le Chat Noir bereits zugesagt und einen Vertrag unterzeichnet. Warum also diese Farce? Vom ersten Moment an hatte sie gewusst, dass Adam gehen würde. Hatte geahnt, dass sie nichts daran würde ändern können, und befürchtet, dass sie es dennoch versuchen würde.
»Du wirst also in London bleiben.« Es war Adam, der die Worte in Stein meißelte.
»Ja, das werde ich. Hier bin ich daheim.«
Dann schwiegen sie.
Grabesstill.
»Wirst du mir schreiben?«, fragte Emily schließlich und wusste nicht einmal, ob sie das überhaupt wollte.
»Das werde ich.«
Adam umarmte sie.
Zärtlich.
Drückte sie an sich, ganz fest, ganz fest.
Emily jedoch blieb einfach stehen, wo sie stand, und erwiderte seine Umarmung nur halbherzig. Und bevor Adam ihr etwas zuflüstern konnte, hatte sie die Umarmung bereits wieder gelöst. »Sag jetzt nichts«, bat sie ihn, und als er ihr einen Kuss auf die Wange geben wollte, da drehte sie ihr Gesicht weg und begann die Bücherkiste, die neben der Kasse stand, zu leeren. »Ich habe zu tun.«Überaus konzentriert sortierte sie die kürzlich erst gelieferten Bücher zu Stapeln. »Geh einfach.« Die Worte schnürten ihr die Kehle zu. »Verschwinde!« Und ohne ihn anzusehen, flüsterte sie: »Pass auf dich auf.« Für einen Moment nur hob sie den Blick und sah ihm hinterher, wie er sich anschickte, den Raritätenladen zu verlassen.
An der Tür drehte Adam sich noch einmal zu ihr um, und Emily dachte, dass er sich kaum verändert hatte seit ihrer ersten Begegnung. Nur die Entschlossenheit in seinen Augen war etwas, was sie vorher noch nie dort erblickt hatte.
Trotzdem.
Er sah nicht glücklich aus.
Nicht an diesem Tag.
Einfach nur zerwuschelt und traurig und irgendwie verloren.
»Adam?«
»Ja?«
»Versprich mir, dass du auf dich aufpasst.«
»Das werde ich.«
Emily wollte noch etwas sagen, aber die Worte blieben ihr im Hals stecken.
Adam drehte sich um.
Die Tür fiel ins Schloss.
Und er war fort.
Es vergingen Augenblicke, bis Emily langsam zur Tür ging, den Riegel vorschob und den alten Raritätenladen für diesen Tag schloss. Mechanisch überprüfte sie die Einnahmen des Tages, vervollständigte die Kassenrechnung und sortierte einige der neuen Bücher in die Regale ein. Es dauerte mehr als eine Stunde, bis sie sich auf einer der Bücherkisten niederließ, an Adam Stewart und die vergangenen zwei Jahre dachte und hemmungslos zu weinen begann.
Drei Stunden später fand sie sich am Südufer der Themse wieder, drüben in Rotherhithe, wo das schmutzige Kopfsteinpflaster und die spärlich beleuchteten Gassen noch immer den Hauch von Bosheit und düsterer Vorahnung verheißen, wie sie es vor hundert Jahren schon taten, als hier in dieser Gegend noch die Waren aus den Kolonien umgeschlagen wurden und es nach exotischen Gewürzen und Träumen duftete.
Emily Laing war an diesem Abend hierher zurückgekehrt und wusste nicht einmal genau, warum.
Sie war einfach hier.
An diesem eisigen Winterabend.
Nicht lange vor Weihnachten.
Sie stand vor dem riesigen alten Backsteinhaus, dessen Fassade bröckelte und das einstmals, vor noch gar nicht allzu langer Zeit, ein Waisenhaus gewesen war. Gerade einmal zwölf Jahre alt war Emily gewesen, als sie das »Dombey & Son« in einer dunklen, stürmischen Nacht überstürzt verlassen hatte und ängstlich und kopflos in die Straßen Londons geflüchtet war. Ein Kind noch, das außer dem Waisenhaus nur wenig von der Welt gekannt hatte. Fast sechs Jahre war dies nun her. Eine Ewigkeit, ein Schmetterlingsflügelschlag. Manchmal träumte sie noch von Reverend Dombey und den Dingen, die sich hinter den hohen Mauern zugetragen hatten. Von der Ratte und dem Kindsraub und der weiß geschminkten Lady namens Snowhitepink, die alle Waisenkinder gefürchtet hatten wie den Tod.
Das Schild aus morschem Holz, das seit jeher klapprig den Eingang geziert hatte, war nun gänzlich verschwunden, und viele der schmutzigen Fensterscheiben waren mit dicken, fleckigen Brettern verschlagen oder dermaßen zersplittert, dass der Wind, der von der Themse den modrigen Geruch der dunklen Fluten hinüberwehte, mühelos seinen Weg ins Innere des Gebäudes finden konnte.
Das Mädchen, das den Kragen seines schwarzen Mantels hochgeschlagen hatte, stand lange vor dem einstigen Waisenhaus, schweigsam und nachdenklich.
Die Welt, dachte Emily, dreht sich eben immer weiter.
Ihre Welt aber war gerade in einem Augenblick stehen geblieben, der immer noch Gegenwart war und nie ganz Vergangenheit sein würde. Der sich wieder und wieder vor ihrem Auge abspielte und der eigentliche Grund dafür war, dass sie nach Rotherhithe gekommen war.
Emily betrachtete die Fenster des schäbigen Gebäudes, die wie tote Augen in die Winternacht starrten. Für einen Moment nur hatte sie mit dem Gedanken gespielt, in das Gebäude hineinzugehen und nachzuschauen, was aus all den Räumen geworden war, jetzt, nachdem die Kinder sie verlassen hatten. Stattdessen nahm sie vorlieb damit, die Handschuhe auszuziehen und zögerlich die kalte Mauer zu berühren.
Vorerst jedenfalls.
Sie schloss die Augen.
Damals war sie ganz allein gewesen, und jetzt, nachdem Adam Stewart nach Paris gehen würde, war sie es wieder. Deswegen war sie hergekommen. Um sich zu erinnern.
Hatte sie es damals nicht auch geschafft, einfach weiterzumachen?
Nur mühsam schüttelte sie die Bilder ab.
Dachte an andere Dinge.
Unterwegs hatte sie dichten Nebel auf der Themse treiben sehen und sich der Geschichten erinnert, die man sich überall erzählte. Im fahlen Schein der Laternen hatte es sogar so ausgesehen, als bewegten sich die Nebel gegen den Wind, was natürlich Humbug war und nur einer Sinnestäuschung zuzuschreiben. Es gab keine Nebel, die sich so verhielten. Nein, Nebel trieben normalerweise mit dem Wind, doch das, was sie gesehen hatte, entsprach durchaus den geflüsterten Beschreibungen, die sich die Kunden im Laden und die Menschen in der U-Bahn hinter vorgehaltenen Händen zuraunten.
Wachsam hatte sich Emily in den engen Gassen und auf den verwinkelten Uferwegen umgedreht und nach lauernden Wegelagerern oder wabernden Nebeln Ausschau gehalten. Immerhin war dies London, und man konnte der Dunkelheit niemals ganz trauen. Wenn es eines gab, das sie während der letzten Jahre gelernt hatte, dann war es dies.
Und nun stand sie also wieder vor dem Waisenhaus von Rotherhithe.
Gerade so, als hätte sich gar nichts verändert.
Sie schlenderte an der schmutzigen Fassade entlang und blieb schließlich vor dem Kellereingang stehen. Jener Tür, durch die sie vor sechs Jahren nach draußen in die Stadt der Schornsteine geflüchtet war. Ein von Rost und Meersalz zerfressenes Schloss prangte an der Tür. Wie oft war sie durch diese Tür ein und aus gegangen? Wie oft hatte der Reverend die anderen Kinder und sie selbst auf Botengänge geschickt?
Sie seufzte.
Und bemerkte erschrocken die Schritte in der Nacht.
Ein leises Geräusch, das irgendwo in den Schatten der düsteren Gassen geboren wurde.
Lauter wurde es, ein wenig nur.
Jemand näherte sich ihr.
Ein nächtlicher Wanderer bloß, dachte sie.
Blickte sich um.
Zu erkennen war nichts.
Fette Schneeflocken wirbelten durch die Nachtluft und verdeckten die Sicht auf die Dunkelheit dahinter. Nun denn, wer auch immer da durch die Nacht schleichen mochte, Emily hatte nicht das geringste Interesse daran, ihm zu begegnen. Also entschied sie sich für den Weg, den sie bereits zuvor ins Auge gefasst hatte und um den zu gehen sie wohl an diesen Ort zurückgekehrt war.
Das rostige Schloss, mutmaßte sie, sollte keinen Widerstand leisten. Fest trat sie mit dem Stiefelabsatz gegen das altersschwache Metall, das augenblicklich nachgab und die alte Tür mit einem Ächzen aufschwingen ließ.
Die Schneeflocken wirbelten unruhig durch die Nacht, und ein eisiger Wind wehte eine ganze Wolke von ihnen in das dunkle Loch hinein, das sich mit einem Mal im Türrahmen aufgetan hatte und hinter dem sich, wie Emily wusste, die ehemalige Küche des Waisenhauses verbarg.
Unverzagt setzte sie ihren Fußüber die Schwelle.
Fragte sich erneut, was sie eigentlich erreichen wollte.
Nach dem Gespräch mit Adam Stewart war sie ziellos durch die Straßen von Covent Garden gelaufen, hatte letzten Endes den nächstbesten Zug der Circle Line bestiegen und war fast eine Stunde lang teilnahmslos in dem überfüllten Abteil sitzen geblieben, hatte die Bahnhöfe vorbeirauschen sehen und sich selbst Fragen gestellt, auf die sie keine Antworten wusste. Am Westminster Pier schließlich hatte sie die gelbe Linie verlassen und war der Rolltreppe hinauf in die klirrende Winternacht gefolgt, wo Touristen das Parlament und den Glockenturm mit der prächtigen Uhr fotografierten und sogar zu solch später Stunde noch in Trauben die Fußwege versperrten.
Dann hatte sie den dunklen Fluss überquert und war dem Uferweg gefolgt, bis sie ihre Schritte nach Rotherhithe geführt hatten.
Und hier war sie nun.
Allein und enttäuscht an einem Ort, den sie niemals wieder hatte betreten wollen.
Das spärliche Licht der Straßenlaterne schien in den großen Kellerraum hinein und warf gezackte Schatten zwischen die von Schmutz und Staub überzogenen Gegenstände. Hier hatte Emily damals ihr linkes Auge verloren, weil einem ungeschickten Jungen ein Missgeschick passiert war. Ein Zufall nur, doch wie zufällig mochte das Leben damals schon gewesen sein? An Eliza Holland musste sie denken und das, was sie erlebt hatte, als sie in Emilys Alter gewesen war. Eliza, die eine gute Freundin gewesen war und die Stadt der Schornsteine verlassen hatte. Und Aurora? Schon viel zu lange hatten die Mädchen sich nicht mehr gesehen. Dabei waren die beiden früher doch unzertrennlich gewesen.
Die Welt, dachte Emily müde, dreht sich eben weiter.
Vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den anderen. Wasserrohre waren infolge der Kälte geplatzt, und die Fluten, die sich aus ihnen ergossen hatten, waren mittlerweile zu einer dicken Eisschicht erstarrt, die alles in dem großen Raum bedeckte.
Emily sollte gar nicht hier sein.
Niemand wusste, wo sie sich aufhielt.
Und sollte etwas in der Nacht nach ihr Ausschau halten, dann würde sie eine leichte Beute sein, und niemand wüsste, wo er nach ihr zu suchen hatte. Erneut warf sie einen Blick nach draußen, wo jetzt keine Schritte mehr zu hören waren, und schloss dann die Tür hinter sich. Es brauchte niemanden zu kümmern, dass sie sich in dem Gebäude aufhielt.
Mutig drang sie weiter in die Räumlichkeiten ihres alten Zuhauses vor. Ihr Auge gewöhnte sich schnell an das Dämmerlicht zwischen Finsternis und Schattenspiel, und die Welt, durch die sie sich bewegte, wurde mit einem Mal wieder zu jener Welt, in der sie die ersten Jahre ihres Lebens verbracht hatte. Da war das riesige Treppenhaus, in dem jetzt Schneeflocken wirbelten. Und weiter oben der Schlafsaal für die Neuzugänge, wie die ganz kleinen Kinder genannt worden waren. Dort hatte sie zum ersten Mal ihrer Schwester gegenübergestanden. So viele Erinnerungen, noch lebendig wie damals. All die Bilder stürmten mit einem Mal auf das Mädchen ein, und Emily war klar, weshalb sie hierher zurückgekehrt war.
Sie schreckte auf.
Etwas hatte in der nachtschwarzen Dunkelheit ein Geräusch hinterlassen.
Womöglich hatte jemand den gleichen Weg wie sie selbst gewählt und die Tür tief unten im Keller geöffnet. Gefolgt von einem heimlichen Rascheln wie von Schuhen, die über die spinnwebenübersäten Treppenstufen huschten.
War ihr womöglich doch jemand vom alten Raritätenladen aus gefolgt?
Sie lauschte.
Stand ganz still.
Nichts!
Sie befand sich im Schlafsaal der Neuzugänge. Das schmutzige Fensterglas war zersplittert, und die weiße Winternacht hatte sich wie ein Teppich über die vielen Kinderbettchen gelegt. Fahles Licht, das unten von der Straße in das Haus drang, brach sich in den Eiskristallen und den Schneesternen, die sich überall im Raum gebildet hatten. Ja, das Waisenhaus war wahrlich zu einem Eispalast erstarrt, und Emily musste an die Hölle denken, die eisig kalt und ebenso winterlich gewesen war, als sie zum ersten Mal in die Schlünde nahe der Kathedrale hinabgestiegen war.
Emily berührte zaghaft eines der Kinderbettchen und versuchte sich daran zu erinnern, wie es damals gewesen war, als sie sich in diesen Raum gestohlen hatte, um die kleine Mara zu besuchen. Damals hätte sie nicht im Traum geahnt, dass sie eine Schwester hatte.
Schnell vertrieb sie den Gedanken daran.
Und wieder war da das Geräusch, ganz nah.
Was, in aller Welt, konnte das nur sein?
Sie suchte nach dem Bewusstsein der geheimnisvollen Person und spürte, dass jemand sein Innerstes vor ihr zu verbergen wusste. Wer immer ihr auch folgte, besaß also die Fähigkeit, sich einer zudringlichen Trickster zu erwehren, was nicht unbedingt ein beruhigender Gedanke war. Bedeutete er doch, dass es nicht ein einfacher Straßenstrolch war, der sie zum Opfer auserkoren hatte, sondern jemand – oder etwas – anderes.
Emily konzentrierte sich erneut und schnappte ein wie von einem Blitzlicht erhelltes Bild auf, das sie bereits zuvor gesehen hatte. Ein zugefrorener See und fröhliche Kinder, die auf dem Eis spielten. Woher, fragte sie sich, kannte sie dieses Bild?
Zeit, darüber nachzudenken, hatte sie jedenfalls nicht.
Immer näher kamen die Schritte.
Hatten bereits die letzte Treppenstufe verlassen.
Emily ging zwischen den Kinderbettchen in die Hocke und hielt den Atem an.
Ihr Verfolger näherte sich zielsicher dem Schlafsaal.
Zweifelsohne.
Im Türrahmen blieb er kurz stehen und inspizierte das Zwielicht.
Emily spürte, wie ihr das Herz bis zum Hals schlug.
Nahezu regungslos kauerte sie am schneebedeckten Boden.
Was wurde hier gespielt?
Wer, in aller Welt, trieb sich außer ihr noch zu so später Nachtstunde in einem leerstehenden alten Hafenmeisterhaus herum? Nun ja, Antworten fielen ihr einige ein, doch war keine davon auch nur annähernd beruhigend.
Das plötzliche Geräusch ließ sie unwillkürlich zusammenzucken.
So laut wie Steine, die in dunkle Fluten plumpsen.
Jemand pochte an die bereits geöffnete Tür.
Dann vernahm sie eine Stimme.
»Klopf, klopf.«
Emily traute ihren Ohren nicht.
Hätte beinah das Gleichgewicht verloren.
Überrascht und leicht echauffiert erhob sie sich.
Sah mich an.
»Wittgenstein!« Es klang wie ein Vorwurf.
Ich betrat den Raum.
Nickte meiner Schutzbefohlenen zu. »Guten Abend, Miss Laing.«
Sie klopfte sich den Schnee vom Mantel. »Was tun Sie hier?«
War das nicht offensichtlich?
»Ich suche Sie.«
»Jetzt haben Sie mich gefunden, würde ich sagen.«
Ich sah mich um. »Dies ist nicht gerade der Ort, an dem man ein Mädchen Ihres Alters nach Einbruch der Dunkelheit vermuten würde.«
»Herrje, Wittgenstein, wie haben Sie mich gefunden?«
»Ich bin Ihren Spuren gefolgt.«
»Sie haben mir einen gehörigen Schrecken eingejagt.«
»Tut mir Leid.«
Emily richtete sich auf und warf mir einen trotzig versöhnlichen Blick zu.
»Schon okay.«
Dieses Kind!
»Vor wenigen Stunden«, teilte ich ihr mit, »wurde uns eine Botschaft aus Moorgate überbracht.« Es war nicht der behutsame Weg, doch manchmal musste man die Dinge einfach beim Namen nennen. Und bei der Erwähnung dieses Namens wurde meine Schutzbefohlene ganz unruhig.
»Was ist passiert?« Emily Laing, die seit all den Jahren wusste, wer ihre Mutter war, ahnte, dass der Grund meines unerhofft plötzlichen Auftauchens kaum angenehmer Natur sein würde und dass sich nur Allerschlimmstes hinter den hohen Mauern von Moorgate Asylum zugetragen haben konnte.
»Wir sollten augenblicklich aufbrechen«, schlug ich vor.
Denn Eile war geboten, zweifelsohne.
»Hat Ihnen Doktor Dariusz etwas Genaues mitgeteilt?«
Ich schüttelte den Kopf. »Eine nahezu erfrorene TrafalgarTaube hat die Nachricht überbracht.« Ein Zettel nur, auf dem unser Erscheinen schnellstmöglich erbeten wurde.
»Was, Wittgenstein, vermuten Sie?«
»Fragen Sie besser nicht.«
Das Leben, dachte ich, kann unvorhersehbar, durchtrieben und boshaft sein, sodass wir hilflos wie Schneeflocken durch die Lüfte gewirbelt werden und nur darauf hoffen können, an einen sicheren Ort zu gelangen. Die alte Stadt London war unsere Heimat und dennoch weit davon entfernt, ein sicherer Ort zu sein. Zu unstet war der brüchige Frieden zwischen den mächtigen Häusern der Stadt, zu tief die Abgründe, die sich in den entlegensten Winkeln der uralten Metropole auftaten.
Emily, die sich schon sehr bald Alchemistin würde nennen dürfen, hatte das Leben in London demjenigen in der Welt jenseits der U-Bahn vorgezogen, weil sie nicht mehr länger den Gefahren ausgesetzt sein wollte, die dort unten in den Gewölben und Röhren und Korridoren lauerten. Nichtsdestotrotz hatte es ihr die Ausbildung abverlangt, dass sie sich zuweilen zu den Märkten und in die Grafschaften tief unterhalb der Stadt begab. Doch waren diese spärlichen Besuche immer nur von äußerst kurzer Dauer gewesen.
»Ich möchte endlich ein normales Leben führen«, hatte sie mir damals mitgeteilt.
Ein Leben mit Adam Stewart.
Das war es gewesen, was sie sich vorgestellt hatte.
Ein Leben in der Stadt der Schornsteine.
Als Alchemistin.
Buchhändlerin.
Vielleicht sogar würde sie sich einmal daran versuchen, eine Geschichte zu schreiben.
Immerhin war ihr Vater ein Künstler gewesen.
Musiker, Komponist, Bohemien.
Ach, eigentlich hatte sie selbst nicht so recht gewusst, was sie einmal tun wollte.
Nur gewusst, was sie nicht tun wollte.
So hatte sie mit meiner Unterstützung schon kurz nach ihrer Rückkehr aus Paris die Whitehall Schule für höhere Töchter und Söhne verlassen und sich am Mayfair College eingeschrieben. Adam Stewart war zu einem ständigen Gast in meinem Haus in Marylebone geworden, und die Gitarre, die er stets mit sich geführt hatte, war von einem Raum in den nächsten gewandert. Doch das, wusste Emily, war jetzt vorbei.
Das Leben, das sie sich erhofft hatte, würde nicht stattfinden.
Schlimmer noch, man hatte uns nach Moorgate Asylum gerufen.
»Es hat mit den Nebeln zu tun, habe ich Recht?«
Sie ließ nicht locker.
»Es wäre möglich.«
Die bösen Nebel waren wie eine Krankheit.
»Was wissen Sie von den Nebeln?«
»Das, was alle wissen. Oder zu wissen glauben.«
»Also nichts.«
»Sie sagen es.«
Glaubte man den Berichten, die seit Wochen schon die Runde machten, dann tauchten die Nebel immer nur des Nachts auf. Unvorsichtige Passanten, die sich in ihnen verloren, fanden nicht wieder aus ihnen heraus. Und diejenigen, die man gefunden hatte, waren in einen tiefen Schlaf gefallen, aus dem sie niemand mehr zu erwecken vermocht hatte.
»Wie man mir mitteilte, hat das North Healing für die Nebelopfer eine eigene Station eingerichtet.« Die wenigen Krankenhäuser der Stadt hatten schnell und beherzt reagiert, doch gab es nicht einen einzigen Arzt in ganz London, der ein Mittel gegen die von den Nebeln verursachte Schlafkrankheit gewusst hätte.
»Sind es denn so viele Opfer?«
»Ich weiß es nicht. Aber die Lage ist angespannt.«
Begonnen hatte es vor kaum mehr als drei Wochen. Ein Dampfschiff, das Touristen vom Tower hinauf nach Westminster bringen sollte, war auf Höhe der Waterloo Bridge in eine Nebelbank geraten, die wohl aus dem Nichts aufgetaucht war. Wie man sich erzählte, hatte es mit einem Mal keinen Kontakt mehr zu dem Vergnügungsdampfer gegeben. Der Metropolitan war es gelungen, die Motoren des Dampfers zu stoppen, noch bevor dieser beim Victoria Embankment auf Grund hatte laufen können.
Die wenigen Touristen, die in diesen Wintertagen zu einer Bootsfahrt bereit gewesen waren, und die fünf Mann starke Besatzung hatte man in einen tiefen Schlaf versunken vorgefunden.
Emily flüsterte: »Etwas sei mit ihren Augen gewesen, habe ich gehört.«
»Man hört vielerlei in diesen Tagen«, gab ich zu bedenken.
Emily sah müde aus.
So erwachsen wirkte sie. Das kleine Mädchen, dessen ich mich einst angenommen hatte, war zu einer jungen Frau herangewachsen, die das Leben schon lange nicht mehr mit Kinderaugen sah.
Und es waren nicht die Nebel, die sie fürchtete.
»Sie denken«, hakte ich nach, »dass man uns nach Moorgate gerufen hat, weil etwas mit Ihrer Mutter nicht in Ordnung ist?«
Ertappt senkte sie den Blick.
Was sollte ich sagen?
Wenn ein Waisenkind in Erfahrung bringt, wer seine Eltern sind, dann ist dies ein magischer Moment. Ja, Emily Laing wusste, wer ihre Mutter war. Was sie aber auch erfahren hatte, war der Grund, weshalb Mia Manderley dem Wahnsinn anheim gefallen war. Seit Jahren schon befand sie sich in der Obhut eines persischen Arztes, der gute Kontakte zu dem mächtigen elfischen Haus vom Regent’s Park unterhielt und zudem der Leiter des berüchtigten Sanatoriums von Moorgate war.
»Was auch immer geschehen ist«, sagte ich, »wir werden es in Kürze erfahren.«
Emily nickte nur.
Schwieg.
Sah aus, als habe sie sich gerade selbst verloren.
Schnellen Schrittes folgte sie mir durch die röhrenartigen Gänge von Aldgate East.
Mürrische Menschen strömten an uns vorbei, und wie so oft fragte sich Emily, was all die Leute wohl sagen würden, wenn sie von der Welt, die sich hinter den schmutzigen Kacheln befand, erführen. Unwissenheit, das wusste sie heute, konnte manchmal auch ein Segen sein.
»Wie viele von denen«, fragte ich meine Begleiterin, »sind wohl glücklich?«
Emily betrachtete die Menschen auf dem Bahnsteig.
Auf einer Bank saß ein Mann in Anzug und feinem Mantel mit einem Laptop auf dem Schoß und tippte mit nur zwei Fingern müde auf der Tastatur herum. Daneben stand ein Paar, das sich keines Blickes würdigte. Ein dicker Mann, dem die Reste seines Mittagessens noch an der Jacke klebten, spuckte auf den Boden. Zwei Punks warfen Bierdosen auf die Bahngleise, und neben einer Werbeanzeige für irisches Bier lehnte ein blinder alter Mann mit einem fleckigen Comic in den Händen.
»Fragen Sie besser nicht«, entgegnete das Mädchen, das im Augenblick wirklich nicht das geringste Interesse verspürte, sich mit seinem Mentor über Glück und Unglück zu unterhalten.
Und so steuerten wir unbeirrt auf den Blinden zu, dem die wenigen Haare, die unter der pelzgefütterten Fliegermütze hervorlugten, fettig an der Stirn klebten.
»Seien Sie gegrüßt«, sagte ich höflich.
Emily, die wusste, wie so etwas ablief, hatte den Duftbaum bereits aus ihrem Mantel gekramt.
Der Mann rollte das bereits zerknitterte Heft säuberlich zu einem Zylinder. »Ah, Kundschaft.« Er sprach es wie »Kunnschaff« aus und grinste und entblößte dabei graues, nahezu zahnloses Zahnfleisch. »Lange nich jesehen, Alchemist.«
»Wir erbitten den Durchgang.«
Emily reichte dem alten Mann den orangefarbenen Duftbaum. Ein Schnüffeln nur, und flink griff der Alte danach. »Dank’ dä Härr.« Er hustete rasselnd, wie es alle taten, die hier unten an den Portalen ihr Dasein fristeten. Dann tippte er mit dem Comic gegen die gläserne Werbetafel, die eine versteckte Tür war, hinter der sich ein Abstellraum für die nächtlichen Putzkolonnen befand.
»Un’ sicher’n un’ fest’n Schritt un’ Tritt Ihn’ beid’n.«
Das Portal schloss sich hinter uns.
»Da sind wir also wieder«, murmelte Emily.
Wir durchquerten den Abstellraum, und dahinter führte ein niedriger Gang abwärts zu einem verlassenen Bahnsteig, auf dem sich Holzkisten und Säcke türmten, aus denen vergilbte Briefe und Päckchen herauslugten. An den Wänden befanden sich hölzerne Regalreihen, und jedes der Fächer, die vor Briefpost nur so überquollen, war mit einer Nummer oder Ziffer gekennzeichnet.
»Dies ist die alte Mail Rail«, erklärte ich meiner Begleiterin.
Emily hatte davon gehört.
Im Jahre 1855 hatte Rowland Hill, ein leitender Angestellter des Post Office den Plan verfolgt, die zentralen Verteilerstellen von St. Martin’s le Grand, Little Queen Street und Holborn unterirdisch zu verbinden, sodass Briefpost und Pakete schneller von einem Ende der Stadt zum anderen geschickt werden konnten. Hill verbündete sich mit den Ingenieuren Rammell und Clark, die eine pneumatische Bahn entwickelt hatten, und so wurden die Tunnel gegraben, die für eine Weile auch tatsächlich in Betrieb gewesen waren. Doch dann geriet die Mail Rail in Vergessenheit, und das, was von ihr übrig geblieben war, sahen wir in diesem Moment vor uns.
»Das ist deprimierend«, murmelte Emily.
»Wie meinen Sie das?«
»Dies alles hier.«
Behutsam schoben wir uns durch die Berge alter Post. Abertausende von Briefen, verfasst in tausenden Handschriften. Unzählige Füllfederhalter und Bleistifte waren von Händen geführt worden, die längst nicht mehr als kahle Knochen waren. Von Händen, die gezittert haben mochten, weil sie die Zeilen an die Liebste oder den Liebsten verfasst hatten. Händen, die um Formulierungen gerungen hatten. Händen, die einander hatten berühren wollen und in Ermangelung dieser Möglichkeit nach Worten gesucht hatten, die Berührungen gleichgekommen waren.
Emily ging ganz langsam durch dieses Meer ungelesener Zeilen.
»All die Gedanken, die zu Papier gebracht worden sind und die niemals die Personen, für die sie bestimmt gewesen waren, erreicht haben.« Behutsam hob sie einen Brief auf, der Poststempel nannte das Jahr 1899. »Adam«, gestand sie, »hat versprochen, mir zu schreiben.« Auf dem Weg hinüber nach Aldgate hatte sie mich in knappen Worten über Adam Stewarts Abreise informiert.
»Es tut mir Leid.«
Sie wirkte überrascht.
Verlegen.
Peinlich berührt.
Geradezu.
»Heute ist kein guter Tag für Sie.« Mit dem Fuß schob ich einige der Briefe vor mir her.
Emily stand inmitten all der ungeöffneten Briefe.
Sagte nur: »Ich weiß.«
Den Brief, den sie in ihrer Hand gehalten hatte, ließ sie fallen.
»Lassen Sie uns von hier verschwinden«, schlug sie vor.
Dann verließen wir diesen Ort der vergessenen Gedanken und Gefühle. Und keiner von uns blickte zurück.
Unterhalb der City of London befindet sich ein Kreuzweg, an dem sich die U-Bahn-Linien der East London und Hammersmith, Bakerloo und Central Line treffen. Und unterhalb des Kreuzweges ist nur Moor, eine düstere Landschaft voll Exkremente, Schlick und seltsam geformter Pflanzen. Von all den mächtigen Bauwerken, die einst in der Stadt der Schornsteine gelebt haben, hat sich die alte London Bridge ausgerechnet diesen Ort ausgesucht, um ihr Dasein zu fristen.
Es befinden sich Häuser auf der Brücke, die sich über den Morast spannt. Häuser mit Erkern und Türmen. Mauern, die Stacheldraht krönt. Dächer, die von schwarzem Moos befallen sind, das gierig das von der Höhlendecke tropfende brackige Wasser aufsaugt. Die Fallwinde aus den U-Bahn-Schächten von hoch oben tragen die Schreie der Kranken über das Moor.
Dieser Ort ist Moorgate Asylum.
Ein Sanatorium.
Einmal die Woche kam Emily hierher, um ihre Mutter zu besuchen, die in einer kargen Zelle des nördlichen Turms hauste. Für meist nur eine Stunde saß das Mädchen dann vor der Zellentür und beobachtete die Frau, von der es wusste, dass es ihre Mutter war, wie sie auf dem Boden hockte und den Körper in einem Takt wiegte, den nur sie selbst zu hören vermochte. Das Gesicht, das sich ihr nur selten zuwandte, war das Gesicht, das Emily in einigen Jahren selbst haben mochte. So ähnlich sahen sich Mädchen und Patientin, dass jegliche Zweifel, es könne sich nicht um Tochter und Mutter handeln, ausgeschlossen werden konnten. Meistens summte Mia Manderley leise vor sich hin, wenn sie sich beobachtet fühlte. Es war keine Melodie, die Emily kannte, aber es war eine Melodie, die schön war. Das Mädchen mochte den Gedanken, dass es vielleicht eine Melodie war, die sich ihr Vater ausgedacht hatte und an die sich Mia Manderley erinnerte. Vielleicht sogar ein Lied, das vergangene Bilder für ihre Mutter zum Leben erweckte. Ja, wenn Mia Manderley summte, dann schlich sich immerzu die Hoffnung in Emilys Herz, dass man ihre Mutter eines Tages vielleicht doch noch würde heilen können.
Wie gern würde Emily mit ihr reden. Erfahren, was einst gewesen war. Doch dann, wenn sie sich der Hoffnung hingab, kam der nächste Anfall, und Mia Manderley tobte wie ein Tier in ihrer Zelle, fauchte und fletschte die Zähne, so lange, bis die Pfleger herbeieilten und sie mit langen Spritzen und Geräten voll seltsam geformter Elektroden ruhig stellten.
Dr. Dariusz, der behandelnde Arzt, sprach nur selten mit Emily.
Und Emily mit ihm.
Das Mädchen fühlte sich nicht wohl in dem Büro mit den hohen Fenstern und den Spiegeln, die in allen Größen und Formen die weißen Wände anstelle von Bildern bedeckten.
Doch heute mussten wir ihn sprechen.
»Ich grüße Sie beide.«
Ein Pfleger, dessen rechtes Auge geschlossen war, weil Piercingnadeln das Lid zuhielten, führte uns durch die Eingeweide des Sanatoriums zum Leiter der Anstalt.
Dr. Dariusz.
Er sah nicht aus wie ein Arzt, sah man von dem langen, hochgeschlossenen weißen Kittel ab. Er hatte feuerrotes Haar, das er zu einem Zopf gebunden trug. Hinter seinen runden spiegelnden Brillengläsern konnte man die Augen, die, wie Emily wusste, weiß waren wie die eines Raubtieres, nur erahnen. An diesem Tag hielt er sich nicht mit höflichen Floskeln auf, und beide spürten wir, dass die Neuigkeit, die uns mitzuteilen er bereit war, einfach nur schrecklich sein würde. »Mia Manderley ist tot.«
Später würde Emily nicht einmal mehr wissen, was genau sie in eben jenem Augenblick empfunden hatte, als all ihre Befürchtungen zur Gewissheit geworden waren. Ein bleiches Gesicht starrte ihr hundertfach aus all den Spiegeln entgegen. Das Herz raste ihr, dass es wehtat. Langsam schlug sie die Hände vors Gesicht, und dann schloss sie die Augen. Und all die Briefe, die sie niemals geschrieben hatte, wurden zu Tränen, die sie nicht einmal weinen konnte.
Kapitel 2
Highgate
Aurora Fitzrovia fand keinen Schlaf in dieser kalten Winternacht, und die Traumbilder, die sie in der wankelmütigen Welt zwischen gedankenverlorenem Wachen und unruhigem Schlaf heimsuchten, trieben sie schließlich zum Fenster, von dem aus sie den verlassenen Streatley Place betrachtete und die schiefe Kirchturmspitze drüben in der Heath Street. Ihr Gesicht spiegelte sich in dem Fensterglas, auf dem sich wuchernde Eisblumen gebildet hatten, und sie musste an die Hölle denken, die ein jeder von uns in sich trägt. Sie dachte an ihre Mutter, die der Sand mit sich genommen hatte, und ihren Vater, dem sie täglich einen Besuch abstattete. Ja, der gewundene Weg, den sie an jedem Nachmittag und an den Wochenenden bereits vormittags beschritt, führte sie vom Streatley Place über Parliament Hill durch den Park von Hampstead Heath. Sie mochte die frühen Stunden des Tages, denn dann lagen die Parkanlagen noch verlassen da, und sie hatte den Raum, den sie brauchte, um ihre unruhigen Gedanken fliegen zu lassen.
Wie seltsam das Leben doch sein konnte. All die Jahre im Waisenhaus hatte sie sich danach gesehnt zu erfahren, wer sie war und woher sie kam. Und warum sie jemand am Fuße eines Briefkastens im Stadtteil Fitzrovia ausgesetzt hatte, als sie noch ein Baby gewesen war. So lange Zeit, in der sie sich einzig und allein nach diesem Wissen gesehnt hatte. Und nun, da sie im Besitz dieses Wissens war, fühlte sie sich da etwas besser?
Müde rieb sie sich die Augen.
Betrachtete ihr Gesicht im Fensterglas und suchte darin nach den Zügen ihrer Mutter. Im Waisenhaus von Rotherhithe hatten manche der Kinder sie nur das »Schokoladenmädchen« gerufen, doch hatte Aurora Fitzrovia sich ihrer Hautfarbe niemals geschämt. Und Emily Laing, die bereits damals ihre beste Freundin gewesen war, hatte ihr immer beigestanden. Am Ende nämlich waren sie beide Ausgegrenzte gewesen. Emily Laing hatte mit ihrem Glasauge ebenso unter den Anspielungen und abfälligen Bemerkungen der anderen Waisenkinder zu leiden gehabt wie sie selbst. Heute wusste sie, dass sich hinter diesen grausamen Beschimpfungen nur Unsicherheit und Verlorenheit verborgen hatten, denn keines der Kinder war glücklich gewesen in Rotherhithe. Für manche war es einfach nur die Art und Weise gewesen, mit der eigenen Furcht vor der Zukunft umzugehen. Man wertete sich selbst auf, indem man andere abwertete.
So einfach war das gewesen.
Die grundlegenden Dinge, dachte sie, sind eigentlich immer einfach.
Und dann war Emily in einer Nacht, nicht lange vor Weihnachten, aus dem Waisenhaus geflohen, und überraschenderweise hatte ein in Weiß gekleideter Elf namens Maurice Micklewhite sich des Mädchens angenommen, das im »Dombey & Son« zurückgeblieben war.
Damals, vor nahezu sechs Jahren, hatte alles begonnen.
Vor mehr als einem ganzen Leben.
Damals hatte sie erfahren, dass die Welt unter London nicht in der U-Bahn oder den weit verzweigten Pfaden der stinkenden Kanalisation endet. Alle waren sie hinabgestiegen an jenen mystischen Ort, den diejenigen Einwohner Londons, deren Augen offen sind für die Welt so wie sie wirklich ist, die uralte Metropole nennen.
Die Stadt unter der Stadt.
Dunkle tiefe Schächte, labyrinthische Straßentunnel und endlose Tonröhren führen zu absonderlichen Grafschaften, Gewölben und Katakomben oder weitaus ungewöhnlicheren Orten, wo die Menschen an der Seite von alten Gottheiten leben, wehmütige Engel singen und hungrige Wölfe unvorsichtigen Wanderern auflauern. Exotische Ländereien existieren zwischen Bloomsbury und Brick Lane Market. Es gibt U-Bahn-Linien, die kein Mensch je erblickt hat und an die sich nicht einmal mehr die Alten erinnern. Brücken mit goldenen Vögeln und steinernen Rittern. Dinge, von denen Geschichten künden, die seit Jahrhunderten niemand mehr erzählt.
Dies war die Welt, die sie gierig verschlungen hatte.
Die ihr gezeigt hatte, wo ihre Wurzeln waren.
Damals …
Wenn sie Hampstead Heath durchquerte, dann dachte sie immerzu an jene Welt, die ihr einen Vater gegeben und auch gleich wieder genommen hatte. Denn wenn es eines gab, was Aurora in ihrem jungen Leben gelernt hatte, dann war es, dass die Welt ein boshaftes und gieriges Tier war, das gute Menschen bestrafen und böse Menschen belohnen konnte, wann immer es ihm gefiel, und dass die Sterblichen kaum Einfluss darauf hatten und die Wege des Schicksals zwar waghalsig beschreiten, aber nur viel zu selten beeinflussen konnten.
Immer wenn Aurora in Highgate war, wurde ihr dies alles zur Gewissheit.
Denn Highgate Cemetery war der Ort, an dem die Welt in dem Augenblick erstarrt war, der für Aurora Fitzrovia noch immer die Gegenwart war und niemals richtig Vergangenheit sein würde.
Dorthin, zu einer Grabstätte nahe der nördlichen Mauer, begab sich Aurora an jedem Tag. Dort verharrte sie ganz still, und nur manchmal flüsterte sie heimliche Worte. Anfangs hatte sie oft geweint, wenn sie hier war, doch waren die Tränen mit der Zeit versiegt. Ja, sie hatte sich zu beherrschen gelernt, was ihrem Vater wohl gefallen hätte.
Immer stand sie da und las die Inschrift.
Betrachtete die geschwungenen Zeilen auf dem Stein. Maurice Micklewhite geboren & gestorben unsterblich in der Erinnerung jener, die sein Leben teilten waren die Worte, die den schlichten Grabstein zierten. Den Stein, der so weiß war wie die Kleidung, die der Elf immer getragen hatte. Ein Sockel, auf dem sich die hohe Gestalt eines Engels in den grauen Himmel erhob, mit Schwingen, weit ausgebreitet.
»Für Elfen sind die Tage ohne Belang«, hatte Aurora erfahren müssen. »Nur das Leben, das zwischen Geburt und Sterben liegt, ist von Bedeutung. Man kann ein Leben nicht danach beurteilen, wie lange es angedauert hat. Nur danach, wie es gelebt worden ist.« Das war es, was die Elfen glaubten. »Und der Tod tritt erst ein, wenn sich niemand mehr zu erinnern vermag.« Denn das Vergessen ist immer das Ende.
Niemand, an den Menschen sich erinnern, stirbt wirklich.
So stand es geschrieben.
Aurora hatte es gelesen. In den Büchern Lord Dunsanys.
Sie seufzte.
Schaute den wirbelnden und tanzenden Schneeflocken zu und erinnerte sich an jenen grauen Tag, an dem sie ihren Vater zu Grabe hatte tragen müssen. Noch immer wunderte sie sich, wie fremd dieses Wort für sie klang.
Vater.
War er für sie doch immer nur Master Micklewhite gewesen, vier Jahre lang.
Selbst am Grab hatte sie an niemand anderen als an Maurice Micklewhite denken können.
Aber vielleicht, und das hatte sie sich einzureden versucht, war das auch in Ordnung. Vielleicht war dies nur der Weg, ihn in Erinnerung zu behalten, so wie sie ihn immer gesehen hatte. All die Jahre über war er ihr fürsorglicher Mentor gewesen, hatte sie geduldig gelehrt, wie man die unübersichtlichen Pfade der Nationalbibliothek im Britischen Museum beschritt und den Büchern jenes Wissen entlockte, das man suchte.
Aurora hatte sich immer schon dort wohl gefühlt, inmitten all der stillen Leser in den Tischreihen unter der Kuppel, wenn die Bibliothek geöffnet war, und inmitten der schattigen Stille, nachdem sie für den Publikumsverkehr geschlossen war.
War Maurice Micklewhite nicht bereits ihr Vater gewesen, noch bevor dies für sie beide zur Gewissheit geworden war? Hatte er sich ihrer nicht angenommen und ihr all das vermittelt, wie es eines Vaters Aufgabe war? Was hatte sich schon in dem Moment geändert, als sie endlich erfahren hatte, wessen Tochter sie war?