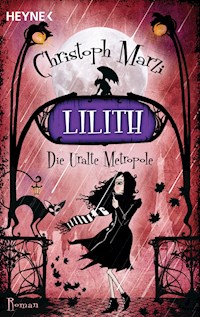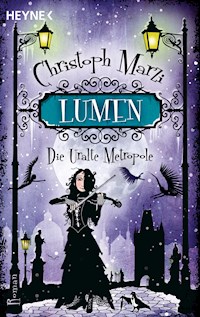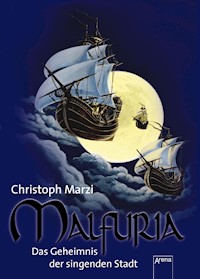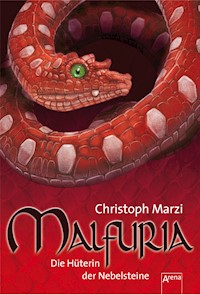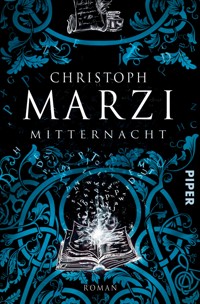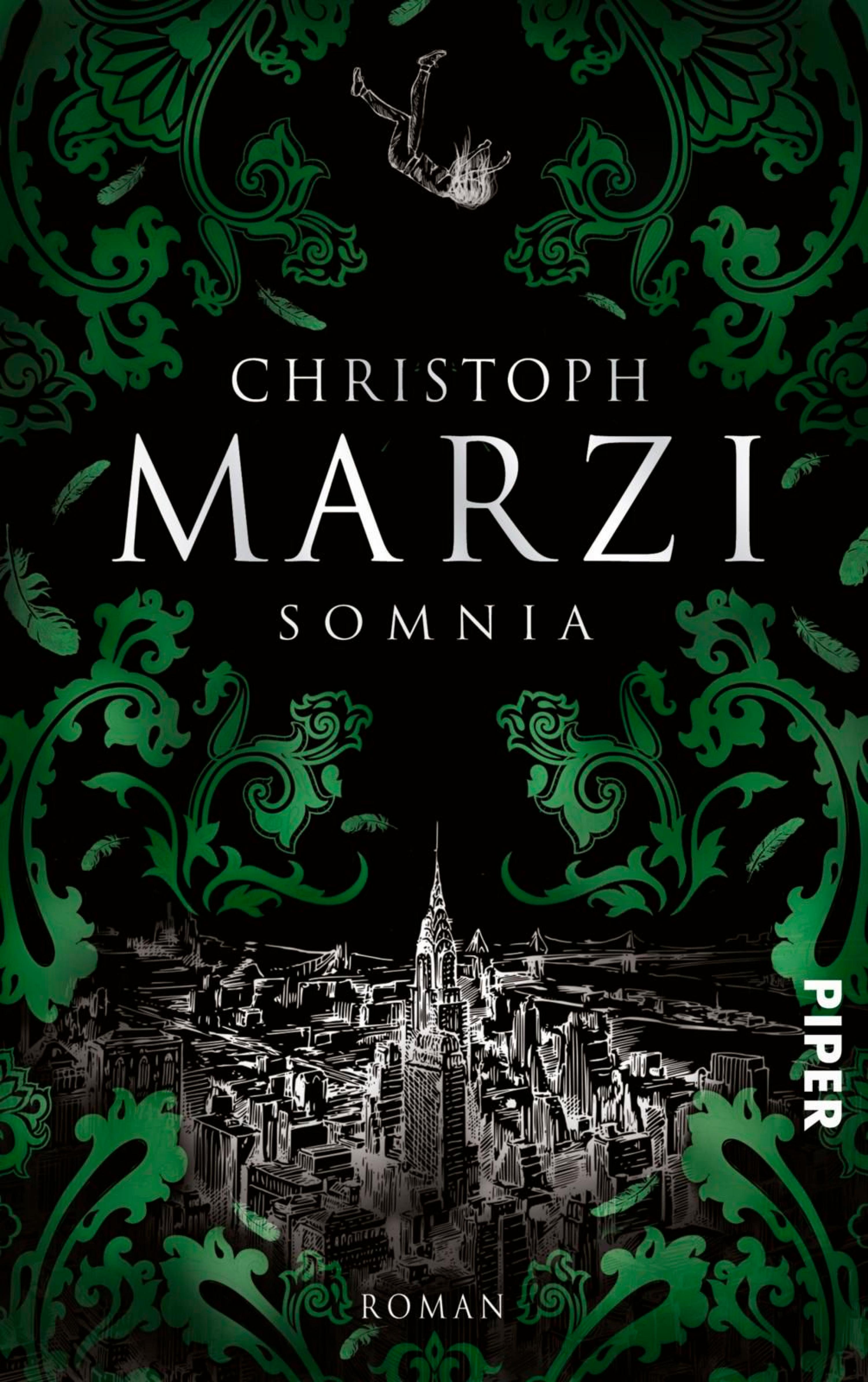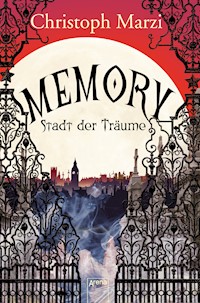
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Jude Finney hat eine besondere Fähigkeit: Er kann die Träume der Toten sehen. Auf dem Highgate Cemetery, in einer Welt zwischen Realität und Traum, begegnet er der geheimnisvollen Story, einem Mädchen, das tausend Geschichten kennt, aber sich an seine eigene nicht erinnern kann. Jude ahnt, dass Story noch lebt, irgendwo in den Straßen von London. Und dass es höchste Zeit wird, sie zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Autor
Christoph Marziwuchs in Obermendig in der Eifel auf, studierte an der Universität Mainz Wirtschaftslehre und lebt heute mit seiner Frau Tamara und seinen drei Töchtern im Saarland. Im Alter von 15 Jahren begann er zu schreiben. Der Autor erhielt 2005 für seine Lycidas-Trilogie den Deutschen Phantastik-Preis für das beste Roman-Debüt. Seit 2007 schreibt er mit großem Erfolg Romane für Jugendliche und Kinder.
Titel
Christoph Marzi
Memory
Stadt der Träume
Impressum
Erste Veröffentlichung als E-Book 2012 © 2011 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Covergestaltung: Frauke Schneider ISBN 978-3-401-80147-6www.arena-verlag.de Mitreden unter forum.arena-verlag.de
Denjenigen, die uns als Traum begleiten
I see thee still! Thou art not dead Though dust is mingling with thy form The broken sunbeam hath not shed The final rainbow on the storm.- Eine alte Inschrift auf dem Highgate Cemetery -
Prolog
Die Stunde, in der das Mädchen ohne Namen seine Geschichte verlor, war die letzte des Tages. Die Nacht aber, in deren gläsernem Gewand diese Stunde schlug, schien der Anfang von allem zu sein. Wie Nebel lag Stille über dem, was kaum mehr als Schattenriss und Schemen war. Nur das spärliche Licht einer Straßenlaterne erhellte jenen verlassenen Ort, an dem ein Mädchen zu dieser Uhrzeit eigentlich nichts zu suchen hatte. Still wie eine Puppe mit geschlossenen Augen saß sie auf der Parkbank gleich neben dem hohen Tor aus geschwärztem Eisen. Mondschein, kalt und schneidend wie der letzte Rest einer Erinnerung, ergoss sich jenseits der Wege und Pfade wie Silber über die Grabsteine, kühler Wind wehte die braunen Blätter über den Boden und in die Eingänge der Mausoleen.
Einst pflegten in Momenten wie diesem die Toten zu singen und in den Liedern, an die sie sich erinnerten, ging es natürlich um das Leben, schillernd und beschwingt wie ein Sonnenstrahl, der sich in einem Regentropfen bricht und von niemandem eingefangen werden möchte. Es war also nicht verwunderlich, dass es dem Jungen, der ebenso wenig wie das Mädchen an einen Ort wie diesen zu gehören schien, in den Sinn kam, eine Melodie zu summen.
Plötzlich blieb er stehen und das Summen, das sich wie der zaghafte Anfang von Heart of Gold angehört hatte, verstummte. Wieder war da nur die Nacht, nur Stille.
Und das Mädchen.
»Hallo?« Die Stimme des Jungen war leise und tastete sich vorsichtig an die Gestalt auf der Bank heran.
Man musste zu dieser Stunde vorsichtig sein, das wusste er. Nie konnte man wissen, was einen erwartete, wenn man in der Nacht hierher kam.
Die Welt des Friedhofs war so trügerisch wie das Leben jenseits der Mauer.
Leise fragte er erneut: »Hallo?«
Das Mädchen blieb still und rührte sich nicht.
Die Steinengel, die nicht weinten, bedachten sie mit kalten Blicken, regungslos.
Der mausgraue Junge beobachtete das Mädchen. In der Nacht und hier an diesem Ort war er kaum wahrnehmbar, leise wie ein Gedicht, dessen Sinn nur begreift, wer genau hinhört. Braune Augen, groß wie Monde, musterten die Gestalt auf der Bank.
»Alles okay mit dir?« Zögernd trat er auf sie zu. In seinen dunklen, lockigen Haaren glänzte der Nachtnebel.
»Was tust du hier?« Sie mochte so alt sein wie er selbst, vielleicht ein wenig älter, schätzte er. Jedoch nicht alt genug, um sich zu dieser Stunde an diesem Ort aufzuhalten.
»Schläfst du?«
Wieder keine Antwort, natürlich.
»War ja auch eine bescheuerte Frage«, gestand sich der Junge kopfschüttelnd ein.
Ein weiterer Schritt in ihre Richtung und ein kalter Lufthauch streifte ihn wie ein Flüstern.
Sie saß noch immer still und aufrecht auf der Bank, und als der Junge nur noch wenige Schritte von ihr entfernt war, sah er, dass sie die Augen fest geschlossen hielt. Sie atmete ruhig, Gott sei Dank.
»Du schläfst.« Er schüttelte den Kopf. »Gibt es denn so was?« Seine Stimme war dünn wie Nebel. Der nahe Winter lag schon in der Luft. In den frühen Morgenstunden und in der Nacht ließ der Herbst die kommenden Monate erahnen.
Langsam, argwöhnisch, ging der Junge die letzten Schritte auf das Mädchen zu und blieb vor ihr stehen. Der Lichtschein der Straßenlaterne streifte ihn.
»Es ist kalt hier draußen«, sagte er, doch auch dieses Mal erhielt er keine Antwort.
Er betrachtete sie eingehend. Sie sah aus wie ein normales Mädchen. Oder besser gesagt, sie sah aus wie ein hübsches normales Mädchen. Ein hübsches normales Mädchen, schlafend auf der Parkbank beim großen Tor. Zu dieser Uhrzeit. Sie trug eine lange Jacke mit Pelzkragen, dazu einen geringelten langen Schal. Jeans, schwarze Stiefel.
Der Junge dachte nach. Das Tor, das auf die Swains Lane hinausführte, war schon seit Stunden geschlossen. Der Friedhof war nur bis fünf Uhr nachmittags für Besucher geöffnet.
Durch das Tor konnte sie also nicht gekommen sein, unmöglich. Und sie wohnte auch nicht in einem der Gräber in der Gegend; nein, danach sah sie nicht aus. Auch hatte er sie hier noch nie gesehen. War sie vielleicht ein Gast? Jemand, der zur Party eingeladen worden war? Nein, davon hätten sie ihm erzählt. Gaskell hätte sie erwähnt, ganz sicher.
Wer aber war sie dann? Wer, in aller Welt, kam in einer kühlen Herbstnacht zu dieser nachtschlafenden Stunde hierher und warum?
»Hallo?«, versuchte er es von Neuem.
Sie rührte sich nicht. Ihr Gesicht war mit winzigen Sommersprossen besprenkelt. Ihr schulterlanges, glattes Haar schimmerte rot wie flammender Mohn im Morgenlicht.
»Du musst aufwachen, sonst erfrierst du noch.«
Nein, sie war bestimmt nicht von hier. Ihre Klamotten waren zu neu, als dass sie von hier sein konnte. Vielleicht gehörte sie zu den Neugierigen, die manchmal nachts auf den Friedhof kamen, weil sie in den Schatten Geheimnisse zu entdecken hofften. Nein, auch danach sah sie nicht aus.
Vielleicht sollte ich Hilfe holen?, fragte sich der Junge und dachte an Gaskell und die illustre Schar, die drüben beim Admiral feierte. Oder besser doch nicht. Er wollte sie nicht erschrecken. Und Gaskell und die anderen könnten sich, nun ja, ein wenig überrumpelt fühlen, käme er mit dem Mädchen daher.
»Du brauchst keine Angst zu haben«, sagte er und dachte an die Gefahren, vor denen seine neuen Freunde ihn oft gewarnt hatten. Seltsamen Wesen, die sich an diesem Ort in gläserner Nacht herumtrieben. »Ich habe auch keine Angst.« Eine Lüge laut auszusprechen, konnte, wie er wusste, wahre Wunder wirken.
Gaskells Geschichten kamen ihm in den Sinn, ausgerechnet jetzt. »Du bist nur du«, fragte er sie, »niemand sonst, nicht wahr?«
Wieder gab sie keine Antwort, schlief einfach weiter.
Okay, dann eben nicht.
»Nur du, nur ein Mädchen, sonst nichts.« Er sprach die Worte aus wie ein Mantra, das einen vor bösen Überraschungen bewahren konnte, wenn man nur fest genug daran glaubte.
Das Mädchen, den Kopf ein wenig schief gelegt, schlief einfach weiter. Sie sah friedlich aus.
Der Junge streckte wagemutig und wie traumwandlerisch die Hand nach ihr aus. Er musste es tun, denn nur so konnte er es herausfinden. Er berührte mit dem Finger ihre Wange und sah, wie ihre warme Haut sogleich seinen Finger benetzte. Ihm war, als tauchte er den Finger in eine Nebelwand hinein, und er zog die Hand ruckartig zurück.
Immerhin wusste er jetzt, was sie war.
Erschrocken flüsterte er: »Aber wie kommt es, dass du gar nicht kalt bist?« Sie war wie Gaskell und doch ganz anders. Nein, das Mädchen hier war anders. Sie war warm wie jemand, dessen Herz noch schlägt.
Aber das eine passte nicht zum anderen. Wer oder was mochte sie wohl sein?
Erneut streckte der mausgraue Junge die Hand aus, um sie noch einmal zu berühren.
Doch kurz bevor seine Finger abermals in ihre Haut eintauchten, öffnete sie die Augen. Sie waren haselnussbraun, das konnte er im Schein der Straßenlaterne sehen, voller Furcht, tief wie die Nacht und ebenso schön. Ein Blinzeln, erschrocken und schnell, dann ein Schrei, laut, verwundert und wütend gleichermaßen.
Noch während der Junge gebannt ihre schönen Augen betrachtete, sprang sie auf, glitt an ihm vorbei und trat, leicht humpelnd, in das Schattenland jenseits der Straßenlaterne.
»Hey!«, war alles, was er hervorbrachte.
Dann verkündigte der Glockenschlag im Verein mit dem rasend pochenden Herzen des Jungen Schlag Mitternacht und auf dem alten Friedhof war gerade eine neue Geschichte geboren worden.
1. Der mausgraue Junge
Einen halben Tag zuvor ahnte noch niemand etwas von den Ereignissen, die sich zu so später Stunde begeben sollten; am allerwenigsten der Junge selbst.
London war gerade golden und bunt wie der Herbst, der über die Stadt gekommen war und alles in die rostroten Farben und rauchigen Gerüche des Oktobers tauchte. Oktoberland, hatte Miss Rathbone es genannt. In den Parkanlagen von Kentish Town schüttelten die Bäume ihre Blätter ab und es schien, als bewegten sich die Straßen mit jedem Windhauch.
Jude Finney, der bei Tage kein bisschen mausgrau wirkte, anders als im Mondschein, und der auch keine Melodie summte, mochte den Herbst genauso wie den Frühling. Die Welt war von einem geheimnisvollen Zauber erfüllt, den Sommer und Winter nicht kannten. Er mochte es, wenn die Luft nach braunen Farben und Holzkohle und gebrannten Kastanien roch und wenn die Erinnerung an den Sommer im Morgennebel verblasste. Wenn es schien, als könnten sich die Sonnenstrahlen nicht so recht entscheiden, ob sie einen wärmen oder frösteln lassen sollen. Irgendwie hatte er dann das Gefühl, unbeschwerter atmen und klarer denken zu können.
Und die Stadt schien sich viel langsamer zu bewegen als sonst.
Aber jetzt trennte ihn schmutziges Fensterglas von der Luft und dem Leben da draußen. Vor ihm auf dem Tisch lag ein dünner Stapel unbeschriebener Blätter, die darauf warteten, dass er sie mit geistreichen Gedanken füllte. Zumindest erwartete das sein Lehrer. Dazu hatte er zwei Stunden Zeit. Und während seine Mitschüler emsig bemüht waren, einen klugen Aufsatz zum Thema Die Welt, in der wir leben zu verfassen, starrte Jude zum Fenster hinaus und dachte an die Party in der kommenden Nacht, zu der Gaskell ihn eingeladen hatte. Es würde eine lustige Nacht werden, davon war Jude überzeugt, denn Gaskells gesamte Nachbarschaft würde sich dort versammeln und im Mondlicht singen.
Mr Ackroyd indes, Fachlehrer und Leiter des Fachbereichs Englisch an der altehrwürdigen Kentish School, schaffte es, den Himmel an diesem Mittag zu trüben. Er hatte eine grüne Karteikarte mit der gedruckten Aufschrift A-Level – General Certificate of Advanced Education in die Mitte des Whiteboards geklebt und darunter handschriftlich den unnötigen Zusatz Irregulärer Test gekritzelt.
Jude seufzte. Sein braunes Haar sah störrisch wie Holzwolle aus und er selbst fühlte sich ebenso. Sobald er die Schule betrat, kam er sich wie ein Fremder vor. Er rückte die Brille mit dem schwarzen Rand zurecht und sah erneut auf die Blätter, die außer dem runden Schulstempel rechts oben in der Ecke und den vorgedruckten Linien noch schneeweiß waren.
»Das, was ich von euch erwarte«, hatte Mr Ackroyd zu Beginn der Stunde näselnd gesagt, »ist, wie alles im Leben, im Grunde ganz einfach. Zeigt mir, dass ihr kritisch denken könnt. Die Welt, in der wir leben. Schreibt eure Gedanken nieder und macht mich stolz, euch meine Klasse nennen zu dürfen. Seid kreativ!«
Jude rollte die Augen. Er war müde und schläfrig und das langweilige Thema tat ein Übriges. Worüber sollte er schreiben? Die überaus reichen Erfahrungen, die er in den letzten Wochen seines siebzehnjährigen Lebens gesammelt hatte, boten wohl kaum Stoff für den Aufsatz, der Mr Philip Ackroyd vorschwebte.
Er starrte auf das leere Blatt und das leere Blatt starrte zurück. Jude gähnte.
Gestern erst hatten alle Spekulationen angestellt, ob Mr Ackroyd den Test in dieser Woche oder in der nächsten schreiben lassen würde. In der Klasse hatte man sich einstimmig darauf geeinigt, dass es wohl erst nächste Woche so weit sein würde. Aber ihre Prognosen waren reine Wunschvorstellung gewesen.
Jude rieb sich die Augen und spielte ein wenig mit der Brille herum, bevor er sie wieder aufsetzte.
Er könnte über Gaskell und all die anderen schreiben, die auf dem Highgate Cemetery wohnten; und über Miss Rathbone. Aber das, befürchtete er, war sehr weit entfernt von dem, was man in einem A-Level-Test erwartete – auch in einem irregulären Test. Mr Ackroyd sagte nie »unangekündigter Test« — er liebte es, mit Fremdwörtern um sich zu schmeißen.
Da aber genau das der interessante Teil der Welt, in der er lebte war, saß Jude weiter wie ausgestopft da und wartete darauf, dass die Zeit verging.
Nur das Klappern der Heizung und das gelegentliche Ächzen und Stöhnen der anderen Schüler durchbrach die brütende Stille, die wie ein Teppich über dem Klassenzimmer lag. Mr Ackroyd saß vorn am Pult und machte sich Notizen.
Jude probierte einige Körperhaltungen aus, die es ihm erlaubten, möglichst unauffällig den Kopf zu stützen, sodass er im Falle vorzeitigen Einschlafens einen unangenehm lauten Aufprall auf der Tischplatte vermeiden konnte.
Er dachte an seinen Vater und das Haus in der Twisden Road. An den Geruch von Mikrowellenessen. Die Stille, die ihn dort erwartete. Er betrachtete das leere Blatt vor sich und genoss das Weiß, auf das sich kein einziger Buchstabe verirrt hatte.
Die Welt, in der wir leben.
Er legte seine flache Hand auf das unbeschriebene Blatt. Die weiße Leere war auf eine Art und Weise betörend, wie es die Lieder von Neil Hannon waren. Manchmal fühlte auch er sich so — wie ein leeres Blatt. Fast war ihm, als könnte er eintauchen in dieses stille Weiß, das wie ein leises Rauschen im Ohr war, dessen Ursprung man nicht ausmachen konnte.
Jude drehte den Kopf zur Seite und beobachtete Melanie Briggs, die fleißig ihren Aufsatz kritzelte und dabei die Stirn kraus zog. Als koste es sie übermäßige Anstrengung, die Belanglosigkeiten zu Papier zu bringen, die zweifellos mit reichlich Schminke und den Jungs aus dem Motorradsportkurs zu tun hatten. Gleich hinter ihr hockte Herbert Sorkin, der sich mit hochrotem Kopf mühsam Sätze abrang, die vermutlich ebenso geistreich waren wie die Parolen, die er bei den Spielen von Manchester United vor dem Fernseher grölte.
»Du schreibst ja gar nichts.«
Jude hob den Blick.
Mr Ackroyd war leise von hinten an ihn herangetreten; geschlichen traf es wohl besser. Das leere Blatt musste seine Aufmerksamkeit erregt haben.
»Ich bin schon fertig.« Jude hielt das Blatt in die Höhe und schaute unschuldig drein.
»Beeindruckend.« Mr Ackroyd sah ihn mit ausdrucksloser Miene von oben herab an. »Höchst beeindruckend.« Die Mundwinkel zuckten missbilligend nach unten. »Du hast nichts zu Papier gebracht.«
»Es steht alles da«, sagte Jude.
Die anderen Schüler im Raum spähten verstohlen zu ihm herüber. Ihre Aufmerksamkeit war wie ein grellgelbes Knistern in der Luft. Einer der seltenen Momente während eines irregulären Tests, in denen endlich etwas passierte.
»Ist das wieder eine deiner Attitüden?«
Noch eines dieser Wörter, die Mr Ackroyd so gönnerhaft verwendete und den Lehrer in Judes Augen noch alberner werden ließen. Jedenfalls konnte er ihn damit nicht beeindrucken. »Und verkneife dir das exaltierte Gehabe.« Mr Ackroyd wertschätzte Schüler, die genau das taten, was er ihnen auftrug, und Jude Finney gehörte nicht zu ihnen.
»Ich verstehe nicht, was Sie daran auszusetzen haben.«
Doch eines musste man Mr Ackroyd lassen: Aufbrausend wurde er nie. Nie erhob er die Stimme. Das war nicht seine Art.
»Das hier«, sagte Mr Ackroyd mit schmalen Lippen, »ist ein wichtiger Test. Das Ergebnis wird Teil der Abschlussnote sein.« Er gab sich Mühe, seine Stimme so leise klingen zu lassen, dass er die Prüflinge nicht unnötig störte, aber laut genug, dass jeder in der Klasse mitbekam, was er sagte.
»Das weiß ich.«
»Dann solltest du dir mehr Mühe geben.«
»Ich habe nachgedacht.« Jude meinte das durchaus ernst. »Und habe meine Gedanken niedergeschrieben.«
Auf Mr Ackroyds Wangen zeichneten sich rote Äderchen ab. »Aber du hast ja gar nichts geschrieben.« Er betonte jedes einzelne Wort.
»Auch ein leeres Blatt kann etwas aussagen. Man muss es nur lange genug betrachten.«
»Mach dich nicht über mich lustig.«
Jude sah ihn ernst an, noch immer ruhig. »Ich mache mich nicht über Sie lustig.« Etwas in seinem Blick schien sein Gegenüber davon zu überzeugen, dass er die Wahrheit sagte. Jude hatte wirklich nicht die Absicht, sich über seinen Lehrer lustig zu machen.
»Du . . .« Mr Ackroyd schien es sich anders zu überlegen. »Nun, ich werde jedenfalls kein leeres Blatt akzeptieren.« Er seufzte. »Ist das deutlich genug, Jude Finney? Kein leeres Blatt!«
»Aber das . . .«
Mr Ackroyd fiel ihm ins Wort. »Das Thema der Arbeit«, wiederholte er mit gepresster Stimme, »lautet Die Welt, in der wir leben.« Er funkelte den Jungen wütend an. »Wir haben in der letzten Stunde darüber gesprochen.« Er wandte sich jetzt an die ganze Klasse, die schweigend das Schauspiel verfolgte. »Ich will, dass ihr euch in diesem Aufsatz kritisch mit einem ernsthaften Thema auseinandersetzt. Nicht mehr und nicht weniger.« Er richtete seine ganze Aufmerksamkeit wieder auf Jude.
»Aber das habe ich doch getan.« Der Junge senkte den Blick auf das Blatt. Es war zu erwarten gewesen, dass Mr Ackroyd ihn nicht verstand. Ebenso wenig wie die anderen Schüler, jedenfalls ließen die Blicke, die sie ihm zuwarfen, darauf schließen. Aber sie waren dankbar für die Ablenkung. Jude hätte es wissen müssen. Genau das war das Problem mit der Schule. Keiner verstand einen. Dabei sollte doch gerade Mr Ackroyd, ein Englischlehrer, der vorgab, die Gedanken all der großen Schriftsteller und Dichter zu verstehen, mehr Verständnis für ungewöhnliche Ansichten aufbringen.
Die Welt, in der wir leben.
Na klasse.
»Du wirst etwas schreiben!«, befahl Mr Ackroyd ihm. »Hast du gehört, Jude Finney.«
Jude betrachtete das leere Blatt.
Die Toten sind viel lebendiger als mein Englischlehrer.
»Okay«, sagte er. Er machte ein nachdenkliches Gesicht und senkte erneut den Blick.
Er wusste natürlich, dass er merkwürdig klingende Sätze wie Ich kenne eine Füchsin, die fast verlernt hat, eine Füchsin zu sein oder Letzte Woche begegnete ich einem Boxer, auf dessen Grab ein Löwe sitzt nicht schreiben konnte.
»Okay«, murmelte Jude noch einmal, leiser und merklich genervt.
Mr Ackroyd indes schritt, nachdem er noch einen Augenblick lang unbeeindruckt an seinem Platz stehen geblieben war, durch die Bankreihen, um sich zu vergewissern, dass Jude der einzige exaltierte und aufmüpfige Prüfling war.
Jude spähte sehnsüchtig nach draußen, wo sich das weite Grün von Hampstead Heath erstreckte. Wie gern wäre er jetzt dort. Die anderen in der Klasse hingegen dachten jetzt bestimmt an ihre Noten, an neue Klamotten, an Smartphones und Geld.
Die Welt, in der wir leben.
»Nun schreib schon was«, flüsterte Mike, der in der Bank neben ihm saß. Mike verbrachte sein Leben jenseits der Schule damit, sich auf Facebook mit Reptilienfreunden über die Lebensweisen und die Krankheiten von Kaimanen, Schlangen und Waranen zu unterhalten. Und trotz seines ungewöhnlichen Hobbys war sein Leben normaler als das Leben, das Jude neuerdings führte.
»Jaja«, murmelte Jude nur.
Dann malte er ein Fragezeichen in die Mitte des Blattes, nicht besonders groß, einfach nur ein Fragezeichen.
Mike, der es sah, rollte die Augen, widmete sich dann aber wieder seiner eigenen Arbeit.
Jude betrachtete sein Fragezeichen und konnte sich ein zufriedenes Grinsen nicht verkneifen. Ja, das war es. Besser als ein weißes Blatt und besser als viele Worte.
?
Sonst nichts.
?
Perfekt!
Er stand auf, ging, begleitet von den neugierigen Blicken der anderen, nach vorn und reichte das Blatt seinem Lehrer, der die Augen, je näher Jude dem Pult kam, immer mehr zusammenkniff.
Er nahm die Arbeit entgegen und betrachtete das Fragezeichen.
»Wir müssen reden.« Mehr sagte er nicht. »Später, in meinem Büro.« Mit einem Kopfnicken bedeutete er Jude, an seinen Platz zurückzukehren.
Und während Jude wieder Platz nahm, zückte Mr Ackroyd einen Kugelschreiber und versah das fast leere Blatt mit dem Fragezeichen in der Mitte mit Anmerkungen.
Jude sah wieder zum Fenster hinaus in den Park, wo sich die kahlen Bäume in den Herbsthimmel reckten.
Als er Mr Ackroyd folgte, waren ihm die neugierigen Blicke der anderen sicher. Jude war einer jener Schüler, den niemand nicht mochte, weil es nichts an ihm gab, was man offenkundig nicht mögen konnte. Jude Finney war aber auch ein Schüler, den niemand so wirklich vermissen würde, wäre er eines Tages einfach nicht mehr da. Er war okay und die anderen waren für ihn okay. Nicht mehr und nicht weniger.
Während er seinem Englischlehrer durch die Gänge und ins Treppenhaus folgte, lauschte er den seltsamen Geräuschen, die Mr Ackroyds Gummisohlen machten, und den kaum hörbaren Geräuschen, die seine in rot-grünem Schottenkaro gemusterten Chucks von sich gaben. Mr Ackroyd, der kein einziges Wort sagte, gefiel sich offenbar in seiner Schweigsamkeit, die der Situation etwas Dramatisches verlieh.
Im Büro der Englischabteilung roch es nach warmem Kopierer und Kaffee. Miss Reng, die in der Unterstufe unterrichtete, saß an ihrem Arbeitsplatz und sah, bei ihren Korrekturen gestört, genervt auf, als sie den Raum betraten. Neben ihr dampfte eine Tasse Kaffee.
»Ich verstehe dich nicht«, begann Mr Ackroyd in einem Tonfall, der Jude verdächtig friedlich vorkam. »Du bist wortgewandt, intelligent.« Er hielt die Arbeit des Jungen in den Händen. »Und dann das hier.« Er lehnte an seinen Schreibtisch und seufzte erneut. »Nein, ich verstehe dich einfach nicht.«
»Ich verstehe mich meistens auch nicht«, antwortete Jude, der wie ein Angeklagter auf dem Drehstuhl vor dem Schreibtisch hatte Platz nehmen müssen.
»Du willst doch den Abschluss machen.«
Jude nickte.
»Und du weißt, dass die Ergebnisse der irregulären Tests in die Abschlussnote einfließen werden.«
»Ja, Mr Ackroyd.«
»Warum gibt du mir dann ein leeres Blatt ab?«
»Es ist nicht leer.«
»Es ist so gut wie leer.«
»Das Fragezeichen hat etwas zu bedeuten.«
Mr Ackroyd wurde allmählich ungeduldig. »Was soll das bitte bedeuten?«
Jude fragte sich, ob er es erklären sollte, unterließ es aber, weil er ahnte, dass ihm das nichts als weiteren Ärger einbringen würde.
»Alle anderen . . .« — Mr Ackroyd pochte auf den Stapel Arbeiten, die vor ihm auf dem Schreibtisch lagen — »haben sich Mühe gegeben und lange Aufsätze zu diesem Thema geschrieben.« Er machte eine Pause. »Die Welt, in der wir leben.« Erneute Pause. »Das ist doch auch die Welt, in der du lebst, Jude. Machst du dir keine Gedanken darüber? Über dich. Dein Leben. Deine Zukunft?«
»Deswegen habe ich doch das Fragezeichen gemacht.«
Der Lehrer sah ihn lange an. Er setzte sich auf seinen Stuhl und lehnte sich zurück. Dann blickte er auf den Stapel der anderen Arbeiten und seufzte. »Weißt du, was ich denke?«
Jude schüttelte den Kopf.
»Ich denke, ich sollte mit deinem Vater reden.«
Jude merkte, wie sich seine Finger um die Armlehnen krallten. »Der ist nicht da.«
»Was heißt er ist nicht da?«
»Er ist für zwei Tage verreist.«
»Ach ja?«
Jude nickte. »Ja, wirklich. Er leitet so ein Projekt.«
»So ein Projekt?« Mr Ackroyd sah ihn misstrauisch an.
»Ja, für das Umweltamt.« Das stimmte, sein Vater arbeitete als Hydrologe in der Environment Agency in Southwark.
»Aha, ein Gewässerkundler.«
»Es geht da wohl um die Säuberung des Rhode Lodge Lake bei Manchester.« Das waren die Dinge, die Judes Vater interessierten: die biologische und chemische Beschaffenheit von Gewässern, die Formen und Gestalten, die Flüsse in verschiedenen Ländern annehmen können.
»Wann kommt er zurück?«
»Am Freitag. Aber er kommt vermutlich erst spätabends nach Hause.«
Mr Ackroyd überlegte kurz. »Nun gut, dann würde ich gern mit ihm reden, wenn er wieder da ist.«
»Ich richte es ihm aus.«
»Um sicherzugehen«, sagte Mr Ackroyd, »werde ich ihm eine Mitteilung zukommen lassen.«
Jude nickte.
»Du kannst jetzt gehen.« Damit war Jude entlassen und der Junge kehrte in den Unterricht zurück.
Nach der Schule schlenderte Jude ohne Eile heimwärts. Die Twisden Road war eine gewöhnliche Straße, wie man sie in jedem englischen Vorort und den Außenbezirken von Greater London fand. Kleine Reihenhäuser, die mit ihren winzigen Vorgärten und Briefkästen alle gleich aussahen, säumten die Gehwege. An der Ecke York Rise und Chetwynd Road befand sich ein Laden, der fast alles im Angebot hatte, wozu man bei Tescos eine Viertelstunde lang in der Schlange stehen musste. In diesem Laden kaufte Jude ein paar Lebensmittel ein, bevor er nach Hause ging.
Die Schule aus seinen Gedanken zu verbannen, fiel ihm nicht schwer. Der Tag war so wunderbar golden, pures Herbstland, und er dachte an die bevorstehende Party. Gaskell verließ sich darauf, dass er seine Gitarre mitbrachte. Also beschloss er, sich zu Hause erst einmal auszuruhen, um nachts dann fit zu sein.
Nur Augenblicke später stand er vor dem Haus in der Twisden Road Nr. 8, von dessen rostigen Briefkasten die blaue Farbe bröckelte. Er kramte den Schlüssel aus seiner Jackentasche, schloss die Tür auf und trat ein.
»Niemand da?«, fragte er in die Stille hinein, als wollte er sich vergewissern, dass sein Vater wirklich fort war. Er schleppte die Einkaufstüten in die Küche und stellte die Milchtüten und anderen verderblichen Produkte in den Kühlschrank. Dann schaltete er den Fernseher neben der Mikrowelle ein, setzte sich an den Tisch, aß zwei Scheiben Toast mit Käse und sah sich eine Wiederholung von Primeval an. Dabei schlief er ein.
Als er wach wurde, den Kopf auf den verschränkten Armen, war es bereits fünf Uhr. Er rekelte sich und dachte müde an die Hausaufgaben für den morgigen Tag und seufzte.
Er ging ins Bad, duschte, hörte laute Musik und sang dazu. Dann streifte er ziellos durch die Wohnung.
Das Arbeitszimmer seines Vaters war wie immer aufgeräumt. Auf dem Schreibtisch stapelten sich fein säuberlich die Dokumente in Ablagefächern. Die Bilder an den Wänden zeigten allesamt Flusslandschaften, vorwiegend Ansichten der Themse.
Ein Bild von Judes Mutter war nirgends zu entdecken. Wie gerne hätte er einmal ihr Gesicht gesehen. Er fragte sich oft, ob er ihr ähnlich sah. Das war eines der vielen Fragezeichen, das größte, das mit dunkler Tinte auf die weißen Blätter seines Lebens gekritzelt war. Sein Vater sprach niemals über Judes Mutter. Und Jude hatte aufgehört, Fragen zu stellen, auf die er nie eine Antwort bekam.
Er verließ das Büro seines Vaters und ging in sein Zimmer, das oben im ersten Stock lag.
Die Dachschräge verlieh dem Raum die Atmosphäre einer gemütlichen Höhle. Zwischen dem Schrank und dem Bett lagen Klamotten, Bücher, CD-Hüllen und allerlei Krimskrams auf dem Boden verstreut, an den Wänden hingen Plakate von Lou Reed, Scouting for Girls, Quentin Gaskell und Thea Gilmore.
Hier fühlte er sich wohl. Dies war Judes kleines Reich.
»Wann wirst du endlich ordentlich?«
Selbst wenn George Finney nicht da war, hallte seine Stimme wie ein Echo durchs Haus.
»Ich . . .«
»Du wirst es nie zu etwas bringen, meine Güte, wann willst du endlich anfangen, dein kleines Leben in den Griff zu bekommen?« Jude wusste, dass sein Vater nicht wirklich eine Antwort von ihm erwartete. Sein Vater wollte nur, dass er ihm zuhörte.
Sobald es ruhig wurde im Zimmer seines Sohnes, schöpfte George Finney Verdacht und platzte unangekündigt herein. Für ihn gab es nur zwei Möglichkeiten: Entweder Jude machte gerade etwas, was nichts mit der Schule zu tun hatte, oder er lag faul auf dem Bett oder schlief sogar. Jedenfalls machte er nicht seinen Job.
»Die Schule ist dein Job«, wurde George Finney nicht müde, wieder und wieder zu predigen.
Jude brachte dann irgendeine fadenscheinige Entschuldigung hervor: »Ich wollte gerade mit den Hausaufgaben beginnen.« »Wir haben eine Arbeit geschrieben, war total anstrengend.« Oder: »Ich bin mit den Aufgaben schon fertig.« Wobei Letzteres nicht als Entschuldigung durchging. Für George Finney war man nie fertig mit den wirklich wichtigen Dingen, und wenn man seine Pflichten allzu sehr vernachlässigte, bekam man das Taschengeld gekürzt.
Sie stritten viel, was vermutlich normal war. Nur beim Kochen war George Finney entspannt. Vor allem, wenn er indisch kochte — und das konnte er sehr gut —, schien er ganz in seinem Element zu sein. Dann war er plötzlich ein ganz anderer Mensch.
»Wir reden viel zu selten miteinander«, hatte er in einem dieser seltenen Momente einmal zu Jude gesagt.
»Du bist oft unterwegs.« Jude liebte den Geruch nach Tandoori Masala, Curry und Jeera-Pulver.
»So ist es halt, wenn man erwachsen ist.« Bedauern schwang in der Stimme seines Vater mit, doch er führte den Gedanken nicht weiter aus: Das waren Dinge, über die sein Sohn nichts wusste und von denen sein Vater nicht erzählen wollte.
Wenn sie gemeinsam am Tisch in der kleinen Küche aßen, war die Beziehung zwischen Vater und Sohn beinahe harmonisch. Dann war es, als würden Dal Makhani und Punjabi Chole, die Lieblingsgerichte von George Finney, einen geheimen Zauber ausüben, der sie verband. Und der die unbeantworteten Fragen, die zwischen ihnen standen, unwichtig erscheinen ließ.
»Indien«, sagte Judes Vater in einem jener seltenen Momente, »ist wie ein Märchen.« Jude wusste, dass er eine Zeit lang in Indien gearbeitet hatte. Aber das war vor seiner Geburt gewesen. Wenn sein Vater in der richtigen Stimmung war, erzählte er von den heiligen Flüssen Indiens, den geheimnisvollen Riten, von exotischen Tieren und dem quirligen Leben in den überbevölkerten Städten.
Jude sah zum Fenster hinaus. Langsam wurde es Abend.
Endlich!
Wenn sein Vater fort war, verbrachte er den Großteil seiner Freizeit damit, auf seiner Gitarre zu spielen. Oder er schlief, las Comics und wartete darauf, dass der Tag verging. Und er dachte viel nach — über sich selbst, über die Welt, über den Friedhof und die Dinge, die er nicht wusste und so gern in Erfahrung gebracht hätte und die sich so verdammt gut mit einem Fragezeichen ausdrücken ließen.
Kurz und gut, Jude Finney war ein ganz normaler Teenager, wenn man einmal von der Sache mit Gaskell und den anderen absah.
Quentin Gaskell hatte vor etwas mehr als dreißig Jahren mit My Perfect Little Daylight einen legendären Hit in England gelandet. Und zu einer seiner nicht minder legendären Partys war Jude an diesem Abend eingeladen.
Gegen acht Uhr abends machte er sich auf zum Highgate Cemetery. Wenn sein Vater, wie heute, nicht zu Hause war, stellten die nächtlichen Besuche dort kein Problem dar. Wenn er, was leider häufiger vorkam, in der Twisden Road war, bemühte der Junge Miss Rathbone, die heute natürlich, wie all die anderen auch, zur Party eingeladen war. Miss Rathbone war sozusagen Judes Alibi. Doch Miss Rathbone war eine ganz eigene Geschichte . . .
Jude nahm seine Gitarrentasche, schulterte sie und machte sich auf den Weg.
Wenn es Abend wurde, war Kentish Town ein ruhiges Viertel. Es lag fernab der hell erleuchteten Londoner Innenbezirke und die Uhren tickten hier anders.
Er ging zu Fuß bis zur Swains Lane, und als er an Miss Rathbones Haus vorbeikam, bemerkte er, dass dort kein Licht mehr brannte. Sie war also bereits in der Egyptian Avenue, wo Gaskell wohnte.
Inzwischen kannte Jude den Weg zu Gaskells Grab im Schlaf. Die anderen Partygäste waren schon da. Dort angekommen, packte Jude seine Gitarre aus und spielte Lieder von Neil Hannon, Justin Sullivan und den Beatles, während Miss Rathbone dazu mit ihrer wunderbaren Fuchsstimme sang, die alle anderen betörte und selbst Quentin Gaskell verzaubert im Takt wippen ließ. Dann legten sie CDs in den schweren Radioplayer ein und die Hits der Rock-’n’-Roll-Ära ließen das Gemäuer erbeben.
Irgendwann ging Jude nach draußen, weil er dringend pinkeln musste. Er suchte sich eine Stelle, die fernab der Avenue lag, wo die Landschaftsgärtner ihre Gerätschaften lagerten. Als er zur Party zurückschlenderte, sah er das Mädchen auf der Bank am Nordtor.
Und das war der Moment, als die Geschichte mit dem Mädchen anfing . . .
»Lauf nicht weg!«, rief er ihr hinterher, als das Mädchen in die Schatten tauchte. Er machte keine Anstalten, ihr zu folgen. Er wusste, dass das keinen Sinn hatte. Noch immer fragte er sich, warum in aller Welt, sie sich so unglaublich warm angefühlt hatte.
Das Mädchen blieb stehen. Sie war zwischen einer Reihe von Gräbern und Skulpturen hindurchgelaufen, bis zu der Hecke weiter hinten an der Mauer.
Langsam drehte sie sich zu ihm um.
»Wer bist du?«, fragte sie.
»Ich bin Jude«, sagte er. »Und du?«
Sie erwiderte nichts. Sie blinzelte und fahles Mondlicht schimmerte in ihren Augen.
»Was tust du hier?«
»Das sollte ich dich fragen.« Ihre Stimme war wie eine unvollständige Melodie, rätselhaft. Ihr Rhythmus wie das Rascheln des Laubs im Wind.
Sie trat näher, musterte ihn vorsichtig. »Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin.« Sie schaute sich um und das, was sie sah, schien sie zu verunsichern. »Wo bin ich hier eigentlich?«
An einem Ort, von dem ich selbst vor einem halben Jahr nicht geglaubt hätte, dass er existiert. Jedenfalls nicht so; nein, mit Sicherheit nicht. Nicht so lebendig und so geheimnisvoll und so voller Geschichten, die seine Bewohner begierig waren zu erzählen.
»Du bist auf dem Highgate Cemetery«, sagte Jude. Er stand noch immer auf dem Weg und rührte sich nicht.
»Auf dem Friedhof?«
»Ja, sieht wohl ganz danach aus.«
Langsam kam sie auf ihn zu. Sie bewegte sich wie eine Marionette, unbeholfen und vorsichtig. »Was mache ich hier?« Sie hinkte kaum merklich.
Er zuckte die Achseln. »Keine Ahnung.« Woher sollte er das wissen?
»Und du? Was tust du hier?«
Jude beschloss, es mit der Wahrheit zu versuchen. »Ich war auf einer Party.« Er verbesserte sich. »Na ja, das heißt, ich wollte gerade wieder zurück zu der Party.« Das mit dem Pinkeln musste sie ja nicht wissen.
»Eine Party? Auf dem Friedhof?« Sie musterte ihn skeptisch.
Jude fand, dass sie keinen Grund dazu hatte, so zu schauen. »Du hast mir noch immer nicht gesagt, wer du bist und was du hier machst.«
Sie atmete tief durch. »Ich . . . ich weiß nicht.« Sie wankte leicht, als wäre ihr schwindelig.
»Du meinst, du hast deinen Namen vergessen?«
Sie nickte.
»Und du hast keine Ahnung, wie du auf die Bank gekommen bist?«
Erneutes Nicken.
»Vielleicht kann ich dir helfen«, sagte er.
»Wie denn?« Sie trat aus der Gräberreihe heraus und auf den Weg. Im Schein der Laterne konnte Jude ihr Gesicht nun besser erkennen. Ihre haselnussbraunen Augen faszinierten ihn noch immer.
»Ich kenne hier einige Leute«, erklärte er ihr.
»Die Leute von der Party?«
»Ja.«
»Und du glaubst wirklich, die können mir helfen?«
»Vielleicht. Sie sind nett. Ja, sie werden sich Mühe geben, bestimmt.«
»Wer sind sie?«
»Sie wohnen hier.«
Sie stand jetzt vor ihm.
»Kann ich dir trauen?« Die Nacht verfing sich in ihrem Haar. Sie sah aus wie ein normales Mädchen, hätte ebenso gut eines aus seiner Schule sein können.
»Ich bin ein ganz normaler Junge«, sagte er, als wäre das ein Grund.
»Na klasse, und ich bin nur ein Mädchen.« Leiser Spott schwang in ihrer Stimme.
»Ich bin wirklich harmlos.«
»Das kann jeder sagen.«
»Ich bin nicht jeder.«
»Toller Trost.«
»Du bist wie sie«, sagte Jude unvermittelt.
»Wie wer? Deine Freunde von der Party?«
Er nickte. Jude fand, dass jetzt der Moment gekommen war, um ihr von den Geistern zu erzählen.
Manchmal passieren einem merkwürdige Dinge, die niemand so richtig erklären kann. Die Geschichte mit den Geistern begann mit Miss Rathbone und dem Unfall in Hampstead. Das war vor einem halben Jahr und bis zu diesem Tag war Jude der Überzeugung gewesen, ein ganz normaler Junge zu sein. Danach wusste er, dass es Dinge gab, die merkwürdig und ein wenig beängstigend waren, aber vermutlich dennoch völlig normal. So jedenfalls sah es Miss Rathbone.
Wie auch immer, nichts von alledem ließ sich mehr rückgängig machen. Im vergangenen Frühjahr war Jude an einer Kreuzung vorbeigekommen, wo sich kurz zuvor ein Unfall ereignet hatte. Davor war er drüben in Hampstead gewesen. Gemeinsam mit Benny Andrews und Joolz Ellison hatte er den ganzen Nachmittag über Balladen von New Model Army auf der Wiese am Parliament Hill geübt. Auf dem Weg zurück zur U-Bahn-Station Hampstead Heath gelangte er dann an die Unfallstelle. Ein Geschäftsmann war an der Ecke Parliament Hill und Nassington Road von einem Motorrad erfasst und auf den Gehweg geschleudert worden. Der Motorradfahrer schien ebenfalls verletzt. Jude war nicht direkt Zeuge des Unfalls gewesen; er hatte aus der Ferne nur das krächzende Geräusch eines aufheulenden Motors und ein sehr lautes krachendes Scheppern gehört. Außer ihm eilten auch andere Passanten zur Unglücksstelle. Ein Polizeiwagen stand bereits mitten auf der Straße und zwei Polizisten liefen geschäftig hin und her.
Das Motorrad lag vor einem roten Mini, dessen eine Seite ganz verbeult war. Hinter dem Mini und dem Motorrad hatte sich eine Menschenmenge aus Neugierigen gebildet.
Der Geschäftsmann in dem blauen Nadelstreifenanzug aber lag allein auf der anderen Straßenseite, niemand schien ihn zu beachten. Jude hatte nicht gesehen, wie er dorthin gelangt war; doch er blieb stehen, stellte die Gitarrentasche ab und kniete sich augenblicklich neben den Mann. Er war noch recht jung, wirkte aufgeregt, aber nicht verletzt.
»Sie dürfen sich nicht bewegen«, sagte Jude.
Der junge Mann sah ihn an. »Ich bin angefahren worden.« Er schüttelte den Kopf, als könne er es noch gar nicht fassen.
»Ich höre den Krankenwagen.« Das Travel Clinic Hospital befand sich gleich um die Ecke, gerade einmal einen Block entfernt, hinter der U-Bahn-Station. »Man wird Ihnen gleich helfen.«
»Mir ist so kalt.« Die Sonne schien dem Mann ins Gesicht. Es war ein recht warmer Frühlingstag.
Jude half ihm, die Krawatte zu lockern.
»Bleiben Sie ruhig liegen.« Jetzt bereute er es, noch nie einen Erste-Hilfe-Kurs belegt zu haben. Aber in Fernsehserien wie Emergency Room oder Dr. House beschworen sie die Verletzten immer, einfach ruhig liegen zu bleiben. Das schien Jude ein guter Ratschlag zu sein; schaden konnte er jedenfalls nicht.
»Ich spüre meine Beine nicht mehr«, sagte der Mann. Seine Augen weiteten sich vor Angst.
Jude berührte ihn an der Hand. Sie war tatsächlich eiskalt.
»Meine Freundin hat heute Geburtstag.« Der junge Mann klang jetzt verzweifelt. »Sie heißt Amy.«
Jude betrachtete ihn. »Sie werden Sie später bestimmt sehen.«
»Ich weiß nicht. Ich bin angefahren worden.«
»Bleiben sie einfach ruhig liegen.«
»Ich habe das blöde Motorrad nicht kommen sehen.« Er hustete, zitterte.
Drüben auf der anderen Straßenseite umringte die Menschenmenge, wie es schien, den Motorradfahrer.
»Hallo?«, rief Jude den Polizisten zu, die drüben standen.
Ein Polizist sah zu Jude herüber. »Was ist los, Junge?«
»Sehen Sie das denn nicht?« Die Begriffsstutzigkeit des Polizisten machte ihn wütend. Er hatte ein komisches Gefühl bei der Sache. Die Sonne stand hoch am Himmel und ihm wurde heiß.
»Geh nach Hause!«, rief der Polizist ihm nur zu, bevor er sich umdrehte und von der Menschenmenge geschluckt wurde.
Eine Ambulanz kam mit Blaulicht und Sirene angefahren. Sanitäter sprangen heraus, es herrschte große Hektik.
»Spinnt der?« Jude fluchte. Hatte der Polizist nicht gesehen, dass es hier auch noch einen Verletzten gab?
Was hatte das zu bedeuten?
Da stöhnte der Mann plötzlich laut auf. Mit weit aufgerissenen Augen blickte er ebenfalls zur anderen Straßenseite. Seine Augen waren vor Entsetzen weit aufgerissen.
»Hey!«, rief Jude abermals über die Straße hinweg, doch niemand beachtete ihn.
Als er sich wieder dem Mann zuwenden wollte, war er plötzlich nicht mehr da.