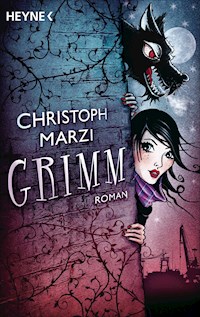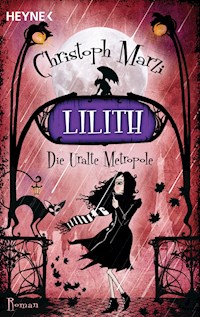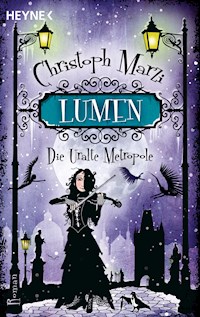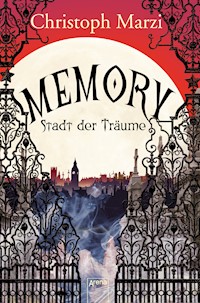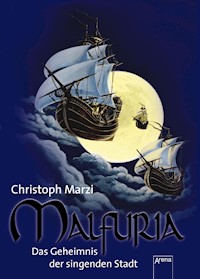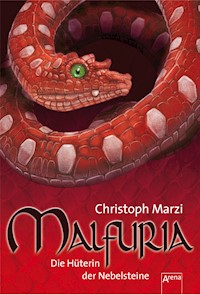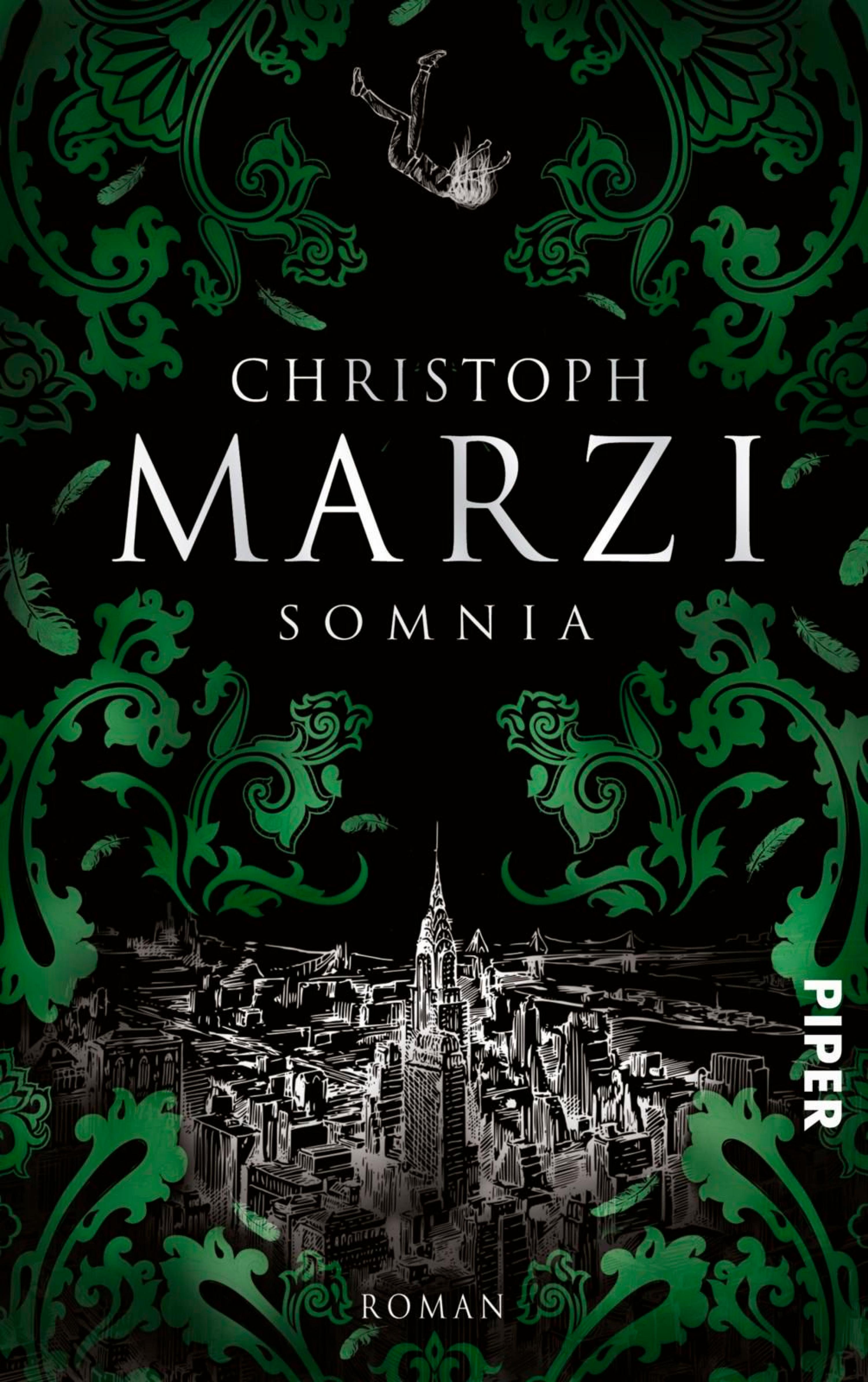Christoph Marzi
Grimm
Roman
Für alle, die nicht verlernt haben, an Märchen zu glauben
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2010 by Christoph und Tamara Marzi
Copyright © 2010 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München. Redaktion: Uta Dahnke
Layout und Herstellung: Mariam En Nazer Satz: C. Schaber Datentechnik, Wels
Umschlagillustration und Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design
ISBN: 978-3-641-05214-0V004
www.heyne-fliegt.de
»Und als das Goldkind sich umsah, so stand es vor einem kleinen Haus, darin saß eine Hexe.«
Jacob Grimm, Die Goldkinder
Es war einmal …
Tage wie dieser, im Regen verweht
Vesper Gold, in deren grün schimmernden Augen sich unverhohlener Trotz zeigte, saß nahezu regungslos auf dem Stuhl im Vorzimmer der Direktorin und wartete darauf, dass ihre Mutter eintraf. Sie trug die wilde Entschlossenheit, sich nicht unterkriegen zu lassen, so eng umschlungen wie den petrolfarbenen Schal, den ihre Finger langsam entknoteten. Tage wie dieser, an denen alles schieflief, waren eindeutig dazu bestimmt, dass man seine Krallen ausfuhr.
»Was haben Sie sich nur dabei gedacht?«, fragte die Sekretärin, schüttelte den Kopf und hantierte lärmend am Kopierer herum. Sie war rundlich, zu laut und trug eine modische Brille in Neonorange, dazu kurzgeschnittene wasserstoffblondierte Haare, die wie verdorrter Rasen im Sommer aussahen.
»Nichts«, erwiderte Vesper mürrisch, »ich habe mir überhaupt gar nichts dabei gedacht.« Diese leidige Frage würde sie gleich noch mehrere Male zu hören bekommen. Warum stellten Erwachsene diese Art von Fragen überhaupt, wenn sie die Antwort ohnehin wussten. Natürlich hatte sie sich etwas dabei gedacht; sie war schließlich keines dieser hirnlosen Püppchen, die den Lehrern schöne Augen machten, um an gute Noten zu kommen.
»Auf was für dumme Ideen die Schüler heutzutage nur kommen«, murmelte die Sekretärin vor sich hin, gerade laut genug, dass Vesper sie verstehen konnte. »Ärztliche Atteste einfach so zu fälschen.« Übertrieben fassungslos schüttelte sie den Kopf, murmelte: »Und das mehrmals«, machte laut und vernehmlich »ts, ts, ts« und sah fast persönlich beleidigt aus.
Vesper seufzte.
Das Leben, das manchmal zu einem Sturm anwachsen konnte, hatte sie hier stranden lassen, könnte man sagen. Sie registrierte die abwertenden Blicke der Sekretärin und fragte sich, warum jemand, der Jugendliche so offensichtlich hasste, ausgerechnet an einer Schule arbeiten musste.
»Früher, zu meiner Zeit«, dozierte Frau Wissmann, »da hatten wir noch mehr Respekt vor den Erwachsenen, ganz ehrlich.« Ein weiterer missbilligender Blick traf das Mädchen. »Mehr Respekt vor den Lehrern und …«
»Schon klar«, grummelte Vesper entnervt und fragte sich, wann genau ihre Zeit gewesen war. Die Wissmann war jünger als Vespers Mutter, und Margo Gold hatte nie den Eindruck erweckt, als sei sie zu einer Zeit jung gewesen, in der die coolen Mädchen sich so verhalten hatten, wie die Sekretärin es sie gerade glauben machen wollte.
»Fräulein, Sie sollten sich nicht im Ton vergreifen!«
»Und Sie hätten die Therapie vielleicht doch nicht so schnell und vorzeitig abbrechen sollen.«
Frau Wissmann schluckte. Jeder hier wusste doch, dass das Sekretariat wegen labiler Fachkräfte andauernd umbesetzt werden musste. Die Wissmann war schon die dritte Sekretärin, die wegen psychischer Probleme oder Überlastung oder aus einem anderen geheimnisvollen Grund erkrankte, sich in fortwährenden Kuren und Rehabilitationen befand und währenddessen bei Facebook die Welt an ihrer Partnersuche teilhaben ließ, was kaum einem Schüler mehr entging.
»Sie …« Ein erhobener Finger nur. Die restlichen Worte blieben ihr irgendwo im Hals stecken, gut so.
Vesper sah sie an und fragte sich, ob sie Mitleid mit dieser unfreundlichen Kuh haben sollte. Sie rief sich in Erinnerung, wie die Wissmann mit den Fünft- und Sechsklässlern umsprang, und entschied sich kurzerhand dafür, sich zufrieden zurückzulehnen.
Sie atmete tief durch.
Meine Güte, was machte sie hier eigentlich?
Die Wissmann ging für einige Minuten still und sauer ihrer Arbeit nach und versprühte leise Gift in Form von verhuscht wirkenden Blicken, die Vesper sehr gut kannte. Sie konnte sich sehr gut vorstellen, wie die Neuigkeit von ihrem Vergehen bei der Lehrerschaft die Runde machen würde. Die Wissmann würde schon dafür Sorge tragen. Sie war wie die dicke Spinne im Netz. Überall gab es Leute wie sie.
»Ist die Chefin schon da?«, fragte Vesper nach einer Weile.
»Sie hat noch ein Telefonat.«
»Also ist sie schon da.«
»Sie wird Sie erst empfangen, wenn Ihre Mutter da ist.«
»Aber ich verpasse wertvollen Unterricht«, gab Vesper zu bedenken.
Frau Wissmann bedachte sie mit einem Blick, der zum Töten bestimmt war, ganz sicher.
Vesper hielt ihm stand. So lange, bis die Wissmann sich wieder ihren Kopien zuwandte.
Ja, mit Blicken wie diesen kannte sie sich gut aus. Sie erinnerte sich an den kläglichen Therapeuten, den zu besuchen ihre Mutter sie erst vor Kurzem, vor dem Umzug nach Hamburg, gedrängt hatte, und es machte ihr auch jetzt keine Mühe, sich durch die neugierigen Augen ihres Gegenübers zu sehen. Eine unscheinbare Siebzehnjährige, das war es, was die Leute sahen, wenn sie ihr heimlich und feige Blicke zuwarfen; eine Schülerin, die eher nach einer Studentin im allerersten Semester aussah, gekleidet in Schwarz, mit Stiefeln (und mit nur einem einzigen warmen Glanzlicht: dem selbstgestrickten Schal); ein bleiches Gesicht, das hager und ein wenig kränklich wirkte und dennoch das rege Interesse der Jungs weckte; ein Körper, an dem die meisten Kleidungsstücke, die sie trug, irgendwie gedankenlos und hastig übergeworfen aussahen und unpassend groß wirkten; Augen von einem Grün, so hell, dass nicht viele Menschen ihrem trotzigen Blick standhielten. Die Haare wie widerspenstige Wolle, hochgesteckt mit einem dunklen Stab voller chinesischer Schriftzeichen, pechschwarz wie alles an ihr.
Sie sah nicht aus wie die typische Schülerin dieser Einrichtung. Hier, an der St.-Nikolai-Anstalt für verwöhnte neureiche Schlampen und saufende und kiffende Schlappschwänze mit unterirdischem IQ und Leistungskurs Sport – oder, benutzte man den offiziellen Namen der Schule, dem Gymnasium St. Nikolai, Eliteschule des Sports -, trugen die Schülerinnen teuere Markenklamotten, gingen alle zwei Wochen zum Friseur und zur Kosmetikerin und kommunizierten ihre Plattitüden mit den neuesten iPhones und iPads. Schülerinnen in Vespers Alter besaßen meist ein Pferd und bekamen jede Menge Taschengeld, sie kotzten, was das Zeug hielt, sobald sie etwas gegessen hatten, und bemitleideten sich ausgiebig gegenseitig, wenn sie die selbstfotografierten Bilder online analysierten, weil sie sich zu fett und hässlich vorkamen. Bei den Jungs war es kaum besser.
Das Telefon klingelte.
Vesper horchte auf, als die Wissmann den Anruf entgegennahm. Während sie sprach, schaute sie fortwährend in ihre Richtung, nickte, sah wichtig aus, lächelte überheblich, nickte erneut.
»Was Lustiges?«, gestattete sich Vesper zu fragen.
»Ihre Mutter wird in zehn Minuten hier sein«, verkündete die Sekretärin.
Vesper nahm es zur Kenntnis.
Ihre langen, nervösen Finger suchten in der Tasche der abgewetzten Lederjacke nach einer Zigarette. Zwischen Krimskrams, Knöpfen, Fäden, lila Nagellack und alten Kassenzetteln fanden sie eine, die noch nicht zerbröselt war. Sie zog ihr Feuerzeug aus einer anderen Tasche, sah es kurz an, lächelte und spürte erneut die unruhige Leere, die ein so großer Teil ihres Lebens geworden war, dass sie manchmal kaum zu sagen wusste, ob es da noch etwas anderes gab.
Gierig zündete Vesper sich die Zigarette an und inhalierte tief.
Sie schloss dabei die Augen fest, ganz fest, spürte den Rauch ihre Kehle hinabrinnen wie Gift und musste husten. Es tat nicht gut, den Rauch und die wabernde Hitze zu spüren, aber es war immerhin ein Gefühl, und jedes Gefühl, das aus ihr hervorbrach, war besser als jenes unwillkommene Gefühl, das sie noch immer zurückzuhalten vermochte.
»Sind Sie von allen guten Geistern verlassen?«, hörte sie die Wissmann keifen. »Sie befinden sich in einer Schule!«
Vesper öffnete die Augen. »Da steht doch ein Aschenbecher«, sagte sie ruhig und deutete auf den Blumentopf mit dem kränklichen Gummibaum, der spätestens in zwei Wochen einem neuen Gewächs weichen würde.
»Was …?«
»Ich behaupte einfach, dass Sie geraucht haben. Merkt sowieso niemand den Unterschied.«
»Wir sind eine gesunde, raucherfreie Schule«, beharrte die Sekretärin.
»Öffnen Sie einfach das Fenster. Das tun Sie doch auch sonst immer.« Jeder wusste, dass die Wissmann heimlich qualmte, wenn die Chefin außer Haus war. Vesper hatte keine Lust mehr, sich von all diesen scheinheiligen Gestalten hier herumschubsen zu lassen.
»Was erlauben Sie sich!«, fauchte die Wissmann Vesper an.
Die blies einen Rauchkringel zur Decke hinauf und lächelte. »Wenn Sie nicht leise sind, dann kommt die Chefin noch aus ihrem Zimmer.«
»Sie wollen es heute wirklich wissen …«
»Sieht wohl so aus.«
Die Wissmann schnaubte, bewegte sich auf die Tür zum Zimmer der Direktorin zu.
»Das würde ich nicht tun«, riet ihr Vesper.
»Ach ja, und warum nicht?«
»Weil der Blumentopf voller Kippen ist.« Sie lächelte ein äußerst nettes Lächeln. »Die können unmöglich alle von mir sein, oder?!«
»Fräulein Gold!« Die Wissmann schnappte nach Luft. Ihr Gesicht lief rot an, und ihr Mund ging auf und zu, als sei sie ein Fisch auf dem Trockenen. »Das ist wirklich …«
Vesper hielt ihrem Blick stand. Dann erhob sie sich, ging zu der Topfpflanze und drückte ihre Zigarette in der feuchten Erde aus. »Besser so?«, fragte sie und ging zu ihrem Platz zurück.
Die Wissmann war mit ihren Nerven am Ende.
Was für ein Tag!
Irgendwie war Vesper heute auf der Suche nach Streit.
Sie hatte verschlafen, war halbfertig und ungeschminkt durch die Kälte zum Gymnasium gelaufen. Schon während der zweiten Stunde hatte Herr Müller, ihr ausschließlich Nadelstreifenanzüge und klassische Krawatten tragender Tutor und Mathematiklehrer, sie offiziell ausrufen lassen und zum Sprechzimmer beordert. Dort hatte er ihr kurz und knapp die Neuigkeiten verkündet, worauf sie in die Klasse zurückgekehrt war, ihre Sachen zusammengepackt und sich bei der Direktorin gemeldet hatte.
Hier saß sie jetzt seit einer geschlagenen Stunde und wartete darauf, dass ihre Mutter endlich eintraf. Vesper starrte die Zeiger der Uhr an, die über den Pflanzen hing.
Draußen, vor dem Fenster, träufelte ein eisiger Wind den Winter in die Welt, noch bevor sich die Schneeflocken dazu entschieden hatten, die Stadt mit einem Mantel aus Weiß zu bedecken. Der Regen klatschte gegen die Fensterscheibe, und unten in den Straßen und auf dem Schulhof klebte rostrotes Herbstlaub an allem, was dort stand und lag.
Hamburg – ihre neue Heimat.
Wow!
»Du wirst dich dort wohlfühlen«, hatte ihr Vater gesagt. Nach dem Desaster in ihrer alten Schule war der Umzug zu ihrer Mutter so etwas wie eine Flucht nach vorn gewesen.
»Ich will aber in Berlin bleiben.« Vesper war verzweifelt gewesen, denn sie hatte gewusst, dass die Entscheidung ihrer Eltern so endgültig gewesen war wie nur irgendwas. Es gab keinen anderen Weg mehr, kein Zurück.
Wie gesagt – jetzt war sie hier.
Unwiderruflich.
Seit knapp vier Monaten nun besuchte sie das St. Nikolai und fand die Schule mit jedem neuen Tag abstoßender. Was lag also näher, als die Zeit, die sie hier in dem altehrwürdigen Gebäude verbringen musste, auf die nötigsten Stunden zu reduzieren?
Sie steckte sich einen Stöpsel ins Ohr und klickte sich durch das Menü ihres iPods, bis sie Sinnerman von Nina Simone gefunden hatte, das brachte sie wieder runter. Die leicht monotone Melodie tat ihr gut und ließ das gediegene Sekretariat wie eine seltsam entrückte Kulisse irgendeines alten Films erscheinen. Mattfarbene Bilder von Schiele und Hopper an den Wänden, ein riesiges Foto, das die Gestalten des Kollegiums zusammengepfercht auf der Haupttreppe unten in der Aula zeigte, das übliche Sammelsurium aus zwei Kopierern, Bildschirmen, ordentlichen Ablagetürmen und Telefonen. Ab und zu steckte ein Lehrer leise seinen Kopf zur Tür herein, weil er faxen, kopieren, über Schüler schimpfen oder einfach nur reden und Neuigkeiten erfahren wollte.
Endlich, nach einer halben Ewigkeit, öffnete sich die Tür, und Margo Gold schneite herein. Sie wirkte wie eine Diva, die sich verlaufen hatte. Sie trug einen Hosenanzug, dazu einen langen dunklen Mantel samt extravagantem Schal mit indisch angehauchtem Muster. Die schulterlangen dunklen Haare trug sie offen und wallend, und als sie den Raum betrat, streifte sie sich äußerst theatralisch die Lederhandschuhe ab, faltete sie säuberlich, begrüßte die Sekretärin mit einem sehr beiläufigen Nicken und erbat sich eine schnelle Anmeldung bei der Schulleiterin, da sie noch einige Termine zu beachten habe.
Erst dann wandte sie sich ihrer Tochter zu.
»Was hast du angestellt?«, kam sie direkt auf den Punkt, wippte unruhig mit dem Fuß und schlug einen imaginären Takt. Mit einer geübten Handbewegung zupfte sie Vesper den Kopfhörer aus dem Ohr. »Ich mag nicht, wenn du das tust, es macht dein Gehör kaputt.« Sie wirkte etwas gehetzt, und Vesper wusste, warum. »Du weißt, dass ich gleich wieder los muss. Das Flugzeug geht in anderthalb Stunden. Also bitte keine Ausreden, Vesper. Was ist los?«
»Sie haben dir nichts gesagt?«
»Am Telefon? Nur dass ich dringend herkommen soll und du womöglich die Schule verlassen musst.«
»Klasse.«
»Nun?«
»Ich habe Atteste gefälscht.«
Margo Gold starrte ihre Tochter an. »Du hast was?« Im Hintergrund telefonierte die Wissmann mit der Direktorin, was ihr Blick auf die Wand, hinter der sich ihr Büro befand, und die unterwürfige Haltung leicht verrieten.
»Du wolltest eine ehrliche Antwort haben, und das war sie.« Vesper musste lächeln, aus einem Grund, der ihr selbst nicht so ganz klar war. »Nun ja, eigentlich habe nicht ich sie gefälscht. Aber man kennt so seine Leute, weißt du?!«
Margo Gold tat überrascht. »Du kennst Mitschüler, die so etwas professionell tun?«
Sie nickte. »Ist eine recht lukrative Nebenbeschäftigung für diejenigen, die es können.«
»Du hast dafür bezahlt?«
»Nichts ist umsonst, Mama, das solltest gerade du wissen.«
Margo Gold seufzte langgezogen. »Geht das jetzt schon wieder los?«
»Du hast angefangen.«
»Ich weiß, ich weiß.«
»Frau Gold?« Die Wissmann schaltete sich ein. »Frau Dr. von Stein kann Sie jetzt empfangen.«
Margo Gold hob die Hand. »Moment noch«, unterbrach sie die Sekretärin, wandte sich erneut ihrer Tochter zu und flüsterte: »Irgendeine Idee, wie wir die Stein davon abhalten können, dich zu feuern?«
»Keine Ahnung.«
»Das ist alles, was du dazu zu sagen hast?«
Vesper zuckte die Achseln. »Es ist, wie es ist. Was soll ich machen?«
»Ich dachte, du wolltest dir jetzt Mühe geben.« Sie machte eine Pause. »Nach allem, was in Berlin passiert ist.«
Vesper senkte den Blick. »Tut mir leid, aber …«
»Kein Aber mehr …«
Die Wissmann nahm zufrieden zur Kenntnis, dass Vesper Ärger bekam, und grinste mit stiller Genugtuung tief in sich hinein.
Dann öffnete sich die Tür zum Zimmer der Chefin.
Frau Oberstudiendirektorin Dr. Isolde von Stein schritt bedeutungsvoll in die Gefilde des einfachen Volkes hinaus. »Ach, die Frau Gold!«, rief sie voller Begeisterung aus.
Vesper erhob sich. Sie hatte geahnt, dass das Auftauchen ihrer Mutter zu einem kleinen Auftritt werden würde.
»Guten Morgen, Frau von Stein«, begrüßte Margo Gold die nun auf sie zustürmende Direktorin. Nur Vesper fiel auf, dass sie bewusst vermieden hatte, sie mit ihrem Titel anzusprechen.
Frau Dr. Isolde von Stein schien das nicht zu stören. Wie eine Nebelkrähe ergriff sie die Hand ihres Besuchs und schüttelte sie. »Wir sind uns noch gar nicht begegnet.«
Wenn es ein kleines Adjektiv gab, das die Direktorin hinreichend beschrieb, dann war dies grau. Alles an Frau Dr. Isolde von Stein wirkte grau: die Haare, die selbst säuberlich geordnet und hochgesteckt noch die Eleganz einer Ansammlung von Staubmäusen besaßen, das dunkelgraue Kostüm, die graue Strumpfhose, die hochgeschlossenen schwarzen Halbschuhe. Kerzengerade Haltung, die Hände gefaltet, sah sie, Lehrerin für Deutsch und ehrenamtliche Leiterin der Theater-AG, aus, als sei sie einem Roman von Thomas Mann entfleucht.
»Damals haben Sie das Vergnügen gehabt, mit Vespers Vater zu sprechen.«
Nur Vesper fiel auf, dass sie nicht mit meinem Mann gesagt hatte. Maxime Gold war jetzt einfach nur noch Vespers Vater.
»Wie schön, dass wir uns nun kennenlernen. Und wie tragisch, dass es unter diesen Umständen sein muss.«
Vesper harrte der Lobhudelei, die jetzt zweifelsohne kommen würde.
»Ich verehre Ihre Kunst«, sagte Frau Dr. von Stein, und Margo Gold rang sich ein müdes und bemüht offenes Lächeln ab. »Diese wunderbaren Händel-Variationen und Mozarts Klavierkonzerte; sie sind schon jetzt ein Klassiker, was soll ich noch sagen?«
Sag besser nichts, dachte Vesper und setzte ein Lächeln auf, das möglichst unverfänglich wirken sollte. Die Ehrerbietung, die ihrer Mutter zuteil wurde, war nichts Neues für Vesper. Margo Gold war eine Legende, interessierte man sich für diese Art von Musik. Sie war in den Konzertsälen der Welt zu Hause. Ihre Hände waren begnadet und einzigartig – und außerdem war sie nervös und eigensinnig. Als sie noch eine intakte Familie gewesen waren, da hatte Vesper in einer Welt der Verbote gelebt. Keine laute Musik, kein Besuch, kein lautes Lachen. Einzig der Musik ihrer Mutter war es erlaubt, die weiten Räume der Villa in Schöneberg mit Leben zu füllen. Ihre manikürten Finger bewegten sich rasch über die schwarzen und weißen Tasten und vollführten unglaublich flinke Tänze. Sie beschworen wilde Melodien herauf, die ganze Konzertsäle füllten und den andächtig lauschenden Zuhörern förmlich die Tränen in die Augen trieben.
»Ich hatte das außerordentliche Vergnügen, Sie in der Mailänder Scala zu sehen«, säuselte Frau Dr. von Stein unterwürfig.
»Ah, die Variationen über Themen aus Hoffmanns Erzählungen.«
Eifriges Nicken.
So standen sie Augenblicke nur herum.
Es war Margo Gold, die das Gespräch wieder in geordnete Bahnen lenkte. »Frau von Stein«, begann sie, und der drängende Unterton in ihrer Stimme fiel nur ihrer Tochter auf, »ich habe nicht viel Zeit. Sie müssen entschuldigen.« Sodann folgte eine Begründung in Form des aktuellen Tourneeplans und ein Hinweis auf den Flugplan und das vor der Schule wartende Taxi.
»Dann lassen Sie uns alles Weitere in meinem Zimmer besprechen«, schlug die Direktorin vor.
Vesper und ihre Mutter folgten der Frau in Grau ins Allerheiligste der Schule. Aus dem großen Fenster hatte man einen Ausblick auf das Mahnmal St. Nikolai, dem die Schule ihren Namen verdankte.
Auf dem Aktenschrank neben dem Schreibtisch stand eine Goethe-Büste, weiß und poliert. An den Wänden hingen Faksimiles von Goethe und Schiller. Eine traurige Grünpflanze reichte bis zur Decke und brachte ein wenig Leben in den Raum.
Die Direktorin nahm hinter dem Schreibtisch Platz, Vesper saß neben ihrer Mutter in einem der bequemen Stühle davor.
»Fräulein Gold«, begann Frau Dr. von Stein, öffnete eine Akte, die bereits auf dem Tisch gelegen hatte, und fasste kurz und knapp zusammen, was ohnehin jeder wusste. Die Verdachtsmomente, der Anruf ihres Tutors beim Arzt, die Beweislage und die Tatsachen. Sie zählte eine Reihe von Tadeln und Verweisen auf, klappte die Akte zu und fixierte das Mädchen. »Warum, meine Teure, tun Sie so etwas?«
»Ich bin der Geist, der stets verneint«, antwortete Vesper und versuchte die scherzhafte Tour.
Margo Gold gab ihr, unmerklich für die Direktorin, einen Tritt gegen das Bein.
»Ach ja, ist das so?« Frau Dr. von Stein wirkte unbeeindruckt. Sie pochte mit dem Finger auf die Akte. »Sie hatten an Ihrer alten Schule einige Probleme, die wir hier zu vermeiden gehofft hatten.« Sie kramte eine Lesebrille aus einem Etui hervor und schob sie sich auf die Nase. »Sie haben einen Ihrer Lehrer verletzt.«
»Es war ein Unfall«, verteidigte Margo Gold ihre Tochter schnell.
»Es war Pech«, sagte Vesper. Im letzten Schuljahr hatte sie ihrem Sportlehrer einen Basketball ins Gesicht geschossen, weil er sie begrapscht hatte. Natürlich hatte sie es wie einen dummen Zufall aussehen lassen.
»Pech?«
»Haben Sie eine Ahnung, wie eifrig und gern manche Sportlehrer an dieser Schule den Mädchen Hilfestellung geben?«
Frau Dr. von Stein brauste entrüstet auf: »Fräulein Gold!«
»Schauen Sie sich doch einfach die Fehlzeiten in den Klassenbüchern an. Bei manchen Kollegen häufen sich die Krankheiten sehr verdächtig. So oft hat kein Mensch seine Tage.«
Die Stein wirkte sauer. »Kein Grund, derart ausfällig zu werden.«
»Tut mir leid.« Vesper zog ein Gesicht. »Wir sind nicht hier wegen dem, was auf meiner alten Schule gelaufen ist, oder?«
»Nein.«
Also kam Vesper der leidigen Frage zuvor: »Ich habe die Atteste gefälscht, um länger schlafen zu können und um einige der stinklangweiligen Grundkurse zu meiden.«
»Sie geben es also zu?«
»Warum sollte ich es leugnen?« Für wie dumm hielt sie die Stein? »Herr Müller hat schließlich bei unserem Arzt angerufen und festgestellt, dass ich nie dort gewesen bin.«
»Sie sind zumindest ehrlich.« Frau Dr. von Stein nickte wohlwollend. »Aber warum haben Sie das getan?«
»Sagte ich doch. Ich bin der Geist, der stets verneint.«
»Lassen Sie das.«
»Lass das«, sagte jetzt auch Margo Gold.
»Ist gut«, murrte Vesper.
»Wie bitte?«
»Entschuldigung, aber ich dachte, Sie wollten eine Antwort hören.«
Frau Dr. von Stein seufzte langgezogen. »Warum, bitte schön, haben Sie die Atteste gefälscht?«
»Ich wollte keine unentschuldigten Fehlzeiten haben.«
»Unterstehen Sie sich, mich zu veralbern.«
Meine Güte, dachte Vesper, sie hat wirklich veralbern gesagt.
»Nun?«
Sie wollte eine Antwort? Na, gut! »Was glauben Sie denn, was in manchen Kursen läuft? Man versäumt überhaupt nichts, wenn man nicht immer hingeht. Im Gegenteil, man lernt die Sachen besser allein zu Hause.« Vesper konnte es nicht fassen. Die ewige Ignoranz der salbungsvoll wohlwollenden Pädagogen und dann noch diese heuchlerische Menschenfreundlichkeit. Pah!
Die Stein starrte erneut und unbeeindruckt in die Akten. »Ihre Leistungen, Fräulein Gold, erwecken nicht gerade den Anschein, als würden Sie das Verfehlte nacharbeiten.«
Okay, der Punkt ging an sie. Vesper verdrehte die Augen.
Ihre Mutter wurde ungeduldig, starrte auf die Uhr an der Wand.
»Was immer Sie auch vorzubringen gedenken«, resümierte die Direktorin, »es ist verboten, ärztliche Atteste zu fälschen. Es handelt sich hier um ein überaus arglistiges Täuschungsmanöver und ein Verhalten, das ich an meiner Schule nicht dulden kann, unter gar keinen Umständen.«
»Was wird jetzt passieren?«, fragte Margo Gold und gebot ihrer Tochter mit einem Fingerzeig, zu schweigen.
Die nachfolgenden Worte schien Frau Dr. von Stein außerordentlich zu genießen, jedes Einzelne von ihnen. »Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir in zwei Tagen eine Konferenz aller Fachlehrer einberufen haben, auf der über den weiteren Verbleib Ihrer Tochter an unserer Schule entschieden werden wird. Sie beide sind dazu natürlich eingeladen.«
Das war jedenfalls etwas, was Margo Gold nicht hatte hören wollen. »Ich bin auf Tournee. Wie stellen Sie sich das vor? Ich habe eine Reihe von Konzerten im Ausland.«
Frau Dr. von Stein nickte.
»Aber Vesper wird natürlich kommen. Sie muss Ihnen Rede und Antwort stehen.« Sie warf ihrer Tochter einen strengen Blick zu.
Vesper nickte. »Versprochen.«
Margo Gold erhob sich, ohne auch nur eine weitere Reaktion der Direktorin abzuwarten. »Dann wäre das geklärt. Mein Taxi wartet.« Sie lächelte das Lächeln, das sie sonst nur der Presse schenkte. »Vesper, du gehst in deinen Unterricht.« Sie schüttelte die Hand der Direktorin. »Es tut mir leid, aber meine Zeit ist sehr knapp bemessen.«
Nur Vesper wusste, wie entnervt ihre Mutter wirklich war. Sie hasste es, zu solchen Gesprächen zu erscheinen. Sie hasste Pädagogen, und sie hasste es, Zeit zu vergeuden.
»Ich bin sicher, dass wir eine Regelung finden werden.« Mit einem Lächeln rauschte sie aus dem Raum und zog Vesper hinter sich her. Beide warfen sie keinen Blick zurück.
Als sie draußen auf dem Korridor waren, hielt Margo Gold inne.
»Danke, Vesper, das war wieder einmal unbeschreiblich.«
»Tut mir leid.«
Margo Gold sah ihre Tochter eindringlich an und knöpfte sich den Mantel zu.
»Okay, mir tut nur leid, dass ich mich habe erwischen lassen.«
»Ja, genau das tut mir auch leid. Du hättest uns einige Unannehmlichkeiten erspart, wenn du dich geschickter angestellt hättest.«
»Dann findest du also, dass …«
Margo Gold ließ ihre Tochter nicht zu Ende sprechen. »Nein«, fuhr sie ihr energisch ins Wort. »Du hast uns ein Versprechen gegeben, deinem Vater und mir. Du wolltest dir Mühe geben.«
Vesper nickte widerwillig.
»Wenn du von der Schule fliegst, dann haben wir ein Problem.«
»Ich weiß.«
»Und?«
Vesper murrte: »Ich werde mich bessern.«
»Schau mich an, wenn du mit mir redest.«
Sie hob den Blick.
»Du hast geraucht.«
Sie wusste, dass ihre Mutter das gerochen hatte. »Und?«
»Du sollst nicht rauchen.«
»Du rauchst doch auch.«
»Ich bin erwachsen, eine Künstlerin, und ich habe genug Geld, um mir die Zigaretten zu leisten.«
»Wahnsinnig gute Begründung. Ich bin bald volljährig.«
Margo schaute erneut auf die Uhr. Zog sich die Handschuhe über. »Ich muss den Flieger erreichen, Kleines. Wie gesagt, das Taxi wartet. Die Koffer habe ich schon zum Flugplatz geschickt.«
»Wann wirst du wieder hier sein?«, fragte Vesper.
»In zwei Wochen. Ich habe dir eine Mail mit den Tourdaten geschickt.«
Vesper nickte nur.
Margo Gold wollte schon gehen, besann sich dann aber und konzentrierte sich noch einmal einen Augenblick lang ganz auf ihr Gegenüber. »Vesper, mein Kind, wie geht es dir?«
»Beschissen«, antwortete sie. »Aber nett, dass du fragst.«
Sie ergriff die Hände ihrer Tochter. »Warum tust du das nur?« Die schwarzen Handschuhe waren kalt. »Machst uns diesen Ärger, dass wir keine ruhige Minute haben. Du solltest dich wie eine Erwachsene benehmen, nicht wie ein verzogenes Gör, das keine Erziehung genossen hat.«
Vesper lächelte leise. »Ich bin doch nur ein ganz armes und vernachlässigtes Scheidungskind, das seinen Platz in der Welt noch nicht gefunden hat.«
Beide mussten sie lächeln.
»Den Humor hast du von deinem Vater.« Nicht einmal jetzt sagte sie mehr Maxime.
»Ja, und die Ohren habe ich von dir.«
»Sie stehen dir gut.« Ein kurzes Lächeln nur. »Geh wieder in den Unterricht«, sagte Margo Gold schnell, gab ihrer Tochter einen flüchtigen Kuss auf die Stirn und rauschte den Korridor entlang.
Vesper sah ihr nach, als sie die Treppe hinab verschwand, raus aus der Tür, hinaus in die Welt, wo sie die berühmte Margo Gold war und im tosenden Applaus der Menschen zu schwimmen vermochte wie ein bunter Fisch im klaren Wasser.
»Ich werde dich auch vermissen«, sagte sie trotzig und irgendwie traurig zugleich.
Dann griff sie nach dem iPod, ließ erneut Sinnerman laufen, zog den Reißverschluss ihrer Lederjacke zu, schlug den Kragen hoch, schulterte den Rucksack, den sie seit Jahren besaß, und ging aus einem der Notausgänge hinaus in die Stadt, die kalt und voller Regen war – und somit irgendwie genau das, was sie von einem Tag wie diesem erwartete.
In der Mönckebergstraße ließ sie sich einen heißen Kaffee im Pappbecher im Segafredo-Café an der Ecke neben dem Taxistand geben, danach schlenderte sie gedankenverloren an den hell erleuchteten Schaufenstern vorbei, wurde ein Teil der Menschenmassen, die wie an jedem Tag vom Bahnhof zu den Geschäften und Kaufhäusern drängten. Sie blieb stehen, als sie einen alten Straßenclown sah, der auf seinem Akkordeon Lieder von Hans Albers spielte und in den Pausen mit bunten Bällen jonglierte. Sie beobachtete die anderen Passanten dabei, wie sie den Clown ignorierten und eilig ihres Weges gingen. Schließlich ging sie zu dem Zylinder, der vor dem Clown auf dem gemusterten Straßenpflaster stand, und warf ein paar Münzen hinein. Der alte Clown entlockte seinem Instrument ein beschwingt quietschendes Geräusch und verneigte sich kurz. Dann wendete er sich den anderen Passanten zu, von denen ihn allenfalls die Kinder beachteten, für die ein Clown an einem so trüben Tag wie diesem noch etwas Außergewöhnliches war.
Vesper ließ sich treiben.
Sie verdrängte alles, was mit der Schule zu tun hatte, und genoss die Stadt, die erfüllt war von einer Magie, die niemand zu sehen vermochte.
Die Lichter der Autos spiegelten sich in den Pfützen, und das Prasseln des Regens auf dem Asphalt zauberte ungehörte Melodien in den Lärm des Verkehrs. Schritte auf dem Pflaster klapperten einen dumpfen Takt, Stimmengewirr in sich verwebt, dicht und filigran. Wütende Taxifahrer hupten, missmutig aussehende Männer in dunklen Anzügen eilten in die Mittagspause, elegante Frauen in geschäftsmäßigen Kostümen bedachten andere geschäftsmäßige Frauen in Kostümen mit boshaften Blicken, Straßenmusikanten und Bettler drückten sich gegen Häuserwände oder zwängten sich in die Ecken neben den Eingängen zu den Kaufhäusern, Touristen mit Kameras schlenderten planlos durch die Gegend.
Vesper nippte an dem heißen Kaffee.
Der Regen machte ihr nichts aus.
Die Luft roch so frisch, wenn es regnete.
Sie mochte das.
Vom Rathaus aus nahm sie die S-Bahn bis zum Baumwall und lief dann zum Hafen hinüber.
Dichte Wolken, schwer und grau, hingen überall, und der Himmel wurde eins mit dem kalten Wasser, das missmutig gegen die Rümpfe der Schiffe schwappte. Vesper mochte den Hafen. Hier waren die Menschen auf der Durchreise, wie sie selbst, irgendwie. Sie stellte sich gern vor, wie es hier vor hundert Jahren oder noch früher ausgesehen hatte. Die Menschen hatten auch damals schon auf den großen Schiffen angeheuert, um sich von ihnen in die Welt hinaustragen zu lassen. Und all diejenigen, die hier lebten, hatten es entweder versäumt, beizeiten die Anker zu lichten, oder sie warteten schlichtweg auf jemanden, der dies nicht versäumt hatte – und auf den zu warten sich lohnte. Sie säumten die Ufer und träumten von fernen Ländern und Abenteuern und Orten, an denen alles anders wäre.
Vesper seufzte.
Sie kam oft hierher, wenn sie die Schule schwänzte. Sie ließ den Wind durch ihr Haar fahren und atmete die frische Luft, die nach Salz und hoher See roch; sie schlenderte an den Schiffen vorbei, blieb lange vor der Cap San Diego und der Rickmer Rickmers stehen und träumte in den Tag hinein.
Nach einer Weile dann ging sie in Richtung der Landungsbrücken.
Auch hier tummelten sich trotz des schlechten Wetters unzählige Menschen, Touristen mit Schirmen und Plastiktüten aus den vielen Souvenirläden. Sie füllten die Bars und Restaurants und Imbissstände, strömten zu den flachen Barkassen, um eine Hafenrundfahrt zu machen, studierten die Schautafeln, an denen sie sich ein Bild von der Geschichte des Hafens machen konnten. Es roch nach Fisch und dem Meer, nach Salz und einer Ferne, die jenseits des Horizonts kein Ende finden würde.
Erst beim zweiten Hinsehen fiel Vesper der Mann auf, der sich an einem der vielen Souvenirläden herumdrückte. Er trug einen Mantel mit silbernen Knöpfen, eng geschnitten und schlicht. Vesper hatte Mäntel wie diesen in Filmen gesehen, schwarz-weißen Abenteuerstreifen, in denen es um Spionage und Krieg ging, um Liebe und Verrat.
Etwas hockte auf der Schulter des Mannes, ein kleines Tier mit einem langen Schwanz.
Instinktiv blieb sie stehen und starrte in seine Richtung.
Sobald der Mann sie bemerkte, drehte er sich zur Seite und betrachtete auffällig interessiert die Auslage in dem Schaufenster, vor dem er stand. Buddelschiffe in allen Größen, Postkarten, Seehunde aus Plüsch, Matrosenmützen, weiß-rot gestreifte Leuchttürme aus Holz, winzige Anker in allen Formen, all der Krimskrams, der angeblich typisch für Hamburg sein sollte.
Vesper konnte nicht sagen, was genau sie beunruhigte. Aber etwas gefiel ihr an dem Kerl nicht.
Sie starrte ihn an, spürte den Regen im Gesicht.
Der Mann in dem Mantel sah verstohlen zu ihr rüber, senkte überaus schnell den Blick, als er bemerkte, dass sie ihn ansah, und verschwand augenblicklich um die Ecke.
Das Tier auf seiner Schulter war irgendwie unscharf gewesen. Ein Affe oder ein Waschbär – sie hatte es nicht wirklich erkennen können.
Drüben auf dem Wasser dröhnte das Horn eines Lastenschleppers.
Vesper schüttelte den Kopf.
Keine Ahnung, wer der Kerl gewesen war.
Sie betrachtete die Stelle, an der er gestanden hatte.
Nichts.
Warum sollte ihr schon jemand folgen?
Sie musste lächeln. Verrückte Idee, der Kerl hatte dort vermutlich nur die Zeit totgeschlagen, das war alles.
Sie machte ein paar Schritte, blieb dann erneut stehen und schaute zurück.
Nur Touristen vor dem Laden, keiner sonst.
Sie schüttelte den Kopf und beschloss, den Kerl in dem Mantel erst einmal zu vergessen.
Mädchen, weich vom Wege nicht.
Keine Ahnung, warum ihr das gerade jetzt einfiel. Ihre Mutter hatte ihr früher das Märchen von Rotkäppchen erzählt, und es war dieser Satz, an den Vesper sich noch immer erinnerte. Mädchen, weich vom Wege nicht. Die entscheidende Warnung, die Rotkäppchen missachtet hatte.
»Blödsinn«, sagte Vesper laut.
Nur ein gewöhnlicher Souvenirladen.
Kein Mann und auch kein Tier auf seiner Schulter. Vesper knotete den Schal enger. Ein unscharfes Tier, sie war sich sicher, dass da ein Tier auf seiner Schulter gehockt hatte. Ein unscharfes Tier, das sie nicht so recht hatte erkennen können.
Ein allerletztes Mal blickte sie zurück, dann ging sie mit schnellen Schritten voran. Schließlich wartete noch Arbeit auf sie.
Es war ein altes Hafengebäude aus rotem Backstein, vor dem sie stehen blieb, direkt oberhalb des Fischmarktes, mitten in St. Pauli. Neben dem spärlich überdachten Eingang mit dem Kassenhäuschen befanden sich zwei Schaukästen, in denen Plakate für die aktuellen Aufführungen hingen: Die Dreigroschenoper und Die toten Augen des Doktor Faustus. Eine Programmankündigung wies auf das neue Musiktheaterstück Rosenrot – was wirklich geschah! hin, das in zwei Wochen uraufgeführt werden würde.
Vesper kam jeden Tag hierher. Das kleine Theater am Fleet war ihr zweites Zuhause.
»Warum heißt es so?«, hatte Vesper damals gefragt, als sie sich um eine Anstellung beworben hatte.
»Als wir das Theater gegründet haben«, hatte ihr Gaetano, der Regieassistent, erklärt, »hatten wir eine Lagerhalle drüben am Herrengrabenfleet gemietet. Später sind wir umgezogen. Der Name ist geblieben.«
»Klingt schön.«
»Was kannst du?«, hatte Gaetano wissen wollen.
»Ich kann schneidern.« Etwas, was sie beizeiten von ihrer Großmutter gelernt hatte.
»Also jemand, der Ida bei den Kostümen hilft.« Ein breites Lächeln hatte sich auf dem Gesicht des glutäugigen Italieners ausgebreitet. »Klingt richtig gut. Du kannst gleich mit einem Kleid anfangen. Wie heißt du?«
Sie hatte es ihm gesagt.
»Vesper?«
»Was dagegen?!«
Er hatte gelacht. »Deine Eltern mögen also Ian Fleming.«
»Könnte man meinen.«
So fing es an.
Seit mehr als drei Monaten kam sie nun fast jeden Tag hierher und half dabei, die Kostüme zu gestalten. Sie zeichnete die Schnittmuster, nahm Maß an den Darstellern, wurde ein Teil der kleinen Gemeinschaft, die mehr vom Applaus als von den recht spärlichen Einnahmen lebte.
»Das ist nun mal Theater«, pflegte jeder hier zu sagen, »man findet vielleicht Ruhm, aber Reichtum muss man woanders suchen.«
Vesper lächelte still in sich hinein.
Hier zu sein war wie nach Hause zu kommen. Sie überquerte die Straße und trat ein.
Die wohlige Wärme, die leicht nach Tabak und Kaffee roch, umfing sie wie eine alte Freundin. Drüben vom Bühnenaufgang her hörte sie ein Stimmengewirr, leisen Gesang, laute Anweisungen an die Darsteller. Sie ging an der Garderobe vorbei in den ersten Stock, wo die Darsteller vor den Vorstellungen geschminkt wurden und wo die Kostüme entstanden.
Um diese Uhrzeit war im Theater wenig los. Die Proben fanden unten statt, und erst am Abend, kurz bevor die Aufführung begann, würde es hektisch werden. Vesper ging den langen Korridor entlang und trat schließlich durch eine grüne Tür auf der rechten Seite.
»Du bist früh dran«, stellte Ida Veidt fest und sah von ihrer Nähmaschine auf, als Vesper den Kopf zur Tür hinein steckte.
»Sei doch froh, dass ich schon hier bin.« Vesper warf ihren Rucksack in die Ecke und nahm an ihrem Tisch Platz.
»Irgendwann werden sie dich feuern.« Ida Veidt war Anfang dreißig, Mutter einer Tochter und alleinerziehend. Ihr rotes Haar war zu zwei Zöpfen gebunden, und der kunterbunte Schmuck, den sie überall trug, klimperte bei jeder Bewegung, die sie machte.
»Scheiß doch auf die Schule«, verkündete Vesper lautstark. Dann berichtete sie in knappen Worten von ihrem Vormittag.
»Deine Mutter sollte sich mehr um dich kümmern.«
»Ich bin dankbar dafür, dass sie es nicht tut.«
Ida schüttelte nur den Kopf. »Ich hätte dir keine eigene Wohnung finanziert, so viel ist sicher.«
Vesper zwinkerte ihr zu. »Schon klar.« Ida musste sich und ihre Tochter mit dem Einkommen über Wasser halten, das sie hier am Theater verdiente. Sie hatte keine reichen Eltern, die ihr unter die Arme griffen. Alles, was sie noch hatte, war der nervtötende Vater ihrer Tochter, der sich regelmäßig um die Zahlungen drückte, sodass Ida mehr schlecht als recht improvisieren musste, um über die Runden zu kommen. »Davon abgesehen«, fuhr Vesper fort, »weißt du, dass meine Mutter mich umbringen würde, wenn sie mit mir zusammenleben müsste. Es ist also für uns beide das Beste.« Dann legte sie los und begann zu arbeiten. Sie breitete die großen Schnittmuster vor sich auf dem Tisch aus und begann die feinen Stoffe danach zu schneiden.
»Du bist dir schon im Klaren darüber, dass du verwöhnt bist?«
»Margo denkt nur an sich. Und ich denke nur an mich. Sie hat nicht mal Zeit gehabt, sich über den Ärger in der Schule aufzuregen. So ist sie nun mal.« Vesper legte die Schere beiseite. »Wir sind uns einfach zu ähnlich. Das wäre niemals gut gegangen, wir beide in der Villa. Herrje, Ida, da darfst du nicht einmal eine verdammte Vase verstellen.«
»Du sollst nicht so viel fluchen.« Ida war viel mehr als eine große Schwester und nur etwas weniger als eine Ersatzmutter. Sie war die gute Freundin, die da war, wenn Vesper sie brauchte.
»Entschuldige.«
»Schon gut.«
Vesper dachte an die Kämpfe, die sie mit ihrer Mutter ausgetragen hatte. Sie hatten einander angeschrien und hin und wieder auch mit Gegenständen geworfen. Ein halbes Jahr nach der Trennung ihrer Eltern waren Margo und Vesper zu einer Therapie angetreten, die sie nach zwei Sitzungen für gescheitert erklärt hatten. Darin zumindest waren sie sich einig gewesen.
»Du bist genauso unzuverlässig wie diese Typen, mit denen du deine Freizeit verbringst«, hatte ihre Mutter sie in der Praxis des ruhigen bebrillten Psychologen angeschrien. »Diese Penner, die Drogen nehmen.«
»Mach dich nicht lächerlich.«
»Und du siehst in diesen Klamotten schlampig aus.«
»Sagt die Richtige.«
Margo hatte nach Luft geschnappt. »Du verlotterte Drecksschlampe!«
Und was hatte Vesper damals entgegnet? »Ist bestimmt toll, zu sehen, dass die Tochter nach einem selbst gerät.«
Ihre Mutter hatte sie daraufhin geohrfeigt, fest mit der flachen Hand, und die Ringe, die sie an den Fingern trug, hatten Vespers Haut aufplatzen lassen. Fassungslos hatte sie die Wunde berührt und das Blut auf ihren Fingerspitzen angestarrt.
Nur wenige Sekunden später hatten sich beide wieder in den Armen gelegen und geweint. Dann waren sie in einem vornehmen Restaurant essen gegangen und hatten wie beste Freundinnen den ganzen Nachmittag über unwichtige Dinge geredet.
Vesper musste auch jetzt leise lächeln, wenn sie daran dachte. Sie hasste ihre Mutter und sie liebte sie innig. Margo Gold, die berühmte Konzertpianistin. Man hatte es nicht einfach, wenn man als ihre Tochter geboren wurde.
»Was ist los mit dir?«, wollte Ida wissen.
»Was meinst du?«
»Du bist nicht gerade gut gelaunt.«
»Wie kommst du drauf?«
»Ich kenne dich.«
Vesper legte zwei Stoffteile zusammen und korrigierte den Schnitt.
»Was ist mit deinem Freund?«
Vesper schaute auf. »Exfreund«, betonte sie.
»Ich dachte, er ruft noch hin und wieder an.«
»Tut er.« Viel zu oft, dachte sie.
»Und?«
»Ich gehe nicht ran, ganz einfach.«
»Wie war noch sein Name?«
»Kann mich nicht erinnern.«
Die Jungs, die ihr Leben bevölkerten, waren wie die Matrosen am Hafen; und Vesper war eine rastlose Katze, die jeden Freund, dessen Nähe sie für kurze Zeit gesucht hatte, zum Gehen ermunterte. Das war schon in Berlin so gewesen und hier kaum anders.
»Jetzt klingst du richtig herzlos.«
»Weiß ich.«
»Du bist ein Mädchen, das gern Herzen bricht«, stellte Ida fest. Ida, deren Herz selbst einmal gebrochen worden war.
»Ich will nur keine feste Bindung«, knurrte Vesper. »Ich brauche Luft, um zu atmen.«
»Weil du Angst hast, dass es wie bei deinen Eltern endet?«
»Spieglein, Spieglein an der Wand«, säuselte Vesper gespielt entnervt.
»Du bist sehr rastlos für ein junges Mädchen«, stellte Ida fest. »Das ist nicht gut.«
»So bin ich eben.«
»Trotzdem. Ist nicht gut.«
Sie schwieg, einen winzigen Augenblick zu lang.
Ida beobachtete sie.
Schließlich nickte Vesper und flüsterte: »Ja, ich weiß.«
Ida nickte wissend.
»Du kommst dir gern weise vor, nicht wahr?«, stellte Vesper fest.
»Wer tut das nicht?!«
Vesper fädelte einen Faden ein. Ja, Ida wusste Bescheid.
Spieglein, Spieglein …
Die scharfen Spiegelsplitter waren noch immer spitz und konnten schneiden. Die Kindheit auf dem Land, der Umzug nach Berlin, die Karrieren ihrer Eltern, all die kurzen Affären, Kränkungen, heimlichen Vorwürfe. Schließlich die schnelle Scheidung vor zwei Jahren.
Die berühmte Pianistin und der von der Kritik gefeierte Regisseur.
Es war schon schwer genug gewesen, den nervigen Reportern auszuweichen, die ihnen überall aufgelauert hatten.
Und dann das Loch, in das sie gefallen war, danach. Es war alles wie eine Montage aus den Filmen ihres Vaters. Filmen, von denen Vesper meist nur die Plakate kannte.
Ida nähte vor sich hin, ließ Vesper aber nicht aus den Augen.
Vesper tat so, als würde sie ihre Blicke nicht bemerken, und vernähte schnell einen Ärmel.
Sie dachte an das Haus am Theresienstieg, die Villa. Nach nur einer halben Woche, in der Margo und sie ganz kläglich ein Zusammenleben versucht hatten, war sie in eine eigene Wohnung gezogen.
Vesper rieb sich müde die Augen und fragte sich, wohin sie im Leben treiben würde. Die Schule würde bald vorbei sein.
Und dann?
Sie seufzte.
Schaute von der Arbeit auf.
Gaetano steckte den Kopf zur Tür herein. »Telefon, Ida«, sagte er eilig und dann: »Hallo Vesper.« Er wendete sich wieder Ida zu. »Der Kindergarten.«
»Oh, bitte, nicht schon wieder«, stöhnte Ida, legte ihre Utensilien beiseite und stand auf.
Gaetano zog ein Gesicht. »Sieht so aus.« Er deutete auf das lange Kleid, das Ida gerade nähte. »Das muss heute fertig werden. Du kennst John.«
Sie nickte. John war Johannes Halberg und der Regisseur des Stücks. Ein ehemaliger Tänzer, der sowohl die Choreographie des Balletts als auch die Regie übernommen hatte.
Ida warf Vesper einen müden und entnervten Blick zu und verließ missmutig den Raum. Das einzige Telefon befand sich unten im Regieraum.
Nach nur wenigen Augenblicken kehrte sie zurück.
»Das ging schnell«, stellte Vesper fest.
»Du darfst raten.« Sie klang resigniert.
Vesper konnte ahnen, was los war. »Läuse?«
Sie nickte.
»Kein Problem«, schlug Vesper vor. Und lächelte unternehmungslustig.
»Wirklich?«
»Klar doch.«
»Du bist meine Retterin, wenn du das tust«, gestand Ida.
»Weiß ich doch.« Sie sprang eilig auf, schlüpfte in Jacke und Schal. Sie tat das nicht zum ersten Mal. Bevor sie das Theater und Ida verließ, sagte sie: »Du siehst, man weiß nie, wofür es gut ist, die Schule früher zu verlassen.«
Dann machte sie sich auf den Weg.
Der Kindergarten befand sich in der Peterstraße, nahe dem Enckeplatz, gleich neben dem Park. Vesper kannte den Weg. Es war schließlich keine Seltenheit, dass sie Ida in dieser Angelegenheit aushalf.
»Alleinerziehende junge Mütter«, pflegte Ida zu sagen, »sind freie Beute für frustrierte Erzieherinnen.«
Vesper hatte recht schnell gemerkt, was genau sie damit meinte. Es war diese äußerst bevormundende Art, die womöglich jeder Erzieherin in die Wiege gelegt worden war und die einen zur Weißglut bringen konnte. Ida hasste es jedenfalls, sich dort blicken zu lassen. Außerdem musste sie schneidern.
Und Vesper mochte es, die kleine Greta abzuholen. Sie hatte immerzu das Gefühl, etwas Ehrenhaftes zu tun, was vermutlich daran lag, dass ihr das Mädchen das Gefühl gab, sie würde sie aus einer misslichen Lage erretten.
Sie nahm den nächsten Bus bis zum Hamburg-Museum am Holstenwall und sprang dort in den Regen hinaus. Wie ein feiner Nebel hatte sich der Nieselregen über die Stadt gelegt und berührte die immer früher hereinbrechende Dämmerung so zärtlich wie ein Liebhaber seine heimliche Angebetete.
Das Gefühl, etwas Nützliches zu tun, tat gut.
Sie überquerte die Straße und lief zum Kindergarten. An einer Laterne blieb sie stehen, weil sie das Gefühl gehabt hatte, dass da jemand stand; jemand, der sie beobachtete.
Doch als sie durch den Regenschleier blickte, erkannte sie nichts außer den gewöhnlichen Passanten, die hektisch auf den breiten Gehwegen dem Feierabend entgegeneilten.
Kurz musste sie an die Gestalt am Hafen denken, doch dann war der Gedanke auch schon wieder verschwunden.
Mädchen, weich vom Wege nicht.
Sie hüpfte beschwingt an den Pfützen vorbei, und schließlich erreichte sie den Kindergarten.
Das flache Gebäude mit dem dichten Pflanzenbewuchs auf dem Dach wirkte heimelig und warm. Drinnen roch es nach hellem Holz und den vielen Kindern, die laut umhertollten, auf großen Matratzen ihre Turnübungen absolvierten, durch Häufchen von Bauklötzen krochen oder ein wenig apathisch Mandalas ausmalten.
Die Leiterin der Einrichtung schnellte aus ihrem Büro, das gleich neben dem Eingang lag, und begrüßte Vesper, sobald sie drinnen war. »Ah, Fräulein …«
»Gold«, half Vesper ihr auf die Sprünge. Der Name der Leiterin stand auf dem Schild neben ihrem Büro: A. Wark.
»Sie sind da, um …?«
»Greta abzuholen«, erklärte sie. »Greta Veidt. Samt der Läuse, wenn sie denn wirklich welche hat.«
Frau Wark wirkte mit einem Mal sehr grimmig. »Wir haben sie eingehend untersucht.«
»Sie selbst?«
»Nein, das war Kristina. Sie kennen sie, sie arbeitet in Gruppe drei.«
Vesper nickte nur, setzte ein seriöses Gesicht auf. »Kristina ist die brünette Dame mit den blondierten Strähnen, die immer ein wenig teilnahmslos in der leeren Spielecke sitzt.« Sie lächelte freundlich. »Die nur darauf wartet, dass sie ein Kind nach Hause schicken kann.«
»Was erlauben Sie sich …«
Vesper machte eine wegwerfende Handbewegung. »Kann natürlich sein, dass ich mich irre.«
»Das tun Sie. Wir alle hier sind sehr gewissenhaft, was diese Sache angeht.«
»Entschuldigen Sie, das glaube ich natürlich sofort.«
»Wir haben Nissen gefunden, einen Zentimeter über dem Haaransatz. Fünf Nissen.«
»Ganze fünf?« Ein neuer Rekord. »Also keine Läuse.«
»Nissen weisen auf Lausbefall hin.«
Ach, herrje! »Keine Laus kriegt ihren Arsch hoch genug, um in einem Zentimeter Höhe ein Ei zu legen.«
Die Erzieherin bedachte sie mit einem skeptischen Blick. »Denken Sie daran, die Kleine muss unbedingt zu einem Arzt.« Offenbar hatte sie keine Lust mehr auf ein weiteres Gespräch.
Vesper starrte die Frau in den Boden.
Schließlich sagte Frau Wark: »Ich rufe dann mal Greta.«
»Bitte«, erwiderte Vesper nur.
Und wartete.
Erst als Greta um die Ecke gefegt kam, breitete sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus.
»Vesper!«, schrie die Kleine freudig, beschleunigte und ließ sich hochheben.
»Hallo, Greta.«
Die Kleine, die rote Zöpfe trug und wie das winzige Abbild ihrer Mutter aussah, ließ sich von Vesper absetzen, umarmen und begann plötzlich zu weinen. »Ich habe Läuse. Sagt Krista.«
»Wo ist Krista denn jetzt?« Die Frage war an die Leiterin gerichtet.
»Ihre Schicht endete vor einer halben Stunde.«
Vesper wandte sich wieder dem Mädchen zu. »Krista ist die große Frau mit den schlechten Zähnen, die nach nasser Katze riecht?«
Die Kleine nickte eifrig. Dann erklärte sie ernst: »Ich musste sogar ins Stille Zimmer.« Tränen standen ihr in den großen Augen.
Vesper sah die Leiterin böse an.
»Wir müssen die infizierten Kinder von den anderen trennen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.«
»Schon klar«, murrte Vesper. Die Infizierten, na klasse! Sie umarmte Greta ganz fest und ganz lange. Ihr Haar roch nach Stroh und der Turnmatte. »Die sind nur so böse zu dir, weil sie hässlich sind. Und du bist so schön, so wunderwunderschön.« Die Kleine lächelte zögerlich. »Hey, du siehst aus wie eine Prinzessin.« Wie eine Prinzessin in knatschbunten Leggins und grünem Jeanskleid.
»Wirklich?«
Vesper nahm den kleinen Mantel des Mädchens von der Mini-Garderobe und half ihr hinein.
Frau Wark stand mit verschränkten Armen da und ließ keine der beiden aus den Augen.
»Diese dummen Läuse«, jammerte die Kleine, als sie in den Mantel schlüpfte.
»Die Läuse sind gar nicht dumm«, erklärte Vesper ihr. »Weißt du, Greta, die Läuse leben eigentlich auf den Köpfen der Erzieherinnen. Sie wuseln in deren Haar herum, springen, spielen, singen. Aber weißt du was? Es ist eigentlich total ungemütlich da drinnen.«
Greta überlegte kurz und stellte fest: »Es riecht so komisch.«
Vesper grinste breit. »Ja, nach Katzenklo und Zigaretten und Haarspray und billigem Parfüm.«
Die Kleine nickte, grinste.
Frau Wark sah immer wütender aus.
»Die meisten Erzieherinnen riechen nach Katzenklo und Zigaretten, das war früher, als ich klein war, auch schon so. Genau deshalb wollen die Läuse auch zu den Kindern.«
»Die Kinder riechen gut.«
Vesper nickte. »Na ja, du riechst gut. Die meisten Kinder tun das.«
»Julian nicht.«
»Okay«, gab Vesper zu, »Julian nicht.«
»Julian stinkt.«
Kann sein, dachte Vesper und zog der Kleinen eine blaue Mütze an. »Läuse sind kluge Tiere. Sie mögen Kinderköpfe. Und sie halten die Luft an, wenn sie in den Haaren der Erzieherinnen sitzen. Aber sie müssen auf den Köpfen sitzen, weil sie sonst nicht an die Kinder herankommen.«
»Genau.«
»Und sie halten die Luft an, weil sie so stinken?«
Vesper tippte der Kleinen auf die Nasenspitze. »Genau, weil die stinken. Und weil sie die Luft nicht ewig anhalten können, klettern sie irgendwann auf die Köpfe der Kinder.«
Greta überlegte. »Dann ist es gar nicht schlimm, wenn ich Läuse habe?«
»Nein.«
»Aber die anderen Kinder schauen mich doof an, wenn ich ins Zimmer muss.«
Vesper seufzte. »Ist doch egal, was die anderen Kinder denken. Die sind nur neidisch, weil du schon nach Hause darfst. Und weil ich dich abhole.«
»Du bist cool«, sagte Greta.
Vesper musste lachen. »Danke, das finden die wenigsten.«
Frau Wark befand mit gestrengem Blick: »Sie sollten jetzt gehen. Ich muss mich heute auch um die Kinder in Gruppe vier kümmern.« Mit einem beleidigten Gesichtsausdruck fügte sie hinzu: »Außerdem muss ich die Sitzbezüge und alle Matratzen im Ruheraum abziehen.«
»Viel Spaß dabei«, wünschte ihr Vesper.
»Und sagen Sie Frau Veidt, dass sie ihre Tochter auch selbst abholen kann, wenn sie wieder mal Läuse hat.«
Vesper trat auf die Leiterin zu, kam ihr ganz nahe. »Wissen Sie was?«, fragte sie und sagte dann im Flüsterton, ganz, ganz verschwörerisch: »Ich bin die Einzige, die mit den Läusen reden kann. Deshalb komme immer ich.« Sie zwinkerte Greta zu, spürte den kleinen Händedruck. »Komm schon, Kleines, wir machen die Fliege.«
So verließen sie den Kindergarten – und keiner von ihnen schaute zurück. Sie gingen über die Straße zur nächsten Bushaltestelle und alberten dabei herum, machten Faxen und wichen den Pfützen aus. Greta erzählte von dem, was sie gemacht hatte, und Vespers Gedanken schweiften ab zu den Dingen, die sich tief in ihr verbargen.
Die dicken Wolken tauchten die graue Stadt schon früh in eine ungemütliche Abenddämmerung.
Die Autofahrer hupten aggressiv, und jedermann sah mürrisch aus.
»Vesper?«, fragte Greta.
»Ja?«
»Der Mann da hinten war eben auch schon da.«
Vesper erstarrte. Schnell schaute sie sich um. Eine hochgewachsene dunkle Gestalt verschwand in den tiefen Schatten zwischen zwei Häusern. Sie glaubte, einen Mantel und sogar funkelnde Knöpfe erkannt zu haben.
»Bist du dir sicher?«
Die Kleine nickte. »Er sah gruselig aus.«
Es schauderte ihr.
Mit einem Mal dachte sie wieder an die seltsame Begegnung drüben bei den Landungsbrücken. War es doch möglich, dass der Kerl hinter ihr her war? Nein, sie wollte das nicht glauben. Wer sollte das sein? Und aus welchem Grund sollte er ihr folgen?
»Wo hast du ihn denn schon gesehen?«
»Vor dem Kindergarten. Als wir rausgekommen sind, da hat er unter einem Baum gestanden.«
»Wirklich?«
Sie nickte. »Ein Tier hat auf seiner Schulter gesessen.«
Wie am Hafen.
Affe, Waschbär, Iltis, Frettchen, was auch immer – es war unscharf gewesen, wie etwas, was man nur aus dem Augenwinkel wahrnimmt.
Vesper starrte angestrengt in das Dämmerlicht.
Nichts!
»Wie hat er ausgesehen?«
Die Kleine überlegte, dann sagte sie: »Wie ein böser Mann in einem Film.«
Nicht gut, nein, gar nicht gut.
Sie sah sich wachsam um, dann gingen sie mit schneller werdenden Schritten ihres Weges.
»Du darfst niemals vom Weg abkommen«, erklärte Vesper.
Greta nickte.
»Weiß du auch, warum?«
»Wegen Rotkäppchen.«
Sie musste schmunzeln.
»Mama hat mir gesagt, dass man nicht wirklich erkennen kann, dass ein Wolf in einem Mann ist.«
Vesper spürte ein Frösteln tief in ihrem Herzen. Irgendwie erfüllte sie dieser Satz mit einer unbestimmten Panik. »Du musst dich vor den bösen Männern in der Stadt immer vorsehen«, sagte sie gedankenverloren und fühlte sich wie die Beute, deren Spiegelbild sich warm in den Augen des Raubtiers bricht.
»Ich weiß.«
»Gut.«
»Wölfe sehen nämlich wie Menschen aus«, erklärte die Kleine und wirkte so unschuldig dabei.
Vesper erstarrte, dann flüsterte sie: »Ja, davon habe ich als Kind geträumt.«
Sie warf einen weiteren Blick zurück in die wabernden Schatten, in denen sich die unscheinbaren Bewegungen der Passanten verloren. Es war ein ungutes Gefühl, das sie dabei hatte. Auch Greta hatte gesehen, dass da jemand war.
Jemand, der ihr folgte. Verdammt, der ihr seit dem Hafen folgte. Womöglich sogar noch länger.
»Was hast du?«
»Nichts«, log sie. »Ist alles in Ordnung.« Dann griff sie die Hand der Kleinen noch fester und ging mit ihr zur Bushaltestelle. Greta lief brav neben ihr her und schaute zu ihr auf, als sei sie ihre große Schwester.
Vesper indes konnte es sich nicht verkneifen, noch einmal nach hinten zu schauen.
Konnte es sein, dass sie sich das alles nur eingebildet hatte? Warum fühlte sie sich mit einem Mal so verfolgt?
Die Dämmerung erinnerte sie an einen Traum, von dem sie geglaubt hatte, sie hätte ihn längst vergessen.
Als kleines Mädchen hatte sie immerzu den gleichen Traum gehabt. Sie rannte über eine Wiese, und ein schwarzer Wolf folgte ihr. Je schneller sie lief, umso langsamer wurde sie; eines der Gesetze, denen Träume folgen. Der Wolf indes, ein pechschwarzes Ding, das eher wie eine Tuschezeichnung aussah als wie ein Wolf, jagte ihr nach, und kurz bevor es sie einholte, erwachte sie. Insgeheim hatte sie immer geglaubt, dass der Wolf gar kein richtiger Wolf war, sondern dass eine dunkle Gestalt eines Tages auf sie warten würde, irgendwo da draußen in der weiten Welt. Sie hatte sich immer schon vor dunklen Ecken und tiefen Kellern gefürchtet.
Genau dieses Gefühl beschlich sie nun, wenn sie an die Gestalt im Schatten dachte.
»Vesper?«
Greta lächelte glücklich. »Ich glaube, die Läuse sind wirklich lieb.«
Vesper beugte sich zu ihr herab. »Wie kommst du darauf?«
»Sie singen jetzt Lieder.«
»Echt?«
»Hör doch.«
Vesper beugte sich zu ihr herab, lauschte. »Stimmt«, flüsterte sie, »ich kann sie hören.«
»Sie spielen Musik wie auf der Kirmes.«
Der Bus kam endlich und hielt an. Mit einem lauten Zischen öffneten sich die Türen. Ein Strom rücksichtsloser Passanten drängte nach draußen. Vesper und Greta hielten ihm stand und stiegen ein.
Als der Bus losfuhr, wurde Vesper einer Gestalt gewahr. Sie trug einen Mantel und war nur sehr undeutlich zu erkennen, weil der dichte Regen und die Dämmerung dem Auge Streiche spielten.
»Wer bist du?«, flüsterte Vesper und war mit einem Mal froh, dass die kleine Greta ihre Hand hielt.
Kurz darauf trafen sie beim Theater ein. Der Regen war kaum mehr als ein Nieseln.
»Ist Mama sauer?«, wollte Greta wissen.
Vesper schüttelte den Kopf. »Nein, gar nicht.«
Sie betraten das Theater am Fleet. Drinnen herrschte jetzt ein kunterbuntes Durcheinander, weil die Schauspieler, Techniker und Helfer für die abendliche Vorstellung inzwischen eingetroffen waren und ihrer Arbeit nachgingen. Vesper zog die Kleine die Treppe hinauf zum Zimmer der Schneiderin.
Ida zog sich sofort einen Mantel über, als sie den Raum betraten.
»Oh, Greta«, begrüßte sie ihre Tochter, »diese dummen Kindergartentanten.«
»Sie riechen nach Katzenklo und Zigaretten«, verkündete Greta freudig. »Und das mögen die Läuse gar nicht.«
Ida sah Vesper fragend an.
»Ist eine lange Geschichte«, wich diese aus.
»Dessen bin ich mir sicher«, antwortete Ida, schnappte sich ihre Tochter und begann ihre Haare zu untersuchen. »Da ist nichts«, schimpfte sie. »Gar nichts, nur Krümel.«
»Du musst zum Arzt mit ihr. Sie wollen ein Attest.«
»Mist, ich wusste es.« Sie schaute gehetzt auf die Uhr.
»Ich kann das fertig machen«, schlug Vesper vor und deutete auf das Kleid.
»Das würdest du tun?«
»Hätte ich sonst gefragt?!«
Ida sprang auf sie zu und umarmte sie. »Du bist schon wieder meine Retterin.«
Vesper zwinkerte Greta verschwörerisch und freudig zu, und die Kleine zwinkerte munter zurück.
»Ich sehe dich«, verabschiedete sich Vesper von dem Mädchen.
»Nicht wenn ich dich zuerst sehe«, antwortete Greta. Dann verließen Mutter und Tochter das Theater. Vesper indes dachte daran, wie gern sie früher die kleine Schwester gewesen war – und wie schnell sich Dinge im Leben ändern konnten, wenn man nicht damit rechnete.
Sie arbeitete noch geschlagene zwei Stunden an dem eleganten Kleid, das für die boshafte sexy Königin, die in dieser Version von Rosenrot vorkam, bestimmt war, und ging dann allein ins Fackelholz, eine düster heimelige Szenekneipe in der Nähe der Überseebrücke, wo sie sich ein schnelles Abendessen gönnte.
Über dem Tresen flimmerten tonlos Musikvideos im Fernseher. Die Luft war erfüllt von Stimmengewirr und einem Lied von Rufus Wainwright. An den Wänden hingen alte Seefahrerbilder, und von der Decke baumelten zwei große Miniaturwindjammer.
Vesper mochte das Fackelholz.
Hier konnte man in aller Ruhe abhängen, ohne dass einen die anderen Gäste komisch ansahen. Meistens traf man auf das eine oder andere Gesicht, das man von anderen Tagen kannte. Es bahnten sich kurze Gespräche an, belanglos und so erfrischend wie unverbindlich. Man war freundlich zueinander, darauf kam es an. Es war ein Ort, an dem man gut in Gesellschaft allein sein konnte, wenn man es wollte.
Außerdem wohnte sie keine fünf Minuten von hier entfernt.
Vesper las ein wenig in einem alten Taschenbuch, das ihr Vater ihr geschenkt hatte, als sie Berlin den Rücken zugekehrt hatte, und ließ sich von den Geräuschen der Kneipe an ferne Gestade schwemmen. Sie wollte einfach noch nicht nach Hause gehen und allein sein. Wie gesagt – sie zog es vor, in Gesellschaft allein zu sein.
Sie nippte an ihrem Tee.
Schnupperte an dem Roman.
Der Schimmelreiter von Theodor Storm.
Ihr Vater hatte das Buch aus dem Regal gezogen und ihr zugesteckt, als sie, beladen mit Koffern, das Haus in Berlin verlassen und mit ihr Mutter nach Hamburg gezogen war.
Es kam ihr vor, als sei es erst gestern gewesen.
»Vielleicht gefällt es dir ja«, hatte er gesagt, und Vesper hatte sich gefragt, ob er das Buch oder die neue Stadt meinte.
Es war eine alte Taschenbuchausgabe mit handschriftlichen Anmerkungen, die Maxime Gold zwischen die Sätze gekritzelt hatte, als er selbst kaum mehr als ein Schüler gewesen war. Das Papier war schmutzig und gelb, und es roch so stark nach Staub und den Jahren, die es einsam zwischen all den anderen Büchern verbracht hatte, dass es beinahe schon wie eine Antiquität anmutete.
Fast eine ganze Stunde ging ins Land.
Vesper bestellte sich noch einen Milchkaffee, nippte langsam daran, tunkte den Keks mehrmals hinein und ließ sich von der Geschichte in ihren Bann ziehen. Sie dachte hin und wieder an den seltsamen Mann, den sie viel zu oft gesehen hatte, als dass es sich um einen reinen Zufall handeln konnte.
Sie starrte gedankenverloren auf den Fernseher, wo Patti Smith, wie die Einblendung zeigte, Everybody Wants to Rule the World sang. Der Raum aber war erfüllt von Bells on the River, gesungen von Jeffrey Lee Pierce. Dann versank sie wieder in der Geschichte um den Deichgrafen, entsann sich des Geruchs, der vom Hafen her durch die Straßen der Stadt wehte, und redete sich ein, dass dies jetzt unwiderruflich und zweifelsfrei ihr neues und zukünftiges Zuhause war.
Als sie fast die Hälfte des Taschenbuchs gelesen hatte, wurde sie von einer näselnden Stimme aus den Gedanken gerissen.
Sie hob den Blick und sah zwei aufgetakelte Mädchen vor ihrem Tisch stehen; zwei Mädchen, die ihr ein laues Lächeln schenkten, das so falsch war wie die Fingernägel und die Wimpern, die billiger aussahen, als sie es waren.
»Wenn das nicht Vesper Gold ist«, sagte die eine.
»Unsere neue beste Freundin.«
Die beiden hatten ihr gerade noch gefehlt. Was machten die hier? »Ich freue mich auch, euch zu sehen.«
Die beiden ungebetenen Gäste hoben unisono die Hände und sagten in einem schrillen Tonfall »Hi!«, als seien sie einer dieser schrecklichen amerikanischen Serien entsprungen.