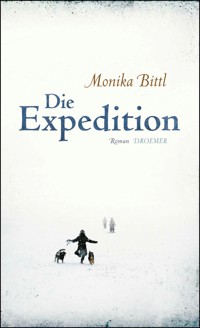9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer nicht reden will, muss streiten! Der humorvolle Familien-Roman von Monika Bittl mit Lachtränen-Garantie Nach 27 Ehe-Jahren ist der Lack eben ab, da sind sich Franziska und Bastian Schweighöfer einig. Jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, hat man sich einfach nichts mehr zu sagen und es wird Zeit für getrennte Wege. Deswegen muss man sich noch lange nicht streiten, hat man ja nie groß getan. Mit der vollkommen friedlichen Scheidung soll nur noch gewartet werden, bis sich Franziskas Mutter Mathilde von einem leichten Herzanfall erholt hat. Bis dahin wird »heile Familie« gespielt. Natürlich haben Franziska und Bastian keine Ahnung, dass Oma Mathilde sie längst durchschaut hat und ihnen die Kranke nur vorspielt. Tatsächlich funktioniert Omas Plan wunderbar: Die heile Familie vorzutäuschen ist nämlich so anstrengend, dass Franziska und Bastian bald streiten, was das Zeug hält. Und wer sich streitet, der liebt sich noch! Mit unnachahmlichen Sinn für Humor seziert Bestseller-Autorin Monika Bittl das Ehe- und Familien-Leben und schreibt dabei so authentisch, dass man meint, die Schweighöfers könnten nebenan wohnen. »Man sollte öfter mal ausmisten« ist ein großer Spaß für alle, die gern in humorvolle Familien-Romane eintauchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Monika Bittl
Man sollte öfter mal ausmisten
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Vom Ehe-Aus zum zweiten Frühling
Nach 27 Ehejahren ist der Lack eben ab, und es wird Zeit für getrennte Wege – da sind sich Franziska und Bastian Schweighöfer einig, ganz ohne Streit. Doch als Oma Mathilde spitz bekommt, dass die beiden sich trennen wollen, entwickelt sie zusammen mit ihren Enkeln einen hinterlistigen Plan: Oma täuscht einen leichten Herzanfall vor; um sie nicht weiter zu belasten, spielen Franziska und Bastian fleißig »heile Familie«. Und wie von Oma und den Enkeln geplant, ist die Schauspielerei so anstrengend, dass das Noch-Ehepaar bald streitet, was das Zeug hält. Und wer sich streitet, der liebt sich noch! Doch dann erleidet Mathilde tatsächlich einen Herzanfall ...
Inhaltsübersicht
Franziska
Bastian
Vincent
Emma
Franziska
Mathilde
Gottlieb
Franziska
Emma
Franziska
Bastian
Vincent
Franziska
Mathilde
Gottlieb
Bastian
Franziska
Emma
Vincent
Gottlieb
Franziska
Mathilde
Bastian
Franziska
Emma
Gottlieb
Bastian
Vincent
Franziska
Emma
Mathilde
Gottlieb
Franziska
Bastian
Emma
Vincent
Franziska
Bastian
Gottlieb
Mathilde
Emma
Vincent
Gottlieb
Franziska
Bastian
Mathilde
Emma
Vincent
Gottlieb
Franziska
Bastian
Mathilde
Vincent
Bastian
Franziska
Emma
Gottlieb
Vincent
Emma
Gottlieb
Franziska
Cara! Wie geht es dir? Was kann ich für dich tun?« Franziska hielt wie beim Schnitt in einem Standbild inne, kramte nicht weiter vor der Theke mit der Kaffeeausgabe in ihrem Geldbeutel, sondern starrte hinein. Diese tiefe Stimme, dieser sonore Sound mit dem Schweizer Akzent – war das wirklich seine? Etwas tiefer, etwas älter? Langsam drehte sie den Kopf zur Seite, ja, verdammt, das war er! Giovanni. Fast dreißig Jahre älter. Sein Kopf rasiert, vermutlich um eine Halbglatze zu verbergen. Kleiner Bauch. Modische Jeans. Immer noch: weißes Hemd und Lederjacke. Und elegante Lederschuhe. Die strahlend blauen Augen und die markanten Wangenknochen. Giovannis eine Hand legte sich auf ihre. Mit der anderen hielt er der Frau hinter der Kaffeeausgabe einen Schein hin.
»Das übernehme ich. Und wenn sie möchte«, erklärte er der Kassierin, »nicht nur die Kosten, sondern die ganze Frau neben mir gleich dazu.« Er wendete sich wieder ihr zu. »Eine so schöne Frau sollte ihre Finger für etwas anderes benutzen und nicht nach Kleingeld suchen!« Sie war so überrascht, dass sie nicht einmal rot werden konnte oder zu zittern begann oder gar einen Kommentar dazu über ihre Lippen brachte. Er genoss offenbar ihre Verblüffung. Seine Augen leuchteten. Sein Lächeln strahlte. Er zog sie zu sich. Bussi links, Bussi rechts. Und verhalten, fast nur angedeutet, eins auf den Mund. Dann trat er einen Schritt zurück, nahm dabei ihre Hände in die seinen, ließ die Augen nicht von ihr und scherte sich nicht um die Wartenden in der Schlange. »Ich hab nicht geahnt, dass du noch schöner werden kannst!«
Da sage noch mal einer, es gäbe kein Karma im Leben! Ausgerechnet heute hatte die Maskenbildnerin sie nach allen Regeln der Filmkunst perfekt geschminkt, weil eine Statistin wegen einer Magen-Darm-Geschichte ausgefallen und keine andere Person weit und breit wie im Drehbuch beschrieben war: »gut normalgewichtig«, mittelgroß, mit rot gefärbten Haaren und um die fünfzig Jahre alt. Sie, die Kamerafrau, die den Spielfilm für Dubois fotografierte, musste kurzerhand mal vor die Kamera und trug deshalb ewig lange künstliche Wimpern, einen fein gepinselten Lidstrich, kussfesten Lippenstift und Rouge auf dem Make-up, das ihr Gesicht fein konturierte, fast so, als wäre sie noch einmal fünfundzwanzig Jahre alt.
Kein Drehbuchautor hätte diese Begegnung für sie so perfekt beschreiben und keine Regie sie so optimal inszenieren können. Eine Autobahnraststätte. Innen. Früher Morgen. Die Protagonistin Franziska trifft nach fast dreißig Jahren wieder auf den Kerl, an den sie in all den Ehejahren immer wieder gedacht hatte.
»Warum ist aus uns nie etwas geworden?«, würde die Protagonistin in einem schlechten Drehbuch, das eine gute Exposition nicht beherrschte, fragen. »Ich bin glücklich verheiratet und meinem Mann immer treu gewesen«, würde es im Skript, das die Vorgeschichte gleich am Anfang mit dem Holzhammer erklärte und nicht nach und nach enthüllte, weiter heißen. Vielleicht war aber auch ihr Leben an der Seite von Basti einfach nach einem langweiligen Drehbuch verlaufen.
»Ich hab immer an dich gedacht, wirklich!«, sprach Giovanni aus, was sie eben gedacht hatte. Vor allen Leuten, laut an dieser Raststättentheke. Doch dabei wurde sie wieder Frau ihrer selbst. Wie kam der Kerl eigentlich auf die Idee, dass sie hier mit ihm flirten konnte und nicht mit Mann und Kindern unterwegs war?
»Ich glaube, die Wartenden und die Dame hinter der Theke interessiert unser Gefühlsleben eher weniger«, bemerkte sie cool und warf dem Mädel der Kaffeekette einen freundlichen Blick zu. Die junge Frau war aber von Giovannis öffentlichem Liebesgeständnis so zu Tränen gerührt, dass sie Franziska die harsche Landung auf dem Boden der Realität fast übel nahm und sich nur widerwillig dem nächsten Kunden zuwendete.
Franziskas Handy bimmelte mit dem Ton einer Whatsapp-Nachricht von der Familie. Nein, jetzt nicht lesen, ob der Gatte fragte, wann er sein Leinensakko von der Reinigung abholen könne oder ob er vier oder vielleicht doch fünf Semmeln einkaufen solle.
Giovanni nahm beide Kaffeebecher in die eine Hand und zog Franziska mit der anderen zu einem Tisch des Schnellrestaurants, das dem ähnelte, in dem Meg Ryan die berühmte Orgasmusszene im Streifen Harry und Sally spielte.
»Du bist berühmt geworden!«, bemerkte Giovanni und küsste den Rücken der linken Hand, die er nicht losließ.
»Quatsch! Ich stehe hinter der Kamera, keiner kennt mich!« Gebannt und doch wieder ganz bei sich konnte sie antworten. Giovanni – der Meister der Komplimente.
»Aber deine Filme sind berühmt!«
»Vielleicht. Ich fotografiere so gut wie möglich, wenn ich einen Spielfilm-Auftrag kriege.«
»Fotografiere? Ich dachte, du hast die Fotografie aufgegeben.«
»Im Film, also beim Dreh, heißt das so, was die Kamerafrau oder der Kameramann macht: fotografieren. Aber witzig, dass du die Fotografie erwähnst. Ich überlege gerade, ob ich da nicht wieder was mache, nach so vielen Jahren.«
Giovanni streichelte ihr – so als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt – über die Wange, bemerkte, dass ihre Fotografien immer außergewöhnlich kunstvoll gewesen seien, und ignorierte ebenso wie sie das ständige Bimmeln ihres Smartphones, ehe Franziska das Gerät auf stumm schaltete, in die Handtasche schob und erklärte, dass sie gern wieder fotografische Porträts machen würde, wie früher. Mit der Digitalisierung sei die Fotokunst ja »gestorben« gewesen, erlebe jetzt aber wieder eine Renaissance. Sie erklärte kurz, dass sie deshalb trotz Familie mit zwei kleinen Kindern noch rechtzeitig auf Kamera im Film umgeschult und durch viel Anstrengung gepaart mit Glück auch bald gute Jobs gefunden hatte. Hauptsächlich fotografierte sie Werbung, aber eben auch die Spielfilme, die er, Giovanni, vor allem wegen Dubois wohl kenne. Gut bezahlt, kreativ, natürlich aber auch sehr stressig, zum Beispiel bei solchen Nachtdrehs, wie sie eben einen hinter sich hätte.
»Wie schön musst du erst sein, wenn du zuvor eine Nacht geschlafen hast?«
Auch wenn sie wusste, dass er der personifizierte Charme war und er auch früher jedem Rock ein passendes Kompliment gemacht hatte – seine Augen konnten nicht wie Worte lügen. Dieses Strahlen war echt. In Franziskas Magen begann es zu kribbeln. Ein ganz seltsames Gefühl. Schmetterlinge im Bauch? Sie? Mit über fünfzig? Quatsch! Die Würfel waren längst gefallen, sie hatte mit Basti zwei wunderbare Kinder bekommen und führte eine Ehe »im üblichen Unglücksausmaß«, wie sie gern scherzend sagte. Sie hatten doch ein gutes Los gezogen, sie hatte es sich gut eingerichtet. Aber stimmte diese Ansicht? Hatte Basti sie jemals gefragt: »Wie geht es dir? Was kann ich für dich tun?« Hatte er jemals eine Duftkerze für sie angezündet? Aber war das wichtig – Kerzen, Seidenbettwäsche und »Take a look at me now« –, wenn man zusammen zwei Kinder auf den hoffentlich guten Weg gebracht hatte? Über Jahre, Jahrzehnte. Windeln wechseln, keine Nacht durchschlafen, Kindergarten suchen, Hausaufgaben betreuen, Fahrradfahren beibringen und Lego-Figuren über Stunden im Schnee suchen, einen Klinikbesuch mit Blinddarm-Notoperation nachts um vier Uhr teilen, zahllose Mittelohrentzündungen mit Arztbesuchen absprechen, das Geld für die Klassenfahrt zusammenkratzen und zuletzt betrunkene Freunde von Vincent davon abhalten, ins Treppenhaus zu kotzen.
Giovannis Worte schienen all ihre Selbstverständlichkeiten auf den Kopf zu stellen und ihren ganzen Körper zu fluten: »Wie schön musst du erst sein, wenn du zuvor eine Nacht geschlafen hast?«
Sie spürte das Handy schon wieder in der Handtasche vibrieren. Was, wenn doch etwas mit den Kindern war?
»Sorry, ich weiß nicht, ob nicht noch mal nachgedreht werden muss«, erklärte Franziska, die Arbeit vorschiebend. Wenn Emma oder Vincent sich meldeten, musste sie sogar in so einer Situation sofort nachsehen, ob es wichtig war. Als Mutter war ihr das in Fleisch und Blut übergegangen. Die Macht der Gewohnheit. Das aber wollte sie Giovanni nicht gestehen, denn die »Kinder« waren ja schon Anfang zwanzig.
»Du musst dich nicht entschuldigen. Und wenn das deine Kinder sind, dann erst recht nicht«, erklärte Giovanni. »Ich hab zwar keine, aber es ist doch klar, wie wichtig sie dir sind! Würd mich wundern, wenn du nicht eine Vollblutmutter wärst. Und bevor du fragst: Ich bin Single, weil ich immer auf dich gewartet habe!« Giovanni grinste breit. »Also genauer: vor und nach einer kurzen Ehe.«
Geschieden also, Franziska lächelte. Vor Jahren hatte die Mama oder eine gemeinsame Bekannte aus der Gegend, aus der beide stammten, etwas von seiner Hochzeit erzählt.
Vincent schickte im Minutentakt eine Nachricht nach der anderen. Er war vor einer Woche ausgezogen und fragte nun, wie man ein Klo putzt, ob man ein Spülmittel auch für die Wäsche verwenden könne, und schickte gefühlt tausend Fotos von Rossmann-Regalen, auf denen er irgendwas mit roten Umrandungen markiert hatte. Ein Kloreiniger in Großaufnahme, schon wieder! Das war definitiv ein Mittel, die Mutter davon abzuhalten, sich in Giovannis Arme zu begeben.
Franziska nahm den letzten Schluck vom Espresso und bemerkte kurz angebunden: »Ich muss los.«
Überrascht und enttäuscht sah sie Giovanni an.
»Jetzt schon? Ich wollte dich noch so viel fragen und von dir erfahren und dich nicht mehr gehen lassen, ehe wir uns draußen noch viel erzählt haben, da hinten auf dem Parkplatz zum Beispiel …«
»… auf dem du dich sicherlich mit einer unverheirateten Frau an so einem kalten Tag wesentlich heißer vergnügen kannst als mit mir!«, konterte Franziska und wünschte sich im nächsten Moment selbst zur Hölle. Wie bescheuert war sie eigentlich, das Aufregendste, das ihr seit Jahren passierte, schon im Keim zu ersticken? War sie wie ein schüchterner Teenie, eine biedere Moralkeule oder schlichtweg einfach so blöd wie die Nacht finster?
Wenigstens fiel ihr noch etwas ein, wie sie sich aus der Situation mit erhobenem Kopf retten konnte, ohne endgültig alle Türen zuzuschlagen.
Sie nahm die Serviette, auf dem der Kaffee stand, kramte einen Stift aus der Handtasche und notierte auf dem Papier ihre Handynummer.
»Hier!«, sagte sie lächelnd und gab das Stück Giovanni. »Meine Nummer. Du bist es mir wert, dass ich dir die richtige gebe.«
Giovanni umfasste zum Abschied ihr Gesicht über den Tisch hinweg mit beiden Händen, küsste sie zart auf die Wangen und bemerkte verschwörerisch: »Das wirst du nicht bereuen!«
Soso. Genau das hatte ihr Bastian damals auch versprochen, als er ihr nach fünf Jahren wilder Ehe einen Heiratsantrag gemacht hatte.
Die Zeit zwischen »Das wirst du nicht bereuen« und Antworten auf Fragen zu Kloreinigern nannte sich also »Ehe«.
Bastian
Der junge Mann, dessen Name Basti einfach nie auf Anhieb einfiel, lief splitterfasernackt aus Emmas Zimmer an ihm vorbei ins Bad. Basti verkniff sich einen Blick auf das beste Stück des Kerls. Er konnte sich doch nicht mit dem Freund seiner Tochter messen, also das ging wirklich nicht. Wobei er den Körper insgesamt natürlich ohnehin mit seinem verglichen hatte. Klar, der war dreißig Jahre jünger als er, mit festen Bauchmuskeln, ohne »Schwangerschaftswölbung«, ohne schlaffe Hautmasse an den Oberarmen, und die Brustwarzen fest auf dem Vorderkörper und nicht wie bei ihm fast mit einem kleinen Busen dazu. Etwas, das er seit einiger Zeit fast noch weniger an sich leiden konnte, als beim Treppensteigen mit schweren Einkaufstaschen zunehmend zu schnaufen. Nur mit der Haarpracht konnte er es nach wie vor aufnehmen: Nirgendwo ein Glatzenansatz zu sehen!
Warum war Franziska schon wieder nicht da und er hatte sich stattdessen um den Gast zu kümmern? »Tee? Schwarz oder Kräuter?«, fragte Basti freundlich durch die Badezimmertür.
»Nein, danke!«, erwiderte der Kerl, der, wie Basti nun wieder einfiel, Leo hieß.
»Leo trinkt immer Kaffee!«, rief ihm Emma, die noch im Bett lag, durch die offene Zimmertür zu. »Für mich auch einen, bitte!«
Seit wann trank Emma morgens Kaffee? Hatte er diese Entwicklung nur wie so vieles sonst auch verschlafen, wie Franziska ihm immer vorwarf, oder passte sie sich diesem Leo, mit dem Basti einfach nicht warm wurde, an? Auch das hatte Franziska und nicht er bemerkt: »Die verbiegt sich doch die ganze Zeit, um ihm zu gefallen. Nur weil er zum Essen Bier trinkt, nimmt sie nun auch ein Glas. Ich frag mich, wo unsere selbstbewusste Tochter geblieben ist!«
Basti hatte kurz überlegt, ob Emma wirklich immer selbstbewusst gewesen war, es schien ihm nicht so, aber vielleicht hatte er auch das falsch im Kopf und Franziska recht, wenn sie so oft sagte: »Merkst du denn gar nichts?«
»Müsli oder Semmeln?«, fragte Basti wieder durch die Badezimmertür.
Keine Antwort. Vielleicht hörte dieser Leo wie Vincent auch morgens schon beim Duschen mit wasserdichten Kopfhörern Musik. Junge Leute machten so was. Duschen mit wasserdichten Kopfhörern. Basti schüttelte innerlich den Kopf darüber und dachte zugleich: Und, waren wir auch nur einen Deut besser? Was für eine Aufregung damals in der Münchner U-Bahn, als der Walkman aufgekommen war und junge Leute wie er sich erdreisteten, unterwegs Musik zu hören! Große Hinweisschilder waren in der U-Bahn angebracht gewesen, das Gerät bloß nicht sehr laut zu stellen, um den Sitznachbarn nicht zu stören.
Basti fiel ein, dass er morgens auch einmal wieder Radio hören könnte, und schaltete das Gerät auf Bayern 4. Mit Klassik ging er auf Nummer sicher, da musste er nicht lange überlegen, was nun angesagt oder der jeweilige Geschmack junger Leute war. Klassik war unverfänglich, wertfrei und einem Vater angemessen. Außerdem käme er so gar nicht in Verdacht, ein Musikantenstadel- oder Schlagermitläufer zu sein. Aber gab es eigentlich den Musikantenstadel im Fernsehen überhaupt noch? Oder hatte er auch dessen überfällige Abschaffung verschlafen?
Er befüllte die Kaffeemaschine, setzte Tee auf, nahm Butter, Marmelade, Käse und Wurst aus dem Kühlschrank, holte Nutella aus dem Lebensmittelschrank und ohne Nachdenken vier Tassen und Teller aus dem Geschirrkasten, um sie auf den Tisch zu stellen. Moment! Waren sie heute wirklich vier? Wie so viele, viele Jahre beim Frühstück als Familie. Nein, sie waren nur drei. Vincent war vor einer Woche ausgezogen, und Franziska hatte einen Nachtdreh auf dem Land gehabt, von dem sie erst zurückkehren würde, wenn er schon im Büro wäre. Witzigerweise ein Dreh nahe der Gegend, aus der sie beide stammten. Bayerisches Land, wunderschöne Natur mit Hügeln, die gerade nicht nur von Touristen, sondern auch vom Film neu entdeckt wurde. Da konnte sich geändert haben, was wollte, wie Franziska immer behauptete – für Basti blieben das immer noch Käffer, Land, wo man mit Lederhosen sonntags in die Kirche ging und anonym angezeigt wurde, wenn man als Jugendlicher ein frisiertes Moped fuhr. »Anonym« – er und jeder andere hatte gewusst, dass der alte Meierhuber dahintersteckte. Der bekam auch Tobsuchtsanfälle, wenn der Nachbar nicht ebenso wie er einen englischen Rasen pflegte oder sein Auto nicht am Samstagnachmittag bis in die letzte Felge hinein säuberte. Und über seine Familie mit der Landwirtschaft, die doch kaum mehr Erträge abwarf, hatte der Meierhuber ebenso geschimpft: »Alles Ganoven, diese Bauern! Immer jammern und viel Geld vom Staat abkassieren!« Später hatte ihn diese Meierhuber-Sippschaft wieder eingeholt – denn die zogen ironischerweise in die direkte Nachbarschaft der Schwiegerleute.
Basti war ja schon früh aus dieser Spießerenge geflüchtet und hatte gegen den ausdrücklichen Willen des Vaters den Hof nicht übernommen, sondern stattdessen in München studiert. Die beiden anderen Brüder wollten auch den elterlichen Betrieb nicht retten, lernten Handwerke, und erst der Jüngste, der Christian, hatte die Landwirtschaft der Familie fortgeführt – und zwar richtig gern. Geschäftstüchtig war er, der Christian, hatte kürzlich auf Bio umgestellt und schon seit Jahren beträchtliche Nebeneinnahmen mit »Ferien auf dem Bauernhof«.
Aber wie kam Basti nur darauf? Er starrte kurz auf das Nutella-Glas, das er immer noch in der Hand hielt. Ach ja: Christian hatte auch immer Nutella gefrühstückt, so wie sein Sohn Vincent. Christian musste bei der körperlichen Arbeit nie an Kalorien denken und verschlang schon als Kleinkind doppelt so viel wie andere, ohne jemals auch nur ein Gramm Fett anzusetzen. So als hätte er einen doppelt großen Durchlauferhitzer. Noch heute war das so beim Bruder, im Gegensatz zu ihm, der mit den kleinen Tierchen namens Kalorien zu kämpfen hatte, die heimtückisch nachts seine Kleidungsstücke enger nähten.
Als Basti das Frühstück ohne Eier fertig hergerichtet hatte, tauchte dieser Leo wieder aus dem Badezimmer auf. Er roch nicht nur frisch geduscht und nach einem herben Parfum, sondern auch nach Rauch. Der Qualm drang durch die offene Tür in die Küche, obwohl beziehungsweise weil Leo das Badezimmerfenster geöffnet hatte. Schon seit dem Einzug vor zehn Jahren in diese Wohnung wunderten sich alle immer wieder über die seltsamen Luftzüge in den Räumen. Öffnete man das Badezimmerfenster, zog der Geruch in die Küche. Umgekehrt aber nicht. Dann wiederum verbreitete sich vom Schlafzimmer aus alles in Emmas Zimmer – in Vincents Zimmer komischerweise aber nicht.
»Du als Statiker müsstest das doch berechnen können«, hatte Franziska mehrmals behauptet. Basti hatte nicht erklärt, dass sein Job ganz andere Kompetenzen erforderte, aber sogar beim Haustechniker-Kollegen nachgefragt. Der hatte gemeint, dass solche Luftzüge sehr schwer zu bestimmen seien.
»Hast geraucht im Bad?«, bemerkte Basti beiläufig, als Emma und dieser Leo schließlich am Frühstückstisch Platz nahmen und ihm nichts Besseres einfiel. Nein, alles verschlief er Trottel nun wirklich nicht, das war ihm doch aufgefallen.
Emma warf ihm einen entsetzten Blick zu. Wieso? Sie wusste doch, dass ihn der Qualm nicht störte, er selbst hatte doch über viele Jahre geraucht.
»Hören Sie, wenn das nicht klargeht, dann sagen Sie es einfach«, meinte dieser Leo und strich genervt Marmelade auf seine Semmel.
»Das stört mich gar nicht, das Rauchen«, erklärte Basti locker und freundlich. »Rauchen ist tödlich, aber Leben auch. Und waren wir nicht schon beim Du? Also, ich bin der Basti!«
Emma warf ihm wieder einen entsetzten Blick zu. Ihr Kopf mit dem blonden, langen Pferdeschwanz schien sich empört über ihn zu schütteln, auch wenn er sich nicht bewegte. Was hatte er denn jetzt schon wieder falsch gemacht?
Höflich, aber nicht wirklich begeistert hob der junge Mann die Tasse wie zum »Prost«. War es Emma peinlich, mit Tee- und Kaffeetassen und nicht mit Alkohol auf das Du zu kommen?
»Wann hast du denn heute Vorlesung?«, fragte Basti den Kerl, weil er sonst nichts zu reden wusste.
»Es sind Semesterferien«, erwiderte Leo kurz angebunden. Und schon wieder so ein empörtes Augenrollen von Emma.
Nein, es machte keinen Spaß hier zu sitzen, bei denen konnte man nur alles falsch machen.
Basti packte schnell Wurst und Käse auf eine Semmel und verabschiedete sich mit einem »Ich muss leider gleich los, muss heute früher ins Büro« von den jungen Herrschaften. War das jetzt spießig zu sagen, dass Emma noch Butter, Wurst und Käse nach dem Frühstück zurück in den Kühlschrank räumen sollte? Egal. Basti tat es trotzdem. Komischerweise folgten daraufhin aber keine entsetzten Blicke von Emma, sondern ein entspanntes: »Klar doch, Dad!«
Basti nahm die Semmel in die Hand, rief »Servus«, packte die Jacke und die Aktentasche und dachte: Weiber sind nichts für Anfänger, nicht mal für Väter mit Töchtern. Pardon! Frauen! Also, ein Macho bin ich ja nun wirklich nicht.
Wie gut, dass es im Büro keine solchen Irritationen gab, denn in seiner Statikabteilung arbeiteten nur Männer. Ein junger Schnösel war zwar als Chef an ihm vorbei die Karriereleiter hinaufgestiegen, aber dessen Ansagen waren trotz seiner unterirdischen Tiefbaudummheit wenigstens berechenbar.
Vincent
Die Oma streckte den Kopf mit den Lockenwicklern im Haar aus dem Küchenfenster des Hanghauses, winkte ihm zu und rief freudig »Vincent«, nachdem er am verwitterten Gartenzaun die Klingel zu dem kleinen Einfamilienhaus gedrückt hatte.
»Moment, ich komm gleich!«
»Nicht nötig«, entgegnete Vincent und sprang, sich mit einer Hand am oberen Rand der Latten festhaltend, über den Zaun.
»Hallo?« Eine ältere Männerstimme rief mehr mahnend als fragend nach ihm.
Vincent drehte sich um. Es war der Nachbar.
»Ach, du bist es, der Vincent«, brummte der Mann beruhigt. »Ich hätt dich fast nicht mehr erkannt. Mit dem Bart, so groß, und die Haare so viel länger.«
Freundlich nickte Vincent mit dem Kopf. Das war halt das Land, oder vielmehr die »Kleinstadt«, wie Oma ihn immer korrigierte. Die Nachbarn beobachteten und kontrollierten alles, wie Mom und Dad nicht müde wurden zu schimpfen.
»Der Vincent!« Die Frau des Nachbarn tauchte hinter einer Hecke auf. Lauter alte Leute, lauter Rentner, die allesamt sehr viel Zeit hatten. Vincent grüßte erneut freundlich, so wie ihm die Großeltern das beigebracht hatten.
Als Junge war er mit der Schwester oft hier gewesen, wenn Mom einen Dreh hatte. Mit dem Opa hatte er die ganze Gegend erforscht und in den umliegenden Wäldern alles Mögliche gespielt: mittelalterliche Kämpfe, Expeditionen und sogar Star Wars, weshalb der Opa extra altmodische Videos besorgt und mit ihm geguckt hatte. Ein Holzstecken war dabei zu einem Leuchtschwert, ein umgefallener Baum zu einem Raumschiff und eine Felsformation zum geheimen Versteck von Meister Yoda geworden, obwohl Opa immer wieder den Inhalt der einzelnen Episoden verwechselt hatte. Trotzdem hatte er mit ihm die besten Jungenspiele dazu auf die Reihe gebracht. Während die Oma wie im Märchenbuch all die Dinge erledigte, die früher ausschließlich die Jobs von Frauen gewesen waren: Wäsche waschen, bügeln, kochen, putzen und Kuchen backen. Opa wusste noch nicht mal, wo in der Küche die Pfannen lagen, die sie als »extraterrestrische Empfangsgeräte« suchten, um sie im Garten aufzustellen.
»Wie der Gottlieb siehst aus!«, bemerkte die Nachbarin. »Der rote Bart, die längeren Haare. Und auch so breit gebaut. Runtergerissen der Opa!«
Wirklich? Sonst behaupteten alle, er sei seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten, und der war als Schwiegersohn ja nun wirklich nicht mit dem Opa genetisch verwandt. Und der rote Bart – he, wann hatte der Opa auch so einen gehabt?
»Was machst denn jetzt?«, fragte die Nachbarin und streifte sich die Gartenhandschuhe ab.
Vincent verstand, wie die Frage gemeint war – was er denn nun nach Beendigung der Hotelkaufmannlehre weiter beruflich vorhatte. Das hätte er ihr sagen können, aber er wollte sich erstens der Oma zuwenden, zweitens im Sinne von Mom und Dad der Übergriffigkeit der Nachbarn einen Riegel vorschieben und drittens schlichtweg nicht den halben Nachmittag am Zaun verbringen, um Auskünfte zu erteilen.
»Was ich jetzt mache? Ich besuch die Oma«, antwortete Vincent freundlich, aber mit Schalk im Nacken und drehte sich mit einem »Schön, Sie mal wieder gesehen zu haben!« um.
Die Oma verstand seine geschickte Abwehr der Aufdringlichkeit, packte seine Hand, drückte ihn kräftig an sich und strich ihm übers Haar.
»Buberl!«, sagte sie strahlend zu dem zwei Köpfe größeren Enkelkind.
»Dann wollen wir nicht länger stören«, bemerkte die Nachbarin mit einem verärgerten Unterton.
»Das hätte die Meierhuberin jetzt gern, dass ich sie zum Kaffee einlade, wenn du da bist«, raunte Mathilde Vincent auf dem Weg ins Haus ins Ohr und grinste doch dabei so freundlich zu den Nachbarn, als würde sie diese herzlich gern mögen. »Bei denen ist doch gar nichts los, total tote Hose. Denen ist es stocklangweilig. Da lauern die nur auf Besuche in der Nachbarschaft und so junge Leute wie dich. Als ob die jetzt im Februar Gartenarbeit machen würden, hast gesehen, die Meierhuberin hat sich extra die Handschuhe angezogen, damit sie so tun kann, als wär sie zufällig draußen. Und dann haben die schon Sachen über mich erzählt, die hab ich selbst noch gar nicht gewusst!«
Vincent grinste. Klar, die Oma war – wie Mom und Dad immer sagten – »fit wie ein Turnschuh« mit ihren achtzig Jahren, lud Gäste ein, beteiligte sich an gefühlt allen Kirchenbesuchen, Bastelkreisen für katholische Hausfrauen, Beten für Tibet, oder was es wohl sonst noch alles gab. Außerdem überraschte sie seit Opas Tod vor drei Jahren alle immer wieder schubweise mit ihren Neuerungsvorhaben. Der neueste Plan war: »Ich brauche ein Handy! Und Internet! Das hat doch heute jeder!«
Mom hatte sich dem strikt verweigert. »Nein, das tue ich mir nicht an. Dann kommt jede Stunde ein Hilferuf zu einem Programm, das nicht funktioniert. Da kann ich meinen Job gleich an den Nagel hängen. Die meint ja eh, ich bin immer verfügbar als Freiberuflerin. Nein. Act your age! Die soll mal lieber sehen, welche Trockenblumen sie für welches Kirchengesteck verwendet!«
Auch Dad hatte zweifelnd die Stirn gerunzelt. »Hm, ich weiß nicht, soll Mathilde sich in ihrem Alter wirklich noch diesen technischen Neuerungen aussetzen? Wozu? Das kostet doch nur Nerven und verführt zum unkontrollierten Konsum. Vor zwanzig Jahren sind wir auch prächtig ohne Handy zurechtgekommen. Man muss ja nun wirklich nicht jede Mode mitmachen!«
Mode? Handy? Internet? Oida! Das waren die Basics, und die wollten die Eltern der Oma verweigern, sie so grausam hängen lassen? Also nicht, dass Vincent darauf erpicht gewesen wäre, einen verdammt langen Seniorengrundkurs zu geben. Aber dass die Eltern einfach zu faul oder zu bequem waren, um Mathilde den Anschluss an das Heute zu ermöglichen, ärgerte ihn. Noch dazu, wo die Oma ins Krankenhaus kam – zwar nur zu einer Routineuntersuchung, aber da brauchte sie doch ein Handy. Vincent erinnerte sich mit Schrecken an die Blinddarm-OP vor sieben Jahren, bei der man ihm das Smartphone abgenommen hatte, weil das in diesem Krankenhaus noch verboten gewesen war. Alle Freunde hatten ihm geschrieben oder Videos geschickt – und er lag im Bett, ohne das alles sehen zu können. Einsam. Dachte, alle hätten ihn vergessen.
»Im Krankenhaus gibt es auch ganz normale Telefone, mit Schnur und so, wie früher«, hatte Mom gemeint. »Damit kommt Mama auch zurecht. Sie will auch gar nicht ins Internet damit, sie will eh immer nur ratschen.«
»Aber wieso möchte sie dann unbedingt ein Handy?«
»Nur weil sie damit keine Gebühren zahlen muss. Ein Krankenhaustelefonanschluss kostet pro Tag. Ein Handy spart ihr Geld, aber uns kostet es tausendfach Nerven!«
Okay.
Aber wie oft hatte Mom ihn gelöchert mit Fragen?
»Ach, und dir musste auch niemand erklären, wie man Apps durch Wischen schließen kann?«, hatte Vincent mit einem Beispiel spitz gekontert.
»Das ist was anderes!« Mom war sichtlich angepisst.
»Und warum?«
»Weil … weil ich das beruflich brauche. Bei Mama ist es doch bloß, weil sie Geld sparen will und uns alle damit rücksichtslos beschäftigt«, hatte Mom barsch erwidert.
So what? Warum auch immer die Oma ein Handy wollte – why not? Und deshalb hatte er sich vom Dad den Fiat ausgeliehen und war hierhergefahren. Na gut, um ehrlich zu sein, vielleicht auch deshalb, weil sich in Omas Haushalt auch Dinge befanden, die er für seine erste eigene Bude gut brauchen konnte. Denn laut Moms Aussage und seiner eigenen Erinnerung hatte die Oma sicherlich gefühlt fünfhundert Bügeleisen, Schnellkochtöpfe oder Geschirrservice im Haus, da sie seit Menschengedenken Sonderangebote einkauft und alles gehortet hatte, weil das kleine Einfamilienhäuschen über einen unfassbar großen Keller mit entsprechenden Lagermöglichkeiten verfügte. In der Garage von Opa mussten außerdem noch alle möglichen Werkzeugsets, Benzinkanister, Bohrmaschinen und Sachen liegen, die jeder Mann brauchte. Denn auch der Opa hatte seit Menschengedenken jedes ALDI-Sonderangebot für Männer eingekauft und die Waren im Haus gesammelt.
»Was ist das denn?« Am Wohnzimmertisch zwischen den Eichenmöbeln musterte ihn die Oma, die gerade Kaffee und Apfelstrudel auf dem geblümten Geschirr servierte, skeptisch. Sie hatte sein Tattoo am Oberarm im Visier. Hatte Mom nicht gesagt, Oma brauche wegen des Diabetes regelmäßig Spritzen, sehe nicht mehr richtig und sei mehr oder weniger halb blind? Dabei hatte sie nicht mal eine Brille auf! Er hatte sich nur kurz geräkelt, und unter dem Ärmel des T-Shirts war die Körperzeichnung herausgelugt. Der Oma fiel auf, was sowohl Mom wie auch Dad entgangen war – sein Besuch im Tattoo-Studio vor zwei Wochen.
»Das ist eine Tätowierung, Oma, das hab ich mir machen lassen –«
»Du wirst doch nicht so blöd sein und dir auch noch den Namen eines Fräuleins, die man heute nicht mehr so nennen darf, da hinschreiben lassen?«, unterbrach ihn Oma und fügte, ohne eine Antwort abzuwarten, hinzu: »Du bist jung, Vincent, aber du bist klug. Ein wenig Weitblick musst schon haben! Ihr jungen Leute heiratet ja heute nicht mehr so schnell und wechselt ständig die Freudinnen. Da können der liebe Gott und ich nun auch nichts dagegen machen. Aber sei doch nicht so blöd, dich mit einer Tätowierung nur auf eine festzulegen!«
Wie? Hatte Mom nicht mehrmals erklärt, die Oma betrachte katholisch »reaktionär« außerehelichen Sex als Sünde, und ohne ein Heiratsversprechen bräuchte er ihr gar keine Freundin vorzustellen? Dabei gab es noch nicht mal ein Fräulein in Sichtweite, nicht mal ganz entfernt außer Sicht. Und schon gar nicht im Bett.
»Oma!« Vincent zog den Ärmel des T-Shirts zurück und zeigte Mathilde seinen Bizeps. »Und?«
Aufmerksam betrachtete Mathilde seine Körperzeichnung. »Aha, eine Rose, gar nicht so schlecht. Rosen waren schon immer die Königinnen unter den Blumen. Also, Hauptsache kein Name!«
Vincent griff zum Zucker und zum Milchkännchen, um sich den Kaffee in der Blümchentasse anzurühren.
»Das ist Kondensmilch«, erklärte Oma.
»Was ist Kondensmilch?«
Die Oma lachte auf. »Hab ich es doch gewusst, dass ich dich warnen muss. Also keine Kuhmilch, die hab ich nicht da. Franziska schimpft immer wie ein Rohrspatz, dass der Kaffee damit so scheußlich schmeckt.«
Vincent beschloss, diese Kondensmilch, was immer das war, einfach mal auszuprobieren. Er hatte schließlich auch schon die laktosefreie Packung Milch, die Dad versehentlich gekauft hatte, überlebt. Seither hatte Vincent ein tieferes Verständnis für Depressionen bei Allergikern sowie ein tieferes Verständnis für Probleme anderer auf der Welt und war noch erwachsener geworden.
Und doch kam sich Vincent dabei albern vor. Erwachsen sein hatte nun wirklich nicht in erster Linie damit zu tun, bei der Oma eine sogenannte Kondensmilch in den Kaffee zu schütten und sich an den laktosefreien Milcheinkauf von Dad zu erinnern. Vincent rührte kurz versonnen in der Tasse. Erwachsen werden hatte doch vor allem auch damit zu tun, sich der Realität zu stellen und nicht mehr zu Ganscha zu flüchten. Er sollte mit dem Kiffen aufhören. Also vielleicht nicht ganz, aber wenigstens mal für eine ganze Woche.
»Es geht mich ja nichts an«, meinte die Oma. »Aber du siehst nicht gerade glücklich aus. Wenn es dir nicht so gut geht, kannst du mir ruhig alles sagen. Ich ratsche nichts weiter.« Liebevoll blickte ihn Mathilde an.
Er antwortete nicht.
»In deinem Alter gibt es drei Möglichkeiten«, fuhr sie unbeirrt fort. »Entweder du hast gehörigen Liebeskummer, oder du säufst wie ein Loch, nein, warte, ihr Jungen hascht doch heute alle … oder du hast den falschen Beruf. Aber das wissen wir ja schon, dass dir die Lehre nicht gefallen hat, deshalb studierst du ja jetzt.« Mathildes Augen blitzten forschend.
»Oma!«, entfuhr es Vincent ehrlich bewundernd. »Das bringt es genau auf den Punkt! Also ähm … die verschiedenen Möglichkeiten.« Seine Kifferei ging die Oma nichts an. Sie würde sich nur Sorgen machen. »Aber vorerst mach ich erst einmal das Abitur nach und studiere noch nicht«, erklärte er.
Mathilde grinste triumphierend. »Hab ich also ins Schwarze getroffen. Die alten Weiber wissen halt manchmal doch was! Und vor allem wissen sie, dass ein Apfelstrudel gegen jeden Kummer dieser Art hilft. Lang zu! Ein gefüllter Magen ist die Grundlage einer gesunden Seele!«
Zehn Minuten später konnte die Oma die blödesten Fragen zum Handy stellen, und Vincent war nicht genervt. Im Gegenteil, es machte ihm Spaß, ihr zu erklären, was eine SMS war, ihr ein Telefonbuch auf dem Seniorenhandy einzurichten und ihr zu erläutern, dass die grüne Taste zum Auflegen diente. Er machte ihr sogar das Internet schmackhaft: Da könne sie alles bestellen, das sei wie ein riesiges Versandhaus. »Neckermann-Versand?«, fragte Oma begeistert. Hatte Vincent noch nie gehört, aber den Laden gab es tatsächlich. Sie müssten jetzt nur noch warten, bis ALDI-Talk die kleinste Flatrate freigeschaltet hatte.
Eine weitere Stunde später galt der Deal: Vincent würde Mathilde einen Computer besorgen, für sie ein »Internetversandhaus einrichten« und sie überhaupt öfter besuchen, zu Arztterminen oder den Kirchenbesuchen den Chauffeur geben, schwere Einkäufe erledigen oder auch mal Glühbirnen im Haus austauschen. Im Gegenzug überließ sie ihm den alten Passat von Opa, der in der Garage nur vor sich hin gammelte – und er könne sich alles aus dem Haus für seine erste eigene Wohnung, also dieses Wohngemeinschaftszimmer, mitnehmen, was er bräuchte.
Dabei hatte Vincent zunächst widersprochen. In der Stadt bräuchte er doch kein Auto und schon gar keinen so großen Wagen, er würde alles mit dem Fahrrad und den Öffis erledigen. Auch Dad fand es ja immer bescheuert, in der Stadt mit einem Auto die Luft zu verpesten.
»Papperlapapp.« Oma lächelte. »Dann lernst ein wunderbares Fräulein kennen, und womit willst du sie beeindrucken? Gut, du siehst wirklich sehr gut aus mit dem roten Bart und den lockigen Haaren. Aber das Aussehen ist bei uns Frauen zweitrangig, auch wenn wir das nicht zugeben können.«
Etwas baff wartete Vincent darauf, was die Oma sonst noch so von sich geben würde. Sie legte die Schürze ab, strich sich den Rock zurecht und ermahnte ihn, aufzupassen, weil die Kaffeetasse mit der scheußlich schmeckenden Kondensmilch auf die Tischdecke tropfte. »Frauen wollen jemanden, der notfalls sie und die Familie gut versorgen kann, Emanzipation hin oder her. Dazu brauchst eine gescheite Ausbildung. Und ein gescheiter Wagen dazu macht dich attraktiv für die Fräuleins, es ist doch immer die selbe alte Geschichte …«
»Oma, mit dem Passat beeindrucke ich keine! Und die Versicherung … ich hab nicht das Geld.«
»Ach, das Geld! Das hab ich vergessen. Natürlich. Aber mach dir keine Sorgen, ich bezahle. Lief ja bisher auch immer mit der Versicherung weiter, obwohl keiner mehr das Auto gefahren hat. Und unterschätz den Passat nicht. Der ist doch schon ein Oldtimer und kann damit beeindrucken. Komm schon, nimm ihn!«
Unter den »gardinenzuckenden Blicken« – so die Oma – der Meierhubers ging Vincent zur Garage. Er wollte Mathilde mit dem Passat in die Mittwochsabendmesse zur Kirche fahren, um selbst damit wieder nach München zurückzukehren. Doch der Wagen sprang nicht an. Kein Mucks. Mist! Klar, die Batterie war leer! Wie lange hatte der Wagen jetzt so gestanden? Drei Jahre seit Opas Tod?
»Die Batterie ist leer«, bemerkte der Meierhuber, der urplötzlich wieder dastand – also »urplötzlich«, nachdem die Oma das Hoftor geöffnet hatte.
»Wir können die Mathilde aber auch gern mit zur Messe mitnehmen«, ergänzte seine Frau, »dann hast keine Umstände.«
Was die nicht sagten! Genervt ging Vincent noch einmal ins Haus zurück, um den Fahrzeugschein zu suchen, weil der weder im Handschuhfach lag noch in der Sonnenblende steckte. Und den brauchte er vielleicht für den Einbau einer neuen Batterie. Doch als er wieder aus dem Haus kam, hatte der Meierhuber schon ein Starthilfekabel von seinem nicht minder betagten Benz zu Opas Passat gelegt und forderte ihn auf, den Wagen zu starten, damit sich die Batterie wieder aufladen konnte. Die Oma setzte sich auf den Beifahrersitz und raunte ihm zu: »Nimm das an. Wir sind hier auf dem Land, also vielmehr in der Kleinstadt, da sind wir aufeinander angewiesen. Da muss man auch solche Leute wie die Meierhubers in Kauf nehmen. Die haben auch Vorteile, die kümmern sich darum, dass mir keiner nachts was über die Rübe knallt, als Witwe so allein im Haus, oder dass jetzt dein Passat wieder läuft«, erklärte sie.
Auf dem Weg zur Kirche begann Vincent die Oma bei ihren Erläuterungen zum Kleinstadtleben – wie »enger Horizont, aber hilfsbereit« – regelrecht zu bewundern. Die konnte sich und ihre eigene Situation sogar von außen sehen und einschätzen. Was hatte er mit Kumpels schon Debatten über Stadt – Land oder Berlin – München geführt! Aber alle hatten immer nur das bessere Leben in der Stadt, auf dem Land, in München oder Berlin als das Beste überhaupt erklärt und nicht verschiedene Vor- und Nachteile erwogen.
»München ist doch ein Kaff!«
»Berlin ist nur vergammelt und gar nicht cool!«
»In der Stadt lebt man zur eigenen Unterhaltung. Auf dem Land zur Unterhaltung anderer«, stellte die Oma beiläufig fest, und diese unaufgeregte Weisheit feierte er. Keiner hatte mal ausgeführt, warum eigentlich München ein Kaff sei oder Berlin die einzige Großstadt Deutschlands. Niemand hatte überlegt, was da oder dort das Leben gut oder schlecht machte. Es ging eigentlich immer nur darum, die eigene Meinung bestätigt zu kriegen. Auch Mom und Dad konnten nicht diskutieren und Argumente austauschen, sondern wollten nur hören, das der andere die eigene Meinung bejubelte. Und offen sprachen die sowieso kein heikles Thema an. Also jedenfalls nicht vor ihm oder Emma. Und sogar beim Thema »Wo soll denn nun der neue Staubsauger hinkommen?« endete jede »Diskussion« mit einem: »Darüber sollten wir uns jetzt nicht streiten.« Woraufhin Mom den Staubsauger in den Abstellschrank stellte und Dad ihn später wieder in die Badezimmerecke verfrachtete.
Nachdem er Oma vor der Kirche abgesetzt hatte, organisierte diese noch einen Typen, der den Fiat zurück nach München bringen sollte, weil dieser ohnehin morgen dorthin müsse. Und Vincent fuhr mit dem Gedanken, dass die Oma die einzige Erwachsene in der Familie sei, da sie über den Tellerrand des eigenen Lebens hinausblicken und größere Zusammenhängen begreifen konnte, zurück nach München und freute sich jetzt erst so richtig über das unverhoffte Geschenk eines eigenen Autos.
Irgendwo auf der Autobahn zwischen Kaff »Land« und Kaff »München« und entferntes Kaff »Berlin« beschloss er, ab sofort und zwar radikal für ein ganzes Jahr mit dem Kiffen aufzuhören. Das musste er jetzt durchziehen. Das musste echt sein, und sei es zu dem Preis, den jede bescheuerte Suchtberatungstante in den Schulen so aufzählte: Grundprobleme anpacken, notfalls den Freundeskreis wechseln und neue Aktivitäten suchen – na, eine neue Aktivität hatte er jetzt ja ohnehin schon gefunden: sich um die Oma kümmern. Guter Plan – das Kiffen aufhören. Nur heute Abend noch einmal, dann aber wirklich! Denn eins hatte er in Mathe gelernt – geht es zu leicht, ist es definitiv falsch.
Emma
Und hier, sehen Sie – alles da. Herd. Spüle, Kühlschrank.« Emma versuchte, nicht den Eindruck zu erwecken, abgehetzt mit dem Fahrrad auf die letzte Minute hier aufgeschlagen zu sein. Möglichst unauffällig zupfte sie sich die unter dem Fahrradhelm zerzausten Haare zurecht.
Ihr Gegenüber, der aalglatte Zwerg, scherte sich nicht um seine ungepflegten Haare. Ein Typ so um die vierzig Jahre. Er zeigte gelangweilt auf die Küchenzeile im Miniappartement, ehe er sich wieder seinem Handy zuwendete, das gebrummt hatte, und tippte eifrig.
830 Euro für nicht mal 30 Quadratmeter! Im Kühlschrank waren die Fächer herausgebrochen, der Herd bestand aus zwei Kochplatten, der Spülenrand in der Arbeitsplatte sah verdammt nach Schimmel aus. Dazu, vor allem: nur ein kleines Fenster im ganzen Raum. Kein Lift. Fünfter Stock ohne Balkon. Wie sollte Leo da morgens gemütlich seine Zigarette zum Kaffee rauchen können? Die genoss er doch vor dem Duschen immer so. Fünf Stockwerke mit der Kaffeetasse in der Hand an den Leuten, die er sicherlich nach ihrem ersten Eindruck im Haus als »ranzige Assis« erachten würde, vorbeigehen, im Hinterhof qualmen und dann wieder zu ihr hochkommen. Turnte ihn das nicht komplett ab, bei ihr zu übernachten?
Diese »Anabolikafresse«, wie sie den Vermieter despektierlich innerlich nannte, starrte auf ihre Brüste – ob jetzt geistesabwesend oder schamlos offen, wusste sie nicht. Emma drehte sich um und ging noch einmal ins Badezimmer. Am Duschrand, da gab es keinen Zweifel wie bei der Arbeitsplatte, drang Schimmel aus den Silikonfugen. Und für diese Bude 830 Euro? Das hieß, zu dem Geld, das sie von den Eltern fürs Studium bekam, müsste sie noch zwei Tage pro Woche arbeiten gehen, um den Rest zu finanzieren. Aber wie, bei dem Praktikum ab nächster Woche und den Vorlesungen, die doch auch im kommenden Semester bestimmt auf alle fünf Werktage verteilt waren? Da blieb nur Gastronomie abends in die Nacht hinein. Das hieß dann wiederum, dass sie mit Leo an diesen zwei Abenden sowieso nicht zusammen sein könnte.
»Wär ja schön mit dir, aber bei deinen Eltern, he, das haut sich nicht!«, hatte Leo schon zuvor einmal gesagt, nachdem sie miteinander geschlafen hatten und er nicht ins Bad konnte, weil die Mama dort mit der Wäsche zugange war. Seither hatte er sich nur noch spärlich über WhatsApp gemeldet. Klar, Leo hatte ein Problem mit einem einundzwanzigjährigen Mädchen, das noch die Eltern im Gepäck hatte. Und dann heute der Super-GAU. Papa aufdringlich an der Badezimmertür, ob Leo Tee wolle. Wer steht schon morgens gern neben einer Frau auf, deren Papa oder Mama unverhofft auftauchen und irgendwelche blöden Fragen stellen wie: »Wann hast du heute Vorlesung?« Und nicht mal mehr Vincent war da, um alles aufzulockern. Im Gegenteil, nach dem Auszug des Bruders stürzten sich die Alten nur noch mehr auf sie – und Leo. Sie musste da raus.
Sie musste unter allen Umständen eine eigene Wohnung oder ein WG-Zimmer kriegen. Unter allen Umständen. Sie versaute sich doch sonst die Beziehung. Aber ein WG-Zimmer zu finden, dauerte ewig, wie sie von Vincent wusste. Und Vincent hatte dabei noch diesen einnehmenden Charme, der so schüchternen Menschen wie ihr nicht in die Wiege gelegt worden war.
»Ich geh jetzt feiern, genieß du den Abend hier«, hatte Leo vorletzte Woche mit einem süffisanten Blick auf ihre Anatomiebücher bemerkt, nachdem Mom gekocht hatte, alle zusammen zu Abend gegessen hatten, sie sich in ihr Zimmer zurückgezogen hatte und ihr nicht mehr nach ausgehen zumute gewesen war. Im Gegensatz zu Leos Fach Ethnologie, für das er keine Praktika brauchte und bei dem sich offenbar alle Termine aufschieben ließen, musste sie sich jetzt schon auf den Stoff vom nächsten Semester vorbereiten, weil sie wegen des Praktikums Kurse versäumen würde. Nein, an ihre mangelnde Vorbereitung wegen der Wohnungssuche sollte sie jetzt gar nicht erst denken, sondern sich hier und jetzt entscheiden, ob sie diese Bude zu diesem völlig überzogenen Preis nehmen sollte und also auf die Tube drücken musste und den Vermieter von sich überzeugen – oder ihm ins Gesicht sagen, wie unverschämt es sei, das Appartement zu diesem Preis anzubieten.
Ha, als könnte ausgerechnet sie jemandem so etwas ins Gesicht sagen. Das blieb so oder so ein frommer Wunsch. Sie könnte einfach auch gehen – es hing nur davon ab, ob sie die Wohnung nun wollte oder nicht. Aber sie musste sie wollen, es gab keine andere Möglichkeit auf dem Münchner Wohnungsmarkt. Es war ganz einfach so: Entweder sie blieb daheim wohnen und konnte dadurch die Zeit und Energie für das Studium sparen, um wirklich zu den Besten zu zählen. Oder sie nahm eine überteuerte Wohnung, musste nebenher arbeiten und fand bei all dem keine Zeit mehr, sich wirklich ganz in die Medizin zu vertiefen. Entweder sie blieb die »Streberin«, als die Leo sie schon in der Schule gesehen hatte – oder es war abzusehen, dass sie den Mann mit den schönsten braunen Augen, den zärtlichsten Berührungen und den lebhaftesten Ideen verlieren würde. Denn wer mochte schon mit so einem Ehrgeizling in weiblicher Form in der Elternwohnung zusammen seine Zeit verbringen? Niemand anderer als Leo konnte ihr – dezent, aber deutlich – auf den Kopf zusagen, dass sie wunderbar weiblich soft wäre, aber das irgendwie auch ein »aufdringliches Helfersyndrom« war. Studierte sie deshalb Medizin? War sie genauso konfliktscheu wie Mom, die jede Auseinandersetzung mit Dad vermied?
»Darf ich Sie zum Essen einladen?«, fragte die Anabolikafresse und glotzte wieder unverhohlen auf ihre Brüste.
»Nur wenn Sie nicht auf meine Titten starren und ich die Wohnung auch billiger kriege!«, hörte sich Emma sagen. Wow! Unglaublich, wie frech sie sein konnte. Hatte das wirklich sie selbst gesagt?
Der Typ lachte. »Super. Punktsieg. Wir gehen essen, und Sie kriegen die Wohnung. 750 Euro warm.«
Zwei Stunden und drei Gläser Wein später fixierte der Typ im Fischlokal wieder ihre Brüste, bemerkte dies aber peinlich berührt selbst und fragte sie lächelnd: »Und nun verraten Sie mir mal, warum eine so schöne, junge, kluge Frau wie Sie diesen exorbitanten Preis für so eine Wohnung akzeptiert. Wo liegt Ihr Problem?«
Emma blickte ihn an, Tränen schossen ihr in die Augen, sie sprang vom Stuhl auf.
»Sie kriegen die Wohnung, keine Sorge!«, beruhigte sie der Kerl. »Das war fürsorglich gefragt, ausnahmsweise von einem Immobilienhai wie mir! Und Sie müssen natürlich nicht darauf antworten!«
Sie setzte sich wieder, trank aber nur noch schnell das Glas Wein leer und rannte danach in die Nacht hinaus, an der nächsten Bushaltestelle vorbei, zurück in Richtung der elterlichen Wohnung. An der übernächsten Busstation hielt sie inne. Sie konnte doch jetzt nicht wieder zu Mami und Papi laufen. So wie immer schon. Immer schon in ihrem einundzwanzigjährigen Leben. Aber wo sollte sie hin, bis sie eine eigene Wohnung hatte?
Der Bus einer ihr unbekannten Nachtlinie stoppte am Wartehäuschen.
Emma stieg einfach ein. Ohne Fahrkarte. Ohne Fahrkarte? Sie wurde nervös, auch wenn so etwas in Anbetracht ihrer Lebenslage eigentlich scheißegal war. Und wenn sie beim Schwarzfahren erwischt würde? Emma fiel ein, dass Vincent immer erzählt hatte, dass nach 21 Uhr in Münchner Bussen keine Kontrolleure mehr unterwegs wären und es nur darauf ankäme, sich an dem Fahrer vorbeizuschleichen. Also lehnte sie sich im Sitz des öffentlichen Verkehrsmittels zurück. Am Buslinienplan las sie ab, wo sie umsteigen konnte. Es würde noch dauern, aber daheim bliebe dann sogar noch Zeit, in die Medizinbücher zu gucken. Denn falls sie die Wohnung wirklich bekam, funkte auch noch ein Umzug in die Vorbereitung zu den Prüfungen dazwischen.
Das Licht des Vollmonds brach sich in den schlecht geputzten Scheiben des Busses. Wieso genoss sie nicht einfach den Blick auf das Gestirn, sondern bemerkte das mies gereinigte Fenster? Ja, sie war für eine klare Optik, einen geraden Weg und deutliche Ansagen. Aber das Leben ging anders. Mit Kerlen wie Vincent, Leo oder diesem Vermietertypen, die auch mal eine falsche Abzweigung nahmen und Quatsch machten. Sie hingegen war doch so langweilig wie Dad, der zudem behauptete, dass zu viel Job nur unglücklich mache. Aber war Dad vielleicht einfach nur gefrustet, weil er in einer Midlife-Crisis steckte? Was ließ sie sich von solchen Rentner-Ansichten beeinflussen? Die Work-Life-Balance musste sie für ihr eigenes Lebens schon selbst herausfinden. Sie sollte leben, denn die meisten Menschen existierten doch nur. Aber verdammt! Was dachte sie da schon wieder? Sie sollte sich endlich einfach nur noch treiben lassen und nichts, nichts, nichts mehr denken! Im Leben konnte frau nie klar auf Sicht fahren – das Leben bestand vielmehr aus mies gereinigten Scheiben, durch die frau souverän hindurchblicken musste, um den Himmel zu sehen.