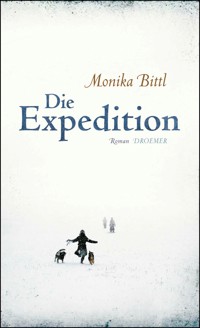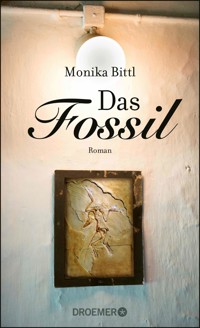9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Spiegel-Bestsellerautorin Monika Bittl begeistert nach ihren beiden großen Bestsellern "Ich hatte mich jünger in Erinnerung" und "Ich will so bleiben, wie ich war" mit einem heiteren Roman über drei höchst unterschiedliche Frauen am Tiefpunkt ihres Lebens und ihren Weg aus der Lebenskrise, über die Kraft der Gemeinsamkeit, das Suchen und Finden der Liebe und die irrwitzige Schönheit des Lebens! Stress im Beruf, Existenzängste, Liebeskummer, schwere Krankheit, finanzieller Ruin - die Anforderungen, die das Leben beständig an Jessy, Charlotte und Wilma stellt, die Sorgen und Nöte im Alltag - es ist einfach zu viel. Es fehlt kein Tropfen mehr, der das Fass zum überlaufen bringt, das Fass ist schon längst leer. Die Lebenskrise perfekt. Und jetzt ist Schluss. Denn nun sind die drei Frauen fest entschlossen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Felsenfest. Wirklich! Nur irgendwie geht dabei ständig etwas schief. Als sie eines Abends beschließen, von einer Brücke zu springen, stellen sie einhellig fest, dass es da viel zu tief runter geht … Folgerichtig wird die nächste Tankstelle geentert, um sich erst mal ordentlich Mut anzutrinken. Dabei gerät das trotzige Trio mitten in einen dilettantischen Raubüberfall. Ein Wink des Schicksals? Kurz entschlossen bieten die Frauen sich den beiden Möchtegern-Gangstern als Geiseln an, und so nimmt eine höchst vergnügliche Reise zurück ins Leben ihren Lauf, bei der diese fünf liebenswerten Menschen lernen, dem Leben die Stirn zu bieten, Liebe zuzulassen und achtsamer mit sich, dem Leben und den Mitmenschen umzugehen: Gemeinsam sind wir stark! Das Leben ist schön! Ein humorvoller Roman, der den Weg aus der Lebenskrise beschreibt und den Wert von Freundschaft und Gemeinschaft feiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Monika Bittl
Man muss auch mal loslassen können
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Spiegel-Bestsellerautorin Monika Bittl begeistert nach ihren beiden großen Bestsellern »Ich hatte mich jünger in Erinnerung« und »Ich will so bleiben, wie ich war« mit einem heiteren Roman über drei höchst unterschiedliche Frauen am Tiefpunkt ihres Lebens und ihren Weg aus der Lebenskrise, über die Kraft der Gemeinsamkeit, das Suchen und Finden der Liebe und die irrwitzige Schönheit des Lebens!
Stress im Beruf, Existenzängste, Liebeskummer, schwere Krankheit, finanzieller Ruin – die Anforderungen, die das Leben beständig an Jessy, Charlotte und Wilma stellt, die Sorgen und Nöte im Alltag – es ist einfach zu viel. Es fehlt kein Tropfen mehr, der das Fass zum überlaufen bringt, das Fass ist schon längst leer. Die Lebenskrise perfekt. Und jetzt ist Schluss. Denn nun sind die drei Frauen fest entschlossen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Felsenfest. Wirklich! Nur irgendwie geht dabei ständig etwas schief. Als sie eines Abends beschließen, von einer Brücke zu springen, stellen sie einhellig fest, dass es da viel zu tief runter geht …
Folgerichtig wird die nächste Tankstelle geentert, um sich erst mal ordentlich Mut anzutrinken. Dabei gerät das trotzige Trio mitten in einen dilettantischen Raubüberfall. Ein Wink des Schicksals? Kurz entschlossen bieten die Frauen sich den beiden Möchtegern-Gangstern als Geiseln an, und so nimmt eine höchst vergnügliche Reise zurück ins Leben ihren Lauf, bei der diese fünf liebenswerten Menschen lernen, dem Leben die Stirn zu bieten, Liebe zuzulassen und achtsamer mit sich, dem Leben und den Mitmenschen umzugehen: Gemeinsam sind wir stark! Das Leben ist schön!
Ein humorvoller Roman, der den Weg aus der Lebenskrise beschreibt und den Wert von Freundschaft und Gemeinschaft feiert.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Charlotte
Jessy
Wilma
Charlotte
Wilma
Jessy
Charlotte
Wilma
Jessy
Ralle
Moritz
Charlotte
Wilma
Ralle
Moritz
Jessy
Ralle
Charlotte
Wilma
Moritz
Jessy
Ralle
Charlotte
Moritz
Wilma
Ralle
Jessy
Charlotte
Moritz
Wilma
Jessy
Moritz
Charlotte
Ralle
Wilma
Moritz
Jessy
Ralle
Charlotte
Moritz
Jessy
Wilma
Charlotte
Wilma
Charlotte
Jessy
Moritz
Wilma
Charlotte
Wilma
Ralle
Charlotte
Jessy
Zitate und deren Quellen
Für Franz
Nichts im Leben macht unglücklicher, als sich selbst zu ernst zu nehmen.
Charlotte
Charlotte verschob den Laptop etwas nach rechts auf dem Küchentisch, der zugleich ihr Schreibtisch war, und kniff die Augen zusammen, um die Buchstaben auf dem Bildschirm besser erkennen zu können. Sie starrte auf das Deckblatt des Romans und stellte wieder alles infrage. War »Julia« wirklich der richtige Name für die Hauptfigur und zugleich den Titel? Klang Julia nicht zu leicht, weil das zu sehr mit dem Sommermonat »Juli« konnotiert war? Erinnerte es vielleicht nicht auch zu sehr an »Romeo und Julia«, also eine Liebesgeschichte? Und hieß mittlerweile nicht auch jede zweite Aldi-Verkäuferin mit Vornamen »Julia«? Wie um Himmels willen konnte ein Textwerk zur Kunst werden, wenn der Name der Hauptfigur nicht schon auf die existenzielle Tiefe und Wahrheit verwies? Denn eins war so klar wie sonst nichts: Nur die Kunst verlieh dem Leben eine Sinnhaftigkeit, und Kunst bestand nun mal nicht aus einer Komödie, sondern im Aufdecken der tiefen existenziellen Wahrheit der Einsamkeit des Individuums. Literatur musste – ob sie wollte oder nicht – sich sperrig dem Vergnügen entziehen, denn sonst übertünchte sie die existenzielle Einsamkeit, die nur die Literatur beschreiben konnte und in die sie sich doch begeben musste, um Kunst zu erzeugen. Schwer zu sagen, warum Aristoteles und andere Dramentheoretiker auch der Komödie so eine Bedeutung zugestanden. Waren sie vielleicht nicht mutig genug, im letzten Moment noch einmal die Hauptfigur und den Titel umzubenennen?
»Was für ein Unsinn!«, dachte Charlotte über sich und ihre abschweifenden Gedanken und schob den Laptop noch einmal ein Stück weiter nach rechts auf dem Tisch. Aristoteles & Co. waren nicht Hinz und Kunz. Diese würden schon ihre Gründe dafür haben, auch das Vergnügen, also die Komödie wertzuschätzen. Charlotte rückte mit dem Stuhl ein wenig weiter nach rechts, um der Mittagssonne, die immer stärker in den Raum drängte, auszuweichen. Dabei verschob sie den Laptop versehentlich mit dem Arm noch ein Stück und konnte ihn gerade noch auffangen, bevor er auf dem Boden aufschlug. Erschrocken umklammerte Charlotte das Gerät. Sie musste unbedingt eine Sicherheitskopie machen! Hatte sie das nicht schon vor einer Woche gedacht? War sie da nicht auch schon der Mittagssonne ausgewichen, bis der Laptop fast vom Tisch gefallen wäre – um sich erst danach daran zu erinnern, dass sie einfach nur einen Vorhang zuziehen musste, damit sie nicht mehr geblendet wurde? Wie blöd war sie eigentlich, immer und immer wieder zu vergessen, dass es ein ganz einfaches Mittel gegen diese aufdringlichen Sonnenstrahlen im Mai gab? Aber war überhaupt wirklich schon Mai? Und welcher Wochentag war heute? Der Rechner zeigte Donnerstag, 4. Mai, 12.30 Uhr an. Immer öfter verlor sie das Zeitgefühl, wenn sie tagelang nicht die Wohnung verließ. Sie sollte sich duschen und anziehen und so tun, als ob alles normal wäre und sie nicht seit vier Jahren wesentlich mehr in diesem Stoff als im realen Leben hauste. »Hauste«? Passte dieser Begriff? Egal. Viel wichtiger war die Frage, ob der Titel »Julia« passte.
Es klingelte an der Tür. Charlotte zuckte zusammen und schüttete beim Aufstehen die Kaffeetasse, die seit acht Uhr auf dem Tisch stand und deren restlicher Inhalt nun erkaltet war, um. Sie starrte auf die dunkle Flüssigkeit, die auf den Boden tropfte. »Sicherheitskopie!«, schoss Charlotte in den Kopf. Sie musste sofort eine Sicherheitskopie machen! Man stelle sich nur vor, der Kaffee wäre auf den Laptop gelaufen und hätte die Daten unbrauchbar gemacht!
Es klingelte erneut. Charlotte griff zu ihrem Morgenmantel, warf ihn über und öffnete die Wohnungstüre.
»Hier!«, sagte ein mürrischer Postbote, der auf dem Treppenweg zum dritten Stock offenbar etwas außer Atem geraten war, und hielt ihr ein Bündel Briefe hin.
Charlotte starrte ihn an. Sollte sie nach seinem Aussehen nicht eine Nebenfigur noch einmal neu beschreiben?
»Da!« Der Briefträger streckte immer noch die Hände mit der Post aus. »Vielen Dank für die Umstände, die Sie sich machen!«, blaffte er sie an.
»Warum?«, fragte Charlotte. Was meinte er?
Der Postbote schüttelte den Kopf, schlug die freie Hand gegen die Stirn und blickte sie mitleidig an. Langsam – und als ob sie geistig zurückgeblieben sei – erklärte er: »Der Briefkasten ist voll, da passt nichts mehr hinein. Deshalb bin ich jetzt extra die vielen Treppen raufgestiegen!«
»Ach so!« War das Erscheinen des Briefträgers vor ihrer Tür nicht ein Wink des Schicksals, das Aussehen der Nebenfigur noch einmal neu zu beschreiben?
»Hier«, wiederholte der Postbote und streckte ihr den Pack Briefe noch mal entgegen. »Der Briefkasten quillt über«, wiederholte er wieder so langsam, als könne sie nur im Schritttempo denken und verstehen.
»Danke!« Charlotte nahm den Pack mit kleinen und großen Kuverts entgegen. »Entschuldigen Sie bitte die Umstände«, erklärte sie peinlich berührt, »ich hab vergessen, im Briefkasten nachzuschauen! Ich arbeite gerade so viel.«
»Vergessen« und »gerade« traf den Sachverhalt nicht genau. Da war vermutlich sehr viel Verdrängung im Spiel, denn im Briefkasten lagen schon seit Jahren keine angenehmen Schreiben mehr, sondern nur noch Rechnungen oder bestenfalls Werbung. Wenn sie in den vergangenen Wochen mal schnell Lebensmittel einkaufen gegangen war, hatte sie immer vorgehabt, am Rückweg in den Briefkasten zu schauen, dann aber nicht mehr daran gedacht.
Ihr Erspartes war fast vollständig aufgebraucht, vielleicht war sogar die Miete nicht mehr abbuchbar gewesen – und »Julia« immer noch nicht fertig, obwohl sie doch schon vor einem Jahr den letzten Satz und »Ende« hatte schreiben wollen und der einzige Verlag, der Interesse an dem Stoff bekundet hatte, vermutlich längst nicht mehr auf das Manuskript wartete.
Verloren stand Charlotte im Bademantel in ihrem Flur, bemerkte, dass der Postbote wieder verschwunden war, und begriff beim Anblick der Briefe in der Hand plötzlich, dass »Julia« einfach nicht gut genug geworden war. Etwas, von dem sie nicht wusste, was es war, fehlte dem Stoff. Etwas stimmte von Grund auf nicht mit der Struktur, da konnte sie so viel an Namen, einzelnen Szenen oder Sätzen basteln, wie sie wollte. Die anderen Verlage und Agenten hatten schon ihren Grund gehabt, die erste Fassung, die sie vor zwei Jahren angeboten hatte, mit Standardabsagen abzulehnen. In der einzigen nicht vorformulierten Absage war von »blutleer« und »zu konstruiert« und »zu verkopft« die Rede gewesen. Und sie war nur deshalb jetzt immer noch nicht fertig und hatte fast alle Freundschaften, Termine und Briefe ignoriert, weil sie mit einer Fertigstellung und einer Abgabe nicht ein endgültiges Scheitern riskieren wollte. Charlotte starrte geistesabwesend ins Leere. Sollte das ein endgültiges künstlerisches Versagen bedeuten, nachdem sie sich vor vier Jahren bei ihrem vierzigsten Geburtstag die Freiheit genommen hatte, endlich einmal zuerst an sich und nicht an die Geschwister zu denken? Und mit jedem Monat und jedem Jahr mehr war »Julia« – falls das Werk wirklich so heißen sollte – zu einem Casino-Chip geworden, mit dem sie unbedingt gewinnen musste, denn sonst hätte sie alles verloren.
Sie brachte die Briefe zum Küchentisch und wunderte sich kurz, warum es so dunkel war – ach ja, sie hatte die Vorhänge zugezogen! Sie musste auch unbedingt an die Sicherungskopie denken. Aber erst einmal duschte sie sich und zog sich frische Wäsche an. Danach würde sie sich wieder dem Leben stellen in Form der Briefe, die zu öffnen waren. Sie musste einen Schlussstrich ziehen.
Während das Wasser beim Duschen über ihren Körper perlte, fiel ihr ein, dass sie zwar auch mit ihrem Musikstudium gescheitert war, aber jederzeit wieder in ihren gelernten Beruf als Maskenbildnerin zurückkehren könnte. Die Filmfirmen, deren Plakate sie regelmäßig an der Litfaßsäule gegenüber dem Supermarkt sah und für die sie so lange gearbeitet hatte, gab es doch noch, und sie hatte sich mit den Leuten stets – unüblich für den Film – gut verstanden.
Zum ersten Mal seit Wochen wählte Charlotte bewusst das schwarze Kleid zum Anziehen aus und streifte sich nicht achtlos das nächstbeste Stück über. Sie zog die Vorhänge zur Seite, setzte Kaffeewasser auf, schloss den Laptop und sah auf die Briefe. Kontoauszüge; eine Mitteilung vom Vermieter, dass demnächst neuere Rauchmelder installiert werden müssten; die kostenlose Broschüre der Bahn; ein dicker Umschlag mit der neuen Übersetzung von Madame Bovary – wie hatte sie vergessen können, dass sie das Buch bestellt hatte! Und ein kleines Kuvert von Dr. Vetter. Ach, der liebe, alte Dr. Vetter, der der beste Freund des Vaters gewesen war, schickte ihr einen altmodischen Brief! Oder stellte er doch eine Rechnung, wie sie gefordert und er empört abgelehnt hatte? Sie hatte sich ihm anvertraut, erklärt, dass sie die Krankenkasse mit Tricks gekündigt hatte, um Geld zu sparen für ein paar weitere Monate Arbeit an ihrem Roman. Zuvor hatte sie, die Weltmeisterin der Verdrängung, die Schwäche ihres Körpers nicht mehr ignorieren können, und war zu ihm gegangen, um sich von dem Internisten untersuchen zu lassen. Wie immer hatte ihr Dr. Vetter nach der Aufforderung, doch privat abzurechnen, scherzhaft erklärt, dass sie mit ihren 1,58 Meter und 45 Kilo als Kind gelten und damit unter die kostenlose Kinderbehandlung fallen würde. Doch dann hatte der Arzt besorgt ausgesehen. Er hatte etwas in ihrer Bauchspeicheldrüse entdeckt, etwas, das dort nicht hingehörte. Da andere, teurere Untersuchungen via Computertomografie oder Kernspin wegen ihrer versicherungstechnisch nicht ganz so optimalen Lage nicht infrage kamen, hatte ihr Dr. Vetter später bei einem »unkonventionellen Kollegen« Gewebe entnehmen lassen – nur zur Sicherheit, wie er sagte, denn »Ärzte müssen immer das Schlimmste ausschließen«. Sollte es Hinweise auf bösartige Veränderungen geben, wollte er sich bei ihr telefonisch melden – das musste nun auch schon fünf oder sechs oder gar acht Wochen her sein. Warum schrieb er ihr nun mit dem Praxisstempel auf dem Kuvert?
»Liebe Charlotte, bitte melden Sie sich umgehend bei mir. Ich kann Sie über Festnetz nicht erreichen (›dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar‹) und auch nicht über Ihr Handy. Das Ergebnis der Biopsie deutet leider auf Schlimmes hin. Die histologische Untersuchung nach Punktion sowie die Laborwerte lassen ein Pankreaskarzinom vermuten. Wir müssen sofort weitere Schritte einleiten. Bitte rufen Sie mich an. Ihr Dr. Vetter.«
Charlotte las den Brief mehrmals, aber ihr Kopf und ihr Körper arbeiteten sich nur am ersten Teil der Zeilen ab. Warum war sie nicht erreichbar gewesen? Stimmt, es war ewig her, dass ihr Telefon oder das Handy zuletzt geklingelt hatten! Sie hatte es darauf zurückgeführt, dass sie ihre sämtlichen sozialen Kontakte in den letzten Wochen und Monaten schwer vernachlässigt hatte. Aber über der Arbeit am Text war sie auch gar nicht auf die Idee gekommen, der Sache weiter nachzugehen. Sie nahm das Festnetztelefon in die Hand, um das Freizeichen zu prüfen. Beim Druck auf die grüne Taste geschah nichts. Aber war das nicht immer schon so gewesen? Sie wählte die Nummer der Schwester – nur ein Klacken kam, dann ein ungewöhnlicher Piepton. War die Telefonie abgeschaltet worden? Hatte sie die Rechnung nicht bezahlt? Aber nein, das konnte nicht sein, sie kam doch problemlos ins Internet, hatte heute Morgen noch online recherchiert, und Internet und Telefonie liefen über den gleichen Anbieter. Aber warum war sie auch über Handy nicht erreichbar? Charlotte suchte das Smartphone, fand es schließlich auf einer Ablage im Flur und stellte fest, dass der Akku leer war. Sie hatte das Smartphone hier – das musste auch schon Wochen her sein – gewohnheitsmäßig mit dem Ladekabel verbunden, aber nicht richtig eingesteckt. Charlotte drückte den Stecker fester, endlich erschien das Blitzsymbol für Aufladung. Na also! So unpraktisch war sie nun auch wieder nicht veranlagt – das Steckerproblem hatte sie sofort erkannt und gelöst! Blieb nur noch das Rätsel des Festnetzversagens. Charlotte lief zu Höchstformen auf, öffnete den Laptop und suchte nach der Seite, die ihr der Telekom-Typ bei der Installation gebookmarkt hatte. Darüber könnte sie mit einem Klick alle funktionierenden Verbindungen prüfen. Sie fand diese Seite jedoch nicht mehr, dachte wieder daran, dass sie dringendst eine Sicherungskopie von »Julia« machen müsste – falls der Name wirklich bliebe – und wollte schon zum Handy, das mittlerweile sicher ein wenig aufgeladen sein müsste, greifen, um bei der Telekom anzurufen und der Sache nachzugehen. Ja, das Smartphone hatte wieder zehn Prozent Akku. 14 entgangene Anrufe blinkten auf. Neun Nachrichten auf der Mailbox. Sollte sie diese noch abhören, bevor sie bei der Telekom anrief? Ja, denn ab heute wollte sie sich dem Leben wieder stellen. Das musste einfach sein, so ging es nicht mehr weiter.
Nein. Weder noch. Charlotte stand mit dem Smartphone in der Hand verloren im Flur herum. Da war noch etwas anderes. Der zweite Teil des Briefes von Dr. Vetter. Oder hatte sie den nur geträumt? Sie ging zurück zum Tisch und nahm das Schreiben des Internisten noch einmal zur Hand und las noch einmal. Und noch einmal. Und erneut.
Plötzlich lächelte sie über sich selbst. Sie fühlte sich wie die Hauptfigur in einem Groschenroman, von der es hieß: »Sie konnte es nicht glauben. Der Arzt musste sich irren. Da musste eine Verwechslung vorliegen. Wie lange hatte sie wohl noch zu leben?«
Charlotte war, als würde jemand anderer in ihr handeln – sie steckte das Handy wieder an das Netzteil, ging zum Laptop, benannte die Romandatei ohne großes Nachdenken in »JuliafinalFassung« um, holte einen Webstick aus der Schublade und zog eine Sicherheitskopie darauf. In ein paar Minuten erledigte sie alles, was sie Wochen aufgeschoben hatte.
Dann googelte sie »Pankreaskarzinom« und hielt sich dabei an ihr Motto, über Medizinisches nur ganz kurz nachzulesen, um Hypochondrie zu vermeiden und erst gar nicht auf die Idee einer tödlichen Krankheit zu kommen – was in diesem Fall aber nicht möglich war, denn es handelte sich nicht um einen Schnupfen, sondern um Krebs. Ein paar Zeilen genügten: Bauchspeicheldrüsenkrebs war einer der aggressivsten Tumore. Bemerkte man schon Symptome, so wie sie, standen die Heilungschancen äußerst schlecht.
Erst jetzt fiel ihr auf, dass das Kaffeewasser schon länger kochen musste. Sie nahm Filter, Pulver und goss auf. Bis auf diesen Brief war alles wie immer. Ihr Blick durchstreifte ihre Wohnküche mit der Ikea-Einrichtung und dem Schatz des 1947er Château d’Yquem im alten Küchenbüfett. Nie hatte sie ein Auge dafür gehabt, aber jetzt sah sie, wie verdreckt und verstaubt hier alles war: Krümel und Staubwolken auf dem Fußboden und vermutlich sogar klebrige Reste auf den Vorhangstangen. Sie musste putzen, alles sauber machen, so konnte sie die Wohnung nicht den Geschwistern, die alles ausräumen würden müssen, zurücklassen. Als sie damals, vor gut zwanzig Jahren, die Wohnung der Eltern geleert hatte, war es unerträglich gewesen, so frische Spuren von ihnen vorzufinden. Die Haare in der Bürste der Mutter, die verklebten Ohropax im Nachtkästchen des Vaters, das Lesezeichen im Fachbuch, die zwei Rotweinflecken vor dem Sofa im Wohnzimmer, die Joggingjacke im Wäschekorb, die noch nach Papas Schweiß roch – und der angebrochene Joghurt im Kühlschrank, in dem noch die Teelöffelspur erkennbar gewesen war.
Nichts davon durfte sie ihren Geschwistern antun. Diese mussten eine möglichst klinisch reine Wohnung vorfinden, wenn Charlotte schon nicht selbst in der Lage war, die Zimmer vor ihrem Ableben auszuräumen und aufzulösen, denn das wäre aufgefallen.
An diesem strahlenden Maitag wurde Charlotte innerhalb von Sekunden klar, dass es nur einen einzigen Weg für sie gab: Sie hatte die Pflicht, Hand an sich zu legen, um ihre Geschwister nicht ausbaden zu lassen, was sie selbst angerichtet hatte. Eine Krebstherapie ohne Krankenversicherung würde ein Vermögen und den Nächsten womöglich deren Zukunft kosten. Und das alles für eine Behandlung, die ohnehin nur geringste Aussichten auf Erfolg hatte.
So unentschlossen sie sonst die vergangenen Jahre gewesen war, so eindeutig stand ihr nun vor Augen, was zu tun war. Sie zog sich eine Jacke über, griff zum Schlüsselbund und steckte den Brief von Dr. Vetter und den Jean-Améry-Band in die Tasche. Draußen würde sie die Diagnose noch einmal lesen. Sie musste hier weg, aus dieser Wohnung, raus ins Freie. Wenigstens war sie heute schon früher als sonst geduscht und sogar auch noch einigermaßen gut angezogen.
Draußen im Park an der Lessingstraße zwitscherten die Amselmännchen laut, jetzt im Mai, auf der Suche nach einem Weibchen. Ein turtelndes Paar zog an ihr vorbei; eine Mutter versuchte ihre rund fünfjährige Tochter zu zähmen, die ständig auf Bäume klettern wollte; ein hagerer Typ, der nach Drogenabhängigkeit aussah, fragte sie nach einer Zigarette. So ging jeder seinem Leben nach. Sie aber hatte jetzt ihrem Tod nachzugehen. Nur wie? Philosophisch war alles klar. »Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Wo er ist, bin ich nicht, und wo ich bin, ist er nicht.« Epikur. Sinngemäß. Sie konnte den Denker nicht mehr wortwörtlich zitieren, denn das Altgriechische hatte sie seit der Schulzeit wieder verlernt. Aber war es denn möglich, nicht nur Altgriechisch, sondern auch das Weinen zu verlernen?
Charlotte saß auf der Parkbank und las noch einmal »Pankreaskarzinom«, also vulgo »Bauchspeicheldrüsenkrebs«. Was hatte sie in ihrem Leben schon geweint. Als Kind wegen aufgeschlagener Knie, als 19-Jährige, weil sie nicht auf Anhieb die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule bestanden hatte, wegen des Todes der Eltern, aus Liebeskummer, aber auch schon oft beim Lesen von Trakl, Rilke, Bachmann, Celan und sogar Goethe. Dabei – dessen war sich Charlotte sicher – hätte Weinen sie sehr erleichtert und die Anspannung abgebaut, eine Anspannung, unter der sie zweifellos stehen musste, auch wenn sich diese nicht zeigte.
Nicht nur Epikur, sondern auch Jean Améry mit seinem Hand an sich legen besaß zweifellos Gültigkeit: »Wer abspringt, ist nicht notwendigerweise dem Wahnsinn verfallen, ist nicht einmal unter allen Umständen ›gestört‹ oder ›verstört‹. Der Hang zum Freitod ist keine Krankheit, von der man geheilt werden muss wie von den Masern. … Der Freitod ist ein Privileg des Humanen.« Wie so oft war auch hier die Begrifflichkeit entscheidend. »Selbstmord« implizierte eine Gewalttat gegen das Leben. »Freitod« bezeichnete hingegen eine Entscheidung für oder wider das Dasein. Im philosophisch-literarisch-psychologischen Mainstream reflektierte das nur niemand mehr.
Aber warum hatte sie nur Améry und weder Rilke noch Trakl noch Celan eingesteckt, um die Gedichte hier lesen zu können? Der Lyrik hatte sie doch drei eigene Fächer im Bücherregal eingeräumt; nachdem sie sich ewig nicht entscheiden hatte können, ob sie die Bände nach Alphabet oder nach Sprache einordnen solle, war sie vor einem halben Jahr auf die Idee gekommen, nach Gattungen zu sortieren. Belletristik stand neben Sachbuch und Drama und Lyrik. Ganz oben thronten selbstverständlich die Werke von Gott Shakespeare.
»Was ist nun wirklich wichtig?«, fragte sich Charlotte plötzlich ganz ungewöhnlich pragmatisch, während sie auf der Parkbank saß. Wohnung putzen, noch einmal mit Dr. Vetter sprechen und wichtige Informationen sammeln – nein, nicht zu dieser scheußlichen Krankheit. Sie musste das »Wie« recherchieren, denn sie wusste nur zu gut um ihr praktisches Ungeschick. Sie entsprach eins zu eins dem Klischee einer verträumten Künstlerin. Sie hatte nicht nur in der Kunst versagt, sondern auch im Leben. Beim Sterben durfte sie auf keinen Fall noch einmal scheitern.
Googeln zu Möglichkeiten der »praktischen Umsetzung des Freitodes« schied deshalb aus. Sie hatte schon von Fällen gelesen, bei denen der Browserverlauf beobachtet worden war (wie sehr wurden sie eigentlich mittlerweile überwacht?) und die Lebensmüden deshalb in die Psychiatrie eingewiesen worden waren. Aber hatte sie nicht in der Zeit, als sie noch ausgegangen war, auf Toiletten immer wieder mal Telefonhinweise zu »Hilfe in Lebenskrisen« gesehen? Sie würde gleich noch in der Alten Kneipe vorbeischauen und nachsehen, denn zunehmend formte sich ein Plan in ihrem Kopf. Eine anonyme psychologische Beratung konnte sie bei geschickter Gesprächsführung für ihre eigentlichen Zwecke nutzen. Sie wollte herausfinden, welche Methode im wahrsten Sinne des Wortes todsicher war. Denn so wie sie sich kannte, würde ein Lokführer bei ihrem Anblick auf den Gleisen einen Herzinfarkt bekommen und den Zug schon weit vor ihr zum Stehen bringen. Oder einem Pflanzengift würde es ausgerechnet in dieser Saison an der nötigen Toxizität fehlen und deshalb würde es nicht wirken. Womöglich würde auch noch der Strick reißen, falls sie sich für Erhängen entschied. Keine dieser Pannen durfte sie den Geschwistern zumuten. Jedes Ungeschick wäre mehr als verantwortungslos.
Wie seltsam: Im Organisieren des Todes kehrten eine Energie und ein Lebenswille zurück, mit denen sie Bäume hätte ausreißen mögen. Jetzt, da es mit ihr vermutlich ziemlich schnell zu Ende ging, spürte sie über diese Aufgabe wieder eine lange nicht mehr empfundene Lebensfreude.
Charlotte kaufte im Vorbeigehen im Drogeriemarkt die qualitativ hochwertigsten Putzmittel ein, schenkte einem Penner das letzte Kleingeld aus ihrer Börse und wählte daheim mit dem Smartphone die Nummer von Dr. Vetter.
Sie war ruhig und gefasst. Sie war zu ruhig und zu sehr in der Spur. Während sie darauf wartete, dass Dr. Vetter abhob, dachte sie seelenruhig: »Ich hatte eh nicht vor, ewig zu leben.« Sollte sie sich das als Inschrift auf dem Grabstein wünschen? Nein! Denn ohne größeres Nachdenken und Suchen nach geeigneten Worten fiel Charlotte etwas Besseres ein. Der Steinmetz sollte in einer schönen, serifenlosen Typo meißeln: »Der gewünschte Gesprächspartner ist momentan nicht zu erreichen.«
Jessy
Sie starrt nur. Sie kann sich nicht bewegen. Ist wie eingefroren. Wie die Fische im Eis in der Palette, an der sie sich den Zeh gebrochen hat. Sie steht da und starrt nur. Das kann doch nicht sein. Muss ein Albtraum sein. Er küsst diese fremde Frau auf die Stirn. Bewegt sich rhythmisch. Fährt der da zärtlich durchs Haar. Stemmt den Oberkörper mit den breiten Schultern hoch und macht schneller. In Jessys Bett! Dort, wo sie selbst heute Nacht noch neben ihm gelegen hat. Mit einem zarten Kuss hat sie sich heute Morgen verabschiedet, weil er noch geschlafen hat. Dort, wo er ihren Kopf fest in die Hände genommen und gesagt hat: »Ich liebe dich. Du bist die Frau meines Lebens.« Und dann: »Wir gründen eine Familie.« Sie hatte gelacht: Jetzt doch noch nicht. Gescherzt: Erst wenn ich 30 bin. Er hatte gesagt: Neun Jahre warte ich nicht. Big love. Forever. Hat er gesagt.
Die stöhnen vor Lust. Sie starrt nur. Es ist 15 Uhr. Der gebrochene große Zeh schmerzt. Deshalb ist sie früher von der Arbeit weg. Er ist nicht in der Vorlesung. Rechtsgeschichte ist heute. Ab 15 Uhr. C.t. »C.t« hat sie von Jossip gelernt. Ist lateinisch. »Cum tempore« heißt das. Akademisches Viertelstündchen. Hat gedacht, der Jossip ist zur Vorlesung gegangen. Son of a bitch! Die stöhnen. Vor Lust. Zerstechen ihr das Herz. Muss ein Albtraum sein. Ihr wird schwindelig. Er will sie doch in der Kirche heiraten. Bald. Sie im weißen Kleid. Er im Anzug. Dann will er Anwalt werden. Sie soll das Abitur nachmachen, sagt er. Sie wollen eine Familie werden. Nicht so asi wie bei ihr daheim soll das alles werden.
Sie möchte das iPhone aus der Tasche holen und filmen. Als Beweis. »Du brauchst immer Beweise«, sagt Jossip. Sie traut ihrem Kopf nicht, der das mit ihren Augen sieht. Sie steckt wie in Watte. Die Hand umklammert das iPhone in der rechten Shortstasche. Sie kann es nicht herausnehmen. Sie kann die Hand nicht bewegen. Sie kann nur starren. Sie kann nicht mal schreien. Big love. Forever. Hurensohn! Diese Bitch. Blond, blaue Augen, wie sie selbst. Nur die Titten kleiner als ihre. Seine breiten Schultern. Er stöhnt lustvoll.
Aufhören! Aufhören! Das muss aufhören! Sie kann nicht schreien. Geht einfach nicht. Kein Laut in der Kehle. Jessys Finger ballen sich um das iPhone in der rechten Hosentasche. In der linken Hand hat sie noch die Schlüssel. Sie schafft es, die Finger zu bewegen. Sie wirft die Schlüssel auf die beiden drauf. Steht immer noch in der Türschwelle. Kann plötzlich doch schreien: »Raus! Raus! Raus!«
So schnell schauste nicht, gehen die auseinander. Die Bitch glotzt sie blöd an, zieht das Laken über sich.
»Raus!«, brüllt Jessy wieder. Die fucking Bitch packt sich ihre Wäsche und rennt an ihr vorbei ins Bad. Jossip steht vor ihr, einen Kopf größer als sie, sieht ihr immerzu in die Augen. Sein Dick ist nach unten gefahren. Sieht ihr immerzu in die Augen. Steht vor ihr, einen Kopf größer als sie.
»Hey, Jessy, ich kann dir das erklären.« Will ihr durchs Haar fahren. Sie schlägt seine Hand weg.
»Das war nur so ein Tagesausflug.«
»Tagesausflug«. Der hat sie wohl nicht mehr alle. Vor Jossip war kein anderer Mann. Hat sie damals niemandem gesagt. Sie war noch Jungfrau. Wollte nie wie Mom werden. Nie so asi mit Alk und Männern wie Mom.
Sie möchte ihn küssen und ihm zugleich eine in die Fresse hauen. Sie wurde mal von einem Hund gebissen. Jetzt fallen hundert Hunde gleichzeitig über sie her. Sie kann sie nicht wegschlagen. Alles, alles tut weh.
»Verpiss dich!«, schreit Jessy. »Los! Sofort!«
Mit dem Liebeslügenblick: »Hör mal Jessy, ich kann dir das …«
»Raus!«
»Lass uns doch in Ruhe …«
»Meine Fresse!« Endlich kann sie sogar wieder normal reden. »Welche Silbe beim Wort ›raus‹ verstehst du nicht?«
»Jessy, es ist anders, als du …«
»Schlüssel! Gib mir die Schlüssel! Du bist hier raus! Für immer!«
Jossip gibt auf. Zieht sich an, nicht besonders schnell. Sie schaut ihm zu. Noch nie hat ihr jemand so wehgetan. Ihr Herz schlägt turbo. Wenigstens sieht es keiner. Love. Forever. Für immer – bis 15 Uhr s. t.
Sie zittert, versteckt die Hände in den Taschen ihrer Shorts. Soll er nicht sehen, das Zittern. Hat Angst, dass sie umkippt.
»Mach schneller. Dann kriegste die Vorlesung vielleicht noch.« Schafft sie, das megacool zu sagen.
»Sweetheart«, sagt er, »der war gut!«
»Fuck off, pick!« House of Cards und andere amerikanische Serien hat sie mit ihm geguckt, aneinandergekuschelt, auf der Couch. Mit Chips und Cola. Jossip wollte sie im Original sehen. Geht doch nicht mit deutschen Sprechern, hat er gesagt. Hatte sie Schiss gehabt, nichts zu kapieren. Und dann richtig gut Englisch dabei gelernt. Jossip war baff gewesen: Hey, du lernst rasend schnell. Hatte Wörter, die sie nicht kannte, immer nachgeguckt. Er: Abitur. Sie: Hauptschulabschluss. Hieß ja jetzt beschönigend »Mittelschule«. Und jetzt war ihr Englisch so viel besser als seins. Sie, die im Deutschaufsatz so oft eine Sechs bekommen hatte und deshalb durchgefallen war. Thanks, Jossip, son of a bitch.
Die Wohnungstür fällt zu. Die Bitch ist raus. Jessy steht immer noch, die Arme verschränkt, in der Türschwelle zum Schlafzimmer.
»Fass mich nicht an!«, zischt sie leise, als Jossip langsam auf sie zugeht. »Sonst bring ich dich um.« Sie denkt: Oder mich. Leben ohne Jossip geht nicht. Geht gar nicht.
»Ich melde mich wieder, wenn du dich beruhigt hast«, sagt er. Das sagt der einfach so wie »Tagesausflug«!
Sie starrt ihn an. »Kein Bedarf.«
Er grinst blöd. Hebt die Hand, will sie streicheln, lässt die Hand wieder fallen, als er ihren Blick kapiert. »Die Schlüssel!«, sagt sie cool. »Gib her!«
Komplett verarscht. Er hat sie komplett verarscht. Nicht mal das Einjährige haben sie geschafft. Ihr wird wieder schwindelig, sie lehnt sich am Türrahmen an. Tut geschmeidig. Innen rast das Herz. Wie oft hat er …? Nee, bloß nicht fragen. Heul nicht! Heul später! Zeig ihm bloß kein Feeling mehr. Love forever – game over.
Er geht hinaus in den Flur. Sie bleibt stehen, wo sie steht. Hört, wie er die Schlüssel auf den Tisch legt. Sie schließt die Augen. Raus, raus, raus, geh endlich raus! Sie hört ihn vor der Wohnungstür stehen bleiben. Überlegt wohl, was er noch tun könnte. Sie möchte das Bett durch das Fenster auf die Straße schleudern und sich ihr Herz ausreißen. Geh endlich raus! Piss off! Mach! Sie kann nicht schreien. Aber sie kann rufen: »Und schöne Grüße an deinen guten Charakter, falls du ihm jemals wieder begegnest.«
Endlich fällt die Tür hinter ihm zu. Sie geht zur Wand, haut mit den Fäusten auf die Mauer ein. Sie weint und schreit. Das ist nicht auszuhalten. Niemand kann so etwas aushalten.
Sie setzt sich auf den Boden, lehnt sich mit dem Rücken an die Wand, zieht die Knie hoch, legt die Arme darauf und starrt auf das Bett, ihr Bett, in dem die beiden es getrieben haben.
Nee, Jossip, nicht mit mir! Ich hab mich aus dem Dreck gezogen. Du ziehst mich da nicht wieder rein! Kannste knicken. Son of a bitch! Life is a bitch! I will end you. Brate in der Hölle! … Yes! Und ich chill im Himmel!
Wilma
Was für eine Friedhofsruhe! Wilma spülte hinter dem Tresen die Weißbiergläser noch einmal durch, gewohnheitsmäßig, wie immer kurz vor fünf an Werktagen. Ein Weißbierglas muss immer gut gespült und vor allem mit klarem Wasser nachgespült sein, sonst bekommt man keine Schaumkrone. Der Lehrer trinkt immer ein Weißbier, manchmal zwei, aber nie mehr. Wilma hat ihm extra den alten Tisch von der Tante Loni herrichten lassen. Sepp hat ihn abgeschmirgelt und neu gestrichen, sie hat ihn abseits gleich rechts vom Eingang gestellt und bei Ikea eine Schreibtischlampe besorgt – ganz egal ob fremde Leute sich darüber wundern würden, dass da ein Schreibtisch in einer Wirtschaft steht. Da konnte der Lehrer in Ruhe sitzen und korrigieren, obwohl es Wilma nach wie vor ein Rätsel ist, wie der Lehrer sich konzentrieren kann, wenn am Stammtisch laut debattiert wird oder nebenan die Schafkopfrunde der Frauengymnastikgruppe sitzt und schrill plärrt: »Herz sticht!« oder auf den Tisch haut, wenn Kontra gegeben wird. Und seit drei oder vier Jahren kommen auch die Jungen wieder, früher haben die so eine Dorfwirtschaft gemieden wie der Teufel das Weihwasser, da sind alle bloß noch in die Disco gegangen. Aber bei ihr dürfen sie rauchen. Vielmehr: Bei ihr haben sie rauchen dürfen.
Die Jungen, fesche Mädels und Burschen aus allen möglichen und unmöglichen umliegenden Dörfern, werden natürlich schnell hitzig und laut. Die plärren immer rum, wegen Mode oder Musik oder Politik. Aber insgesamt sind die Jungen viel vernünftiger als die Leute noch zu ihrer Jugendzeit. Wer fährt, bleibt immer nüchtern. Da hat sie keinem mehr die Autoschlüssel abnehmen müssen, nie mehr, so wie früher dem Sepp oder dem Martin, die zwei, die zwar nie gestänkert haben, aber immer betrunken heimfahren haben wollen. Mit dem Auto heimfahren, obwohl der eine in drei und der andere in fünf Minuten zu Fuß daheim gewesen ist.
»Pfundskerle sind die«, dachte Wilma, »der Sepp und der Martin.« Die zwei und die Frauen der beiden haben ihr immer geholfen, sie hat nie darum bitten müssen. Sie hat bloß gesagt: »Für den Lehrer würd ich gern den Tisch von der Tante Loni herrichten, damit er einen eigenen Schreibtisch hat.« Am nächsten Tag war der Sepp in seiner Mittagspause gekommen, hat den Tisch vom Speicher geholt, ihn mitgenommen, hergerichtet und einen Tag später dort hingestellt, wo Wilma meinte, dass ein Schreibtisch am besten hinpassen würde, nämlich gleich beim Eingang in die Ecke, in der es im Winter schön warm ist und im Sommer nie zieht. Und der Martin ist ja auch sofort gekommen, wie sie gesagt hat, sie braucht jetzt auch Internet, das hängt ja jetzt auch mit dem Fernsehen zusammen, schon alleine wegen dem Fußball. Ihr ist der Fußball ja schon immer herzlich wurscht gewesen, aber die Jungen schauen wieder gern Champions League. Und die haben sie darauf gebracht, dass man auch »schwarz« fernsehen kann, über das Internet, »first rau« oder so ähnlich heißt das, die Jungen können ja alle viel besser Englisch, sie hätte »Sky« schon bezahlt, aber alle – vom Stammtisch bis zum Lehrer – waren sich einig, dass man diesem Sender doch nicht noch mehr Geld in den Rachen schieben soll. Ja, und der Lehrer hat sogar seelenruhig korrigiert, wie Weltmeisterschaft gewesen ist. Hauptsache, er hatte sein Weißbier. War nicht jetzt auch bald wieder Weltmeisterschaft, in Russland? Aber was ging sie das noch an?
Gläser spülen, obwohl keiner kommt, was für ein Schmarrn. Aber was sollte sie denn sonst tun? Für die Gläser und den Tresen bekommt sie doch nichts mehr, wenn sie das gebraucht verkauft, ob die Gläser nun dreckig oder sauber sind. Und über dem Gläserregal steht immer noch die Anrichte mit dem ganzen Hochprozentigen. Überall noch was drin, beim Whiskey, Aperol, Martini und sogar Jägermeister. Den tranken die Jungen plötzlich wieder gern, nachdem er überhaupt nicht mehr in Mode gewesen ist. Aber die Jungen zogen ja auch plötzlich wieder Tracht an, Dirndl und Lederhosen zur Wiesn, so sind die schon zu ihr in die Wirtschaft gekommen. Da hat sie gestaunt, denn sie selbst hätt ja lieber einen Schulaufsatz geschrieben, als ein Dirndl anzuziehen.
Wilma blickte durch ihre Wirtschaft mit den 40 Sitzplätzen ohne Nebenzimmer und ging zum runden Stammtisch. Der Sepp hatte gefragt, ob er das »Stammtisch«-Schild bekommt, zur Erinnerung. »Freilich«, hatte Wilma geantwortet. Denn dem Sepp, dem Martin und dem Lehrer hatte sie unter dem Siegel der Verschwiegenheit die Wahrheit gesagt, wie es bestellt war um ihr Lokal. Der Sepp, der Martin, deren Frauen und der Lehrer würden nie schlecht über sie reden. Bei denen hat sie nie aufpassen müssen, was sie gesagt hat. Was wird jetzt wohl über sie geratscht werden, wenn das ganze Dorf und die Nachbardörfer das erfahren?
Wilma saß am runden Stammtisch ohne Stammtischschild. Das Stammtischschild war ja noch vom Papa gewesen, von dem sie die Wirtschaft übernommen hat. Das musste ihr erst einmal wer nachmachen: drei kleine Kinder großziehen und eine Wirtschaft führen! Und wie sie das geschafft hat! Da hatte ihr Herrmann ja schon nicht mehr gearbeitet, ein halbes Jahr später ist er gestorben; allein hat er sie gelassen mit den drei Kindern, das jüngste erst ein Jahr alt. Da war was geboten gewesen. Tag und Nacht ein Trubel, immer was los, daheim und in der Wirtschaft, wobei sie bis heute gar nicht genau sagen kann, was nun Wirtschaft und was daheim ist. War ja auch immer schon alles im gleichen Haus. Und mittags hat sie für die Kinder in der Wirtschaft gekocht, aber gleich so viel, dass es abends dann das »Tagesgericht« geworden ist.
Damals haben alleinstehende Männer noch bei ihr gegessen, heute können die ja alle auch selber kochen. Und trotzdem waren viele auch noch oft zum Essen gekommen, nicht bloß zum Trinken, und nicht bloß zu Kommunion-, Hochzeitstags- oder betrieblichen Weihnachtsfeiern; richtig gut gelernt hat sie das Kochen und sich auch immer fortgebildet. Sogar beim Schuhbeck persönlich ist sie im Kurs gewesen. Seitdem war ihr Gulasch ein Gedicht, wie die Leute gesagt haben, und auch das Blaukraut hat erst seit dem Schuhbeck-Kurs richtig gut geschmeckt, denn da hat sie gelernt, dass es vorher in Essig eingelegt werden muss, damit es knackig bleibt, auch wenn es dann verkocht wird. Nein, ihre Kochkünste kann ihr so schnell keiner schlechtreden, egal was sonst bisweilen wohl über sie geratscht wird. Obwohl sie selbst sich stets mit Geschmacksurteilen, persönlichen Meinungen über andere oder politischen Ansichten sehr zurückhält. Denn sie ist schließlich als Wirtin eine Gastgeberin, und eine Gastgeberin hat sich mit niemandem anzulegen, sondern hält sich dezent zurück. Demonstrieren für irgendwelche eigenen Ansichten kann man vor dem Landtag, aber doch nicht hier!
Weil Wilma nichts Besseres einfiel, setzte sie sich an den Lehrerschreibtisch. Auf jedem Stuhl war sie schon x-mal gesessen, weil sich doch eine jede gute Wirtin auch mal kurz zu den Gästen dazugesellte. Bloß am Lehrerschreibtisch war sie nie gesessen, weil entweder der Lehrer dort gehockt war oder keiner. Und der Lehrer war ja eigentlich immer an seinem Platz gewesen. Außer einmal im Jahr an Weihnachten. Da hat er sich mit an den Stammtisch gesetzt. An Weihnachten, am Heiligen Abend, wo alle richtig zusammengehören.
Ein Lehrer hat doch mehr Ferien als Arbeitszeit. Sie hat nie Ferien gemacht, nur Montag war Ruhetag gewesen. Sie hat ja auch mal einen Großeinkauf machen, zum Doktor oder Winterjacken kaufen müssen – so wie früher für die Kinder. Oder ins Krankenhaus hat sie müssen. Fünf Monate ist sie dort gelegen wegen einer Entzündung an der Herzklappe. Mit drei kleinen Kindern! So was ist kein Sonntagsspaziergang! Und was haben der Martin und der Sepp gemacht? Die haben ihre Kinder zur Betreuung mit heimgenommen. »Auf drei mehr oder weniger kommt es nicht an«, haben sie gesagt. Die Frauen vom Sepp und vom Martin haben sie sogar mit den Kindern im Krankenhaus besucht und ihr verraten, dass die Leute an Wilmas Wirtschaft ein Schild gehängt hatten: »Wegen Renovierung vorübergehend geschlossen«. Und als sie wieder heimgekommen ist, nach fünf Monaten Krankenhaus, hatten die Gäste unter der Leitung von Martin und Sepp bis auf die Küche das ganze Lokal renoviert gehabt. Holzbänke und Wände waren gestrichen und die wackligen Barhocker repariert. Da war sie zu Tränen gerührt gewesen.
Es war so ruhig hier in der Wirtschaft, dass man fast hören konnte, wie Wilmas Tränen auf den Stammtisch tropften. Normalerweise war so was undenkbar in der ständigen Geräuschkulisse einer Wirtschaft. Und wenn sie doch mal weinen hat müssen, ist sie in die Küche gegangen. Sollte ja keiner mitkriegen, dass die Wirtin weint, wär ja noch schöner. Eine Wirtin weint doch nicht vor den Gästen. Die Gäste hatten sich bei ihr zu vergnügen oder sich bei ihr auszuweinen, aber sie doch nicht bei ihnen. Die bezahlten doch auch für eine fröhliche Stimmung hier, und zwar immer sofort. Denn anschreiben hat Wilma höchstens für einen Tag lassen, wenn jemand mal wirklich das Geld vergessen hat. Das hatte der Papa ihr eingetrichtert: Nur der Bierdeckel von einem Tag wird aufgehoben, nie mehr!« Hat ihr auch nie jemand übel genommen, diese Strenge, es hat immer geheißen: »Jeder braucht seine Grundsätze.«
Aber vielleicht hat es ihr doch jemand übel genommen. Die Petra wahrscheinlich. Irgendjemand muss sie ja hingehängt haben. Sonst wär sie doch nicht drei Mal innerhalb von vier Wochen kontrolliert worden! Niemals! Bis auf die Petra wollte ihr doch keiner im Dorf wirklich was Böses. Freilich haben die Leute bestimmt auch über sie gelästert, und ihr ist nicht alles zugetragen worden. Aber im Prinzip war sie doch beliebt bei allen, da müsste sie sich sonst schon schwer täuschen. Und eigentlich mochte sie auch wirklich alle mehr oder weniger, nicht bloß als Wirtin. »Das ganze Dorf ist meine Familie«, hat sie oft genug gesagt, wenn man sie gefragt hat, wie sie es geschafft hat, drei Kinder nicht nur alleine, sondern auch noch anständig aufzuziehen. Aus jedem der Kinder ist was geworden. Vier Enkelkinder hat sie nun auch schon und teilweise auch mit aufgezogen, weil ihre Älteste, die Maria, ja immer als Krankenschwester arbeiten gegangen ist. Und find mal eine Kinderbetreuung für jemanden, der Schichtdienst arbeitet!
Sie hat ja immer gern auf die Enkelkinder aufgepasst. Als Oma ist es doch viel schöner, da hast du nicht die ganze Verantwortung, und da bist du auch viel gelassener. In der Wirtschaft sind die Kleinen dann auch wieder mit dabei gewesen, so wie die Kinder früher. Die haben in der Ofenecke gespielt, wo jetzt der Lehrerschreibtisch steht, oder ihr die Kochtöpfe aus den Küchenschränken gerissen. Da war wieder alles geboten gewesen.
Wilma schüttelte schmunzelnd den Kopf – zwanzig Gäste, und die Enkel haben das Damenklo mit Nivea-Creme eingeschmiert. Aber das hält jung. Und jetzt sind die Enkel auch schon alle aus dem Gröbsten raus. Und der Lack von den Bänken, die der Sepp und der Martin damals gestrichen haben, glänzt auch schon lange nicht mehr. Das gehört doch alles dringend mal wieder renoviert; die vergilbten Wände, die geflochtenen Lampenschirme, der Parkettboden. Dabei haben die Jungen gesagt, sie sollte bloß nichts verändern! Das dunkle Holz, die Vorhänge, die Lampen mit den Weidenschirmen – auf all das haben die Jungen gedeutet – wo gäbe es so was noch? »So schön retro«, haben die Jungen gesagt. Und ihre Tochter Maria hat von den Wirtschaften in der Stadt erzählt, so als würd Wilma nie in die Stadt kommen. Maria hat von den hellen Räumen, den Glasfassaden und Designstühlen berichtet. Nirgends gäbe es mehr Vorhänge oder Gardinen; vertäfelte Holzwände seien passé, und wenn, dann hell gestrichen. Aber erst nachdem die Tochter das erwähnt hat, war es auch Wilma aufgefallen, wie gemütlich es doch bei ihr ist.
»Kein Schaden, der nicht auch einen Nutzen hat.« Wie oft hatte Wilma versucht, andere damit zu trösten. Ob sie jetzt renovieren lassen sollte oder doch lieber nicht – darüber brauchte sie jedenfalls nicht mehr nachzudenken. Drei Kontrollen innerhalb von vier Wochen! Und vorgestern das Einschreiben: Die Konzession wurde entzogen, mit sofortiger Wirkung. Wenn sie die Wirtschaft noch einmal öffnete, drohte ihr wohl sogar eine Haftstrafe, weil sie die Bußgelder zuvor nicht bezahlt hatte. Drei Bußgeldbescheide hatte sie bekommen, gestaffelt, von 200 bis 3000 Euro, zusammen genau genommen 4517 Euro, plus 25 Euro Mahngebühr. Wilma hat den Bescheid in die Büroschublade unter dem Tresen gelegt. Da waren Stifte, Abrechnungsblöcke der Brauerei, Tempos, Feuerzeuge und sogar Tampons drin. Was sie und die Gäste halt so brauchten und jeder Mensch gerne mal vergisst. Wie hatten sich die jungen Dinger schon darüber gefreut, dass bei ihr sogar Tampons vorrätig waren!
Erst heute hat sie sich getraut, den Bescheid zu zerreißen. Danach hat sie angefangen, die Gläser zu spülen, obwohl das vollkommen sinnlos war. Denn es stimmte schon, es war tatsächlich so, sie hatte es nicht bloß geträumt – sie hatte die Konzession wegen mehrmaliger Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz verloren.
Wilma fiel plötzlich ein, dass vielleicht nicht nur ihr eine Strafe drohte, wenn sie wie bisher weitermachte, sondern womöglich auch den Gästen. Sie konnte also nicht einfach aufsperren. Aber sie konnte auch nicht so ohne Weiteres verkünden, dass ihre Wirtschaft ein für alle Mal am Ende war. Was sollten denn die Leute von ihr denken? Dass sie mit dem Kopf durch die Wand hat wollen? Dass sie sich nicht in ihr Schicksal einfügen kann? Dass sie doch wissen hätte müssen, wo alles enden würde, weil sie einfach weiter rauchen hat lassen?