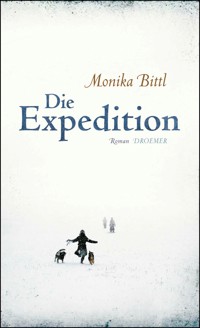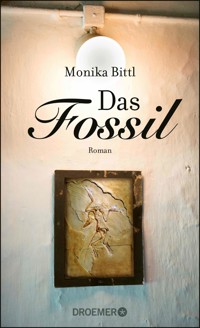9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Vom ganz normalen Wahnsinn zwischen Kind, Kerl und Karriere Bis zur Geburt des ersten Kindes leben Frauen und Männer heute meist als emanzipiertes Paar. Doch kaum ist das Baby da, wird schnell klar: Für die Frau ändert sich viel mehr als nur der Bauchumfang: Die neuen Mütterwunder arbeiten in Voll- oder Teilzeit, kaufen ein, erziehen, kochen, schlafen NICHT und recherchieren bei Mutti.de, wie man Karottenflecken entfernt. Die Männer dagegen scheinen wie vom Erdboden verschluckt, dabei sind sie ganz leicht zu finden: in der Arbeit – fern vom Haushalt und der alltäglichen Kinderbetreuung. Auch Monika Bittl und Silke Neumayer haben diese Erfahrung gemacht und berichten witzig, ehrlich und charmant vom Leben als Alleinerziehende – mit Mann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Monika Bittl / Silke Neumayer
Alleinerziehend mit Mann
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Alle im Buch vorkommenden Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder mit uns lebenden Personen sind rein zufälliger Natur.
Vorwort
Als gleichberechtigte Partner gehen Mann und Frau heute in den Kreißsaal hinein – und kommen mit Baby im Maxi-Cosi als Paar der fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts wieder heraus.
Bis zur Geburt des ersten Kindes leben Frauen und Männer aus der Mittelschicht heute meist als »emanzipiertes« Paar, beide arbeiten selbstverständlich, beide basteln an der Karriere, den Haushalt teilt man sich mehr oder weniger gerecht, und man schüttelt gemeinsam den Kopf über die »Glucken und Ernährer« in der traditionellen Rollenverteilung. Denn eins ist sicher: »Wir machen das später ganz anders, wir teilen uns auch mit Kind alles!«
Ein paar Wochen nach der Geburt des ersten Kindes stellen die meisten Frauen jedoch plötzlich fest, dass sie langsam, aber sicher zu Hause die Rolle der Großmuttergeneration übernommen haben, während sie gleichzeitig immer noch versuchen, sich im Job mit Baby auf dem Arm auf dem gleichen Level wie die Männer zu halten.
Während die meisten Männer – abgesehen von einer halben Stunde »duziduzi« pro Tag – linear ihr Leben weiterleben und ihre Karriere verfolgen, mutieren Frauen zum neuen Fräuleinwunder der Mutterschaft: Sie organisieren Betreuung, um arbeiten zu können. Sie lesen Kochbücher über gesunde Ernährung, legen fachmännische Wadenwickel, füllen die Waschmaschine, telefonieren gleichzeitig mit einem Geschäftspartner und reden dazu nebenher pädagogisch korrekt in ganzen Sätzen mit dem Kind. Die Mütterwunder kaufen ein, erziehen, kochen, schlafen nicht, arbeiten und recherchieren nebenher bei frag-mutti.de, wie man Karottenflecken entfernt.
Die Männer scheinen wie vom Erdboden verschluckt, dabei sind sie ganz leicht zu finden: in der Arbeit – fern des Haushalts, fern der alltäglichen Kinderbetreuung. Und die neuen Mütter protestieren nicht wirklich lautstark wegen der Dreifachbelastung oder nehmen den Mann und Vater mehr in die Pflicht. Warum das so ist, darüber kann spekuliert werden, aber das ist nicht das eigentliche Thema des Buches.
Die Mütter lernen einfach – nach ein paar vielversprechenden, aber im Alltag völlig wirkungslosen Diskussionen –, fünfzig Bälle gleichzeitig in der Luft zu jonglieren. Sie werden Expertinnen für selbstgemachtes Müsli, Management und Multitasking und vertrauen sich nur manchmal der besten Freundin an: »Im Unterschied zu einer Alleinerziehenden hab ich bloß mehr Wäsche.«
Immerhin sind Väter nicht mehr so wie noch vor hundert Jahren: Damals ist jeder Mann, der einmal eine Windel gewechselt hat, danach einfach tot umgefallen. Trotzdem sind Mütter meist vierundzwanzig Stunden am Tag Mütter, und Väter sind meistens dann Väter, wenn es gerade in den Terminkalender passt.
Es gibt viele Versuche – auch politische –, diese Situation zu verändern. Das neue Elterngeld zum Beispiel. Eine großartige Sache. Immer mehr Väter nutzen diese Möglichkeit und bleiben tatsächlich ein paar Monate zu Hause beim Baby. Tendenz durchaus steigend und eine tolle Leistung. Unser Nachwuchs braucht ja auch gerade mal so achtzehn Jahre (und manche sogar noch ein paar Jährchen mehr), bis er auf eigenen Beinen stehen kann.
Ein Kind zu haben ist Marathon, kein Sprint.
Während die Frauen in den vergangenen Jahrzehnten in die Arbeitswelt mit einhundert Prozent eingestiegen sind – oder noch mehr, da sie im gleichen Job oft mehr leisten müssen als ein Mann –, liegen die Männer bei den Themen Kind und Haushalt weit unter fünfzig Prozent. Das ist nicht nur unsere subjektive Meinung, das zeigen viele aktuelle Studien.
Dabei ist ein Kind zu bekommen und es groß werden zu sehen so ziemlich die schönste Sache auf der Welt. Ein Geschenk des Himmels. Und es ist es wert, sich die Hälfte dieses Himmels zu erobern. Auch wenn dieser Himmel manchmal aus der Hölle von zwei Millionen mal Waschmaschine ein- und ausräumen besteht.
Von der viel schwierigeren Situation tatsächlich alleinerziehender Mütter (und Väter) wissen wir – und wir wollen uns damit auch nicht vergleichen oder gar denen, die ohne Partner tagtäglich ihre Mutter stehen, vorjammern, wie schlecht es uns doch geht.
Überhaupt wollen wir nicht jammern. Wir lachen lieber.
Als Autorinnen und Mütter haben wir im Lauf der Jahre viele Gespräche geführt – mit allen möglichen berufstätigen Müttern, die wir privat oder beruflich kennen oder kennenlernten. Im Kindergarten, im Job und an der Supermarktkasse. Und wir haben festgestellt – egal, ob es sich um eine Schauspielerin oder um eine Verkäuferin handelt –, jede berufstätige Mutter weiß, wovon die andere spricht, wenn es um das Thema Kinder, Job, Haushalt und den dazugehörigen Vater geht. Fast alle machen tagtäglich die gleiche Erfahrung: Wir sind alleinerziehend mit Mann – aber nicht allein in dieser Situation.
1.24/7
Solange es noch keinen An- und Ausschaltknopf für Kinder gibt (es wird von einigen Müttern streng geheim seit Jahren schon heftig in diese Richtung geforscht, leider ist ihnen in dieser Hinsicht noch kein nennenswerter Durchbruch gelungen), ist eines klar: Bis die Kiddies ein gewisses Alter erreicht haben, kann man sie keine Sekunde allein lassen. Und manche sollte man sogar gerade dann, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, auf keinen Fall mehr allein lassen.
Ein Kind zu haben, das heißt vieles, und unter anderem heißt es: Jahrelang einfach rund um die Uhr, jeden Tag, der von Gott gegeben wird, sieben Tage die Woche, vierundzwanzig Stunden – immer und überall muss jemand für das Kind da sein.
Eben zumindest, bis es ein gewisses Alter erreicht hat.
In der Schwangerschaft ist das alles ja noch ganz klar – da habe ich Sophie einfach sowieso 24/7 durch die Gegend getragen. Komplettbetreuung mit essen und schlafen und pinkeln in meinen Bauch inklusive. Als sie dann endlich draußen war, hat sich daran eigentlich nicht viel geändert. Ich meine daran, dass irgendwie immer nur ich für die Kinderbetreuung zuständig bin. Vielleicht hat mein Mann einfach noch nicht bemerkt, dass Sophie seit acht Jahren draußen ist. Kann ja mal passieren.
Ich habe eine Freundin (Zwillinge, Frauenärztin), die hatte so die Schnauze voll davon, dass immer sie die Babysitter aussuchen und organisieren musste, dass sie ihren Mann endlich mal mehr in die Pflicht nehmen wollte. Das lief bei einem späten Familienfrühstück am Sonntagmorgen ungefähr so:
»Bernd, du weißt doch, wir sind übermorgen beide bei deinem Geschäftspartner zum Abendessen eingeladen.«
»Mmmh.« Gefolgt von leisem Zeitungsrascheln.
»Ich habe zurzeit so viel um die Ohren, und jetzt hat meine Mutter ja auch noch ihr künstliches Hüftgelenk bekommen, und ich muss mich auch noch um sie kümmern. Kannst du bitte mal den Babysitter für Freitagabend bestellen?«
»Mmmh.« Mehr Zeitungsrascheln.
»Bernd! Kannst du bitte den Babysitter für Freitagabend bestellen. Es ist dein Geschäftsessen.«
Ein tiefer Seufzer. Bernd legt die Zeitung nieder.
»Klar, mach ich, kein Problem. Und jetzt muss ich ins Büro.« Bernd verschwand im Büro, und meine Freundin war verblüfft über den leichten Sieg.
Freitagabend stand dann tatsächlich eine Babysitterin vor der Tür. Es war die Babysitterin von vor drei Jahren mit eigenem Kind auf dem Arm – das Kind sah Bernd verdammt ähnlich. Bernd und meine Freundin sind mittlerweile geschieden.
Aber das nur am Rande.
Also meinem Schatz könnte das nicht passieren. Natürlich ist er erstens absolut treu, und zweitens hat er gar nicht die Telefonnummer irgendeiner Babysitterin. Oder weiß überhaupt, wie sie heißt. Oder wo sie wohnt, oder was sie und ihr polizeiliches Führungszeugnis so machen.
Über die Jahre sind völlig verschiedene Mädchen und junge Frauen jedweden Alters und jeglicher Nationalität als Au-pairs oder Babysitter durch unser Haus gewandert und haben auf den größten Schatz in unserem Leben aufgepasst. Eingestellt, getestet und für gut befunden hat der Vater meiner Tochter keine davon. Nicht dass er sonst nichts mit Personal zu tun hätte. Als Chef einer eigenen Firma führt er ja ständig irgendwelche Vorstellungsgespräche. Aber irgendwie bleibt die Wahl des Hauspersonals an der Hausfrau hängen. Und da wir keine Hausfrau zu Hause haben, bleibt es eben an mir hängen.
Tja. Das Thema Kinderbetreuung ist in jeder Hinsicht ein weites Feld. Und da gibt’s ja nun einiges an Angeboten: Krippe. Kindergarten. Elterninitiative. Schule. Hort. Tagesmutter. Au-pair. Babysitter. Und für die privilegierten Mütter gibt es willige Omas und Opas um die Ecke. Und für die ganz verzweifelten Eltern gibt es immerhin noch IKEA. Ich habe gehört, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder morgens ins nächste IKEA fahren, um ihre Kinder dort – kostenlos – im IKEA Kinderparadies abzugeben, und dann gemütlich und entspannt zurück in die Stadt oder sonst wohin fahren, um ihr Kind dann fünf Minuten vor Ladenschluss schnell abzuholen.
Nun, Ikea ist für berufstätige Mütter auf Dauer wohl keine Lösung. »Die kleine Marie-Jeanette möchte dringend vom Kinderparadies abgeholt werden.« Und die Mama sitzt im Büro. Nicht so wirklich praktikabel.
Kind und Job sind zwei Dinge, die immer irgendwann miteinander kollidieren. Egal, welchen Job man macht, und egal, welche Art von Kinderbetreuung man findet. Das, was wir brauchen, ist eine möglichst gute Vereinbarkeit von Job und Familie und viel Improvisationstalent. Das gilt für Mütter wie für Väter.
Männer können das Thema Kinderbetreuung im Übrigen oft erstaunlich, nun ja, nennen wir es mal: kreativ lösen. Ich kenne einen Vater, der seine Tochter Luisa Samstags mal schnell in der Früh um zehn bei der benachbarten Familie einer Kindergartenfreundin seiner Tochter abgegeben hat mit den Worten: »Ich bin nur schnell mal eine halbe Stunde beim Joggen. Luisa kann doch so lange bei euch bleiben?« Klar. Kann sie. Kein Problem. Luisa und Marie verstehen sich supergut. Luisa wurde dann abends um acht Uhr wieder abgeholt. Von einer völlig fassungslosen Luisa-Mutter, die nach einem Tag Wochenendfortbildung beim Nachhausekommen abends nur ihren Mann alleine vor dem Computer völlig in ein Ballerspiel vertieft vorgefunden hatte. Er hatte Luisa nicht vergessen. Er hatte nur einfach nicht mehr an sie gedacht.
2. Mutter Natur
Jede Zeit hat ihre eigenen Wahrheiten. Heute glauben wir zwar nicht mehr, dass außerehelicher Geschlechtsverkehr direkt in die Hölle führt oder die Erde eine Scheibe ist, aber eins halten wir für ganz selbstverständlich: die »natürliche Mutterliebe« und alle Mythen, die sich aus dieser Behauptung ergeben.
Erste Zweifel am meiner natürlichen Mutterliebe beschleichen mich, als mein erstes Kind vier Wochen alt ist. Lukas ist ein Schreibaby und mein Mann seit zwei Wochen wieder in der Arbeit mit plötzlich sehr, sehr vielen Überstunden. Lukas schreit. Lukas schläft eine Stunde. Lukas schreit wieder. Und ich probiere das ganze Programm durch: füttern, Windeln wechseln, wiegen, ruhig halten, füttern, Windeln wechseln, wiegen, ruhig halten … und alles wieder von vorne. Trial-and-Error-Verfahren, das manchmal hilft, manchmal auch nicht. Und ich schäme mich dafür, schäme mich zutiefst dafür, weil meine Schwiegermutter doch schon während meiner Schwangerschaft mehrmals gesagt hatte, wir würden das mit dem Kind sicher gut hinkriegen, denn: »Eine Mutter erkennt am Schreien, was dem Kind fehlt.« Ich fühle mich zunehmend elend, weil ich auch vier Wochen nach der Entbindung keineswegs erfühlen kann, warum mein Sohn denn nun schreit. Jeder Erfolg der Ruhe ist nur dem schieren Zufall geschuldet.
»Was hat er denn?«, fragt mein Mann, als Lukas plötzlich wieder wie eine Sirene losbrüllt.
Ich zucke mit den Schultern. »Ich weiß es nicht, ich probiere einfach alles durch.«
»Meine Mutter sagt immer, dass sie an unserem Schreien erkannt hat, was uns fehlte.«
Seine Mutter hat also mehr natürliche Mutterliebe in sich gehabt als ich. Aha. Seine Mutter ist und bleibt vermutlich sowieso die beste Mutter auf der Welt. Gegen deren Mythos werde ich nie eine Chance haben. Seine Mutter weiß ja auch, dass ich die Zeit mit Baby genießen soll, denn sie vergeht so schnell.
Ich hingegen suche vier Wochen nach der Entbindung verzweifelt nach einem Genuss in einer Welt, die nur aus urplötzlichem Sirenengeheul besteht, die keinen Schlaf, kein Schminken und nicht einmal mehr einen ungestörten Toilettenbesuch zulässt. Und ich frage mich, ob ich je eine liebende Mutter sein kann, wo ich doch nicht einmal erkenne, warum mein Kind schreit! Dazu noch der Kommentar meines Mannes über seine Mutter – das männliche Einfühlungsvermögen ist an dieser Stelle nur von der Frage »Hast du deine Tage?« übertroffen.
Tief im Inneren schäme ich mich weitere drei Monate dafür, offenbar keinen natürlichen Mutterinstinkt zu besitzen. Haben nicht Kulturpessimisten jeglicher Couleur recht, und unsere neue Muttergeneration ist von Grund auf degeneriert? Die Momente, in denen ich mich nur noch ins Büro zurückwünsche, frisch geduscht, sauber angezogen und vor allem ausgeschlafen, beschäftigt mit einem geistigen Inhalt, steigen proportional zu den Schreiphasen meines Kindes.
Doch eines Tages, plötzlich, rund vier Monate nach der Entbindung, ertappe ich mich dabei, wie ich, bei Sonnenschein im Park spazieren gehend, in den Kinderwagen hinein meinen Sohn anstrahle und mich so glücklich und innig mit ihm verbunden fühle wie sonst noch nie mit einem Wesen auf der Welt. Ich hole ihn aus dem Wagen, drücke ihn an mich und beschließe sogleich, mit ihm künftig viel öfter in Baby-Trage-Tüchern unterwegs zu sein.
Weitere drei Jahre später – Lukas kann nun schon reden und seine Bedürfnisse ganz alleine bekunden – folgt nach der gefühlsmäßigen »Offenbarung« die geistige. Zufällig fällt mir beim Friseur eine Frauenzeitschrift in die Hand. Ein Artikel gibt einen kurzen Abriss über die Entwicklung von Kleinkindern. »Im vierten Monat«, so heißt es da, »entwickeln Säuglinge ein differenziertes Schreien, das es der Mutter ermöglicht, die Bedürfnisse des Kindes zu unterscheiden.«
Ein klassisches Aha-Erlebnis. Meine »mütterliche Natur« scheint also ganz intakt zu sein. Aber warum lassen wir Mütter uns so schnell verunsichern? Und was hat es eigentlich mit der mütterlichen Natur auf sich? Dieses Mal warte ich nicht auf den Zufall eines Aha-Erlebnisses. Ich schlage nach. Und siehe da, schneller als gedacht werde ich zum Thema fündig. Bei den alten Herren Kant, Knigge, Goethe und neuen Forscher-Damen wie Bovenschen, Pusch und Hausen.
Demnach hat man unsere »mütterliche Natur« erst vor zweihundert Jahren erfunden. Zuvor wäre niemand auf die Idee gekommen, Frauen für empfindsamer, instinktgesteuerter oder »natürlicher« als Männer zu halten. Weiber waren ein guter oder aber auch schlechter Hausvorstand, fleißige Mägde oder faules Gesinde, redliche Adelige oder verweichlichte Mitregenten – aber von einer »Natur der Frau« war vorher keinesfalls die Rede.
Doch in der Aufklärung erfand man unsere »weibliche Natur« – übrigens in allerbester Absicht der damals fortschrittlichsten Köpfe, denn sie wollten buchstäblich ein paar Frauenleben retten. Ähnlich wie Ende des zwanzigsten Jahrhunderts der Abtreibungs-Paragraph 218 des Strafgesetzbuchs für erbitterte Diskussionen sorgte, so war Ende des achtzehnten Jahrhunderts der Paragraph 217 des Strafgesetzbuchs, der Kindsmord-Paragraph, heftig umstritten. Viele Frauen töteten damals ihr Neugeborenes gleich nach der Geburt, um der Schande der ledigen Kindsmutter zu entkommen, und darauf stand Kerker oder Schafott. Goethe ergriff Partei für die »armen Weiber« und schilderte in Faust, wie das arme Gretchen zu so einem Verbrechen »verführt« wurde. Kant und Knigge kamen auf die damals sehr fortschrittliche Idee, uns eine weibliche Natur zuzuschreiben, die manchmal unberechenbar sei, völlig abweichend vom vernunftgesteuerten Mann und also in Ausnahmesituationen wie während oder gleich nach einer Geburt einfach »nicht mehr berechenbar«. Die »Geschlechtercharakteristik«, wie wir sie heute noch kennen, entstand: Der Mann sei hart und stark, die Frau weich und schwach, Männer vernünftiger und Frauen emotionaler, und schließlich besäßen wir Frauen eine »mütterliche Natur«. Die fortschrittlichen Denker erwirkten damit eine Änderung des Paragraphen 217, die Strafen wurden deutlich gesenkt, und bis vor kurzem noch bestand der Gesetzestext in dieser Form. Immer noch herrscht in unseren Köpfen die Vorstellung einer mütterlichen Natur, die alles gibt – und auch undifferenzierte Schreie des Säuglings erkennen würde.
Beim zweiten Kind und der damit ohnehin einhergehenden größeren Gelassenheit weiß ich von den ganzen Hintergründen. Es dauert einfach ein wenig, bis ich verstehe, was Eva mit ihrem Schreien ausdrücken will. Nur mein Mann sagt plötzlich einmal wieder: »Warum schreit sie denn so? Und du weißt auch nicht, was los ist? Also meine Mutter hat bei uns immer gewusst, warum wir schreien.« Ich lächle meinen Mann an. Hat einfach keine Ahnung von unserer weiblichen Natur.
3. Märchenstunde für große Prinzessinnen
Es waren einmal ein Prinz und eine Prinzessin, die hatten sich sehr lieb. Und deshalb dachten sie, dass die Krönung ihrer Liebe doch so ein winziges kleines Baby sei – eine wunderbare Mischung aus ihnen beiden. So machten sie sich ans Werk, und kaum neun Monate später war das entzückendste Wesen auf der ganzen Welt da – ihre kleine Prinzessin.
Und wahrlich, was für eine Prinzessin das war – so klein, so süß und so hilflos. Die Herzen des Prinzen und der Prinzessin flossen über vor Liebe. Vierundzwanzig Stunden am Tag. Und vierundzwanzig Stunden in der Nacht. Wobei die Nächte für die große Prinzessin nun merklich kürzer und merklich unruhiger waren als vorher. Während der Prinz neben ihr einfach weiterschnarchte. Schließlich konnte er ja nicht stillen – Prinzen haben nun mal keine Brüste. Und die Prinzessin wünschte sich nach der fünfhundertsten nicht geschlafenen Nacht ganz dringend eine gute Fee herbei, die dem Prinzen auch Brüste zaubern sollte. Aber die gute Fee kam einfach nicht – die gibt es nun wirklich nur im Märchen. Und natürlich wollte die große Prinzessin ihren tollen Beruf auch mit einer kleinen Prinzessin weitermachen. Schließlich hatte sie in vielen Schlachten gekämpft und viele Präsentationen gewonnen und war sich sicher, das mit der vollen Unterstützung des Prinzen auch weiterhin problemlos und mit links zu schaffen.
Alles kein Problem, hatte ihr der Prinz noch mitten in den Presswehen versichert. Aber kaum waren alle wieder in ihrem kleinen Schloss in der Vorstadt, stellte die große Prinzessin fest, dass der Prinz immer öfter und immer länger mit seiner goldenen Audi-A8-Kutsche in Richtung Büro verschwand. Und die große Prinzessin fragte sich immer öfter, ob sie vielleicht einen Prinzen geküsst hatte, der sich langsam aber sicher in einen Frosch verwandelte?
Und auch die Prinzessin verwandelte sich. Langsam aber sicher in Aschenputtel. Statt Gold und Seide trug sie immer häufiger Schlabberhosen und Spuckefleck. Und statt von einem goldenen Tellerlein zu essen, kaufte sie Pappteller, die man einfach in den Müll werfen konnte und nicht spülen musste. Und als sie wieder in ihre erste Schlacht im alten Job ging, stellte sie fest, das Heer war während ihrer kurzen Abwesenheit schon weitergezogen, und sie durfte statt an der Spitze nur noch ganz hinten bei den Halbtagskräften und Marketenderinnen mitreiten.
Und so fingen der Prinz und die Prinzessin über den Laufstall der kleinen Prinzessin hinweg an zu streiten. Über Geld, den Haushalt und wer sonntags endlich mal ausschlafen durfte. Und sie stritten und stritten und stritten sich, und wenn sie nicht gestorben sind, dann streiten sie noch heute.
4. Ein mal eins ist Fünf
Mein Mann und ich sind beide berufstätig.
Mein Mann und ich sind beide Eltern von Sophie.
Mein Mann und ich leben in einem Haus.
Mein Mann und ich teilen Tisch und Bett und manchmal sogar einen Pullover. Und einmal hatte ich sogar eine Unterhose von ihm an, natürlich eine frische. Aber das ist eine andere Geschichte und war lange vor Sophies Geburt.
Trotzdem leben mein Mann und ich offensichtlich auf verschiedenen Planeten, wenn nicht sogar Sonnensystemen oder Galaxien. Wieso ich das denke? Ein Beispiel:
Mein Mann und ich gehen auf eine Party. Fünfzigster Geburtstag von Stefan, dem Mann von Annette und dem Vater von Jasper und Jana. Nette Party. Gutes Essen und gutes Trinken. Alle so gesettelt und so alt wie wir. Dabei sind wir natürlich gar nicht alt, weil wir uns natürlich viel jünger fühlen. Und wenn ich ehrlich bin, sehe ich doch auch locker wie vierzig aus – bei gutem Licht gebe ich mir sogar die Achtunddreißig. Also, wie man sieht, habe ich ein durchaus realistisches Verhältnis zu Zahlen. Und um Zahlen dreht sich diese ganze Geschichte. Wie gesagt, es ist ein netter Abend. Sophie ist sicher schon im Bett. Und ich bin entspannt, denn Pauline, unsere Babysitterin, ist schon seit über einem halben Jahr bei uns, kennt sich also bestens aus. Die Wahrscheinlichkeit eines Notfallanrufs auf meinem Handy liegt unter fünf Prozent.
Wir reden über alles, worüber gesettelte Paare und Eltern bei einer solchen Party so reden. Über den letzten Urlaub, die Pläne für den nächsten; über den Job, die Kinder, den ganzen Wahnsinn und Stress des Alltags. Und dann sagt mein Mann locker und entspannt in die Runde: »Also meine Frau und ich, wir sind ja beide berufstätig, und daher teilen wir uns Kind und Haushalt fünfzig zu fünfzig.«
Mein Mann strahlt triumphierend in die Runde. Wow!
Wir teilen uns. Fünfzig zu fünfzig. Kind und Haushalt.
Großartig. Phantastisch. Und vor allem: unglaublich.
Im ersten Augenblick denke ich, ich hätte mich einfach verhört. Aber als ich in die verblüfften und teilweise andächtigen Gesichter der anderen anwesenden Frauen blicke, wird mir klar, dass mein Mann das tatsächlich gesagt hat.
Sollte ich ausnahmsweise eines dieser seltenen männlichen Exemplare unserer Spezies erwischt haben, die sich tatsächlich real-partnerschaftlich an der Beseitigung von Schmutz und Aufzucht und Pflege der Nachkommenschaft beteiligen? Wenn ja, ist mir die Bewunderung und der Neid aller anwesenden Mütter sicher.
Wie hat das der vielzitierte Soziologe Ulrich Beck so schön ausgedrückt: Die Männer von heute zeigen, wenn es um Familie und Kinder geht, »Verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre«. Das ist wunderbar, elegant und schön wissenschaftlich ausgedrückt. Im Alltag heißt das nichts anderes als: Männer quatschen viel und machen wenig.
Nun, auf einer Party einfach mal so zu sagen, wir teilen uns Kind und Haushalt fünfzig zu fünfzig, zeugt in jedem Fall von großer verbaler Aufgeschlossenheit meines Mannes. Ich bin in jedem Fall verbal erst mal außer Gefecht gesetzt, denn ich bin sprachlos. Und deshalb lächle ich einfach mal in die Runde und hoffe auf einen schnellen Themenwechsel. Ich will ja nicht kleinlich sein. Wenn die Waage mal zwei Kilo mehr zeigt, drücke ich auch ein Auge zu. Aber bei mehr als fünfzig Kilo kann man doch nicht mehr die Augen zudrücken, geschweige denn den Knopf zumachen.
Also, meine Bilanz ist, was Kind, Haushalt etc. angeht, eine völlig andere. Wenn ich das jetzt mal so ausrechne, dann teilen wir uns Kind und Haushalt so neunzig zu zehn. Nun, ich will mal nicht so sein, also okay, selbst wenn ich großzügig bin, komme ich auf eine Verteilung von fünfundachtzig zu fünfzehn. Wobei ich natürlich auf der Fünfundachtziger-Seite stehe.
Den Rest der Party überlege ich, wie diese doch völlig verschiedenen Zahlen zustande kommen. Keine Ahnung. Vor allem keine Ahnung, mit welchen Taten mein Mann auf seine fünfzig Prozent kommt. Einer von uns kann offensichtlich nicht rechnen.
»Wie um alles in der Welt kommst du denn auf diese Zahl?«, frage ich daher mal vorsichtig nach, als wir im Auto auf der Heimfahrt von der Party sind.
»Auf welche Zahl?«
»Na, darauf, dass wir uns Kind und Haushalt fünfzig zu fünfzig teilen.«
Mein Schatz blickt mich verständnislos an.
»Ja, aber … das machen wir doch schon immer so.«
»Also ich komme auf eine Verteilung von fünfundachtzig zu fünfzehn.«
»Also Schatz, das ist lieb von dir, aber so viel mach ich jetzt auch wieder nicht.«
»Ich meinte auch, dass die fünfundachtzig Prozent Arbeitsleistung bei mir liegen.«
»Wie kommst du denn jetzt darauf?«
»Siehst du das denn nicht so?«
»Nee, wieso? Ich finde, wir teilen das alles ganz gerecht. Nun gut, mag sein, dass du dich bei manchen Dingen etwas mehr engagierst, dafür übernehm ich dann aber anderes.«
»Was denn?«
»Ich nehm den Müll mit raus.«