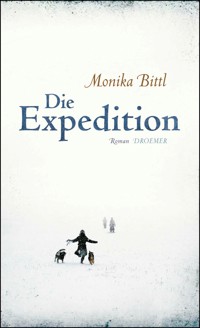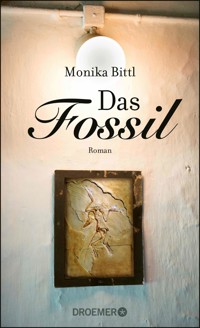
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautorin Monika Bittl (" Ich hatte mich jünger in Erinnerung", "Die Expedition") entwirft in ihrem Roman "Das Fossil" ein großartiges Panorama unserer Geschichte. Anhand der großen und kleinen Dramen einer Familie, die im Altmühltal lebt, zeichnet die erfolgreiche Schriftstellerin und Drehbuchautorin ("Sau sticht") die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen der letzten hundertfünfzig Jahre nach. Vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart, vom bayerischen Dorf bis nach Berlin: fünf Lebensläufe, die bestimmt sind von einem spektakulären Fund, dem Abdruck eines Archaeopteryx, der zu einem gut gehüteten Familiengeheimnis wird. Die verträumte Babette ist die Erste, die mit dem Abdruck eines Archeaopteryx in Berührung kommt. Sie erlebt hautnah mit, wie dieser Fund den Blick auf die Entwicklung der Menschen verändert. Für die Wissenschaft ist die Entdeckung des Fossils ein riesiger Erfolg; Babette allerdings bringt der eigenartige Vogel nur Unglück. Sie glaubt, dass auf dem Fossil ein Fluch liegt und vergräbt die Steinplatte im Garten. Die Geschichte der auf sie folgenden Generationen gibt ihr Recht: Jeder, der das Fossil zur eigenen Bereicherung einsetzen will, wird vom Schicksal bestraft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Monika Bittl
Das Fossil
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Fünf Generationen, vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart, vom bayrischen Dorf bis nach Berlin, fünf Lebensläufe, die bestimmt sind von einem spektakulären Fund: dem Abdruck eines Archaeopteryx. Für die Wissenschaft ist die Entdeckung des Fossils ein riesiger Erfolg. Für die fünf Familienmitglieder ist die Steinplatte mit dem einzigartigen Vogel jedoch Fluch und Segen zugleich. Denn jeder, der das Fossil zur eigenen Bereicherung einsetzen will, wird vom Schicksal bestraft …
Inhaltsübersicht
In memoriam meines Bruders meiner Familie gewidmet
»Der Weise dagegen lehnt weder das Leben ab, noch fürchtet er sich vor dem Nichtmehrleben, denn ihn widert das Leben nicht an, und er betrachtet das Nichtmehrleben nicht als ein Übel.«
Epikur
Das Fossil
Als Gott noch nicht die Menschen und die Menschen noch nicht Gott erschaffen hatten, kam ich zwischen lärmenden Dinosauriern auf die Welt. Damals umkreiste ein zweiter Trabant die Erde, der Kontinent Nordamerika trennte sich gerade von Europa und nirgendwo hier in Bayern zeigten sich auch nur ansatzweise Alpen, vielmehr lebte ich am Meer mit traumhaften Stränden, palmenartigen Farnen und dem Jahrhundertfeuerwerk eines implodierenden Gestirns. Mein Vater und meine Mutter, Echsenbeckendinosaurier, hatten mit mir als Erstgeborenem meiner Art ganz besonders hochtrabende Pläne, was aber leider zu meinem frühen Ableben führte. Denn während sich die Eltern darüber zankten, ob ich zuerst laufen oder fliegen lernen sollte, sich nicht einigen konnten und über ihren Streit vergaßen, mich zu hüten, stieß mich ein Titanosaurus robustus im Vorbeigehen mit seinem Schwanz über einen Felsabhang in einen seichten Salzsee, der so giftig war, dass jedes Leben darin sofort starb.
Hunderteinundfünfzig Millionen achthundertsechsunddreißigtausend und fünfhundertvierundsechzig Jahre, sieben Monate und dreiundsechzig Tage hatte ich meine gottverdammte Totenruhe, bis ich neulich in dieser menschlichen Familie landete. Bei meiner frühkindlichen Erfahrung mit Todesfolge wegen streitender Eltern begegnete ich dem Familienverband zunächst natürlich mit größter Skepsis. Doch weil es ständig Wirbel, Ärger, Höhenflüge und Trubel gab, schlugen sie mich in ihren lebendigen Bann. Kaum glaubte ich zu verstehen, wie sich eins aus dem anderen entwickelt, überraschten sie mich mit Unvorhergesehenem. Und so wurde ich eine Art adoptiertes Mitglied und trug meinerseits wiederum zu Freude, Tränen, Glück und Unglück sowie beträchtlicher Aufregung bei. Wahlweise werde ich von ihnen als »Fluch« oder »Segen«, »Glück« oder »Unglück«, »Schatz« oder »Ausbesserungsstein« bezeichnet.
Diese Familie ist – wie vermutlich all diese menschlichen Verbände – eine Komödie und eine Tragödie zugleich. Da sterben sie fast vor Liebe oder ziehen freiwillig in einen Krieg – und streiten sich dabei doch über ein Geburtstagsgeschenk. Sie errichten ein Haus und freuen sich über die Kinder – und wechseln nach einer blöden politischen Bemerkung jahrelang kein Wort mehr miteinander. Da leben sie nebeneinander her wie Fremde oder entfliehen sich betrinkend der Welt – und bügeln doch die Dummheit eines Jungen aus und retten damit Menschenleben. Hier tummeln sich eine Schönheit, ein Krüppel, eine Atheistin, ein tief Gläubiger, Angepasste und Rebellische, Feige und Mutige, Kluge und Dumme, Arme und Reiche.
Ich hab mich mittlerweile in diesen hundertdreiundfünfzig Jahren so an diese Familie mit ihren Eigenheiten, Abgründen und Höhenflügen gewöhnt, dass ich gar nicht mehr anders kann, als jetzt für sie einzustehen. Denn ganz objektiv gesehen habe ich zwar ständig Ärger mit ihnen, aber in Wahrheit auch großes Glück, denn langweilig wurde es mir hier noch nie. Mit meinem kleinen Bruder möchte ich nicht tauschen. Der fristet seit unserer Entdeckung vor einhundertdreiundfünfzig Jahren sein Dasein im Britischen Museum unter trockenen Wissenschaftlern und bildungsbürgerlichen Besuchern. Er wurde zwar zum Star und mich kennt niemand, aber hinter Sicherheitsglas muss er sich Kommentare von Gaffern anhören wie: »Look at it, my son! That’s how we began!« Als ob ein Archaeopteryx die Menschheit begründet hätte! Wir haben zwar noch Kopf und Becken eines Reptils, aber schon Federn, mit denen wir das Fliegen revolutionierten, den Flugsauriern überlegen wurden und so die Ahnen der heute über neuntausend Vogelarten wurden. Aber der Ursprung der Menschheit sind wir ganz gewiss nicht!
Ausgerechnet der Homo sapiens, wie dieser Besucher im Britischen Museum, nimmt sich selbst so wichtig wie keine Art sonst. Dabei würde ich es den Menschen ja nicht verübeln, wenn er nur die eigene Spezies höher als andere bewertete – das tun wir doch alle! Die Menschen finden Affen beispielsweise nicht so schön wie Bären oder Katzen, weil sie sich von ihren nächsten biologischen Verwandten im Schönheitsideal abgrenzen müssen. Nase abschneiden war in finsteren Zeiten der Menschen deshalb so eine schlimme Strafe, weil man damit dem Gesicht eines Affen ähnlicher wurde. Lange Beine gelten als attraktiv, weil der Homo sapiens damit weniger »affig« wirkt, und warum enthaart sich das schöne Geschlecht wohl? Selbst Darwin, dem mein Bruder und ich zum Durchbruch verhalfen, fand keine schlüssige Antwort auf das Rätsel der Schönheit – und dabei ist sie keine Laune oder Verschwendung der Natur, wie heute noch viele glauben. Nehmen Sie den männlichen Pfau und sein Gefieder. Es behindere seine Tarnung und schränke die Bewegung ein, meinte Darwin. Etwas sei also entweder schön oder funktional. Doch das Gegenteil ist der Fall: Der männliche Pfau überlebt mit seinem vermeintlichen Ballast leichter als das unscheinbare Weibchen!
Warum gibt es die Schönheit in der Natur, in der Kunst oder im Leben? Und stimmt es wirklich, dass Schönheit nur im Auge des Betrachters liegt? Nein. Aber auf das Rätsel der Schönheit komme ich im Laufe der Erzählung noch zurück, es beschäftigt mich seit meiner Entdeckung.
Denn seit einiger Zeit nimmt sich nicht nur der Homo sapiens als Gruppe so wichtig, sondern auch die einzelnen Menschen sich selbst – und vergessen darüber die Schönheit. Man findet sich mit der Bedeutungslosigkeit nicht ab und phantasiert sich ständig einen höheren Sinn ins Leben, im Kleinen wie im Großen. Ein jeder macht ein Theater um seine eigene Existenz, die sich doch bloß mit Vergänglichkeit und Tod nicht abfinden will. So als hätte nicht sogar innerhalb des Menschseins ein Buddha oder Epikur längst gezeigt, wie kleinlich, engstirnig und beschränkt das ängstliche Getue um das eigene Leben ist. Oder glauben Sie, das All interessiert Ihr Seitensprung, Ihr verpasster Bus heute Morgen oder das Hühnerauge an Ihrer Zehe? Momentan sind alle Menschen fast hysterisch von der eigenen Bedeutung in einem Ausmaß überzeugt, dass sie sich gar nicht mehr in die Natur und ihren Lauf einordnen wollen, sondern sich lieber sogar schädlich als gar keine Spuren hinterlassend denken und dazu den »globalen Fußabdruck« erfanden.
Der Mensch überschätzt seinen Einfluss maßlos und denkt sich wieder böse wie einst, die Erde zerstörend, so kam die Erbsünde im neuen Gewand wieder auf. Was für ein Rückfall in finstere Zeiten! Der Mensch misstraut sich und seinem Verstand wieder und verspielt die Errungenschaften der Aufklärung. Das macht ihn krank. Nehmen Sie den Klimawandel als Beispiel. Neueste wissenschaftliche Forschungen gehen heute von Sonnenzyklen aus, die bei der Erwärmung der Erde eine zentrale Rolle spielen. Der menschengemachte Anteil am Klimawandel scheint viel geringer zu sein als bisher angenommen. Und was hab ich selbst schon für Warmzeiten erlebt, weitaus heißer als heute, und damals war noch weit und breit kein Mensch in Sicht!
Denn glauben Sie bloß nicht, ich Fossil hätte die neueste Entwicklung verschlafen, im Gegenteil, die Familie hat mich zwar in ihren Bann geschlagen, aber wissenschaftliche Debatten verfolge ich hellwach mit der gebührenden Distanz, man könnte fast sagen, mit einem gesellschaftspolitischen Interesse auf der Grundlage aufklärerischer Werte. Denn ohne die Aufklärung und Wissenschaft dürfte ich gar nicht existieren. Entsprechend bekämpfte mich die Kirche nach meiner Entdeckung auch wie den Leibhaftigen, und ich wiederum kämpfe jetzt entsprechend gegen die Aushöhlung dieser Werte. Denn mein Bruder und ich bewiesen nicht nur Darwins Evolutionstheorie, sondern stürzten die Pfarrer von der Kanzel und Gott vom Himmel. Wir verhalfen dem Humanismus zum Durchbruch und machten aus der Krone der Schöpfung den Menschen zum Maß aller Dinge.
Damit bereiteten wir den Weg für die individuelle Freiheit der Menschen und die magischen Momente des Lebens, in denen die Schönheit weilt. Nur Dummköpfe glauben, diese magischen Momente lägen in Abwesenheit von Arbeit oder vice versa Karriere; sie lägen im Reichtum oder vice versa Konsumverzicht; oder sie lägen im Ansehen oder vice versa in der Einsamkeit. Ein magischer Moment kann bei einer banalen Arbeit eintreten, in einer religiösen Versenkung, bei einem Kuss, beim Betrachten eines Kunstwerks oder auch nur im Sehen eines Kindes, das vor Freude im Sonnenuntergang hüpft. Die magischen Momente suchen uns nicht zufällig, sondern immer nur bei einem neuen, tieferen Verstehen des Seins. Das beste Beispiel dafür ist vielleicht die Entbindung eines Kindes. Dem großen Schmerz folgen der erste Blick in seine Augen und der magische Moment, das neue Leben zu sehen, ohne es begreifen zu können.
Aber das führt jetzt alles zu weit. Ich muss mich sputen mit meiner Erzählung für die kranke Kathrin, einem jüngeren Spross der Familie, um damit vielleicht ihr Leben zu retten. Sie wurde vor kurzem in ein Krankenhaus eingeliefert und ringt um ihr Leben. Die Ärzte können sich nicht erklären, warum die Frau zusammenbrach und immer schwächer und schwächer wird. Weder Laborwerte, die üblichen Untersuchungen bis hin zu einem speziellen Computertomogramm ergaben Hinweise auf die Ursache der Krankheit. In ihrer Hilflosigkeit vermuten die Mediziner nun, sie hätte sich einen exotischen Virus auf den Reisen durch Afrika und Asien eingefangen. Was alles über die ärztliche »Kunst« aussagt, denn diese Reisen liegen fast dreißig Jahre zurück! Aber deshalb befindet sie sich nun auf der Isolierstation, darf Besuch nur durch eine Scheibe sehen und niemanden berühren, was den Krankheitsverlauf natürlich ungünstig beeinflusst. Sie wird überwiegend künstlich ernährt und hört sich seit zwei Tagen über einen Laptop den Gesang von Vögeln an, denn nicht einmal das Fenster darf geöffnet werden.
Unversöhnt steht Kathrin ihrer eigenen Geschichte und der ihrer Ahnen gegenüber, weshalb ich nun alles erzähle, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass dies zur Gesundung beiträgt. Körper und Seele hängen bekanntlich ja eng zusammen, wenn auch nicht so eindeutig, wie jede Küchenpsychologie heute verkündet. Die Kranke beginnt sich gerade zu fragen: Was ist Schönheit im Leben? Warum gibt es das Schöne?
Ich erzähle ihr ihre Familiengeschichte, denn nicht ich bin Fluch oder Segen, sondern die eigene Familie, je nachdem, wie man sie lebt oder an ihr vorbeilebt oder sie falsch lebt. Dabei ist die Familiengeschichte wie eine Cloud, aus der jeder Informationen abrufen und hineingeben kann. Die Ahnen haben die Cloud mit ihren Erzählungen gefüllt, wir verändern sie mit unserem Leben immer weiter, und die nächste Generation wird sie wieder neu formen und ihren Anteil aus dem kollektiven Gedächtnis der Cloud abrufen.
Im kahlen Krankenzimmer zur Südseite blicke ich vom Fensterbrett aus direkt zur Dahindämmernden, sie weiß noch nicht, wer ich bin, misstraut mir. Ich beginne den Bericht mit meiner Entdeckung und ihrer Ahnin Babette, deren Leben durch mich eine entscheidende Wendung nahm.
Babette 1861
An einem warmen Frühlingstag des Jahres 1861 grub die damals siebzehnjährige Babette zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Toni die Gemüsebeete hinter dem Wolkertsheimer Haus mit einem Spaten um. Babette trug ganz der Tradition und Gegend entsprechend einen dunklen, langen Rock mit Schürze und ein helles Oberteil. Die kräftigen schwarzen Haare hatte sich die junge Frau zu einem losen Schopf hochgesteckt, so dass der leichte Wind, der in Wolkertsheim stets ein wenig bläst, ihren Nacken bei der schweren Arbeit kühlte. Bisweilen ging sie auch zum Regenfass, formte ihre Hände zu einem Halbrund und spritzte sich mit dem Wasser Schweiß aus dem Gesicht, das im Jahre 1861 als das schönste Antlitz des Bistums Eichstätt galt. Babette sah in ihrem Spiegelbild im Wasserfass jedoch nicht ihre ebenmäßigen Gesichtszüge, die vollen Lippen, die großen Augen und die feine Nase – sie blickte auf die kleinen Wellen des Wassers, die ihr Ebenbild laufend veränderten, einmal die Stirn vergrößerten, die Nase streckten und dann wieder den Mund verengten. Wenn das kleine Wasser im Regenfass schon stets alles veränderte, um wie viel mehr musste das Meer, von dem sie gehört hatte, erst die Menschen und die Welt bewegen?
»Babette?!« Toni spritzte ihr Wasser aus der Regentonne ins Gesicht und lächelte sie an. »In welchem Traum bist denn gerade wieder?«
»Oh, entschuldige, ich hab ganz vergessen …«
»… wie du heißt und wo du lebst!«, ergänzte der Bruder scherzend und kühlte sein Gesicht auch mit dem Wasser aus der Regentonne.
Babette lachte und griff wieder zum Spaten.
»Du kannst jetzt zeichnen, wenn du magst, das bisserl schaff ich auch alleine!«
Babette dankte dem Bruder das Angebot mit einem flüchtigen Kuss auf die Wange. Die Mutter war zum Waschtag an der Altmühl, der Vater noch im Steinbruch bei der Arbeit, und beide würden nicht über das »nichtsnutzige Kritzeln« schimpfen können. Sie würde zeichnen, was sie heute gesehen hatte: einen Schmetterling, dessen Flügel das Regenfass so verzerrt dargestellt hatte, als wären es Adlerschwingen. Babette eilte ins Gartenhäuschen, wo Feder und Papier lagen.
Doch kaum hatte sie das Material in der Hand, hörte sie Doro keuchend »Babette! Babette!« rufen, und sie legte die Feder und Papier wieder weg. Über eine seitliche Lücke im Zaun kam die füllige Doro auf sie zugerannt.
»Komm, schnell! Babette!«, rief sie. Wie immer hätte Doro am liebsten sofort losgeplappert, aber sie musste nach Luft schnappen und konnte bloß aufgeregt an Babettes Ärmel ziehen. Es musste etwas gesellschaftlich Besonderes vorgefallen sein, denn die Arzttochter Doro war immer genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn sich in bayerischen Dorf Wolkertsheim etwas ereignete, ob nun der Graf von Pappenheim auf einem Araber angeritten kam, der Pfarrer mit dem Sepp raufte, ein reicher Patient bei Doros Vater eintraf oder der Brief eines Ministers per Post auf Durchreise in Wolkertsheim war, um ins nahe Solnhofen zu gelangen.
»Ein Münchner ist im Gasthaus abgestiegen! Ein ganz feiner Herr! Im dunklen Frack. Mit einer Tasche so groß wie das Regenfass!« Aufgeregt zupfte Doro weiter an Babettes Ärmel.
»Was für eine Ungeheuerlichkeit!«, spottete Toni vom Beet herüber. Bruder und Freundin verband eine herzliche Spottlust. Doro lästerte so gut es ging über den »groben Lackel«, und Toni frotzelte so oft es ging über die »eingebildete Etepetetesse«. Aber immer griffen sie sich direkt an und niemals wie die Ratschweiber hinter dem Rücken des anderen.
Doro ärgerte sich über Toni und suchte noch nach einer Erwiderung, als Babettes Mutter mit einem Korb voll nasser Kleidungsstücke durch die Terrassentür in den Garten kam, um dort die Textilien zum Trocknen aufzuhängen.
»Ein feiner Herr?«, fragte die Mutter Doro. »Im Gasthaus?«
»Ja, Frau Gründinger, sehr fein!«, antwortete Doro aufgeregt und vergaß das Grüßen darüber.
Babette seufzte leise. Jetzt würde die Mutter sie bestimmt gleich wieder zum Umkleiden und ins Wirtshaus schicken. Die Haare würden fein gekämmt werden, und jede Menge Ratschläge würden auf sie einprasseln. »Deine Schönheit musst du einsetzen! Mit deinem Gesicht und deiner Figur kannst du das ganz große Los ziehen! Schau, dass du in seine Nähe kommst, aber bloß nicht so, dass er es merkt. Die Mannsbilder müssen dich entdecken! Deine Schönheit ist deine Aussteuer, setz sie ein!«
Während Doro und die Mutter noch ein paar Sätze über das seltsame Wesen der Städter und den Anzug des Neuankömmlings austauschten, überlegte Babette, mit welchen Strichen sie die Konturen des Schmetterlings am besten abbilden könnte.
»Und, was ist jetzt, Babette? Wo ist denn dein Kopf schon wieder?« Doro ließ keine weiteren Gedanken an Schmetterlinge mehr zu. »Willst du ihn dir nicht ansehen?«
»Aber …« Babette deutete mit fragendem Blick zur Mutter auf die Beete, die noch umgegraben gehörten, und hoffte wider besseren Wissens, es würde ihr erspart bleiben, sich selbst wie ein Zirkuspferd vorführen zu müssen.
»Geh schon!«, forderte die Mutter Babette auf. »Schau dir den Herrn mit Doro an. Der Toni kann die Beete alleine fertig machen. Aber vorher machst dich noch hübsch, gell!«
Doro zog Babette wieder am Ärmel und mahnte sie zur Eile, um nur ja nichts zu verpassen.
Doch die beiden Freundinnen kamen zu spät. Im Gasthaus hatte der Münchner schon ein Zimmer bezogen und schlief sich nach Auskunft der Wirtin von der Reise aus. Zu allem Überfluss traf Babette beim Verlassen der Gaststube auf den Müller Nikolaus. Dieses Mannsbild mit den kleinen, dicken Fingern und dem Stiernacken griff ihr immer an den Hintern und fragte stets: »Wann heiratest du mich, Babette? Oder ist dir ein Müller nicht gut genug?« Dabei hatte die Mutter dem Müller schon das Haus verboten. Heute half ihr die Wirtin, die Nikolaus schimpfte: »Schleich dich und lass endlich die Babette in Ruh!« Aber der Müller ließ seinen Blick nicht von ihr, Speichel lief ihm seitlich aus dem Mund, er wischte ihn zusammen mit Rotz mit dem Ärmel weg. Doro nahm Babette an der Hand und eilte mit ihr schnell davon.
Wie geräumig, sauber und fein möbliert war doch Doros Haus im Vergleich zu ihrem! Babette bewunderte die Spitzendeckchen, das Biedermeiersofa, den blitzblank geschrubbten Kalkplattenboden und vor allem das eigene Zimmer von Doro. Während sich Babette zusammen mit Toni eine kleine Kammer teilen musste – und als die Großen noch nicht aus dem Haus waren, schliefen je zwei Geschwister in einem Bett –, konnte sich Doro in ihr Zimmer zurückziehen und ungestört ganz für sich alleine sein, wann immer sie wollte. Eine Haushälterin entfernte ständig Dreck und Staub, wusch, flickte, spann, strickte und kochte – mehrmals in der Woche sogar Fleisch, denn Doktor Häberlein mochte kräftige Mahlzeiten und guten Wein. Manchmal empfing Doro die Patienten des Arztes und wies ihnen den zugehörigen Sitzplatz zu. Arme Tagelöhner – wie Babettes Vater – mussten auf dem Holzstuhl vor dem Behandlungsraum Platz nehmen, um das gute Sofa nicht zu verschmutzen. Feine und reiche Patienten wies Doro zum Polstermöbel. Waren an einem Tag die Kranken nur Arbeiter, verabschiedete sich Doro schnell, denn über diese Leute gab es gesellschaftlich nur selten etwas zu berichten.
Der Vater ließ Doro völlig freie Hand. Doro war als Nachzügler das einzig verbliebene Kind im Haus, die Mutter schon lange gestorben, und der vierundsiebzigjährige Vater »verzog die Matz nach Strich und Faden«, wie Toni gerne sagte.
Vor allem um der Tochter eine entsprechende Mitgift zu beschaffen, so hieß es im Dorf, treibe der Doktor seine Nebengeschäfte, die ihn immer wieder nach München oder womöglich noch ganz woandershin reisen ließen, denn der Postbote hatte auch schon Schreiben aus Berlin und aus Amerika an Häberlein zugestellt. Babette mochte das Gerede im Dorf über die Freundin und dessen Vater nicht. Jeder Steinbrucharbeiter hatte doch selbst schon seine unsauberen Geschäfte mit Häberlein gemacht und davon profitiert, aber den Doktor nannten sie alle geldgierig. Sogar der eigene Vater hatte ihr neulich erzählt, für eine aus dem Steinbruch herausgeschmuggelte Platte vom Doktor wegen seiner Bronchitis behandelt worden zu sein. Großzügig hatte Häberlein ihm viel mehr als erwartet dafür gegeben, nicht nur weitere kostenlose Untersuchungen bis zur vollständigen Genesung versprochen, sondern obendrein noch die Medizin aus der Apotheke bezahlt. So hatte der Vater bald wieder arbeiten gehen können, und sie hatten nicht hungern müssen. Wie gut hatten sie es doch in Wolkertsheim mit den vielen Steinbrüchen rundum! Außer im Bayerischen Wald gab es woanders für die unteren Stände den ganzen Winter über keine Möglichkeit, in Stellung zu gehen oder als Arbeiter Geld zu verdienen. Und den kleinen »Nebenerwerb« mit dem Doktor nutzten fast alle. Bloß der Bruder Toni fragte oft ketzerisch, warum es überhaupt obere und untere Stände gäbe, Grafen und Tagelöhner, Steinbruchbesitzer und Arbeiter. »Weil das der Herrgott so gewollt hat!«, schimpfte dann der Vater. »Versündige dich nicht! Und Vater und Mutter sollst du ehren!« Aber der Toni kam immer wieder damit daher, vor allem wenn er betrunken war. Selbst ein paar kräftige Watschen vom Vater neulich hatten ihm seine Flausen nicht austreiben können. Und dabei nannte ausgerechnet der Toni sie immer zärtlich »Dummerle«.
»Wünschen die Herrschaften einen Tee?«, fragte die Haushälterin der Häberleins wie immer etwas mürrisch.
Doro stupste Babette an. »Willst du?«
Ach so, sie und Doro waren mit »Herrschaften« gemeint! Babette kicherte verschämt und nickte.
»Bring ihn uns doch auf mein Zimmer oben!« Doro konnte anschaffen wie eine Gräfin, Babette kicherte darüber schon wieder. »Und was von den Nürnberger Keksen.« Doro wollte mit der Freundin ratschen, sie mussten die unverhoffte Freiheit auf einen Tee ausnutzen, ehe Babette daheim doch bloß wieder Arbeit erwarten würde.
Babette sprang die ersten Treppenstufen wie ein kleines Mädchen nach oben und erschrak, als der Doktor mit einem blutverschmierten Kittel aus dem Behandlungszimmer unter der Treppe kam. War sie zu laut gewesen? Babette grüßte höflich.
»Ah, die Babette!«, rief Häberlein erfreut und schickte den nächsten Patienten ins Behandlungszimmer. »Nach dir hätt ich heut sowieso noch schicken lassen.«
»Nach mir? Warum?«, fragte Babette und fühlte sich nicht wohl, so auf der Treppe erhöht über dem Doktor zu stehen. Sie ging die fünf Stufen zurück.
»Ja, nach dir. Oder kannst nicht mehr zeichnen?«, fragte der Doktor scherzend.
»Aber natürlich …«
»Ich hab eine ganze Menge Arbeit für dich. Sollst auch was kriegen dafür«, kündigte Häberlein an und rief nach Doro.
»Doro! Geh gleich zum Simmler nach Eichstätt. Wir brauchen das beste Papier und die besten Stifte. Babette soll dir anschaffen, welche genau!«
»Aber heut doch nimmer, da brauch ich ja zwei Stunden hin und zurück!«, protestierte Doro. »Und die Berta macht uns gerade einen Tee!«
»Weiber und die Ratscherei!« Häberlein schüttelte den Kopf und lenkte doch ein. »Also gut, aber dann gleich morgen Früh! Und kauf von allem das Doppelte, was die Babette dir sagt. Die Hälfte soll sie für sich behalten und mit dem anderen hier arbeiten.«
Babette staunte. Nicht nur, dass Doro einfach so ihren Willen mit dem Tee hatte durchsetzen können. Nein, viel mehr noch, der Doktor hatte ihre Zeichnerei »Arbeit« genannt und ihr dafür sogar einen Lohn in Aussicht gestellt! War sie heute nicht das glücklichste Wesen unter der Sonne? Im Sonnengelb leuchteten auch die besten Papiere und die besten Stifte des Simmlers – wie oft war sie schon vor dem Schaufenster des Eichstätter Kramerladens gestanden und hatte von den unerschwinglichen Bleistiften, Federn und Buntstiften in allen Farben geträumt; Stifte, die so weich waren, dass man Konturen damit verwischen konnte, und das in über dreißig Farben! Und all das durfte sie nun Doro auftragen und würde es bald verwenden können.
Am Nachmittag darauf hörte Babette ein paar Patienten des Doktors im Behandlungszimmer aufschreien, während sie im Nebenzimmer zum zweiten Mal ein gutes Papier zerknüllen musste. Mit dem Radiergummi hatte sie ihre ungelenken Striche nicht entfernen können. Babette hielt einen Moment inne, und ihr Blick schweifte im Raum umher. Die ganze sogenannte Schreibstube des Doktors war mit Platten von versteinerten Tieren vollgestellt, in der Vitrine fanden sie längst nicht mehr alle Platz, auch der Nussbaumschrank war so überfüllt, dass sich eine Tür nicht mehr schließen ließ. Seitlich am Boden standen im ganzen Raum Exemplare von irgendwelchen ausgestorbenen Dinosauriern und sogar auf der Werkbank, an der Häberlein die an ihn verkauften Platten bearbeitete, türmten sich die aus dem Steinbruch geschlagenen Tafeln aus feinem Kalkstein mit toten Tieren darin.
Babette hatte gesehen, wie viel Mühe sich der Doktor beim Freilegen der Fossilien gab. Vorsichtig hatte er mit einem kleinen Hammer und Meißel entlang der Ränder der Abdrücke geklopft. Dazwischen fegte er mit einem Pinsel immer wieder feinen Staub und Steinchen weg. Er dürfe, so hatte Häberlein erklärt, nicht zu viel wegnehmen und müsse sich dabei den Knochen und anderen Tierresten doch so weit wie möglich annähern, damit das Relief auch gut sichtbar würde. »Jahrelange Erfahrung« brauche es fürs Präparieren, hatte Häberlein gesagt und Babette bewundernd dazu genickt. Was für eine Kunst, die toten Saurier so wieder zu neuem Leben zu erwecken! Und ihr musste das auf eine andere Art und Weise nun mit den Zeichnungen auch gelingen. Wenn nur die Hand geschickter wäre!
Babette nahm ein neues Blatt Papier. Sie dürfe nicht so zögerlich sein, sondern müsse beherzter ansetzen, Häberlein hatte ihr selbst gesagt, auf das gute Ergebnis käme es an und nicht auf einen Bogen Papier mehr oder weniger. Und in drei Wochen musste dieses gute Ergebnis vorliegen – an die hundert Platten waren abzubilden. Da musste sie ja jeden Tag mindestens drei Zeichnungen schaffen, dachte Babette erschrocken, aber nein, was rechnete sie da, die Hand würde schon noch gelenkiger werden, jetzt galt es einfach, einen neuen Versuch zu wagen. Babette griff zum nächsten Blatt Papier, rieb den Bleistift spitz und schob das Fossil vor sich auf dem Schreibtisch seitlich in ein besseres Licht. Ja, so zeigten sich die Knochenreste des Sauriers besser.
Vier Stunden und eine fast fertige Zeichnung später kam die Freundin mit einem Tee in die Stube und forderte sie zu einer Pause auf.
»Schön wird es!«, bemerkte Doro mit Blick auf das Papier.
Babette seufzte. »Hoffentlich! Wenn ich mehr Zeit hätte, könnt ich vielleicht noch besser sein.«
»Das hängt wahrscheinlich mit dem Besuch des Münchners zusammen, dass es so pressiert«, erklärte die Freundin. »Der Vater hat da wahrscheinlich was vor. Ich wär froh, wenn er das ganz Zeug da verkaufen würd, dann würd es nicht andauernd hier herumstehen, und Geld für meine Aussteuer käm auch herein. In letzter Zeit hat er es ja ganz brisant.«
Doro beugte sich zu Babette, um leise ein Geheimnis zu verraten. »Stell dir vor, eine Platte hat er jetzt sogar in sein Nachtkastl eingesperrt, und keiner darf mehr in sein Schlafzimmer! Vielleicht wird er jetzt auch altersg’pinnert!« Doro schien einen Moment besorgt. »Aber nein, solang der Vater noch Geschäfte machen kann, bleibt sein Hirn schon beieinander!« Die jungen Frauen lächelten.
Doro fuhr fort, von bestimmten Marotten des Vaters zu erzählen, dass er zum Abendessen jetzt immer einen Wein trinke, den er extra von einem Händler aus Frankreich kommen lasse. Dass er am Grab der Mutter nun immer so vor sich hinrede, so als würde er sich mit der Verstorbenen unterhalten, und dass er sie jetzt immer auffordere, vor dem Essen die Hände zu waschen. Babette hörte Doro zu, blickte auf die Platte und zum Papier, lauschte erneut Doros Worten und wollte wieder zeichnen, aber das ging nicht nebenbei beim Ratschen. Und wenn die Freundin erst einmal angefangen hatte zu plappern, dann hörte sie nicht mehr auf.
»Red ich zu viel?«, fragte Doro, als hätte sie ihre Gedanken erraten, und fügte, ohne eine Antwort abzuwarten, hinzu: »Jetzt bin ich still.«
Als Doro kurz darauf trotzdem wieder zu plappern begann, kam Häberlein zur Tür herein. Babette sprang auf, bedankte sich mit einem Knicks für die großzügigen Geschenke an Stiften, Federn, Farben und Papier »für den Eigenbedarf« und zeigte ihm die erste Zeichnung. Der Arzt warf ein paar vergleichende Blicke von der Platte zum Papier, lobte Babette zum gelungenen Werk und befahl Doro in ungewöhnlich scharfem Ton, auf ihr Zimmer zu gehen, damit Babette in Ruhe arbeiten könne, denn die Zeit dränge.
Babettes Augen waren gerötet, als sie sich zu Toni an den Frühstückstisch setzte, um für heute ein letztes Mal zum Dienst beim Doktor aufzubrechen. Drei Wochen lang war sie täglich außer sonntags in der Früh zu Häberlein gegangen und hatte so lange gezeichnet, bis es dunkel wurde, manchmal auch mit Kerzen bis tief in die Nacht. Einmal war sie noch ganz in Gedanken bei der Stiftführung auf dem Heimweg dem Müller Nikolaus über den Weg gelaufen, er hatte an ihrer Schürzenschnur gezogen, sie festgehalten und ihr zugeraunt: »Irgendwann gehörst mir!« Babette gruselte vor ihm und seinem Blick so sehr, dass sie in seiner Nähe leicht zitterte.
Drei Wochen lang war die Welt ein sonnengelber Traum aus zeichnen, zeichnen, zeichnen. Vater und Mutter fanden es »nicht schlecht«, so Geld zu verdienen, ermahnten sie aber, sich spätestens zu Lichtmess eine Stellung zu suchen, wenn sie weiter keinerlei »Anstalten« machte, die Augen für einen Bräutigam offen zu halten, obwohl es – so die Mutter – fast eine Gotteslästerung sei, ihre Schönheit und Jugend so »dahingehen« zu lassen. Denn auch der feine Herr Münchner, für den sie im Auftrag Häberleins die Fossilien abzeichnete, hatte ihr den Hof gemacht und wäre für sie – so Toni scherzend – »nackert auf den Kirchturm gestiegen«, wenn er Babette damit hätte erobern können. Toni war es, der immer wieder stichelte, so wie jetzt beim Frühstück.
»Was zahlt dir denn der Doktor nun?«, fragte er.
»Ich weiß es noch nicht!«
»Dummerle! Meinst, ich geh in den Steinbruch und frag den Grafen nachher, was er mir zahlt? Nicht einmal ein trockenes Stück Brot würd er mir geben, wenn das vorher nicht ausgemacht ist!«
»Aber das ist ja auch was anderes bei dir … richtige Arbeit!«
»Papperlapapp! Wenn du Zeit im Dienst bei jemandem verbringst, dann ist das Arbeit. So oder so.«
»Schon, aber … ich mach’s doch auch so gern.«
»Das ist doch keine Arbeit nicht, als ob man im Sitzen von Arbeit reden könnt!«, warf der Vater ein.
Toni seufzte. »Ich hätt das in die Hand nehmen und den Doktor vorher fragen sollen, was er zahlt.«
»Jetzt ist es aber so, wie es ist … Und die ganzen Stifte, Farben und Papiere hab ich ja auch noch, das Geschenkte.«
Toni schüttelte liebevoll den Kopf, wie immer wenn er meinte, sie hätte wieder einmal gar nichts verstanden.
»Ich möchte nicht wissen, was der für ein Geschäft mit dir macht und was die Platten wirklich wert sind, die er unsereiner für ein paar Behandlungen abkauft!«
»Wenn die Gelehrten so viel für die alten Knochen bezahlen, dann ist ja nicht der Doktor dran schuld.«
Toni seufzte. »Ich versteh bloß nicht, warum er dich die ganzen Viecher abzeichnen lässt, wenn der Münchner doch extra da ist und alles in Augenschein nimmt.«
»Das hab ich auch schon überlegt. Vielleicht möchte er ein Andenken an die Saurier haben, und er behält die Zeichnungen und der Münchner nimmt die Platten mit.«
Toni lachte. »Dummerle! Der Doktor liebt die Viecher nicht, der liebt bloß Geld.«
Die Mutter kam in die Küche und ermahnte beide, zu gehen, die Uhr in der guten Stube hätte bloß noch nicht geschlagen, weil der Vater gestern vergessen hatte, sie aufzuziehen.
Babette nahm deshalb nicht den Wiesenweg, der in einem Halbrund am Dorfrand vorbei zum Haus des Doktors führte, sondern eilte über die Hauptstraße an den drei Wirtshäusern und der Kirche Wolkertsheims vorbei zu Häberlein. Dieser Weg war zwar schneller, aber ständig von Ratschweibern belagert, die sie nicht bloß flüchtig grüßen konnte, sondern mindestens auch einen Satz mit ihnen zu wechseln hatte. Nach »Ah, die Babette, wie geht’s uns denn?« oder »Ah, die Babette, wir haben schon gehört, was du alles für den Doktor machst!« oder »Ah, die Babette, fesch wie immer, hast jetzt eine Stellung?« brauchte die Siebzehnjährige deshalb über die kürzere Strecke fast genauso lang wie über den Wiesenweg.
In der Schreibstube blickte Babette stolz noch einmal auf all die Blätter in der Mappe mit Ledereinband. Nicht jede Zeichnung war zu ihrer vollen Zufriedenheit gelungen, aber manche Saurier hatten sich auch nicht vollständig im Jurastein verewigt, und wenn ein Körperglied fehlte – manchmal sogar ein Kopf –, sahen auch die Zeichnungen einfach nicht harmonisch aus. Am schönsten war der Pterodactylus geworden – ein Name, den ihr Häberlein gesagt hatte und über den sie jetzt noch kicherte. Auf welche Zungenbrecher die gelehrten Leute auch kamen!
Der Doktor lobte ihre Arbeit und steckte ihr Geld in die Schürzentasche. Der Münchner nahm die Mappe, bedauernd, dass er nur die Zeichnungen und nicht die Schönheit Babettes mit nach München nehmen könne. Doro bat die Freundin noch zu einem Tee auf ihr Zimmer und wusste das Neueste aus Eichstätt zu berichten. Abends war Toni mit der Bezahlung zufrieden – der Doktor hatte ihr so viel wie einen Monatslohn von Tonis Steinbrucharbeit zugesteckt.
»Das hätt ich dem Doktor nicht zugetraut, dass er so großzügig ist!«, bemerkte der Bruder und versprach, so schnell nicht mehr über den Arzt zu lästern.
Babette setzte die Arbeit fort, die sie vor drei Wochen liegengelassen hatte, und grub das letzte Beet im Garten um. Sie zählte die Schmetterlinge, die sie am Tag sah, und schlug manchmal ein Stündchen zum Zeichnen heraus. Der Frühling blieb mild, Babette begleitete die Freundin zwei Mal mit einem Brief vom Doktor nach Eichstätt zu einem Übersetzer, und zwei Burschen dort hätten – so Doro – Babette sofort einen Heiratsantrag gemacht, wenn die bildhübsche Freundin nur ein Auge für sie gehabt hätte. Oder warte Babette wirklich auf etwas viel Besseres, wie der Müller immer sagte? Sie müsse sich doch in ihrem Alter endlich einmal Gedanken um ihre Zukunft machen, mahnte Doro die Freundin fast so ernst wie die Mutter. Babette wartete aber nicht auf einen Besseren, wie der Müller und Doro meinten und die Mutter es wohl hoffte. Wenn Babette überhaupt auf etwas wartete, dann auf einen Schmetterling, denn heute hatte sie erst zwei gesehen und wollte deren Körper noch einmal genau studieren, um sie zeichnen zu können. Toni übernahm immer wieder Arbeiten wie Milch holen und Unkraut jäten für sie, damit sie in Ruhe das eine oder andere Bild im Gartenhäuschen fertigbekam. Zugleich geriet sich der Bruder immer wieder mit dem Vater in die Haare. Toni sprach von der »Ausbeutung der Steinbrucharbeiter«, der Vater von einer göttlichen Ordnung der Stände und davon, dass der Toni sich versündige. Der Vater schlug schließlich mit der Faust auf den Tisch.
»Noch mal sagst das nicht, solang du die Füß unter meinen Tisch stellst!« Alle verstummten, denn was der Vater sagte, das galt. Babette richtete ihre Augen auf das Nächstschöne, in diesem Fall in der heimischen Küche beim Frühstück auf den Laib Schwarzbrot, der der Mutter ganz rund und ohne Dellen gelungen war. Stumm aßen alle ihr Butterbrot, ehe der Vater und Toni sich auf den Weg zur Arbeit in den Steinbruch machten und die Mutter ihr auftrug, mit der Wäsche zur Altmühl zu gehen.
Wehmütig dachte Babette an die »Sonnenwochen« zurück und nannte sie die schönste Zeit ihres Lebens. Doch das korrigierte sie bald – denn es kam noch viel wunderbarer, als Babette es sich erträumt hatte.
»Babette, Babette!« Doro kam der Freundin auf dem Weg zur Sonntagsmesse die Dorfstraße entgegengerannt. »Schon wieder ist ein feiner Herr im Wirtshaus abgestiegen! Ein Engländer! Ein junger, fescher.« Toni, bei dem sich Babette untergehakt hatte, entgegnete spitz: »Und wenn er noch reich ist, dann wär er doch etwas für dich!«
»Papperlapapp!«, entgegnete Doro dem Bruder. »Das ist ein Ausländer und ein Protestant! Als ob man den heiraten könnt!«
»Und wozu dann die Aufregung, Doro? Macht der Vater vielleicht wieder ein gutes Geschäft?« Toni grinste über seine gelungene Provokation.
»Toni, bitte …« Babette strich dem Bruder besänftigend über den Arm, nicht dass die Frotzeleien der beiden noch zu einem Streit führten, reichte doch schon der ständige Widerspruch zum Vater.
»Schon gut«, lenkte Toni ein und erwiderte gleich wieder provozierend: »Du kannst ja schließlich auch nichts für deinen Alten!«
Doro sah Toni kurz fragend an, sie wusste offenbar nicht, wie sie das zu verstehen hatte, war sie doch die Tochter eines angesehenen Arztes, was sollte sie da für einen Makel haben? Aber eine Doro grübelte nicht über so einen Satz, sie zog Babette am Ärmel. »Komm schnell, dann sehen wir ihn vielleicht beim Auspacken aus der Postkutsche! Grad eben hat er noch mit dem Kutscher verhandelt. Der kann Deutsch! Stell dir vor, der kann Deutsch!«
Babette schaute zur Kirchturmuhr und löste sich von Toni. Sie waren früh dran, die Messe begann erst in einer Viertelstunde, also könnte sie Doro noch den Gefallen tun.
Er war wirklich ein feiner Herr im Frack, wie man schon von weitem sah. Er hatte einen Zylinderhut auf und einen roten Bart nur an den Backen. Babette und Doro kicherten darüber. War das eine englische Mode? Wenn ja, dann war sie scheußlich, so sah ein Mann ja fast wie ein Affe aus. Kichernd und unter den Augen der Ratschkatheln schlenderten die Freundinnen vor dem Wirtshaus zur Post an dem Fremden vorbei.
Der Engländer bezahlte gerade den Kutscher und griff zu seiner Reisetasche. Doch statt ins Wirtshaus zu gehen und sein Quartier zu beziehen, blieb er stehen und starrte Babette an. Selbst Babette bemerkte, was die Doro damit meinte, dass manchen Männern beim Anblick Babettes »schier die Augen aus dem Kopf fielen«. Die Siebzehnjährige senkte verschämt den Blick, hob ihn wieder und sah wieder weg – der Engländer hörte nicht auf, sie anzuschauen. War das eine englische Sitte? Plötzlich wurde der feine Herr ganz rot im Gesicht, stellte die Tasche ab und kam auf Babette zu. Doro stieß Babette mit einem Ellbogen leicht in die Seite, was so viel hieß wie »jetzt wird es aufregend«. Der Engländer nahm den Zylinder ab, strich sich kurz durch die feuerroten, geschneckelten Haare und verbeugte sich leicht vor Babette. »Entschuldigen Sie bitte vielmals meine Unhöflichkeit, Sie so anzustarren. Ihr Erscheinen hatte mich verzückt, und das Kleid, das Sie tragen, ist mir nicht bekannt. John Stuart Cumberland ist mein Name.«
Babette fiel kein einziges Wort dazu ein, doch sie suchte auch gar nicht danach, wie früher manchmal, wenn sie einfach verlegen war. Versteckt stupste Doro sie noch einmal an, Babette wusste aber immer noch nicht, was sie hätte antworten können, und auch der Engländer schwieg. Doro sprang höflich ein. »Keine Ursache, Herr Cumberland, haben Sie noch einen schönen Aufenthalt in Wolkertsheim! So ein Kleid heißt Dirndl, das tragen wir alle am Sonntag.«
Der Engländer ließ die Augen von Babette, drehte sich um und ging mit seiner Tasche ins Gasthaus.
Doro schüttelte nur noch den Kopf. »Hast du gesehen? Hast du gesehen? Ach, du merkst doch gar nichts, Babette!« Und schon plapperte die Freundin weiter – aber Babette hörte nicht zu, sie verstand kein Wort, ihr war ganz flau im Magen, und ihr Körper bebte leicht, so als stünde sie auf dem wackligen Steg über die Altmühl.
»Babette!« Doro zog sie Richtung Kirche. »Zählst du wieder Schmetterlinge? Wo bist du denn mit deinen Gedanken? Babette! … Komm! Die Messe fängt gleich an!«
Babette dachte schlicht gar nichts, war von der Schönheit einer sonnengelben Welt erfüllt und ging einfach der Freundin in die Kirche nach.
Die jungen Frauen setzten sich, wie es sich gehörte, auf die Weiberseite, bekreuzigten sich zum Messbeginn und lauschten den Worten des Priesters. Doch Babette war, als würde ein anderer Mensch in ihrem Körper das große Altarbild mit der Muttergottes sehen und den Pfarrer predigen hören. Nur schemenhaft nahm sie Vater und Mutter in der Kirche und die Holzfigur des heiligen Sebastians neben der Kanzel wahr – Babette sah immerzu diesen Engländer vor sich, seine Augen, seine seltsame Ausdrucksweise, seinen forschen Gang, sein rotes wuscheliges Haar und den seltsamen Backenbart. Hätte sie jemand nach dem Gottesdienst gefragt, worüber der Pfarrer gepredigt hatte – sie hätte es nicht sagen können. Und dieser seltsame Zustand mit dem flauen Gefühl im Magen hörte nicht auf! Ausgerechnet heute, wo die Mutter einen fetten Sonntagsbraten auftischen konnte, weil der Vater dem Metzger in irgendeiner Sache geholfen hatte, verspürte Babette keinen Hunger und legte nach zwei Bissen Messer und Gabel zur Seite. Wie gerne wäre sie gleich noch einmal zum Wirtshaus gerannt, um diesen Engländer wiederzusehen und von ihm erneut auf diese Art und Weise betrachtet zu werden! Aber das ging natürlich nicht, was träumte sie sich da schon wieder zusammen?
Babette stand vom Esstisch auf und ging in den Garten hinaus. Sie suchte etwas Schönes, um ihre Blicke darauf zu heften. Doch sie fand nichts außer den Augen des Engländers in ihrer Erinnerung. Um Gottes willen, schoss es ihr plötzlich in den Kopf, war das ein protestantischer Hexer, der sie mit einem Zauber belegt hatte und nicht mehr klar denken ließ?
Nein, dachte Babette am nächsten Morgen, als Toni ihr die Bettdecke wegzog, um sie zu wecken, nein, das war nur eine affige Begegnung gewesen, denn das flaue Gefühl im Magen hatte nachgelassen und einer gehörigen Portion Appetit Platz gemacht. Außerdem war der Engländer gar nicht so jung, wie Doro behauptet hatte, sondern mindestens schon fünfundzwanzig. Nein, überlegte Babette, keiner konnte so mir nichts, dir nichts hexen, auch kein Engländer mit feuerroten Haaren. Die älteren Schwestern Zensi und Loni hatten – als sie noch im Haus waren – zudem einmal gesagt, dass ein Weib im Grunde genommen mehr Macht über ein Mannsbild habe, weil die Frauenzimmer die Mannsbilder verhexen konnten und nur selten umgekehrt. Aber kannten die Schwestern überhaupt die Welt der träumerischen Phantasien und fabelhaften Begegnungen? Vernünftig hatten sie sogar dem Wunsch der Mutter beigepflichtet, die immer sagte: »Erst kommt die Sach und dann die Liab«, und die Mannsbilder geheiratet, die Vater und Mutter für angemessen gehalten hatten, obwohl andere im Dorf sich längst nicht mehr verkuppeln ließen, sondern nach der Liab heirateten.
Babette kleidete sich an und fragte den Bruder: »Warst du eigentlich schon einmal verliebt?« Toni sah sie ungläubig an und prustete vor Lachen.
»Schwesterlein, mit siebzehn Jahren auch schon entdeckt, dass nicht der Storch die Kinder bringt?« Babette ließ sich von seinem Lachen anstecken und schlug ihm trotzdem »zur Strafe« ein Kissen an den Kopf.
An diesem milden Frühlingstag erledigte Babette brav alles, was ihr die Mutter auftrug. Sie säuberte den Brunnen im Garten, kalkte den Brotbackofen hinter dem Haus neu und ging zum Müller, um Mehl zu kaufen. Je näher sie auf ihrem Weg dem Wirtshaus kam, desto flauer wurde ihr wieder im Magen. Doch wie immer half es, ihren Blick auf das Nächstschöne zu richten – es war der goldfarbene Gockel auf dem Kirchturm, den sie noch nie genauer angesehen hatte. Babette blieb stehen und schaute nach oben, bis ihr plötzlich so war, als würde sie jemand beobachten. Sie drehte sich um und sah, wie jemand im Gasthaus im ersten Stock ein Fenster öffnete. Babette eilte weiter über die Mühlbachbrücke an der Statue des heiligen Nepomuk vorbei zum Müller, dessen ekliger Sohn Gott sei Dank nicht da war, kaufte Mehl und vermied auf dem Rückweg, am Wirtshaus vorbeizugehen. Sie nahm den Wiesenweg, der in seinem Halbrund außerhalb des Dorfes an zwei kleinen Hölzchen entlangführte. Babette hielt das Mehl gut fest, als sie über die vierzehn Felsplatten auf dem Weg hüpfte. Seit ihrer Kindheit freute sie sich und deutete es als gutes Zeichen, wenn ihr die Sprünge über die Platten gelangen. Kam sie jedoch mit den Beinen auf dem Rand wie bei einer Linie des Kästchenhüpfens auf und hatte bei über der Hälfte der Felsplatten »verloren«, sagte sie sich am Ende des Weges, das sei doch bloß ein kindischer Aberglaube – um es beim nächsten Mal erneut zu probieren. Mit dem Mehl in der Hand schaffte sie heute elf gelungene Sprünge und zählte zudem acht Schmetterlinge auf dem Weg. Sie überlegte, ob sich eigentlich seinerzeit Vater und Mutter ineinander verliebt hatten oder auch erst die Sach und dann die Liab gekommen war.
Am späten Nachmittag zeichnete sie mit dem neuen Material vom Doktor einen Specht, der nicht aufhören wollte, den Kirschbaum im Garten abzuklopfen. Mit den weichen Stiften, die sie bisher gar nicht gekannt hatte, gelangen Babette feine Schattierungen und fließende Übergänge, die sogar die Mutter zu einem »schön« bewogen. Beim Abendgebet vor dem Essen kam Doro in die Küche der Gründlingers gestürmt, grüßte außer Atem und erklärte freudestrahlend, dass der Vater sie schicke und Babette wieder brauche, noch einmal sollte sie die ganzen Fossilien für den Engländer abzeichnen und dafür auch wieder gebührend entlohnt werden. Babette strahlte. Die nächtlichen Träume waren sonnengelb.
Nach nur einer Woche Pause nahm Babette ihren Dienst in der Schreibstube des Doktors wieder auf. Die Hände waren in Übung, flink zeichnete sie schon am ersten Tag fünf Fossilien zu ihrer eigenen Zufriedenheit ab. Zweimal kam Doro mit Tee und Keksen herein und forderte vehement einen kurzen Ratsch, dieses Mal wollte sie nicht komplett auf ihre Freundin verzichten, bloß weil der Doktor sie wieder eingespannt hatte. Während der zweiten Teepause hörten die beiden Freundinnen draußen auf dem Flur Häberlein mit jemanden sprechen, der Stimme nach mit dem Engländer. Der Doktor öffnete die Tür und stellte Babette offiziell vor als »Gründlinger Babette«, so als wäre sie keine einfache Magd, sondern so etwas wie seine Tochter. Der Engländer feixte, er hätte die reizende Bekanntschaft schon gemacht und sich seinen guten Ruf bei der Dame bereits verscherzt. Babette lächelte, grüßte mit einem Knicks, der Doktor zog den Engländer wieder mit sich, und Babettes Magen wurde bei weitem nicht mehr so flau wie beim ersten Treffen. »Jetzt hat er nimmer so geschaut!«, kommentierte Doro den kurzen Auftritt und wechselte das Thema zum neuen Pferdeknecht des Grafen von Pappenheim, der – obwohl noch so jung – schon diese Position innehatte und wirklich fesch aussah.
Es war noch hell, als sich Babette zufrieden mit ihrem Tagwerk auf den Heimweg machte. Beim Huber-Bauern holte sie Milch, wie die Mutter es ihr in der Früh aufgetragen hatte und woran die leere Milchkanne sie gerade noch rechtzeitig erinnerte. Von dort aus nahm Babette den Wiesenweg, nicht nur um den Ratschweibern zu entgehen, sondern auch wegen der Schönheit der Blühpflanzen im Mai. Gelb, lila, rosa, fliederfarben, blau, weiß und dunkelrot standen die Blumen zwischen dem satten Grün, so als hätte der Herrgott mit den teuersten Farben Wolkertsheims Umgebung gesprenkelt. An der Gabelung zum Eichstätter Hölzchen entdeckte sie eine besonders schöne Gruppe von Frühlingsknotenblumen, stellte die Milchkanne ab und pflückte sie. Sie würde sie auf den Küchenkasten stellen, das machte doch jedes Zuhause schöner.
»Guten Tag!«, sagte eine Stimme hinter ihr. Babette zögerte, sich umzudrehen, und starrte auf die Frühlingsknotenblumen in der Hand. Die Stimme gehörte zum Engländer, und überhaupt würde niemand sonst hier »Guten Tag« sagen, sondern »Grüß Gott«. Das flaue Gefühl im Magen setzte auf der Stelle wieder ein. Babette drehte sich um, erhob sich, vergaß den Knicks und sagte: »Grüß Gott.«
»Schön, Sie so schnell wiederzusehen!«, sagte John. Ohne eine Doro neben sich war Babette verlegener denn je.
»Übrigens habe ich Sie neulich auch beobachtet. Da blickten Sie zum Kirchturm, so lange! In der Tat eine seltsame Tatsache, dass man Federvieh auf Kirchendächer stellt.«
Babette nickte und kicherte. Wie der sprach, der Engländer, wie lustig die deutschen Wörter aus seinem Mund klangen.
Auch Cumberland lächelte breit. Was für strahlende Augen dieser Mann hatte. Und komischerweise fand sie plötzlich auch den Backenbart nicht mehr affig, sondern zu ihm passend.
Beiden fiel daraufhin nichts mehr ein, was zu bereden gewesen wäre, man stand da und schwieg, hob und senkte die Blicke und lächelte.
»Darf ich Sie zu einem Tee einladen, oder ist das hierzulande ebenso unschicklich wie bei uns, so ein Antrag?«, fragte John schließlich.
»Ja, das ist es.« Babette hatte eigentlich noch nie darüber nachgedacht, aber natürlich konnte sie sich nicht von einem Wildfremden einfach so ins Wirtshaus einladen lassen.
»Aber darf ich Sie wenigstens ein kleines Stück des Weges begleiten?«, fragte John Stuart Cumberland.
»Ja, gerne!«, hörte sich Babette sagen.
Die Strecke bis zur nächsten Gabelung dauerte schließlich statt der üblichen zehn Minuten fast eine Stunde. Immer wieder blieben sie stehen, wenn Babette einen schönen Schmetterling sah und »Da, sehen Sie!« rief. Sie erklärte dem Engländer, was ein Zitronenfalter und ein Pfauenauge waren und wie häufig sie hier vorkamen. Das beeindruckte ihn offenbar, denn er rief begeistert: »Sie sind ja eine kleine Naturforscherin!« Babette lachte, aber der Engländer hatte das ernst gemeint, er wisse, wovon er spreche, denn Naturforschung sei im weitesten Sinne sein Beruf. Ursprünglich zum Arzt ausgebildet, sei er heute an der Universität als Assistent eines großen Wissenschaftlers und dabei, eine Arbeit zu schreiben, um selbst Professor zu werden. Aber Babette brauche nicht zu glauben, um sein Ansehen stünde es zum Besten, im Gegenteil. Die etablierten Kollegen würden ihn und ein paar andere Wissenschaftler verspotten und lächerlich machen, weil sie einer neuen Theorie anhingen, der Darwins.
»Was meinen Sie mit Theorie, und was ist Darwin?«, fragte Babette.
Cumberlands Augen begannen zu funkeln, und er erklärte, dass Darwin herausgefunden habe, dass sich eine Art aus der anderen entwickelte und nicht Gott zu einem bestimmten Zeitpunkt Vögel, Fische oder Säugetiere geschaffen habe, sondern man vielmehr gemeinsame Vorfahren hätte. So stamme der Mensch wahrscheinlich auch vom Affen ab.
Babette lachte. Auf diese Idee war der Engländer wohl gekommen, weil er selbst so affig aussah, dachte sie, aber sprach das natürlich nicht aus. John Cumberland schmunzelte und sprach über Eigenheiten bestimmter Arten und Charakteristika einzelner Menschen. Manchmal gebe es seltsame Abweichungen und die setzten sich dann durch, weil sie für das Überleben von Vorteil seien. Wieder andere Mutationen führten zu nichts, aber da experimentiere die Natur gewissermaßen. So wie mit ihm selbst – er könne weder Kälte noch Wärme richtig empfinden und kleide sich einfach immer so, wie andere Menschen es tun, im Winter mit Stiefeln und im Sommer ganz leicht.
Babette staunte. »Dann können Sie im Winter einen Schneepalast mit bloßen Händen bauen? Und im Sommer auf einer Wiese liegen und träumen, ohne von der Sonne braungebrannt zu werden?«
So einfach sei das leider nicht, erklärte John, die Folgen von Kälte und Hitze spüre er durchaus, als Kind sei ihm einmal fast eine Zehe erfroren, es sei zwar nicht tragisch, aber hinderlich, wenn der Körper nicht warnen kann.