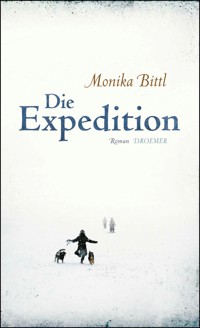9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In "Jünger wären mir die Alten lieber" nimmt sich Bestseller-Autorin Monika Bittl ("Ich hatte mich jünger in Erinnerung") ein Thema vor, das früher oder später auf uns alle zukommt: Die Eltern werden alt, und wir machen eine Rolle rückwärts ‒ jetzt kümmern wir uns um sie, statt sie sich um uns. Das kann man tragisch oder komisch sehen. Monika Bittl hat sich für den Humor entschieden, denn ein Leben als Senioren-Tochter ist höchst anstrengend, aber auch voller Überraschungen. In unterhaltsamen Alltagsgeschichten erzählt sie vom Abenteuer, in einem Sammlerhaushalt Steuerunterlagen zu finden, vom Aufschrei der Mutter: "Ich geh nicht ins Gedächtnistraining, da sind doch nur alte Leute!", vom eigenwilligen Ergebnis eines Briefings zum Besuch des Pflege-Gutachters ‒ "Ich soll sagen, dass es mir schlecht geht!" ‒ und davon, wie Google Übersetzer bei der Arbeit mit osteuropäischen Pflegekräften zur besten Freundin wurde. "Jünger wären mir die Alten lieber" ist ein wunderbares Buch für alle, die sich um ihre alt werdenden Eltern kümmern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Monika Bittl
Jünger wären mir die Alten lieber
Lese-Booster für Frauen, deren Eltern in die Jahre kommen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Ich brauch keinen Rollator! Ich hab eine Tochter!«
Wenn die Eltern alt werden, machen wir eine Rolle rückwärts – jetzt kümmern wir uns um sie statt sie sich um uns. Das kann man tragisch oder komisch sehen. Bestsellerautorin Monika Bittl hat sich für den Humor entschieden, denn ein Leben als Seniorentochter ist höchst anstrengend, aber auch voller Überraschungen. In unterhaltsamen Alltagsgeschichten erzählt sie vom Abenteuer, in einem Sammlerhaushalt Steuerunterlagen zu finden, vom Aufschrei der Mutter: »Ich geh nicht ins Gedächtnistraining, da sind doch nur alte Leute!«, vom eigenwilligen Ergebnis eines Briefings für den Besuch des Pflegegutachters: »Ich soll sagen, dass es mir schlecht geht!«, und davon, wie der Google Übersetzer bei der Arbeit mit osteuropäischen Pflegekräften zur besten Freundin wurde.
Inhaltsübersicht
Vorwort
Ich gebe mein Bestes
Das Haus verliert nichts …
Stellenausschreibung
Laaangweilig
Werd bloß nicht erwachsen, das ist eine Falle!
Bei Zeus! Die lieben sich wirklich
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben 100000 Euro gewonnen!
Die K-Frage
Was du heute kannst besorgen, das verschieb auch mal auf morgen
Tischdecken & Krankenbetten
Spießer, Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll
Ordnung ist das halbe Leben
Dein Papa ist das Nilpferd
Aktenzeichen XX ungelöst
Das blaue Dirndl
Echte Kerle lieben Autos
Schokoladenseiten der Familienbande
Sommer, Sonne, Schlafanzug
Interview mit einem Vampir
Schlüsselerlebnis
Fragen über Fragen zu den Fragen
Wie geht es Ihnen?
Alltägliche Abenteuer
Tante Lici*weiß haargenau Bescheid – und zwar zu jedem Thema
Die fabelhafte Prinzessin
Intelligenztest
Dealen für die Mama
Bruderherzchen, hör mal!
Ich geh nicht ins Gedächtnistraining, da sind nur alte Leute!
Die Liebe in Zeiten von Corona
Wen die Götter lieben
Woher kennen wir uns?
Vorwort
Uns Frauen der »Generation Seniorentochter« macht normalerweise so schnell keiner was vor – nicht mal mehr wir uns selbst. Nach den persönlichen Verunsicherungswellen der ersten Jahrzehnte unseres Lebens sind wir endlich stark, souverän und selbstbewusst geworden. Wir haben miese Chefs, exorbitante Steuernachzahlungen, Arbeitslosigkeit und schlaflose Nächte mit Kleinkindern überlebt. Wir haben unmögliche Typen vor die Tür gesetzt, bleiben mit weniger unmöglichen Männern zusammen oder geben als Single nicht mehr jedem Kerl die richtige Handynummer. Wir sehen Konflikte als Gratisfortbildungen und haben vor allem auch gelernt, »Nein« zu sagen – in erster Linie zu all den Dieben, die uns unsere Zeit stehlen wollen wie nervige Bekannte, energieraubende Verwandte oder arrogante Kollegen. Wir durchschauen Manipulationsmethoden, Marketingtricks und Machtspielchen und machen bisweilen trotzdem noch all den Blödsinn, für den uns mit zwanzig bloß das Geld gefehlt hat – aber mangels psychischer und physischer Kondition nur noch eine Stunde am Tag. Kurzum: Wir sind endlich erwachsen geworden und haben nun sogar die menschliche Reife, das Richtige zu tun, obwohl es unsere Eltern empfohlen haben.
Doch dann klingelt mitten in unserem epochalen Höchststand des Selbstbewusstseins plötzlich das Handy und wir erhalten Anrufe wie diese: »Du, dem Papa geht’s nicht so gut, kannst du mal kommen?«, oder: »Hier ist das Klinikum Neustadt, wir haben den Seelsorger zur Krankensalbung Ihrer Mutter geholt«, oder: »Müller, Josef, der Nachbar. Wenn du nicht endlich das Löwenzahnproblem im Garten deiner Alten behebst, zeigen wir sie an! So geht das nicht mehr weiter, da wachsen jetzt schon drei Stück! Die ruinieren uns noch das ganze Grundstück mit dieser Verwahrlosung daneben.«
Solche Nachrichten schrecken uns leider nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft hoch. Plötzlich wird uns klar, dass eine neue Lebensphase beginnt und uns nun möglicherweise jeden Moment noch schlimmere derartige Hiobsbotschaften erreichen könnten. Wir stehen vor emotionalen und organisatorischen Herausforderungen der Extraklasse: Wie sag ich meinen Eltern, was sie tun sollten? Wie bekomme ich Job, Haushalt und Familie mitsamt botanischer Fortbildung (Stichwort »Löwenzahnbekämpfung«), Krankenhausbesuchen, Finden von Steuerunterlagen in einem Sammlereinfamilienhaus, Handy-Einweisungen (»Die grüne Taste ist zum Abnehmen«) oder gar die Erforschung eines unbekannten Universums namens »24/7-Pflege« unter einen Hut?
Da wir als mitten im Leben stehende Frauen gelernt haben, Lösungen zu suchen, statt Probleme zu wälzen, bleiben wir bei den praktischen Herausforderungen meist noch ganz gelassen – nach dem Motto: »Bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal.« Weniger entspannt können wir jedoch mit all den Emotionen umgehen, die uns plötzlich überrumpeln. Gefühlsstürme, von denen wir glaubten, wir hätten sie nach der Pubertät daheim im Kinderzimmer zurückgelassen und sie würden dort für immer vor sich hin gammeln, wühlen uns auf. Wir kommen den Eltern mit all ihren guten und schlechten Seiten wieder näher, als uns lieb ist – nur unter anderen Vorzeichen. Während wir damals riefen: »Sie wollen nur unser Bestes, aber das kriegen sie nicht!«, fragen wir uns heute: »Wie kriege ich es hin, ihnen mein Bestes zu geben?«
Der Satz »Kinder wissen, wie anstrengend es ist, Eltern zu haben« erhält plötzlich eine neue, tiefere Dimension. Während wir damals die moralische Instanz der Eltern mit ihren Geboten und Verboten ganz selbstverständlich mit einem »Die können mich mal!« in die Tonne gestampft haben, geben wir nun selbst den inneren Moralapostel und liefern uns einem ewig schlechten Gewissen aus, nicht genug zu tun. Wir fühlen uns wie missratene Töchter, egomanische Karrierefrauen oder rücksichtslose Verteidigungsministerinnen unseres eigenen Lebens (und haben nicht mal sieben Kinder oder einen Regierungsauftrag dazu in der Hinterhand), obwohl wir unseren Kids jahrelang erklärt haben: »Das schlechte Gewissen schadet dir nur und bringt anderen gar nichts.«
Wo und wie war das noch mal mit der weiblichen Emanzipation? Wir sind doch bisher so selbstsicher geworden wie keine Frauengeneration vor uns. Wir haben Alice Schwarzer gelesen, den Mount Everest bestiegen und sind sogar Vorstandsvorsitzende und Bundeskanzlerin geworden. Wir haben den Männern ein IN oder ein *angehängt und mit unserer Lebenserwartung nach der Entdeckung des Kindbettfiebers die Männer statistisch abgehängt. Wir kämpfen zwar immer noch damit, Kind, Küche, Kerl und Karriere unter einen Hut zu kriegen, aber haben wenigstens die Freiheit, uns mehr oder weniger ohne gesellschaftliche Ächtung aussuchen zu können, wie wir das gestalten. Wir können Hausfrau werden, ein Kindermädchen engagieren, Karriere machen, Stütze als Alleinerziehende beantragen oder – wie im Normalfall – einen ganz persönlichen Mix aus alldem leben, je nachdem, was für uns ganz individuell das Beste ist. Wir haben sogar gelernt, diese Freiheit mit einer großen Toleranz zu verteidigen und anderen Frauen nicht mehr vorzuschreiben, dass sie »daheim bleiben« oder auf Kinder zugunsten von Karriere verzichten oder sie sich wahlweise in Blümchenschürze oder lila Latzhosen kleiden sollten. Klar lästern wir nach wie vor gerne über Birkenstocksandalen oder alternativ High Heels ab – aber das ist uns als privater Spaß bewusst, jenseits der Errungenschaften unserer weiblichen gesellschaftlichen Erfolgsgeschichte, hinter der wir alle gemeinsam stehen. Wir wissen, dass das Private auch politisch und ein löwenzahnloser Garten der Eltern ein Normdruck auf die Mutter ist.
Doch dann erwischt es uns eiskalt, wenn die Eltern plötzlich Fürsorge oder gar Pflege brauchen. Wenn wir eine Rolle rückwärts machen und nicht mehr die Kinder von starken Erwachsenen sein können, sondern plötzlich starke Kinder für schwächer werdende Erwachsene sein müssen – wenn die Eltern fast wieder wie Kinder werden. Statt dass Mama und Papa uns sagen, was wir tun und lassen sollten, müssen wir nun bisweilen auf einmal für sie entscheiden, was sie lieber tun oder lassen sollten. Manchmal aus dem Stand heraus – meist jedoch in einem schleichenden Prozess, verbunden mit Schuldgefühlen, uns zu wenig um die Alten zu kümmern.
Für diese neue Lebensphase haben wir im ersten Moment kein Konzept oder gar Rezept. Strukturen, Mechanismen und Befindlichkeiten, von denen wir bis dato dachten, wir hätten uns längst davon emanzipiert, greifen uns plötzlich aus dem Hinterhalt an. »Plötzlich« – denn die Familienplanung oder die Karriere konnten wir mit der Pille oder Bewerbungsschreiben aktiv beeinflussen. Der Alterungsprozess unserer Eltern aber lässt sich nicht einfach in ein Terminbuch eintragen, selbst wenn er längerfristig absehbar ist. Wir haben zwar abstrakt »irgendwann einmal« immer damit gerechnet, dass »was auf uns zukommt« – aber doch nicht schon jetzt! Und ehe wir’s uns versehen, sprechen wir plötzlich mit so unbekannten Wesen wie Geriatrieärzten, verstehen Sanitätshäuser nicht mehr falsch als Installateurbetriebe und kennen bürokratische Monster wie Witwenrentenanträge.
Männer nehmen sich jetzt zwar auch öfter »Elternzeit« – aber nur für die Kinder. Bis zu einer fairen Aufteilung der Pflege der »Alten« haben wir Frauen die Emanzipation noch nicht vorangetrieben. Denn noch immer sind es hauptsächlich die Töchter, die sich um Vater und Mutter kümmern. Wer Glück hat, versteht sich mit den Geschwistern oder nahen Verwandten gut und teilt sich mit ihnen die Verantwortung. Auch Freunde, nette Nachbarn, ein gutes Netzwerk vor Ort oder eine »Dr. med. Cousine« sind ein Segen. Und alle eigenen Gefühle – auch die negativen – wertneutral zuzulassen stärkt uns enorm, weil wir mit diesem Eingeständnis einen ersten Schritt dahin machen, Krisen auch als Chancen zu verstehen – eine Binse, die wir jetzt aber souverän auch zulassen können, weil wir uns diese Einsicht selbst hart erarbeitet haben und sie anwenden können.
Ohne es im ersten Moment zu verstehen, finden wir uns als »Generation Seniorentochter« meist irgendwann in einer Lage wieder, auf die uns niemand vorbereitet hat: Wir zehren uns in Fürsorge auf und ignorieren dabei unsere Grenzen. Wir lieben Mama und Papa, wollen zurückgeben, was sie uns einst gegeben haben, und blenden die Implikationen der »Rolle rückwärts« aus. Denn wir haben zwar im Laufe unserer Emanzipationsgeschichte gelernt, was es heißt, eine gute Mutter zu sein: eine, die auch ihre eigenen Bedürfnisse sieht und sich nicht bloß aufopfert. Dass wir im Notfall wie im Flugzeug zuerst uns und dann erst den Kindern die Sauerstoffmaske anlegen sollen und der alte Hebammenspruch stimmt: »Dem Kind geht es gut, wenn es der Mutter gut geht – und nicht in umgekehrter Reihenfolge!« Was wir aber nicht gelernt haben: dass es sich mit einer »guten Tochter« ähnlich verhält wie mit einer »guten Mutter«. Dafür haben wir keine Orientierung an Rollen-Vorbildern, sondern nur die verinnerlichten Stimmen gehässiger Verwandten im Ohr: »Diese undankbare Göre lässt die Eltern in Stich und zieht nicht zu ihnen zurück oder holt sie zu sich heim!«
Oft lässt sich die Entwicklung der in die Jahre kommenden Alten in drei Phasen einteilen: 1. Schleichende Verschlechterung, 2. Dramatische Verdichtung mit Krankenhausaufenthalten, 3. Pflegesituation.
In diesem Buch gibt es zu all diesen Entwicklungen Geschichten in abwechslungsreichen Formen. Die Kapitel hier berichten aber nicht tragisch von einem sich stets verschlimmernden Verfall, sondern vom Suchen und Finden des Humors selbst in schlimmsten Lebenssituationen – und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe alle drei Stadien mit meinen beiden Elternteilen durchlebt. Ich weiß, was es bedeutet, sich nach ausuferndem »Krankenhaus-Hopping« nicht über fünf verlorene Kilos zu freuen. Ich weiß, was es bedeutet, wenn ungeputzte Fußböden plötzlich so unwichtig werden wie der sprichwörtlich umgefallene Sack Reis in China. Wenn aufmunternde Worte bedeutsamer werden als jeder kleine Lottogewinn. Und was einen dazu bringt, sich eines schönen Sommertags ganz alleine vor ein Café zu setzen, sich einen Cappuccino zu bestellen und schlicht das lebendige Leben »da draußen« jenseits von Krankheit und Pflege samt dem eigenen Dasein für den Moment zu genießen.
Ich weiß, was das heißt: Nachdem schon Jahre dieser beispielhafte Löwenzahn im Garten meiner Eltern mitsamt meinem schlechten Gewissen prächtig gedieh, kam mein Vater mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus, eine Woche darauf meine Mutter mit der Diagnose Herzinfarkt – in ein anderes Krankenhaus, beide jeweils in unterschiedlichen Richtungen hundertfünfzig Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Ich funktionierte nur noch wie ein Automat bei Autofahrten, Arztgesprächen, dem Ausräumen eines Sammler-Haushalts, um Platz zu schaffen für eine bald einziehende Pflegekraft, bei Besuchsorganisationen oder Verhandlungen mit dem Stromanbieter, weil die Rechnung in dem Wirrwarr nicht bezahlt worden war und keiner mehr einen Überblick über die Papiere hatte. Mein Vater konnte sich zwar relativ gut vom Schlaganfall erholen, aber die bereits fortgeschrittene Demenz bekam einen größeren Schub. Die Diagnose Herzinfarkt bei meiner Mutter war zwar falsch – aber nach Wochen und Monaten ständig neuer Hiobsbotschaften von Kalibern wie Nierenversagen oder Magendurchbruch stellte sich heraus, dass die Grundursache in einem metastasierten Krebs lag, der nicht mehr therapierbar war.
Ich fuhr die Arbeit gegen null zurück und »vernachlässigte« Mann, Freunde und große Kinder – wie zuvor gefühlt die Eltern jeweils wegen der anderen Bereiche. Ich schwankte zwischen Verzweiflung, Verzagtheit und Überforderung.
Bei einer jener Fahrten zum Krankenhaus legte sich aber plötzlich ein Schalter in meinem Kopf um. »Nein, das kann es nicht sein!«, sagte ich mir. »Aber was kann eigentlich nicht sein?«, schloss sich als Frage an. »Was genau kann nicht sein?« Es kann nicht sein, den natürlichen Lauf der Welt – dass die Eltern älter und gebrechlicher werden – so tragisch zu sehen und dabei nicht mehr über dich selbst und deine Situation lachen zu können! He, das hast du doch sonst auch noch immer gekonnt!
Vielleicht resultiert mein persönliches »Heureka« auch aus einer mir von meinen Eltern in die Wiege gelegten, grundsätzlich positiven Lebenseinstellung, die mir bis dahin gar nicht so bewusst war, oder meiner Liebe zum (schwarzen) Humor. In der Kombination bewirkt beides, dass ich nach einem ersten Strudel von Ereignissen auch mal einen Schritt zurücktreten konnte, um die Lage von außen anzusehen. Humor erzeugt die Distanz, sich selbst und den kleinen Radius nicht ganz so wichtig zu nehmen. Vielleicht spielt dieser Hintergrund aber auch gar keine Rolle, sondern ist schlicht der Weisheit zu verdanken: Wenn ich die Umstände auch nicht ändern kann, so doch meine Haltung zu ihnen.
Denn man kann alles tragisch sehen – oder auch komisch. Der humorvolle Blickwinkel verändert nachhaltig die eigene Lebensqualität und -freude ganz nach dem Motto: Lachen ist die beste Medizin!
Ich kann mich über »Löwenzahnnachbarn« ärgern – oder mich über die Mehrheit der anderen hilfsbereiten Nachbarn mit ihrer menschlichen Wärme freuen, die mich zu Tränen rührten, weil sie Mama und Papa wie selbstverständlich mit Autofahrten zu Ärzten unterstützten. Ich kann besserwisserische Tanten meine Gedanken beherrschen lassen – oder das Thema offen ansprechen und mit der Mama endlich ganz befreit über deren Art ablästern. Ich kann Pflegegutachterinnen als meine natürlichen Feinde sehen – oder mit einer von ihnen gemeinsam feststellen, dass alles im Leben seinen Preis hat und nur kleine Kinder oder Männer glauben, es gäbe Schokoladeneis ohne Hüftgold, ein Plus auf dem Girokonto ohne arrogante Chefs oder gar Feen, die unsere Wohnung putzen, während wir schlafen.
Jünger wären mir die Alten zwar auch jetzt noch lieber, aber ohne all die Herausforderungen mit den lieben Senioren würde ich auch viele menschlich wertvolle Erfahrungen, neue Erkenntnisse und urkomische Erlebnisse missen.
Ich gebe mein Bestes
In meiner Jugend gab es den Spruch: »Sie wollen unser Bestes, aber das kriegen sie nicht.« Heute würde ich ihn mit Blick auf meine alternden Eltern dahingehend korrigieren: »Ich gebe mein Bestes, aber sie wollen es nicht.«
Mama und Papa weigern sich einfach standhaft, meine Vorschläge anzunehmen.
Statt weiter schwere Lebensmittel auf dem Fahrrad heimzutransportieren, könnten sie doch einen Lieferdienst beauftragen!
Statt immer eigens zur Bank zu gehen, um Geld abzuheben, könnten sie doch eine EC-Karte verwenden!
Statt vier Stunden Zugfahrt zum alten Zahnarzt in Kauf zu nehmen, könnten sie doch einen ortsansässigen Dentisten konsultieren!
Statt die selbst gestrickten Socken von Tante Lici als Geschenk anzunehmen und sich deshalb mit gefühlt 276 selbst gebackenen Torten erkenntlich zeigen zu müssen, könnte doch über meinen Internet-Account warme Beinkleidung, die nicht kratzt und noch dazu auch passt, für nur sieben Euro das Paar erworben werden!
Statt die Treppe hinunter im Haus zu nehmen, könnte man doch den elektrischen Türöffner mit Sprechanlage verwenden!
Das müsste ja nicht für immer so sein – aber sie könnten es doch wenigstens einmal ausprobieren!
Nein, auch dieser rhetorische Trick zieht nicht.
Ich höre wahlweise: »Das haben wir immer schon so gemacht«, oder: »Lass mal, das passt schon!«, oder: »Solange es uns noch so gut geht!«
Also gut, denke ich mir dann meist, verkneif dir diese Vorschläge, es ist ja auch deren Leben, misch dich nicht in alles ein! Die sind nun wirklich alt genug, um schon zu wissen, was sie tun.
Aber dann fällt doch alles wieder auf mich zurück, wenn das Fahrrad einen Platten hat, die Bankfiliale am Ort schließt oder wie damals, als Papa im Eifer des Gefechts eine Treppenstufe hinunterstürzte, weil eben kein Türöffner mit einem Knopfdruck die Tür für den Besuch ganz leicht hätte öffnen können. Als ganz normale Erzählungen getarnte SOS-Telefonate der Eltern berichten dann ausführlich von den Widrigkeiten des Alltags. Und ich schlage einmal mehr etwas vor – nur damit es zwei Tage später wieder verworfen wird.
Ü-70-Personen scheinen jedenfalls in einer erneuten Trotzphase zu stecken – hoch beratungsresistent, und nur bloß nix von den Kindern (wie umgekehrt vormals von den Eltern) annehmend.
»Das haben wir immer schon so gemacht«, sagen die Alten. »Ich lass mir doch von dir nicht das Leben diktieren«, sagen die Jungen zu uns. So haben diese beiden Generationen plötzlich einen neuen gemeinsamen Schnittpunkt. Weil sie ein gemeinsames Feindbild haben, nämlich uns, die pragmatischen Macher der Zwischengeneration, die sich Rebellion nicht erlauben können, weil sie einfach funktionieren müssen? Verstehen sich deshalb Enkel und Großeltern bisweilen so gut? Ach herrje, vielleicht ist das Schlimmste an alternden Eltern, selbst zu einer Buhfrau zu werden, fast so, als wären Mama und Papa nun die neuen, alten Kinder, die sich trotzig an der Supermarktkasse aufführen und denen man mit einem kühlen Kopf begegnen muss.
Da bleibt mir nur darauf zu warten, irgendwann auch wieder in das rebellische James-Dean-Alter zu kommen, von dem es heißt: »Denn sie wissen nicht, was sie tun.«
Das Haus verliert nichts …
… aber es gibt auch nichts her!
Meine Eltern haben als typische Vertreter der Nachkriegsgeneration immer schon ein anderes Verhältnis zum Konsum gehabt als ich. Während ich tendenziell mehr auf »Klasse« denn auf »Masse« stehe (Handtaschen, Gürtel und Schuhe ausgenommen, ich bin eine Frau! Und auch jede kluge Frau hat ihre Achillesferse), also lieber eine kleine Flasche Olivenöl aus der Toskana statt fünf Packungen billiges Fett vom Lidl in meinem Vorratsschrank beheimate, war für Mama und Papa das »Haben« an sich immer mehr wert als das »Nichthaben«.
Komisch eigentlich, denn sie haben mir zugleich immer »gepredigt«, dass »Verzichten« auch ein Wert an sich sei, den sie im Gegensatz zu mir noch gelernt hätten, denn unsere Generation käme nicht mehr damit zurecht, wenn es mal an etwas mangeln würde. »Klar!«, hab ich irgendwann einmal gerufen, als beide noch gesund und fit im Haus waren. »Euch wird es nie wieder an etwas mangeln, denn ihr baut vor – in dieser Speisekammer werden noch die Urururenkel einmal satt, es sei denn, die Haltbarkeitsdaten der Lebensmittel sind dann nicht noch weiter abgelaufen, als sie es jetzt schon sind!«
In guten Stunden nenne ich das »Eichhörnchentrieb« – wenn ich aber mies drauf bin, habe ich die Bilder vor Augen, die ich mal im Fernsehen zu Messies sah: Da waren die Wohnungen und Häuser so vollgestopft mit alten Flaschen, Zeitungen und sonstigem Abfall, dass es nur noch schmale Durchgangswege innerhalb der einzelnen Räume gab. Also, so weit sind meine Eltern noch lange nicht. Wobei … wenn ich mein ehemaliges Jugendzimmer betrete, frage ich mich zunehmend … Aber gut, ich will nicht ungerecht werden.
Der Eichhörnchentrieb meiner Eltern muss zudem auf einem Gen liegen, in dem noch ein anderes Merkmal fest implementiert ist: der Jagdtrieb nach Sonderangeboten. Denn Sparsamkeit ist die zweite Säule eines Weltbildes der Generation »Morgen könnten wir verhungern«.
Nicht umsonst erzählt mein Vater noch heute die Geschichte eines Onkels aus Berlin, der gut durch den Zweiten Weltkrieg kam, weil in seinem Keller so viel Seife lag, dass er sie nicht nur in Bombennächten gegen Brot eintauschen, sondern die Russen auch noch nach 1945 damit bestechen konnte. »Der kluge Konsument baut vor und hortet!«, war wohl die Botschaft. Weshalb nicht nur mein Jugendzimmer, sondern auch der Keller im Haus meiner Eltern auf dem Land mit seinem Warenlager an Lebensmitteln, originalverpackten Porzellanservices, Werkzeugpackungen, Koffersets und anno 1967 selbst gestrickten Socken heute noch problemlos jedem noch so großen Berliner Kaufhaus Konkurrenz machen könnte.
Der Vergleich hinkt aber leider – denn im Privathaushalt kam es nie zu einem Abverkauf wie in den Kaufhäusern. Bei Mama und Papa füllte sich alles im Gegenteil immer mehr, und irgendwann (also gefühlt 397 Jahre nach Kriegsende) sind sogar meine Vorfahren an dem Punkt zu sagen: »Jetzt ist genug!«
Mama beschließt: »Jetzt wird nichts mehr angeschafft, wir haben zu viel!«
Papa meint: »Vielleicht sollten wir jetzt endlich einmal alles aufbrauchen, was wir im Laufe der Zeit so gehortet haben?«
Mama erklärt: »Der Mensch schafft sich zu viele Dinge an, die er nicht braucht!«
Papa nickt dazu: »Da hat sie recht. Der Mensch umgibt sich mit viel zu vielen Dingen, die er letztlich nicht braucht!«
Wie? Habe ich richtig gehört? Was ist denn hier passiert? Hat ein Außerirdischer meine Eltern entführt, ihnen in einem schwarzen Loch den Kopf gewaschen und sie nur wieder unter der Bedingung zurück auf die Erde gebracht, dass sie einmal ganz einer Meinung sind und ihren Haushalt reduzieren? Geschehen tatsächlich noch Wunder auf Erden?
Ich biete natürlich meine Hilfe beim Ausmisten an.
»Ausmisten! Wie das klingt!«, erwidert meine Mutter. »Das hier ist ein Haus und kein Kuhstall!«
»Ich mein ja nur, manchmal ist es leichter, wenn jemand hilft, wenn man sich von Dingen trennen will!«
»Und du trennst dich immer vorschnell!«
»Was soll das heißen, Mama? Ich bin seit fünfunddreißig Jahren mit meinem Mann zusammen …«
»Von Dingen! Du wirfst immer alles sofort weg! Mich reut der schöne Tisch heute noch, den du dir damals im Studium gekauft hast und den du dann einfach an den Nachmieter verschenkt hast!«
»Mama, das war ein Zehn-Euro-Teil von Ikea und nie stabil!«
»D-Mark!«, korrigiert mich meine Mutter. »Damals hatten wir noch D-Mark!«
»Also, bei dem Betrag ist die Währung jetzt auch schon wurscht!«
»Nein! Das summiert sich im Laufe der Jahre. Kleinvieh macht auch Mist!«
»Ich dachte, wir sind kein Kuhstall, sondern führen einen Haushalt ohne Mist!«, entgegne ich ausnahmsweise einmal schlagfertig.
Wir lachen beide.
Gut, dann misten sie halt nicht in einer größeren Aktion aus, so wie ich das machen würde. Dass sie überhaupt mal »abspecken« wollen, ist ja schon phänomenal. Um ein Lieblingszitat meiner Mutter zu verwenden: »Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung.«
So weit der theoretische Stand der Dinge.
Der praktische Stand der Dinge sieht etwas anders aus:
Nach vier Wochen ist der Vorrat an Eingemachtem von vor 1999 weggeworfen oder aufgebraucht. Mama hat alle Marmeladengläser unter die Lupe genommen und extra viel Kuchen gebacken, um alles zu verwerten.
Der kleine Durchgang im Kellerraum ist um mindestens fünf Zentimeter breiter geworden – Papa hat alle Zeitschriften aus den Jahren 1957 bis 1983 entsorgt und sogar (Tusch!) zwei seiner sieben Bohrmaschinen, die nicht mehr funktionieren, zum Müll gegeben.
Außerdem hat sich meine Mama nach etlichen inneren und äußeren Kämpfen von Lesebrillen getrennt, die vermutlich in einem Drogeriemarkt für je rund drei Euro erstanden worden waren. Die äußeren Kämpfe bestanden unter anderem darin, mich mehrmals mit Fragen anzurufen:
»Glaubst du, es rentiert sich, in alte Lesebrillen neue Gläser einbauen zu lassen?«
»Nein!«
»Kannst du mal im Internet schauen, wo die Caritas solche Brillen sammelt?«
»Kein Land auf der Welt braucht diese Brillen, die man dort auch schon für ein paar Cent kriegt!«
Mein Mann war weniger mutig in Sachen Widerspruch und nahm mit einem »Danke« Batteriengroßpackungen meines Vaters an (»Können wir immer brauchen!«), von denen nach nur wenigen Stichproben klar war, dass sie längst keine Energie mehr liefern konnten. (Am Rande: Dass mein Mann uralte Dinge aus dem Haushalt meiner Eltern freudestrahlend zu uns in die Wohnung schleppte, brachte mich auf die Idee, Krimis zu schreiben. Da lassen sich Mordfantasien prima ausleben!)
Außerdem sortierte Mama noch alle Nudeln aus, die schon zerfallen waren (gibt es!). Und Papa brachte eigenhändig Bleistifte, die die Ein-Zentimeter-Grenze unterschritten hatten, zur Tonne.
Dann aber geriet das ganze Vorhaben ins Stocken, langsam, schleichend. Mama konnte eine Brigitte mit Datum 1973 nicht entsorgen, weil sie darin ein Rezept vermutete, mit dem sie einmal einen unvergessenen Geburtstag bei ihrer Freundin Angela ausgerichtet hatte. Ganz zu schweigen davon, dass ihr die Brigitte-Diät damals zum Purzeln sehr vieler Pfunde verholfen hatte.
Papa kam nicht umhin, die Miniatur-Isetta zu behalten, denn heute gebe es so qualitätsvolle Fahrzeugnachbildungen ja gar nicht mehr – meinen Einwand, dass dies billigster Made-in-China-Plastikmüll sei, ließ er nicht gelten. Das würde ich nicht verstehen, denn er sammle nicht nur Matchbox-Autos, sondern alle Arten von Isetta-Nachbildungen, »die alle noch mal etwas wert werden, in der ganzen Summe, also als komplette Sammlung«.
Nun gut – frau will ja niemanden drängen. Brauche ich selbst nicht auch schon immer mehr Zeit für gewisse Dinge? Habe ich nicht auch schon seltsame Anhänglichkeiten an abgewetzte Jacken entwickelt, mit denen ich die schönsten Urlaube verbinde? Und hat meine Tochter Eva nicht recht, wenn sie sagt, ich solle endlich mal diese Levi’s-Jeans aussortieren, in die würde ich auch in meinem übernächsten Leben nicht mehr passen? Bloß weil ich damals ein ganzes Jahr lang mein Taschengeld für die Jeans gespart hatte, würde sie auch nicht größer! Und liegt nicht in meinem Küchenschrank auch ein Salatbesteck, das ich noch nie verwendet habe, aber so schön finde und nicht weggeben kann, weil es das besondere Geburtstagsgeschenk einer Freundin inmitten einer schlimmen Lebenskrise war? Und am Allerallerallerschlimmsten: Ich könnte mich von keinem einzigen Buch in meinem Bücherregal trennen – mit jedem Band sind so besondere Lektüre-Erlebnisse verbunden. Erkenntnisse und Emotionen. Erleuchtungen und das Abtauchen in andere Welten. Auch wenn das Papier abgegriffen und vergilbt ist. Das brächte ich niemals übers Herz!
Was fällt mir also ein, über den Eichhörnchentrieb meiner Eltern zu lästern, nur weil ich »das Glück der späten Geburt« hatte und selbst doch jetzt schon ganz ähnliche Ansätze zeige, ohne jemals an Hunger oder anderen existenziellen Mängeln wie Brennholz zum Heizen (das sie auch horten!) gelitten zu haben?
Einen Anruf später revidiere ich meine Meinung aber wieder. Mama meint, weil sie jetzt schon so kräftig aussortiert hätten, sei endlich wieder Platz im Haus und sie müsse mir unbedingt erzählen, dass es beim Aldi hohe Filzhausschuhe im Sonderangebot gegeben habe, für Männer und Frauen! Für nur 9,99 Euro das Paar, das sei doch sensationell günstig!
»Mama, ihr habt mindestens fünf Paar Hausschuhe pro Person!«
»Schon, ja, vielleicht, aber die passen alle nicht mehr so gut!«
»Dann werft die alten weg!«
»Wer weiß, wozu die noch mal gut sind!«
»Mama, so mistet ihr nie aus!«
»Aber diese neuen Hausschuhe sind gut, für Besucher!«
»Mama, es gibt immer Gründe …«
»Ach, du kannst einfach nicht sparen, du kaufst alles immer nur, wann es dir passt, und baust nicht vor und denkst nicht weiter. Du musst nach Sonderangeboten sehen!«
Uff.
Ich spare mir eine Schnappatmung und versuche, meinen Kopf wieder einzuschalten.
Ich spare es mir, einen Sohn des bereits erwähnten Berliner Onkels zu zitieren, der sagt: »Zum Sparen brauchst du Zeit.« Seit der Rente habe er jetzt auch Zeit zu vergleichen. Jemand mitten im Berufsleben könne sich aber eine Schnäppchenjagd gar nicht leisten, schon gar nicht eine Frau mit Familienanhang.
Ich spare mir auch eine generelle Kritik an der Konsumgesellschaft.
Und ich spare mir zu sagen, was es für ein Unsinn sei, noch mal Hausschuhe zu kaufen, die sie bestimmt nicht mehr tragen würden, weil sie eh nur die alten verwenden, die sie seit Ewigkeiten lieben – und Gutes und Neues ohnehin immer »aufsparen für später mal«.
Mama hat unrecht – ich bin sparsamer, als sie glaubt. Allerdings auf einem anderen Feld. Ich bin nicht beim Erwerb von Dingen sparsam, sondern beim verbalen Austeilen. Bedingt durch eine gewisse eigene »Altersmilde«, den Alten auch ökonomischen Quatsch zu verzeihen, spare ich mir so einige Worte, die mir auf der Zunge liegen. Darunter auch den Satz meines Vaters, der immer gesagt hat: »Ein Klump kaufst dreimal!«
Das ist Erzbayerisch und heißt übersetzt: »Billige Waren rentieren sich in der Summe nicht, weil sie schnell kaputtgehen und du ständig nachkaufen musst.«
Und irgendwann in ganz grauer Vorzeit hatte meine Mutter einmal zu einer Freundin gesagt (ich war noch ein Kind, aber das habe ich genau gehört): »Lieber nur ein paar wenige, aber dafür gute Stücke bei Kleidung und Porzellan. Das macht mehr her, und der Schrank ist nicht so vollgestopft.«
Ah, das ist also mit Altersvergesslichkeit auch gemeint – die eigenen Weisheiten zu vergessen!
Stellenausschreibung
aufgeschlossen
psychisch belastbar
ehrlich
körperlich trainiert
pünktlich
warmherzig
organisationsstark
hilfsbereit
tolerant
bürokratieversiert
unvoreingenommen
haushaltserfahren
respektvoll
krisenerprobt
einfühlsam
Karriere
Eigenleben mit Mann und Kindern
Freizeit
Geldverdienen
Hobbys
Partynächte
lange Urlaube
Vereinsleben
Teilnahme an gesellschaftlichen Ereignissen und Zeitgeschehen wie politische Informiertheit durch Zeitunglesen/Internetportale
Wir suchen dich, genau dich! Du bist eine Vollbluttochter!
Wir sind ein transparentes Familienunternehmen, das nicht verheimlicht, dass dir zwar wenig Gehalt winkt, dafür aber ein höherer Gotteslohn. Ganz speziell spricht für uns:
Du musst dich nicht mit Gewerkschaftsvertretern herumschlagen und kannst ganz nach Gusto ständig übertarifliche Leistungen erbringen.
Du lernst immens viele Konfliktbewältigungsstrategien von Streit bis Beleidigtsein.
Du hast die einmalige Chance, dich über Gebühr komplett aufzuopfern.
Du gehst kein Karriererisiko ein, denn eine Karriere in diesem Bereich gibt es ohnehin nicht.
Du trainierst deine Belastbarkeit ins Unermessliche.
Du hast die einmalige Chance, dein schlechtes Gewissen zur Perfektion zu treiben und Schuldgefühle zu sammeln, denn du wirst es dir selbst nie recht machen können.
Dann bewirb dich unter: »IchbindieperfekteTochter.de« mit Angabe deiner Gehaltsvorstellungen. Bewerberinnen unter einer Forderung von hundert Euro werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt.
*Bewerbungen von Söhnen bei gleicher Qualifikation können wir leider nicht berücksichtigen, da sie erfahrungsgemäß den Anforderungen nur kurzfristig und nicht dauerhaft standhalten.
Laaangweilig
Als Frau in den besten Jahren geht es Ihnen bestimmt so wie mir: Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit der Langeweile in meinem Leben. Zwei Kinder sind zwar gerade erwachsen geworden und ausgezogen – auch wenn Tochter Eva vorübergehend auf der Suche nach einem neuen WG-Zimmer kurzfristig ihr Lager wieder bei uns aufgeschlagen hat –, aber trotzdem brauchen sie ständig noch irgendwas, angefangen bei Liebeskummertrost bis hin zu praktischen Haushaltsanweisungen für den Sohn Lukas (Mom, wie putz ich eine Toilette? Genügt da ein Spülmittel oder muss ich Salzsäure im Darknet besorgen? Wie machst du das eigentlich, ein Hemd zu bügeln, bist du eine Hexe?). Außerdem gibt es noch einen Mann an meiner Seite, der die drängendsten Fragen der Kinder nicht beantwortet, aber selbst Ansprüche der Art stellt wie: »Am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr wäre die beste Zeit, die Vögel auf dem Balkon zu füttern. Kannst du Nüsse dazu rösten?« Und dann sind da auch noch pflegebedürftige Mamas und Papas, die uns nicht zur Last fallen wollen und deshalb meist alles dafür tun, um uns nicht über Gebühr zu beanspruchen.
»Wir haben die Pflanzen aus dem Treppenhaus nach draußen gestellt und weißeln es«, sagt meine Mutter stolz am Telefon – und ich stehe sofort auf der Alarmbereitschafts-Matte. Treppenhaus weißeln? Die beiden werden ausrutschen und die Stufen hinunterfallen, weil ein Nachbar ihnen Planen geschenkt hat, aber kein Krepp-Klebeband dazu, weshalb sie alles garantiert ungesichert einfach so auslegen werden, denn so was wie Klebebänder zählt zu unnützen Ausgaben verschwenderischer Charaktere ganz nach dem Motto: Das ist doch unnötiger Luxus!
Am nächsten Wochenende bin ich bei meinen Eltern, und das Treppenhaus im Einfamilienhaus erstrahlt fünf Stunden später im neuen Weiß. Mama hat Kuchen gebacken, und Papa ist zwar etwas nörgelig, weil er nicht zugeben kann, Hilfe bei dieser Malaktion zu brauchen – aber gut, das konnte ich psychologisch ganz gut meistern (»Ach, Papa, weißeln hast du noch nie besonders gemocht, auch wenn du sonst fast alles alleine im Haus gemacht hast! Denk dir nichts, das mache ich gerne!«).