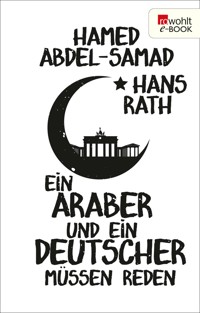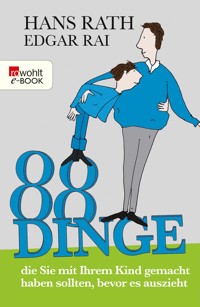Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Habe ich eine Affäre oder eine Beziehung? Kann ein Vollbart zwischen einem Mann und seiner wahren Liebe stehen? Warum wissen Hunde eigentlich immer alles besser? Und warum muss man so lange besoffen Auto fahren, bis der Lappen endlich weg ist? Paul sucht Antworten. Genau wie sein Kollege Schamski, sein bester Freund Günther und der erfolglose Künstler Bronko, die plötzlich alle vor seiner Tür stehen ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
4,0 (1 Bewertung)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.