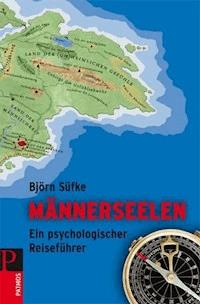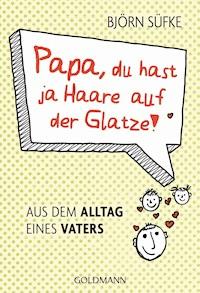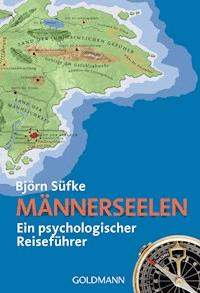9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Was gestern noch als männlich galt, ist heute verpönt – und auch wieder nicht. Der Mann von heute soll gefühlvoll sein, aber kein Weichei. Ein 24-Stunden-Papa, aber bitte auch beruflich ein Überflieger. Kein Wunder, dass Mann sich verwirrt fragt, wo’s nun langgeht. Der Diplom-Psychologe Björn Süfke zeigt, was das traditionelle Verständnis von Männlichkeit in der Familie und in der Gesellschaft angerichtet hat. Er fordert die Männer auf, sich zu bewegen – und die Frauen, dies auch wirklich zuzulassen. Denn dann werden wir alle profitieren: durch eine Partner- und Elternschaft auf Augenhöhe und eine gleichberechtigte Gesellschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Was gestern noch als männlich galt, ist heute verpönt – und auch wieder nicht. Der Mann von heute soll gefühlvoll sein, aber kein Weichei. Ein 24-Stunden-Papa, aber bitte auch beruflich ein Überflieger. Kein Wunder, dass Mann sich verwirrt fragt, wo’s nun langgeht. Björn Süfke, Diplom-Psychologe, zeigt, was das traditionelle Verständnis von Männlichkeit in der Familie und in der Gesellschaft angerichtet hat. Er fordert die Männer auf, sich zu bewegen – und die Frauen, dies auch wirklich zuzulassen. Denn dann werden wir alle profitieren: durch eine Partner- und Elternschaft auf Augenhöhe und eine gleichberechtigte Gesellschaft.
Autor
Björn Süfke ist Diplom-Psychologe. Er hält regelmäßig Vorträge und bietet Fortbildungen zu verschiedenen Männerthemen an. Privat ist er passionierter Fan von zwei Fußballvereinen und drei Kindern. Er lebt mit seiner Familie bei Bielefeld.
Weitere Informationen zu Björn Süfkes Veranstaltungen finden Sie auf
www.maenner-therapie.de.
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Dieses Buch erschien bereits 2016 im Mosaik Verlag
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 2016 Mosaik Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Cover: Uno Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Entwurfs von *zeichenpool, München
Covermotiv: shutterstock/Kraphix
Lektorat: Maria Koettnitz
Layout: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling/Kim Winzen
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
JE · Herstellung: IH
ISBN 978-3-641-23557-4V002
www.goldmann-verlag.de
Inhalt
VORBEMERKUNG
Die Chance unseres (Männer-) Lebens
EINEARTEINLEITUNG
1 Das verleugnete Leid
EINMANNHATKEINEPROBLEME!
2 Die wirre Debatte über Männer
ALPHA-SOFTIESUNDDIEKRISEDERKERLE
3 Das Gesetz der Traditionellen Männlichkeit
GEFÜHLEVERBOTEN!
4 Der Zerfall der Traditionellen Männlichkeit
TIMETOSAYGOODBYE!
5 Die Widerstandsfähigkeit der Traditionellen Männlichkeit
WASHÄNSCHENGELERNT …
6 Die ewigen MännerKatastrophen
SEX, DRUGSANDLONELINESS
7 Die aktuellen MännerKrisen
WOZUBEWEGEN, ICHWEISSDOCHNICHTWOHIN …
8 Die Chancen der Krisen
MÄNNER, EMANZIPIERTEUCH!
9 Wege aus dem Krisendschungel
FRAGENICHT, WASDIEMÄNNERFÜRDICHTUNKÖNNEN!
Männer, hört die Signale!
EINEARTAUSBLICK
LITERATUR
DANKSAGUNG
REGISTER
Vorbemerkung
Liebe Leserin, lieber Leser,
lange habe ich gegrübelt, ob ich in diesem Buch die geschlechtsneutrale Schreibweise »Innen« verwenden, also von ProfessorInnen oder PolitikerInnen sprechen soll oder nicht. Es gibt eigentlich nur ein einziges Gegenargument: Sprachlich schön ist es nicht! Auf der anderen Seite fand ich es unangemessen, einem Buch, in dem vehement gegen den Geschlechterkampf gewettert wird, den lapidaren Hinweis voranzustellen, Frauen mögen sich doch bitte schön mitgemeint fühlen, wenn ich die männliche Form verwende. Als könnte man irgendetwas fühlen, weil man – oder frau – es soll.
Ich saß also in einem Dilemma. Glücklicherweise weiß ich als Diplom-Psychologe, was man in so einem Fall macht: Man bittet um Hilfe. Also fragte ich meine Frau, meine beste Freundin, meine Lektorin sowie meine Mutter, ob ich die geschlechtsneutrale Form verwenden soll oder nicht. Alle vier sagten unisono: »Nein, lass es!« – »Wieso?«, fragte ich. Vierfache Antwort: »Weil es nicht schön ist!«
Ich gab nicht auf: »Aber kann man wirklich Rücksicht auf Schönheit und Ästhetik nehmen, wenn man etwas verändern will in der Welt?« Meine Lektorin lächelte bloß vor sich hin, während meine Frau und meine beste Freundin mich anschauten wie einen dieser hageren, zottelhaarigen Prediger, die an der Rednerecke Speakers’ Corner im Londoner Hyde Park Apokalyptisches von einer Holzkiste herunterbrüllen. Meine Mutter war die Einzige, die sich zumindest bemüßigt fühlte, mir überhaupt zu antworten. Sie sagte: »Wie willst du die Welt besser machen, wenn dir Schönheit völlig egal ist?«
Die Chance unseres (Männer-) Lebens
EINE ART EINLEITUNG
Ich bin verrückt. Ich habe ein gutes, friedliches Leben – warum wage ich mich an ein solches Buch? An einen gesellschaftspolitischen, schlimmer noch: einen psychologisch-gesellschaftspolitischen Rundumschlag? Die Psyche der Männer plus die Psyche der Gesellschaft zum Thema »Männlichkeit« auf knapp vierhundert Seiten. Das ist mehr als vermessen.
Das ist so vermessen, dass man das Ganze sehr fachlich und strukturiert aufziehen sollte, sonst gibt es sofort Gegenwind. Schon deswegen, weil das Thema von den meisten Menschen überaus persönlich genommen wird. Aber auch von Fachleuten ist Gegenwind zu erwarten, wenn man Themen wie »Suizid« oder »Anlage-Umwelt-Debatte«, über die es schon ganze Bücher gibt, in einem Unterpunkt abhandelt. Daher habe ich versucht, das Buch sachlich nachvollziehbar zu gestalten.
Allerdings: Wenn man über Männer spricht, über männliche Eigenheiten und männliches Leiden, männliche Täter- und Opferschaft von Gewalt, über Vaterschaft, Diskriminierungserfahrungen oder einfach über die männliche Psyche im Allgemeinen, bekommt man immer von irgendeiner Seite Gegenwind. Ganz gleich, wie vorsichtig man formuliert und wie sachlich man argumentiert. Diese Beobachtung hat mich ermutigt – ganz im Sinne einer positiven Scheißegal-Haltung –, auch das Nicht-so-Sachliche, das Persönliche, das Beispielhaft-Anekdotische in dieses Buch einzubringen. Denn wenn das Thema »Mann-Sein« grundsätzlich auch ein persönliches ist, wieso sollte ausgerechnet ich, der ich seit zwanzig Berufsjahren ausschließlich mit Männern arbeite, meinen »Gegenstand« aus rein distanziert-analytischer Distanz sehen? Ich bin davon überzeugt, dass sogar ein Biologe, der ein Vierteljahrhundert lang das Paarungsverhalten von Weinbergschnecken studiert hat, eine wie auch immer geartete persönliche Beziehung zu »seinen« Schnecken hat. Für das Thema »Mann-Sein« gilt das ganz sicher.
In dieses Buch fließen also persönliche Gedanken ein, manche Aspekte illustriere ich mit Beispielen aus meinem privaten oder beruflichen Alltag, und Sie werden an manchen Stellen bemerken, wenn mich etwas besonders ärgert oder umtreibt. All das habe ich nicht eingestreut, weil irgendwelche Verlagsleute der Meinung waren, dass es sich so besser liest. Es ist dabei, weil ich nicht anders schreiben kann.
Schließlich mache ich ja auch den ganzen lieben (Arbeits-) Tag lang nichts anderes, als mich mit Männlichkeit zu beschäftigen. Ich bin nämlich Männercoach. Es ist mein Beruf, über Schwierigkeiten und Probleme von Männern zu sprechen, um dann Lösungen für diese Probleme zu finden. Oder seien wir mal etwas bescheidener: gute Umgangsweisen mit diesen Problemen. Ich mache das, wie gesagt, seit zwanzig Jahren – und es ging eigentlich immer ganz gut. Es berührt mich persönlich und es macht Spaß, meist mehr, selten weniger und immer so viel, dass ich nie etwas anderes hätte tun wollen. Es macht mir sogar so viel Freude, dass ich irgendwann begonnen habe, über uns Männer zu schreiben.
Erfreulicherweise hat das so einige Menschen interessiert. Daher führt mich mein Buch Männerseelen– ein psychologischer Reiseführer (2010) nun öfter aus meinem kleinen Therapiezimmer hinaus in die Öffentlichkeit. Bei Tagungen, Vorträgen oder Podiumsdiskussionen darf ich über Männlichkeit sprechen: über die männliche Psyche und Geschlechterbeziehungen, über Vaterschaft und Kitas, über Gesundheit, Sexualität und gesellschaftliche Männerbilder. Ich will da gar keinen falschen Eindruck entstehen lassen: Auch all das macht mir großen Spaß. Sonst würde ich ja auch nicht ein weiteres Buch schreiben. Ich bin also kein »Märtyrer für die Sache der Männer«, ich opfere nicht mein Leben und meine Gesundheit, um Hilfen für Männer zu befördern. Ich werde vielmehr eingeladen, über Themen zu sprechen, über die ich auch gern privat am Abendbrottisch reden würde (wenn mir dort jemand zuhören würde). Und ich verdiene auch noch Geld damit. Das ist ein großes Glück, gar keine Frage.
Auf den Flügeln dieses Glücks hebe ich jetzt etwas ab. Inhaltlich, meine ich. Es geht mir nun nicht mehr allein um den einzelnen Mann, sondern um die Gesellschaft. Genauer: um den allgemeinen krisenhaften Zustand der Männlichkeit sowie das Verhältnis zwischen Männern und Frauen im öffentlichen und im privaten Raum.
Natürlich bleibt mein Blick aber ein psychologischer. Ich werde mich also wieder vor allem auf psychologische Aspekte konzentrieren – nur jetzt nicht mehr allein auf die Psyche der Männer, sondern eben auch auf die Psyche der Menschen bezüglich des Themas »Männlichkeit«. Man könnte auch sagen: auf das »Psychologische der Gesellschaft«. Die im Übrigen eine Psychotherapie nötiger hätte als jeder einzelne Mann, den ich je getroffen habe. Denn wir haben heute eine Krise des Mann-Seins. Und zwar in erster Linie eine gesellschaftliche Krise, wenn nicht sogar diverse gesellschaftliche Krisengebiete.
Nun gibt es in Bezug auf Krisen durchaus Parallelen zwischen der individuellen und der gesellschaftlichen Psyche: Krisen gibt es nun einmal, und es wird sie auch immer geben, das ist in einem sich weiterentwickelnden System nicht zu verhindern. Es kann stets nur darum gehen, diese Krisen bestmöglich zu nutzen.
Deswegen ist eine Krise noch lange nicht schön. Kein Mensch und keine Gesellschaft wünschen sich eine herbei, denn Krisen tun immer weh. Aber wenn man sie zu nutzen weiß, kann man in der Tat gestärkt aus der Krise hervorgehen.
Die Betonung bei alldem liegt auf »wenn«. Es ist beileibe kein Automatismus, dass eine Krise zur Weiterentwicklung genutzt wird. Wir wissen alle, dass viele individuelle Krisen in Selbstmord, Chaos oder Familiendramen enden und viele gesellschaftliche Krisen im Krieg, im Wiedererstarken menschenfeindlicher Ideologien oder in der Wahl absurder Parteien.
Zu mir kommen einzelne Männer in einer Krise. Wenn – wieder so ein »wenn« – der Mann und ich erfolgreich zusammenarbeiten, ist es nach der Therapie nicht mehr so wie vor der Krise. Denn in der Therapie wird der Mann seine Verhaltensmuster reflektieren, er wird eventuell abgespaltene Gefühle und Bedürfnisse entdecken, wird Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten. Das führt in der Regel dazu, dass er sich, sein Verhalten und seine Denkmuster grundlegend ändert – und zwar so, dass sie besser zu dem passen, was er wirklich ist. Ganz gleich, ob ihm das, was er wirklich ist, besonders gefällt oder nicht. So hat der Mann dann die Krise genutzt, um etwas Neues zu schaffen.
Ein gutes Beispiel dafür sind Erektionsprobleme. Die betroffenen Männer kommen meist nicht, um ihre ganze Sexualität zu reflektieren, sondern um die Erektionen, die Leistungsfähigkeit zurückzubekommen. Nach der Therapie jedoch ist die Sexualität meist nicht wieder exakt so wie vor den Erektionsschwierigkeiten, sondern irgendwie neu. Häufig hat sich sogar die gesamte Partnerschaft weiterentwickelt. Mit oder ohne Erektionen.
Die Frage, die ich hier von der individuellen auf die gesellschaftliche Ebene heben möchte und die in diesem Buch über allem stehen soll, ist also nicht in erster Linie: Wie können die Krisen schnell überwunden und beendet werden? Die Frage ist vielmehr: Wie können die Krisen genutzt werden?
Psychotherapeutisch gesehen ist das im Prinzip einfach. Zwei Schritte sind zu gehen: Erstens muss man eine jede Krise im Detail verstehen. Nicht so en gros und schnell-schnell, sondern wirklich im Detail. Man muss jeden Aspekt, der hineinspielt, also jedes Gefühl, jedes Bedürfnis, jede Einstellung und jeden verinnerlichten Glaubenssatz herausarbeiten und einzeln verstehen. Dann muss man zweitens für alle diese Aspekte bessere Umgangsweisen finden als die, die man zuvor – meist unbewusst – angewendet hat. Denn diese haben dazu geführt, dass die Karre im Dreck gelandet und nun nicht mehr allein herauszuziehen ist.
Das klingt einerseits – eben vom Prinzip her – lächerlich einfach. Andererseits wäre es natürlich für jeden Menschen in einer Krise, dem man dieses Prinzip so mit nach Hause gibt und ihn dann damit allein lässt, eine grenzenlose Überforderung. Die Wahrheit liegt in der Mitte: Es ist vom Grundsatz her tatsächlich so einfach – und manchmal findet man auch relativ schnell entscheidende Aspekte, und ebenso schnell entstehen Ideen, wie man die Dinge bewältigen kann. Manchmal ist es aber auch eine ziemlich mühsame, schweißtreibende Arbeit, die Ursachen für die Krise zu finden.
Wenn man also einerseits harte Arbeit nicht scheut und andererseits in der Lage ist, auch mal einfach zu denken beziehungsweise zu fühlen, sind die Erfolgschancen ziemlich gut. Aber noch einmal: Voraussetzung ist, dass man mit alldem nicht allein bleibt, sondern Hilfe bekommt bei dieser Arbeit. An genau dem Punkt scheitert es leider bei sehr vielen Männern.
Um die Chancen der gesellschaftlichen Krise heutigen Mann-Seins zu nutzen, schlage ich dasselbe Vorgehen vor wie gerade beschrieben: Wir müssen zunächst möglichst exakt verstehen, was genau die Krisengebiete sind. Wer oder was ist in einer Krise, worin besteht sie, wie ist sie entstanden und wie pflanzt sie sich fort? An diesem Verständnis mangelt es meines Erachtens bisher eklatant, zumindest an einem geordneten und nicht bloß bruchstückhaften Verständnis.
In der gesellschaftlichen Diskussion wird alles munter durcheinandergeworfen: jahrhundertealte gesellschaftliche Problemgebiete des Mann-Seins, individuelle Probleme oder auch Diskriminierungserfahrungen von Männern, das Bröckeln oder aber Fehlen bestimmter Männlichkeitsbilder, die daraus resultierende Verunsicherung und so weiter und so fort. All das wird unter »Krise der Männlichkeit« subsumiert und herzhaft durcheinanderdiskutiert. So ist nichts zu verstehen, und vor allem kann so nicht zum zweiten Schritt übergegangen werden: dem Entwickeln von neuen Bewältigungsideen. Denn ohne Verständnis des Problems gibt es kein effektives Brainstorming zur Lösungsfindung. Daher möchte ich die Krisen so gut es geht sezieren.
Das setzt aber voraus, dass wir über Krisen im Zusammenhang mit Männern überhaupt nachdenken und sprechen dürfen. Bislang ist das leider noch keine Selbstverständlichkeit. Es gibt da nämlich ein mächtiges Denk- und Sprechverbot.
1
Das verleugnete Leid
EIN MANN HAT KEINE PROBLEME!
Seit etwa zehn Jahren spreche ich mehr oder minder regelmäßig öffentlich über Männer: über männliche Macken und männliches Fehlverhalten ebenso wie über die Leiderfahrungen und den wunderbaren Facettenreichtum der Männer. Dabei habe ich relativ schnell lernen müssen, dass man nicht gut von Männern sprechen kann, ohne einen »über die Rübe« zu bekommen. Und zwar aus zwei Richtungen.
Lächerliches Leiden oder Mann ohne Macken?
Da ist zunächst eine weitverbreitete Mitleidslosigkeit mit Männern: Sobald ich bei einer Veranstaltung irgendetwas äußere, das mein Mitgefühl mit Männern zum Ausdruck bringt, gibt es grummelnde Unmutsbekundungen bis hin zu handfester Kritik – übrigens beileibe nicht nur von Frauen. Mein eindrücklichstes Erlebnis in dieser Hinsicht war eine Podiumsdiskussion in Darmstadt vor einigen Jahren, bei der ich wahnwitzigerweise schon in meinem Eingangsstatement darauf hingewiesen habe, dass es auch männliches Leiden gibt. Als naiver Diplom-Psychologe hielt ich das nicht für eine revolutionäre Aussage und war daher ziemlich konsterniert, als mir aus dem abgedunkelten Zuschauerraum als spontane Reaktion ein ironisch-mitleidiges »Oooooch!« entgegenschlug. Es waren keine vereinzelten Stimmen, sondern eher ein synchroner Chor von etwa einhundert Menschen.
Was mich besonders schockiert hat, war nicht die Vielstimmigkeit und Lautstärke der Ablehnung jeglicher Empathie für Männer, sondern die Spontaneität dieser Ablehnung. Es war kein wohlüberlegter Widerspruch gegen meine Aussage, es war ein Reflex. Ich hatte auch zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Argumente vorgetragen, keine detaillierten Behauptungen aufgestellt, keine Forderungen abgeleitet. Ich hatte lediglich darauf hingewiesen, dass es überhaupt männliches Leiden gibt.
Diese Tatsache an sich muss also abgewehrt werden – vermutlich gar nicht bewusst, was die Unmittelbarkeit dieser kollektiven Zuschauerreaktion ja zeigt. Das simple Motto lautet: Männer haben nicht zu leiden! Und behauptet jemand das Gegenteil, wird diesem Tabubruch auf äußerst effiziente Art und Weise begegnet, nämlich mit ironischem Nicht-Ernstnehmen. In den vergangenen fünfzig Jahren wurde immer und immer wieder – und völlig zu Recht – darauf hingewiesen, dass Frauen der Eintritt in viele »Männerdomänen« nicht in erster Linie durch Gewalt und kategorischen Ausschluss verwehrt wird, sondern durch konsequentes Nicht-Ernstnehmen. Nun, diese Strategie funktioniert auch andersherum …
Machen Sie doch mal in Ihrem Bekanntenkreis die folgende Umfrage: »Wer ist wehleidiger, Männer oder Frauen?« Meiner eigenen Umfrageerfahrung zufolge antworten gefühlte 100 Prozent der Menschen sofort und ohne Umschweife: »Männer!« Gerne wird diese Antwort noch von dem Witz begleitet, dass die Menschheit schon längst ausgestorben sei, wenn Männer die Kinder bekämen. Und neulich zeigte ein Freund mir ein YouTube-Filmchen, in dem ein Mann mit einem Schnupfen in die Notaufnahme eines Krankenhauses geht, wo er dann unmittelbar mit »Männergrippe« eingewiesen wird. Fakt ist aber, dass Männer weitaus seltener über Schmerzen klagen als Frauen, generell schmerzunempfindlicher sind, also in Experimenten Schmerzreize länger auszuhalten bereit sind und den identischen Schmerzreiz auch schwächer einstufen, als Frauen dies tun (siehe etwa Pogatzki-Zahn, 2012; Pogatzki-Zahn, Ruscheweyh & Evers, 2015).
Die Erklärung für all das ist wohl, dass das körpereigene Schmerzhemmsystem von Männern bei Schmerzreizen stärker aktiviert wird. Aber das ist jetzt gar nicht der Punkt. Die Frage ist eher: Wie kommt es trotz einer offenkundig fehlenden Verankerung in der Realität zu dieser kollektiven Wahrnehmung von Männern als den wehleidigeren Menschen? Meines Erachtens kann das nur daran liegen, dass die Klagen von Frauen über Kopf-, Menstruations-, Erkältungs- oder sonstige Schmerzen als »normal« betrachtet werden und somit gar nicht groß herausstechen oder im Gedächtnis bleiben. Wenn ein Mann hingegen im Alltag oder bei einer Erkältungskrankheit über Schmerzen spricht, dann ist dies so »unmännlich«, dass es sofort auffällt. Es handelt sich also um ein (Fehl-) Wahrnehmungsphänomen, welches in dieselbe Richtung deutet wie die erwähnte Reaktion des Darmstädter Publikums: »Männer, die jammern, sind lächerlich!«1
Auf männliches Leid hinzuweisen, fördert also nicht die eigene Beliebtheit. Am »anderen Ende« sieht es aber auch nicht viel besser aus: Wenn ich in meinen Veranstaltungen auch nur ansatzweise auf männliche Defizite zu sprechen komme, wird mir gerne unterstellt, ich wolle Männer an den Pranger stellen und mich als »Gut-Mann« bei den Frauen einschmeicheln. Die Palette reicht von höflichen Nachfragen am Ende eines Vortrags, warum ich nicht noch auf ureigene »männliche Stärken« eingegangen sei (auch wenn Stärken oder Schwächen gar nicht Thema des Vortrags waren) bis hin zu der im Internet geäußerten Meinung, ich sei mit meinen Ausführungen »eine Schande für meine Geschlechtsgenossen«.
Es ist nicht mein Beruf, Männer zu verteidigen oder zu loben. Es ist ebenfalls nicht mein Beruf, über Männer herzuziehen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Frauen. Beides ist auch nicht mein Hobby, im Gegenteil, ich finde blinde, selbstkritikfreie Parteilichkeit albern bis ärgerlich.
Natürlich haben Männer Probleme, seelische wie körperliche, und diese werden nicht dadurch verschwinden, dass man sie ignoriert. Und es gibt auch eine strukturelle, das heißt gesellschaftlich verankerte Diskriminierung von Männern. Ersteres wird vermutlich jeder, der ein Buch wie dieses hier in die Hand nimmt, abnicken – auch wenn er oder sie vielleicht noch neugierig darauf ist, wie genau diese Probleme aussehen. Letzteres aber ist meiner Erfahrung nach erklärungsbedürftig.
Diskriminierungsblindheit
Ich höre auf Tagungen häufig Aussagen wie: »Wir sollten jetzt aber nicht so weit gehen, von einer Diskriminierung von Männern zu sprechen.« Oder: »Es gibt keine strukturelle Benachteiligung von Männern.« »Basta!« könnte dem letzten Satz noch angehängt werden, denn es schwebt sehr deutlich im Raum: »In die Richtung darf man nicht einmal denken!« So etwas sagen wohlgemerkt Menschen, die beruflich mit dem Thema zu tun und somit eine gewisse Einsicht haben.
Jener typische Satz, der von Männern gern als Antwort auf Fragen nach ihrem persönlichen Befinden gegeben wird: »Mir geht es gut, ich habe keine Probleme!«, findet also seine Entsprechung auf der Ebene der gesellschaftlichen und auch fachlichen Auseinandersetzung: »Männer werden nicht benachteiligt, es gibt keinen Grund zum Jammern.« Meine Vermutung ist, dass hinter solchen Denk- und Sprechverboten über männliche Diskriminierungserfahrungen der Gedanke liegt, dass in unserer Gesellschaft Frauen weiterhin vielfältigen Benachteiligungen ausgesetzt sind und dass man diese leugnen oder herunterspielen würde, wenn man über Diskriminierungen von Männern spräche. Nach dem Motto: Solange Frauen noch diskriminiert werden, ist jedes Erwähnen einer männlichen Diskriminierungserfahrung ein perfides, frauenfeindliches Sich-zum-Opfer-Stilisieren.
Nach dieser Logik könnte auch jede politisch motivierte Demonstration in Deutschland verboten werden. Schließlich geht es ja in vielen anderen Staaten noch grausamer zu: »Wie könnt Ihr Euch bloß über Datenvorratsspeicherung ereifern, wenn andernorts willkürlich hingerichtet wird?« Dazu fällt mir auch die stereotype Antwort der Erwachsenen aus meiner Kindheit ein, wenn ich unter Tränen vorbrachte, dass die gerade erhaltene Bratwurst doch ziemlich verkohlt sei: Sie wiesen stets auf die hungernden Kinder in Äthiopien hin, die überhaupt nichts zu essen hätten. Das hat mir als Kind irgendwie eingeleuchtet. Oder sagen wir lieber, es hat mich so beeindruckt, dass ich entweder brav weitergekaut oder aber die Wurst heimlich und schambeladen illegal entsorgt habe. Krebserregend war das Zeug trotzdem, Äthiopien hin oder her.
Und bevor mich jetzt empörte Hinweise erreichen, dass man doch handfestes männliches Leid nicht mit Datenspeicherung und verkohlten Bratwürsten vergleichen könne und die weibliche Lebensrealität nicht mit Hinrichtungen und verhungernden Kindern: Ich habe eindrückliche Beispiele dafür gesucht, dass es doch grundsätzlich erlaubt sein muss, Schwierigkeiten einer Personengruppe zu thematisieren, egal wie groß die Schwierigkeiten einer anderen Personengruppe sind. Denn ich persönlich fand es schon immer zynisch bis menschenverachtend, die Leiden von Frauen und Männern gegeneinander aufzurechnen: »Wer hat es denn nun schwerer/schlechter?« Eine sinnlose Frage, die aber gerne gestellt wird.
In meinen Arbeitskontexten geht es natürlich häufig in die Richtung: »Im Grunde haben es Männer doch letztlich schwerer, oder?« Die Frage soll dann besonders plakativ daherkommen. Oder provokativ. Oder betont progressiv. Ich weiß es nicht. Mich macht sie bloß müde. Ich möchte auf männliches Leid hinweisen. Darf ich das nur, wenn ich weibliches Leid relativiere?
Als ich Anfang der Neunzigerjahre an der Universität Bielefeld Psychologie studierte, hatte die Studierendenvertretung des Fachbereichs gerade erkämpft, dass jährlich drei »Frauen-Seminare« stattfanden: Seminare zu frauenspezifischen oder -typischen Themen, die direkt von der Studierendenvertretung organisiert wurden und nur für Frauen zugelassen waren. Ich konnte daran nichts Empörendes finden. Freundinnen von mir haben die Kurse besucht, sie waren wohl immer sehr gut.
Genau zwei Tage nachdem ich mein Psychologie-Diplom in der Tasche hatte, legten ein Freund und ich der Studierendenvertretung ein Konzept für ein »Männer-Seminar« vor: »Männlichkeit aus interdisziplinärer Perspektive«. Die Studierendenvertretung war begeistert und brachte einen entsprechenden Antrag ein. Wenig später bekamen wir die Nachricht von der Fakultät, dass die zuständige Kommission entschieden habe, das Seminar zu bewilligen: Es dürften in dem betreffenden Jahr dann neben dem Männer-Seminar eben nur zwei statt der üblichen drei Frauen-Seminare stattfinden.
Die Studierendenvertretung hatte zu dieser Entscheidung der Fakultät bereits eine überaus hitzige und fruchtlose Debatte geführt und trat nun etwas ratlos an meinen Freund und mich heran. Ich schrieb einen Brief an die Kommission, dass wir das Seminar unter diesen Bedingungen nicht abhalten wollten, sondern nur, wenn es zusätzlich zu den bereits fest etablierten Frauen-Seminaren stattfinden könne. Man mag das für naiv halten, für emotional begründet (wir hatten freundschaftliche Verbindungen zur Studierendenvertretung), für machomäßig-ritterlich oder einfach für dämlich. Aber für mich war damals schon klar, dass ich mit Männern arbeiten will, auch durchaus für Männer – aber doch nicht gegen oder auf Kosten der Frauen.
Das Seminar fand dann natürlich in jenem Semester nicht statt, wurde von uns aber für das folgende Semester wieder vorgeschlagen. Und siehe da: Es wurde bewilligt – unabhängig von den Frauen-Seminaren. Es nahmen übrigens ganze sechs Männer an dem Seminar teil. Davon stammten ungefähr sechs aus unserem persönlichen Umfeld. Soweit ich weiß, ist es bis dato das einzige Männer-Seminar an der Universität Bielefeld geblieben.
Ich führe dieses Beispiel hier so ausführlich an, um meine Grundmotivation und meine Grundintention deutlich zu machen: Ich möchte über männliches Leid und auch männliche Benachteiligungen sprechen können, sie sichtbar machen können, so dass es vor allem Männern leichterfällt, diese Themen überhaupt wahrzunehmen. Es wäre wunderbar, wenn meine Gedanken und Ausführungen Grundlage für Männer und Frauen sein könnten, sich mit einigen der angesprochenen Aspekte auseinanderzusetzen, vielleicht auch mit anderen darüber zu reden.
All dies ist völlig unabhängig von weiblichem Leid. Daher möchte ich mir auch nicht anhören müssen, ich sei frauenfeindlich, wenn ich über Abwertung von Männern, Diskriminierungen von Vätern oder männliches Leiden an Einsamkeit oder Überforderung spreche. Genauso wenig Lust habe ich, als »Schande für meine Geschlechtsgenossen« oder »anbiedernder Frauenversteher« tituliert zu werden, weil ich keine Veranlassung sehe, über Frauen per se zu lästern oder persönliche Negativerfahrungen zu verallgemeinern. Wie sollen Männer und Frauen in unserer Gesellschaft zusammenleben, wenn diejenigen, die sich für Männer engagieren, ohne gegen Frauen zu arbeiten (oder umgekehrt), ihre Meinung nicht öffentlich vertreten können? Lieber noch ein paar Jahrzehnte Geschlechterkampf?
Männliches Leid kann kaum darauf warten, dass sämtliches weibliches Leid erst aus der Welt geräumt ist, bevor es sich Gehör verschafft. Das erlebe ich in unserer Männerberatungsstelle täglich. Auch wenn das ja durchaus die Umgangsweise vieler Männer mit ihren persönlichen Problemen ist: »Darum kümmere ich mich, wenn ich mal Zeit habe«, »… wenn ich mit diesem Projekt fertig bin«, »… wenn das Haus gebaut ist«, »… wenn die Scheidung durch ist«.
Selbstverständlich gibt es alltägliche und teilweise auch strukturell verankerte Benachteiligungen von Männern qua Geschlecht. Nur betreffen diese Fälle von Diskriminierung logischerweise andere Bereiche als die Diskriminierungen von Frauen. Männer und Frauen werden beide benachteiligt, nur in jeweils unterschiedlichen Gebieten des gesellschaftlichen und privaten Lebens. Grob beschrieben ist es traditionell so: Frauen werden tendenziell in ehemaligen »Männerdomänen« benachteiligt, Männer in ehemaligen »Frauendomänen«.
Manche Diskriminierungen sind auch gesellschaftlich so gewollt (gewesen). Denken Sie beispielsweise an die Wehrpflicht für junge Männer. Oder aber sie sind als politische Interventionen ausgedacht und beschlossen worden, um die Diskriminierung des anderen Geschlechts zu verringern: Die berühmte »Quote« etwa ist eine diskriminierende Maßnahme zur Bekämpfung von Diskriminierung. Man mag über Sinn, Zweck und innere Logik solcher Maßnahmen denken, wie man mag. Aber man kann doch nicht einfach ausblenden, dass sie zu individuellen Benachteiligungserlebnissen führen. Es ist ein bisschen so, als würde man die Mehrwertsteuer für Lebensmittel erhöhen, um mehr Kita-Plätze zu finanzieren, und dann behaupten: »Es wird für niemanden eine Verringerung der Kaufkraft geben!«
Im Übrigen widerspricht diese »Es gibt keine Diskriminierung von Männern«-These auch deutlich den subjektiven Erfahrungen einzelner Männer. Denn immerhin gaben bei einer repräsentativen Befragung 41 Prozent der Männer an, sie seien schon einmal Frauen gegenüber benachteiligt worden (Institut für Demoskopie Allensbach, 2013). Das ist eine erstaunlich hohe Zahl, wenn man berücksichtigt, dass nicht jeder Mann sich explizit mit Gender-Themen auseinandersetzt. Außerdem können wir davon ausgehen, dass der Begriff »Benachteiligung« von den meisten Männern als handfeste Diskriminierung, etwa am Arbeitsplatz oder vor Gericht, verstanden wird. Ich bin gespannt, wie sich die Zahl entwickeln würde, wenn man bei der Umfrage explizit sozialkommunikative Diskriminierungen einbeziehen würde: Witze, Abwertungen, Ausgeschlossenwerden, Nicht-als-gleichwertig-betrachtet-Werden …
Von meinen eigenen Erfahrungen möchte ich hier (noch) nicht erzählen, denn ich bin in dieser Hinsicht sicherlich nicht repräsentativ, da ich mittlerweile überall das Gras wachsen höre. Aber eine kleine private »Feldstudie«, die ich seit einigen Jahren durchführe, will ich Ihnen nicht vorenthalten. Sie betrifft das spannende Thema »Postkarten auf Kita-Toiletten«. Sehr häufig nämlich, wenn dort schmückende Postkarten oder Plakate hängen, haben diese Bilder beziehungsweise die Sprüche darauf überwiegend männerdiskriminierenden Charakter. Mein persönlicher Rekord war eine Kita mit insgesamt neunzehn (!) Postkarten, von denen mindestens ein Dutzend explizit männerabwertend war: die obligatorischen Sitzpinklerwitze und Waschbrettbäuche natürlich, darüber hinaus Männer in Haustierstellungen oder als bemitleidenswerte Cartoon-Figuren (»Der Mann ist sozial und sexuell ein Idiot!«). Das alles garniert mit mehr oder minder geistreichen Sprüchen wie: »Männer oder Alkohol? Natürlich Alkohol!!!« oder »Natürlich sind Frauen klüger als Männer – aber sie brauchen viel Klugheit, um dies zu verbergen!« Es erinnert mich alles sehr an die oft gerügte Bilder- und Kalenderauswahl von Kfz-Werkstätten. (Über deren Toiletten kann ich leider keine Auskunft geben.)
Tobender Geschlechterkampf
Nun ist das alles so deutlich erkennbar und eigentlich auch logisch, dass es mich fasziniert, wie viele aufgeklärte Menschen Schwierigkeiten haben, die Diskriminierungserlebnisse von Frauen und Männern nebeneinander stehen zu lassen. Ich meine das weder zynisch noch herablassend. Es ist tatsächlich faszinierend in dem Sinne, dass es zeigt, wie sehr wir von der Vorstellung eines Geschlechterkampfs in Form einer win-lose-Situation geprägt sind: Frauen gegen Männer, Männer gegen Frauen, »Was gut ist für Männer, ist schlecht für Frauen!«, »Was gut ist für Frauen, ist schlecht für Männer!« Oder noch schrecklicher: »Was schlecht ist für Frauen, ist gut für Männer!«, »Was schlecht ist für Männer, ist gut für Frauen!«
Könnten wir diese Geschlechterkampfbrille für einen Moment abnehmen, würden wir problemlos erkennen, dass Diskriminierungsprozesse in folgenden Fällen selbstverständlich eine Rolle spielen: Mehr Frauen als Männer erreichen Studienabschlüsse, aber nur knapp 11 Prozent der C4-Professoren sind Frauen – so die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts (2015). Und bei gerichtlichen Sorgerechtsentscheidungen bekommt die Mutter mehr als zehnmal häufiger das Sorgerecht zugesprochen als der Vater (Brings, 2011).
Häufig potenzieren sich auch verschiedene Diskriminierungsprozesse: Dass Frauen etwa seltener C4-Professuren innehaben als Männer, hat neben konkreten Ausschlussprozessen an den Hochschulen wohl auch damit zu tun, dass den Frauen eher als den Männern die Sorge für die Kinder zugesprochen wird. Und das nicht nur im Scheidungsfall, sondern auch in der »intakten Familie«. Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen werden dadurch logischerweise verringert.
Es kann eben Pest und Cholera geben. Selbst wenn die Metapher hier möglicherweise hinkt: Pest und Cholera hängen sogar zusammen, haben zum Teil dieselben Ursachen. Es wäre also sicherlich sinnvoll, wenn sich diejenigen, die unter dem einen leiden, mit denjenigen, die unter dem anderen leiden, zusammenschlössen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen, statt sich in Diskussionen darüber zu ergehen, was von beidem nun schlimmer ist. Und um die Metapher auszureizen: Im Laufe dieser ewigen Diskussion verschlechtert sich der Gesundheitszustand beider Patientengruppen zusehends.
Ich möchte mich an diesem immer noch tobenden Geschlechterkampf nicht beteiligen. Ich glaube nicht daran. Ich bin in der Hinsicht auch nicht geläutert oder frühzeitig altersweise. Ich habe einfach noch nie daran geglaubt. Alle grundsätzlich erstrebenswerten Ziele, die ich je für Männer im Allgemeinen gesehen habe, waren Ziele, die nicht auf Kosten von Frauen gingen. Natürlich sind Ziele dabei, sogar nicht gerade wenige, die Frauen involvieren, die auch Entgegenkommen und Abgabebereitschaft von Frauen voraussetzen. Aber diese Form von Kooperation ist nun einmal per definitionem nicht kriegerisch zu erlangen. Frauen und Männer stehen eben nicht in einer Beziehung zueinander wie Großgrundbesitzerinnen und Kleinbauern (oder umgekehrt), sondern eher wie Liebende oder meinetwegen auch wie Vater und Mutter: Zugeständnisse, die mit Waffengewalt erreicht werden, entpuppen sich letztlich immer als Pyrrhussiege. Man kann eine bestimmte Form der partnerschaftlichen Arbeitsteilung einfordern, sich argumentativ dafür starkmachen, sich nicht von klischeehaften Bedenken kleinkriegen lassen und immer wieder entsprechende Grenzüberschreitungen thematisieren. Wenn man aber mit einer Vorstellung von »Sieg oder Niederlage« den Säbel schwingt, hat man am Ende vielleicht die gewünschte Arbeitsteilung erreicht, die Partnerschaft aber verloren. Etwas, das von seiner Grundstruktur her einzig und allein gemeinsam zu erlangen ist, entzieht sich nun einmal dem darwinistischen Prinzip.
Ich bewundere oder liebe oder verehre Frauen nicht mehr und nicht weniger als Männer. Ich betrachte sie auch nicht als eine übergeordnete moralische Instanz. Aber ich kämpfe schon deswegen nicht gegen sie, weil es Unsinn ist zu kämpfen. Sollte irgendwer irgendwann etwas, das ich in diesem Buch schreibe, als Munition im Geschlechterkampf verwenden, so ist eines sicher: Sie oder er hat nicht verstanden, was ich ausdrücken will.
Es geht mir darum, dass Männer wie Frauen gleichermaßen das Recht haben, ihre Unzufriedenheit, ihre Probleme, ihre Diskriminierungserfahrungen und ihr Unglück darzulegen. Es gibt kein verbrieftes Recht auf Mitgefühl vonseiten der anderen. Aber es könnte auch nicht schaden, sich die Situation des anderen Geschlechts einmal für einen Moment vorbehaltlos vor Augen zu führen und zu schauen, ob sich nicht eventuell etwas Mitgefühl einstellt. Wie sagen die Amerikaner so schön: Jeder hat das Recht auf die Suche nach Glück. Ich finde auch: Jeder hat das Recht auf die Äußerung von Leid.
1 Ich führe dies hier aus, obwohl es relativ hoffnungslos ist. Meine Erfahrung ist nämlich, dass sich insbesondere Frauen, die seit Längerem liiert sind, zunächst mit Händen und Füßen gegen diese Argumentation wehren und anschließend ausgiebig von der speziellen, extrem ausgeprägten Wehleidigkeit des eigenen Partners berichten.
2
Die wirre Debatte über Männer
ALPHA-SOFTIES UND DIE KRISE DER KERLE
Wer oder was ist nun eigentlich in der Krise? Bislang ist die öffentliche Diskussion über diese Frage noch reichlich ungeordnet – durchaus auch in Fachkreisen: Mal wird dort von der »Krise der Männlichkeit« gesprochen, mal von der »Krise der Männer« oder etwas flapsiger der »Krise der Kerle«. Oder ist gar die »männliche Natur« eine in sich krisenhafte?
Feuilleton und Boulevard treiben es blumiger und damit noch verwirrender: DIE ZEIT sprach Anfang 2014 in einem lesenswerten Dossier vom »schwachen Geschlecht«, womit grundsätzliche und tiefgehende Männer-Problematiken angedeutet wurden. Fast zur gleichen Zeit gab sich die Bild am Sonntag, die ja zuvor des reflektierten Gender-Diskurses eher unverdächtig war, deutlich realpolitischer als Verteidigerin des kleinen Mannes und titelte: »Männer-Mobbing!« An anderer Stelle wird dann von der »Jungen-Katastrophe« gesprochen oder aber – wohl in Anlehnung an die amerikanische Fernsehserie – von »broken men«.
Zu einem großen Teil hängt diese verworrene Darstellung männlicher Krisenhaftigkeit sicher mit dem bereits angesprochenen Denk- und Sprechverbot hinsichtlich männlichen Leidens zusammen. Denn solange die Männer auf ihre Krisenhaftigkeiten nicht hinweisen, privat wie auf gesellschaftlicher Ebene, kann natürlich kein umfassendes und eindrückliches Gesamtbild ihrer Situation sichtbar werden.
So nimmt jedes Medium und auch jede Institution stets nur diejenige Männerproblematik in den Blick, die ihre spezielle Zielgruppe unmittelbar betrifft: Für die Männerzeitschriften mit den nackten Oberkörpern auf dem Cover ist die fortschreitende »Verweichlichung« des Mannes ein bedrohliches Thema. Für den riesigen Markt der Frauenzeitschriften ist ebenfalls der »Softie« oder aber im Gegenteil der nicht kuschelnde, nicht sprechende (Macho-) Partner das Problem. Manchmal wird auch eine Lanze für den Mann mit Kindern aus erster Ehe oder den »von gesellschaftlichen Anforderungen überfrachteten Mann« gebrochen. Schließlich gibt es ja auch Leserinnen, die mit großer Neugierde und Zuwendung auf die Männer schauen.
Politik und Wirtschaft wiederum interessieren sich vor allem für die »Krise der Vaterschaft«, genauer: die Vereinbarkeitsproblematik. Wobei klar definiert ist, was hier vereinbart werden soll, nämlich Familie und Karriere. Nicht, dass irgendein Mann auf die Idee käme, eines von beiden gänzlich zu lassen! Auf die Karrieren der Männer können wir nämlich bei unserem Fachkräftemangel nicht verzichten, ebenso wenig aber auf die Karrieren der Frauen. Und es ist ja mittlerweile belegt, dass Mütter, deren Partner frühzeitig die Kinderbetreuung mit übernehmen, schneller wieder in den Beruf einsteigen (siehe Hobler, 2013).
Nicht ganz so felsenfest stehen Politik und Gesellschaft hinter dem Gedanken, dass mehr männliche Präsenz in der frühkindlichen Erziehung tatsächlich glücklichere und psychisch gesündere zukünftige Fachkräfte hervorbringen könnte. Auch die Plakate mit den leuchtenden Vater- und Kinderaugen oder die Initiative Mehr Männer in Kitas können nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies nicht das Thema zu sein scheint, das in nächtlichen Fraktionssitzungen rauf- und runterdiskutiert wird.
Ebenso schwer tut sich die Politik mit einem Thema wie »Männergesundheit«: Bis ins Jahr 2009 hinein wurde die Erstellung eines Männergesundheitsberichts von der Bundesregierung schlicht abgelehnt. Seit 2010 war ein solcher Bericht in Arbeit, Ende 2014 (!) ist er dann schließlich fertiggestellt worden (Robert-Koch-Institut, 2014; die private »Stiftung Männergesundheit« hatte übrigens zwischen 2010 und 2013 gleich zwei sehr fundierte Männergesundheitsberichte herausgegeben: Bardehle & Stiehler, 2010; Weißbach & Stiehler, 2013).
Eine derart ungeordnete und halbherzige Debatte kann natürlich keine Lösungsansätze hervorbringen. Wenn ich etwa auf einer Veranstaltung gefragt werde, was man denn nun gesellschaftlich gegen die »Krise der Männlichkeit« tun könne, weiß ich gar nicht, auf welcher Ebene ich antworten soll: Geht es um Männlichkeitsentwürfe? Sollte ich also nach mehr Aufklärungsarbeit rufen, nach Emanzipation von traditionellen Vorstellungen von Männlichkeit? Oder hat der Fragende individuelle Männer im Blick, solche, die leiden, die es schwer haben, die Hilfe brauchen? Sollte ich also über die mangelnde finanzielle Ausstattung von Hilfsangeboten, die sich an Männer richten, klagen? Und konkret umsetzbare politische Forderungen stellen? Oder bin ich gar als Guru gefragt, der heilsbringende Lösungen für eine problematische männliche Natur präsentieren soll?
Wir müssen also unterscheiden, worüber wir eigentlich sprechen: Über eine biologisch bedingte »männliche Natur«? Über Arten und Weisen, wie Männlichkeit gesellschaftlich konstruiert wird? Oder über individuelle männliche Erlebnisse und Lebensrealitäten? Gehen wir es doch einmal einzeln durch.
Krise der Männer? Nein!
»Krise« ist ein sehr allgemeiner Begriff, der in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen Unterschiedliches meint. Grundsätzlich geht es darum, dass etwas oder jemand durch aktuelle Geschehnisse in Gefahr ist, nicht mehr so weiterbestehen zu können wie bisher. Handlungen, die zuvor erfolgreich waren, laufen nun ins Leere, die Zukunft ist kaum noch vorhersehbar, geschweige denn kontrollierbar.
Von einer generellen »Krise der Männer« zu sprechen, wäre also schon aus definitorischen Gründen gewagt. Denn den Weiterbestand der Männer sehe ich, ehrlich gesagt, nicht in Gefahr. Auch zu behaupten, dass zuvor erfolgreiche Handlungen von Männern heutzutage gänzlich ins Leere laufen, wäre wohl übertrieben. Vor allem aber würde die Subsumierung aller Männer, die ja in der Formulierung enthalten ist, verlangen, dass es unter Männern ein übergreifendes, homogenes Krisen-Erleben gibt. Davon allerdings sind wir weit entfernt. Von der Frauenbewegung zu sprechen, mag angesichts der Breite der Bewegung berechtigt gewesen sein, auch wenn natürlich nicht jede einzelne Frau mitdemonstriert oder die Entwicklungen mit Wohlwollen verfolgt hat. Die Umwälzungen im Zuge der Frauenbewegung waren sicher auch substanziell genug, um heute eine »veränderte gesellschaftliche Stellung der Frau« zu konstatieren. Bei uns Männern ist die Situation doch deutlich anders: Eine »Krise der Männer« haben wir ebenso wenig wie eine Männerbewegung.
Natürlich gibt es auf der individuellen Ebene Männer in Krise. Die gab es aber schon immer und wird es auch immer geben, sie sind sozusagen eine Selbstverständlichkeit unserer Gesellschaft, so bedauerlich es ist. Diese durchaus zahlreichen Männer in Krise rechtfertigen aber nicht den Begriff einer »Krise der Männer«, denn dann müsste man eben grundsätzlich und zu allen Zeiten von einer Krise der Männer reden. Und natürlich auch von einer Krise der Frauen. Der Begriff wäre sinnlos.
Vermutlich gibt es zurzeit tatsächlich mehr Männer als früher, die bewusst in einer Krise sind, die sehr unsicher sind in ihren verschiedenen Rollen und sich intensiv mit diesen auseinandersetzen (müssen). Eine schlechte Neuigkeit ist das allerdings nicht. Denn wenn man in einer Krise steckt, ist es doch besser, das auch zu bemerken, als unbewusst in immer misslichere Lagen zu gelangen. Im ersten Fall hat man die Möglichkeit, sich Lösungen zu überlegen, Hilfe zu holen, Veränderungen mitzugestalten, im letzten Fall bleiben nur Magengeschwüre oder cholerische Ausbrüche.
Männer erleben also Krisen. Und kaum verwunderlich sind darunter auch Krisen, die vom Mann-Sein in der heutigen Zeit nicht gänzlich unabhängig sind. Diese treffen nicht unbedingt auf alle Männer zu und sind insofern nicht geschlechtsspezifisch. Aber es sind eben doch so einige Männer, die momentan Krisen durchmachen. Oder anders formuliert: Eine ganze Reihe von Krisen betreffen heutige Männer deutlich stärker als Frauen, sind also geschlechtstypisch. Und sie betreffen auch die heutige Männergeneration stärker als frühere Männergenerationen. Ich werde diese aktuellen, weitverbreiteten Krisen im Folgenden als »MännerKrisen« bezeichnen. Dazu später mehr.
Krisenhafte männliche Natur? Nein!
In immer mehr Zeitungsartikeln zum Thema »Mann-Sein« werden wir Männer etwas ironisch als das »schwache Geschlecht« bezeichnet. Darin steckt mehr Wahrheit als von den meisten Autoren angenommen. Denn die männliche Natur hat etwas grundlegend Fragiles. So ist etwa die Säuglingssterblichkeit von Jungen höher als die von Mädchen. Die starke Testosteronausschüttung bei Jungen, insbesondere im frühen Grundschulalter, trägt dazu bei, dass Jungen sehr viel Antrieb haben, dadurch aber auch mehr Unfälle erleben als Mädchen.
Vor allem aber haben Männer zwei Chromosomen nur je einmal: die Geschlechtschromosomen X und Y. Der Hirnforscher Gerald Hüther, der 2009 ein spannendes Buch über das männliche Gehirn geschrieben hat, vergleicht das mit »einem Auto ohne Ersatzrad«: »Alle anderen Chromosomen müssen paarweise vorhanden sein, damit ein Embryo lebensfähig ist. Nur den Mann schickt die Natur mit diesem einzelnen X-Chromosom auf die Welt. Das macht das männliche Geschlecht anfälliger.« (Faz.net-Interview 2009) Frauen, die ja zwei X-Chromosomen besitzen, können Fehler des einen Chromosoms durch das andere ausgleichen, Männer haben diese Möglichkeit nicht.
Diese physischen Anfälligkeiten meinen wir aber in der Regel nicht, wenn wir die männliche Natur als solche problematisieren. Sie würden ja auch eher Mitgefühl mit Jungen und Männern schüren oder Überlegungen anregen, wie etwa mit dem hohen Testosteronspiegel im Grundschulalter besser umzugehen ist, als vorschnelle ADHS-Diagnosen zu stellen (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) oder Jungen zu mehr Ruhe zu »erziehen«. Das Problem besteht darin, dass es eine grundlegende Abwertung der männlichen Natur gibt. Also keine Abwertung eines speziellen Männerbildes, auch keine Abwertung aller Männer und Jungen, weil »Ausnahmen« von der vermeintlichen Regel nicht von der Hand zu weisen sind, sondern eine Abwertung der normalen männlichen Natur. Das gipfelt dann in Aussagen wie: »Männer sind von Natur aus egoistisch, triebhaft, wild und ungezügelt, nur auf den eigenen Vorteil bedacht, emotional tumb, sexbesessen und gewaltaffin!« Dass diese Attribute der männlichen Natur zugeschrieben werden, macht die Abwertung besonders mächtig, stabil, geradezu unabänderlich. Gegenbeispiele werden als »unmännlich« oder »nicht-männertypisch« bezeichnet, um die grundlegende Charakterisierung nicht verändern zu müssen.
Es gibt also keine grundlegende »Krise der männlichen Natur«: Der Mann als solcher ist nicht plötzlich von seiner biologischen Grundausstattung her schlecht ans moderne Leben angepasst. Es gibt vielmehr eine Krise, weil die männliche Natur beziehungsweise das, was dafür gehalten wird, abgewertet wird.
Das Phänomen ist gar nicht so neu. Eine gesellschaftlich breit angelegte Abwertung von Männern gibt es bereits seit zwei bis drei Jahrhunderten (siehe Kucklick, 2008). Sie ist keineswegs eine über das Ziel hinausgeschossene Erfindung radikaler Feministinnen. Die heutige Abwertung von Männern ist quasi nur das Update eines seit Jahrhunderten laufenden Programms. Allerdings ein aus dem Ruder gelaufenes Update, da der Mann nun im Ganzen als eher ungeliebter Problemfall betrachtet wird. Diese Erfahrung destabilisiert natürlich viele Männer auf verschiedenen Ebenen – und diese Destabilisierung ist durchaus als krisenhaft zu bezeichnen. Ich werde diesen Aspekt am Ende des siebten Kapitels intensiv behandeln. Aber so viel sei schon jetzt gesagt: Die Abwertung der männlichen Natur hat meines Erachtens die dramatischste aller hier angeführten Krisen hervorgerufen.
Apropos Natur: Gene oder Sozialisation? Ja und Ja!
Man kann schwerlich über Männlichkeit sprechen, ob krisenhaft oder nicht, ohne am frühen oder späteren Abend in die Anlage-Umwelt-Debatte zu geraten, also die Frage, was erblich ist und was sozialisiert. Diese Frage ist ja nicht nur aus einer Freude am Erkenntnisgewinn heraus interessant, sondern hat ganz praktische Handlungsrelevanz: Wenn etwas genetisch unabänderlich ist, hat es keinen Sinn, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie es verändert, erweitert oder modifiziert werden könnte.
Ich werfe diese Frage hier auf, um gleich deutlich zu machen, dass ich zu diesem Thema weder etwas beizutragen habe noch etwas dazu beitragen möchte. Denn ein Großteil der wahrnehmbaren Unterschiede zwischen den Geschlechtern hat eine biologische und eine sozial konstruierte Komponente. Und beide Komponenten interagieren, wie es in der Wissenschaft so schön heißt: Sie bedingen einander wechselseitig. Und wenn man dann den unglaublichen Facettenreichtum, die unsagbare Komplexität von sowohl genetischen als auch sozial konstruierten Komponenten berücksichtigt, dürfte sofort klar sein: Jeder Versuch, das Verhältnis der Anteile genetischer und sozialer Faktoren zu ermitteln, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Selbst auf ein einziges Phänomen bezogen: etwa die gesprochene Wortmenge pro Tag oder die Fähigkeit, mit einem Ball umzugehen.
Auch wenn nur ein einziges Chromosom Männer und Frauen voneinander unterscheidet: Dieses eine Geschlechtschromosom ist nun ganz sicher so wirksam, dass die Psychologen gern von einer großen »Augenscheinvalidität« sprechen. Übersetzt heißt das: »Das sieht doch jeder Idiot, dass dieses Chromosom einen Unterschied hervorbringt!«
Gleichzeitig birgt schon ein einziger Tag, eine einzige Stunde im Leben eines Menschen eine solche Vielzahl an Lernerfahrungen, auch und gerade was die Geschlechterrollen betrifft, dass diese unmöglich fassbar sind. Sie haben ebenfalls eine Augenscheinvalidität: Man muss auf dem »Gender-Auge« mehr als blind sein, um nicht zu sehen, wie Medien, Familie, Freundeskreis, Schule oder Kita Mädchen und Jungen alltäglich mit völlig unterschiedlichen Erwartungen, Zuschreibungen oder Spielangeboten konfrontieren.
»Spielangebote« ist schon ein gutes Stichwort. Denn was die mächtige Sozialisationsinstanz Spielwaren betrifft, ist es meinem persönlichen Eindruck nach in den vergangenen dreißig Jahren eher schlimmer als weltoffener geworden. Sicher, auch in meiner Kindheit gab es »Mädchen-Spielzeug« wie Puppen oder Bastelsachen und »Jungen-Spielzeug« wie Lego oder Technik-Bausätze. Heute aber fehlt es eigentlich bloß noch, dass Mädchen und Jungen bei Teddy Toys oder Toys R Us direkt am Eingang gewaltsam getrennt und in verschiedene Teile des Gebäudes geführt werden. Im »Jungen-Bereich« gibt es nicht mehr einfach nur Lego, sondern Lego Star Wars in tiefschwarzen, martialisch anmutenden Verpackungen. Sämtliche Autos können sich in – meist schwarze – Kampfmaschinen verwandeln, und der Rest der Spielsachen hat ein Piratenlogo (schwarz). Über den »Mädchen-Bereich« kann ich leider nicht so viel sagen, da die dort vorherrschende Farbkombination aus Rosa und Zartrosa bei mir umgehend Schwindelanfälle hervorruft.
Wo wir schon bei Farben sind: Ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, dass das Tragen von grünen Pullovern bei Mädchen in den Achtziger- oder Neunzigerjahren reihenweise Depressionen ausgelöst hätte. Auch habe ich eigentlich nie beobachtet, dass Jungen mit roten T-Shirts auf dem Schulhof kategorisch gemobbt wurden. Nein, meiner möglicherweise naiven Vorstellung zufolge gab es früher tatsächlich so etwas wie geschlechtsneutrale Farben. Damit aber ist spätestens seit dem Aufstieg der Kinderbekleidungsversandhäuser endgültig Schluss.
Wenn wir etwa im Internet für unsere jüngste Tochter (perverse Lieblingsfarbe: Blau!) eine Jacke suchen, müssen wir bei »Jungenjacken« nachschauen. Dort finden wir dann die exakt gleiche Jacke, die in der Rubrik »Mädchenjacken« in Rot und Rosa angeboten wird, in Blau, Grün und natürlich Schwarz. In nicht allzu ferner Zukunft werden Otto oder jako-o beim Kauf von Kinderklamotten vermutlich eine Namensangabe verlangen und dann die Auslieferung einer blauen Jacke an eine Marlene oder eine Hannah verweigern. Und bei Bestellung eines rosa Einhorn-T-Shirts für einen Jason oder Maximilian wird routinemäßig das Jugendamt verständigt werden.
Nun gut, vielleicht halten Sie es doch mehr mit der um Präzision bemühten Wissenschaft als mit der Augenscheinvalidität. Dann empfehle ich Ihnen die nicht nur wissenschaftshistorisch hochinteressante Lektüre der sogenannten Baby X-Studien, die in den USA vor allem in den Siebzigerjahren en vogue waren. Sie beschreiben die Interaktionen von Versuchspersonen mit etwa drei Monate alten Babys (siehe Seavey, Katz & Zalk, 1975; Sidorowicz & Lunney, 1980). Natürlich waren die Ergebnisse dieser dutzendweise durchgeführten Studien sehr unterschiedlich. Die Interpretationen der Ergebnisse waren, je nach Weltbild der Autoren, noch variantenreicher. Von der Tendenz her zeigte sich aber das folgende Bild: Eine Puppe wurde als Spielzeug wesentlich häufiger gewählt, wenn man den Versuchspersonen das Baby als Mädchen vorstellte; zum Football wurde eher gegriffen, wenn das Kind als Junge bezeichnet wurde.
Ein weiteres sehr überzeugendes Beispiel für die Bedeutung von Geschlechterkonstruktionen sind die deutlich sichtbaren Veränderungen, die es seit der zweiten Frauenbewegung bei den Frauen gegeben hat. So haben etwa Mädchen innerhalb kürzester Zeit ihren schulischen Rückstand gegenüber Jungen nicht nur aufgeholt, sondern die Ausgangslage ins Gegenteil verkehrt. Eine veränderte Wahrnehmung oder auch Förderung von Mädchen, eventuell auch die Umgestaltung des Unterrichts, haben die konkrete Leistungsfähigkeit also massiv beeinflusst. Denn Gene, so viel ist sicher, verändern sich innerhalb von ein paar Generationen nicht so drastisch.
Langer Rede kurzer Sinn: Die Frage nach dem jeweiligen Einfluss von Genen und von Faktoren der Sozialisation auf die Unterschiede der Geschlechter ist berechtigt, aber nicht zu beantworten. Und da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage: Sie wird auch noch sehr lange unbeantwortbar bleiben.
Nun sind unbeantwortbare Fragen ja durchaus interessant, sie regen die Gedanken an und fördern den Meinungsaustausch. Sie ermöglichen es überhaupt erst, eine persönliche Meinung zu haben. Denn wo es unzweifelhaft eine Antwort gibt, können Meinungen nicht mehr existieren, nur noch Wahrheit und Irrtum. Unbeantwortbare Fragen sind also persönlichkeitsstiftend und damit ganz wunderbar. Ich verfolge sie privat auch leidenschaftlich. In der Psychotherapie sind sie ebenfalls gut einsetzbar, insbesondere beim häufigen, aber schwer behandelbaren Phänomen der richtungslosen Reue: »Was wäre gewesen, wenn …?« Ich »antworte« dann gerne mit einer schönen unbeantwortbaren Frage wie etwa: »Wäre ich ein guter Japaner?« Oder auch: »Was denkt mein Auto über mich?« Diese und viele andere herrlich unbeantwortbare Fragen stammen aus dem Buch Findet mich das Glück? der Schweizer Künstler Peter Fischli und David Weiss.
Als Diplom-Psychologe interessiere ich mich aber noch mehr für konkrete Veränderbarkeit. Und für mögliche Veränderungen im Bereich der Geschlechterverhältnisse ist der ewige Richtungsstreit zwischen verbissenen Soziobiologen auf der einen und Radikalkonstruktivisten auf der anderen Seite wenig hilfreich. Ich habe in den ersten Jahren meiner Auseinandersetzung mit Geschlechterthemen vermutlich ein Dutzend Bücher zur Anlage-Umwelt-Debatte gelesen. Es waren durchaus spannende Bücher dabei. Außerdem war ich damals noch sportlicher unterwegs und suchte ein Team, eine Seite, der ich mich zuordnen konnte. In den letzten fünfzehn bis zwanzig Jahren hat mich die Gene-versus-Sozialisation-Frage aber kaum noch beschäftigt. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu alt oder zu wenig ambitioniert für die großen Fragen des Lebens.
Krise der Männlichkeit? Mehr als das!
Es gibt also weder eine »Krise der Männer« noch eine »Krise der männlichen Natur«. Was es aber durchaus gibt, ist eine »Krise der Männlichkeit« – also der Art und Weise, wie Mann-Sein in unserer Gesellschaft sozial konstruiert wird, welche Leitlinien und Vorbilder vorgegeben werden, welche Erwartungen an Männer gestellt und welche Beschränkungen ihnen auferlegt werden.
Aber welche Form von Männlichkeit ist in der Krise? Kein Mensch wird ja behaupten wollen, dass etwa die heute so häufig genannte »moderne Männlichkeit« in der Krise sei. Oder grundsätzlich alle vorstellbaren Konstruktionen von Männlichkeit. Oder gar all die Subgruppen-Männlichkeiten, mit denen sich die Männerforschung intensiv beschäftigt und dabei den Begriff »Männlichkeiten« schon seit Langem nur noch im Plural benutzt, um eben den Unterschieden zwischen verschiedenen Gruppen von Männern gerecht zu werden.
Nein, in der Krise ist eine ganz bestimmte Konstruktionvon Männlichkeit, nämlich die der traditionellen Männlichkeit. Also jener Männlichkeitsentwurf, der über Jahrhunderte und sogar Jahrtausende hinweg vorherrschend war und das gesellschaftliche Bild vom Mann-Sein geprägt hat. Er lässt sich mit Schlagwörtern beschreiben wie »Ernährer«, »Beschützer«, »Härte«, »Rationalität« oder »Dominanz«.
Diese Männlichkeitskonstruktion, die ich im Folgenden »Traditionelle Männlichkeit« nennen (und aufgrund ihrer Bedeutung großschreiben) werde, ist ganz sicher in der Krise, denn sie ist in den letzten Jahrzehnten derart unter Beschuss geraten, dass ihr weiteres Bestehen auf längere Sicht in Gefahr ist. Meines Erachtens ist das eine gute Entwicklung. Auch darauf werde ich zurückkommen. Zunächst müssen wir aber wieder dieses Sprechverbot durchbrechen.
»Psssst!«
Ich hatte schon erwähnt, dass es problematisch sein kann, auf männliches Leiden oder männliche Diskriminierungserfahrungen hinzuweisen und dabei vielleicht sogar Mitgefühl zu signalisieren. Doch es geht noch weiter: Schon der Gebrauch des Begriffs »Krise der Männlichkeit« ist für viele Autoren entweder Anzeichen von Ignoranz oder Beweis für eine frauenfeindliche Gesinnung.
So wird etwa die gesamte Auseinandersetzung mit diesem Thema im Blog der Journalistin Teresa Bücker (2013) als grundlegend antifeministisch angesehen. Bücker wittert nämlich hinter der »These von der Krise der Männlichkeit« die Vorstellung, die Krise der Männer könne nur über eine Rückkehr in traditionelle Rollenmuster beigelegt werden. Entsprechend schlussfolgert sie: »Dieser Diskurs ist damit ein Instrument zur Verstärkung des Backlashs.«
Diese keinen Widerspruch duldende Aussage ist umso erstaunlicher, als in dem Artikel ansonsten durchaus bemerkenswerte Gedanken stecken. So fragt die Autorin etwa, wo denn die »Debatte unter Männern über die vielfältigen Rollen, die sie einnehmen könnten – und schon immer einnehmen«, bleibe. Diese Debatte vermisse ich in der Tat ebenfalls bei uns Männern. Aber es ist auch nicht hilfreich für eine Debatte über alternative Männlichkeitsentwürfe, wenn den Diskutierenden per se Frauenfeindlichkeit unterstellt wird.
Ähnlich zwiegespalten war ich nach der Lektüre eines Aufsatzes von Rolf Pohl (2010) zum »Diskurs über die Krise der Männlichkeit«. Der Soziologe entlarvt schonungslos die latente bis manifeste Frauenfeindlichkeit einiger Autoren und hinterfragt das Bedürfnis mancher Gruppen von Männern nach der Wiederentdeckung einer »wahren Männlichkeit«. Viele von Pohls Analysen finde ich sehr zutreffend. Eine persönliche Begegnung mit einem ideologisch verwirrten Frauenhasser, die Pohl zu Beginn schildert, habe ich übrigens in beinahe identischer Form selbst schon zweifach erleben müssen. Ich fand das ähnlich unangenehm wie Pohl.
Umso mehr war ich irritiert, als Fazit dieses beachtenswerten Textes Folgendes zu lesen: »Die Rede von der ›Krise der Männlichkeit‹ ist eine rückwärtsgewandte Reaktion auf die marktradikale Verschärfung des gesellschaftlichen Krisengeländes und enthält hohe projektive Anteile. Das bedeutet: Die Krise erscheint in vielen einschlägigen Diskursen als Folge einer die Männer pauschal diffamierenden, vor allem aber die Jungen und Väter einseitig vernachlässigenden Frauenpolitik und Mädchenförderung und kann, zugespitzt, als Backlash, als antifeminine und antifeministische Gegenbewegung im Rahmen einer allgemeinen Re-Maskulinisierung der Gesellschaft interpretiert werden.« (S. 21) Zwar spricht Pohl hier relativierend von »vielen« Diskursen und weist sein Fazit auch als »Zuspitzung« aus, aber, nun ja, diese allgemein gehaltene Spitze trifft mich schon persönlich.
Denn natürlich ist es wahr, dass manche Männer von genau dieser rückwärtsgewandten Sehnsucht nach einer »starken Männlichkeit« angetrieben sind. Und manche Menschen, die sich in dieser Debatte zu Wort melden, erzählen schlicht frauenfeindlichen Unsinn. Aber nur weil einige Leute den Diskurs missbräuchlich führen, kann es doch nicht grundsätzlich verboten sein, auf die Krisen und das Leiden von Männern hinzuweisen. Und geradezu kontraproduktiv ist es doch, mit einer solchen Argumentation die Debatte über die Krise der Traditionellen Männlichkeit zu unterbinden.
Bei allem Respekt: Es wurden vermutlich auch schon Menschen mit Stricknadeln ermordet, dennoch käme keiner auf die Idee, ein Internetforum über Strickmuster als kriminelle Vereinigung einzustufen. Ich habe auch noch nie gehört, dass jemand den Mitgliedern von Attac, die ja nun beständig von der »Krise des Kapitalismus« sprechen, unterstellt, sie wollten in Wahrheit einen Kapitalismus alter Schule stützen. Und wenn Alice Schwarzer morgen einen Vortrag zur »Krise des Patriarchats« hielte, würde wohl kaum jemand davon ausgehen, dass sie urplötzlich eine Sehnsucht nach den alten Zeiten entwickelt hätte.
Wie gesagt: Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass diese so populäre Interpretation von Pohl, Bücker und anderen Autoren auf so manchen, in der Regel männlichen Diskursteilnehmer zutrifft. Aber ich halte es für wenig hilfreich, grundsätzlich allen, die von einer »Krise der Männlichkeit« sprechen, eine frauenfeindliche Motivation zu unterstellen.
Als Diplom-Psychologe mache ich im Übrigen häufig die Erfahrung, dass Menschen, die sich in Krisenlagen konstruktiv mit ihrer Situation auseinandersetzen, ihre Krisen keineswegs dadurch lösen, dass sie alte Verhaltensmuster verstärken oder wiedererlangen. Zwar kommen in der Tat einige Männer anfangs mit genau diesem Wunsch in die Therapie, etwa bei sexuellen Schwierigkeiten oder Depressionen. Beziehungsweise Burn-out, wie Männer es ja lieber nennen: »Machen Sie mich wieder stark, leistungsfähig, potent, stabil, so wie ich früher war!« Diesen Auftrag weise ich immer gleich zurück. Erstens habe ich keine Lust, ihn zu erfüllen, da er so begrenzt ist. Und zweitens ist er unerfüllbar: Es geht einfach nicht! Die Wiederherstellung eines früheren Zustands ist schlicht nicht möglich. Mit ein klein wenig Unterstützung bei der Selbstreflexion kommen die Männer aber in der Regel auch sehr schnell darauf, dass es ja genau ihre alten Verhaltensweisen und Einstellungen waren, die sie in die Krise geführt haben. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Krise führt also häufig dazu, dass die Männer neue Impulse spüren, neue Verhaltensweisen in Betracht ziehen und ausprobieren.
Um es plakativer zu fassen: Männliches Jammern wird gleichgesetzt mit Zurück-zum-Alten-Wollen. Das finde ich unzulässig und falsch. Man jammert, weil einem etwas fehlt, vielleicht etwas Altbekanntes, gerne aber auch etwas Neues. Und selbst wenn man nur um das Verlorene jammert, ist das meines Erachtens auch erst einmal legitim. Aus dem Jammern kann dann ja irgendwann ein erweiterter, nach innen wie auch nach vorne gerichteter Blick entstehen. Wenn Männer also nicht jammern dürfen, wenn sie sich nicht beklagen dürfen, wenn sie rein gar nichts rund um ihr Mann-Sein in der Krise wähnen dürfen, dann ist das für mich Ausdruck der äußerst traditionellen Vorstellung: Männer haben keine Probleme (zu haben)!
Wie soll denn die allseits gewünschte »männliche Debatte über vielfältige Rollen« (Bücker), die Auseinandersetzung unter Männern, ja, die vielfach geforderte Männerbewegung entstehen, wenn Männer gar nicht jammern dürfen? Woraus soll denn Veränderung sonst resultieren, wenn nicht aus einem Beklagen der gegenwärtigen Zustände? Wo wäre die Frauenbewegung heute, wenn die Frauen nicht gejammert hätten, wenn sie sich nicht beklagt, beschwert, auf Krisenhaftes und Unduldbares hingewiesen hätten?
Also: Selbstverständlich gibt es eine »Krise der Männlichkeit«, nämlich der Traditionellen Männlichkeit. Und wie gesagt: Das ist auch gut so. Denn aus den gesellschaftlichen Verunsicherungen, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, weil die Traditionelle Männlichkeit bröckelt, erwachsen zahlreiche Chancen.
Übrigens: Eine Krise der »modernen Männlichkeit« gibt es auch.Sie besteht im Wesentlichen darin, dass zwar viele von »moderner Männlichkeit« sprechen, aber eigentlich keiner so genau weiß, wie diese aussieht und wofür wir sie überhaupt brauchen. Die »moderne Männlichkeit« hat also sozusagen eine Existenzgründungskrise. Ich schreibe sie daher weiter klein.
Risse im Fundament
Das traditionelle Männlichkeitsbild wurde schon vor hundert und mehr Jahren immer wieder einmal infrage gestellt, in aufgeklärten Männerkreisen und in der ersten Frauenbewegung. Zudem haben vermutlich einige Mediziner das Gesundheitsschädliche, oft sogar Todbringende der traditionell-männlichen Lebensweise frühzeitig erkannt. Manch progressiver Mensch mit gesundem Menschenverstand hatte sicher auch im Nationalsozialismus Zweifel an dem Bild vom »harten Kruppstahl«.
Eine so starke Breitseite, dass man von einer beginnenden Krisenhaftigkeit sprechen kann, bekam die Traditionelle Männlichkeit aber wohl erst in den Siebzigerjahren. Wenn das, was bis dato als »männliche Verantwortung und Führungsstärke« durchging, öffentlich als »Machtmissbrauch« bezeichnet werden darf und wenn die Position des »Familienoberhaupts« mit »unterdrückender Gewalt« assoziiert wird, dann sind schon erste Kratzer im Lack sichtbar. Spätestens aber, wenn eine Gesellschaftskonstruktion sich gezwungen sieht, auf ihre Kritikerinnen zu reagieren, sie als »Emanzen« und »sexuell frustrierte« Frauen zu bezichtigen, entstehen deutliche Risse im Fundament.
Spätestens seit Beginn dieses Jahrtausends nun wird die Kritik an der Traditionellen Männlichkeit nicht nur immer lauter, sondern auch merklich differenzierter. Zudem wird sie mittlerweile von Frauen und Männern geäußert und stammt aus zu vielen politischen und gesellschaftlichen Lagern, als dass die Gegner noch als »radikalideologisch motivierte Elemente« diskreditiert werden können. Die Leitmedien trauen sich zunehmend, diese Kritik aufzugreifen, oder sie sehen sich gar dazu gezwungen, um nicht dem Zeitgeist hinterherzulaufen. So wird also die traditionelle Männlichkeitskonstruktion in immer größeren Teilen der Gesellschaft nicht mehr unhinterfragt übernommen. Sie beginnt, ihre uneingeschränkte Führungsrolle und ihre Ordnungsfähigkeit zu verlieren. Für ein gesellschaftliches Leitbild ist das schon mehr als nur der Anfang vom Ende.
Von daher halte ich es für gerechtfertigt, im Folgenden nicht mehr von einer Krise der Traditionellen Männlichkeit zu sprechen, sondern vom Zerfall der Traditionellen Männlichkeit. Zum einen ist der Begriff des »Zerfalls« aus meiner Sicht inhaltlich noch präziser: Eine Krise ist in der Regel zeitlich begrenzt, und es gibt eine reale Chance, sich von der Krise zu erholen, sie zu überstehen und stärker denn je aus ihr hervorzugehen. All das erwarte ich von der Traditionellen Männlichkeit jedoch nicht. Sie wird sich meines Erachtens nicht wieder stabilisieren, reformieren und im neuen zeitgemäßen Gewand die Alleinherrschaft zurückgewinnen. Sie wird vielmehr eingehen. Wir, unsere Kinder und unsere Enkel werden das vermutlich nicht mehr erleben, denn manche Dinge brauchen eben sehr, sehr lange, um endgültig zu Staub zu werden. Aber zerfallen wird sie.
Davon abgesehen können wir so den Begriff der »Krise« ohne jede inhaltliche Verwirrung dort verwenden, wo er hundertprozentig passend ist: bei den gesellschaftlichen Männer-Problemen, die infolge des Zerfalls der Traditionellen Männlichkeit entstanden sind. Bei den Verunsicherungen und Herausforderungen, denen Männer in der heutigen Umbruchsituation begegnen.
MännerKrisen? Ja! Und leider auch MännerKatastrophen!
Der Begriff »Krise« ist aber auch mit Vorsicht zu verwenden, wenn wir über einzelne Männer sprechen. Denn er suggeriert ja, es könne auch krisenlose Identitätsentwicklungen geben. Gibt es aber nicht: Krisen sind unvermeidlich. Und es soll hier auch keineswegs der Eindruck entstehen, das perfekte Männerleben sei krisenfrei. Ehrlich gesagt, mag ich mir Menschen ohne Krisen in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft gar nicht vorstellen. Ich persönlich würde mit so einem Menschen kaum ein Bier trinken wollen. Nicht nur, dass der Vergleich mit einem selbst ja entsetzlich deprimierend wäre. Worüber sollte man sich mit so jemandem unterhalten?
Krisen von Männern gibt es also genügend für so einige Biere – oder auch Psychotherapiestunden. Und einige dieser Krisen hängen eben mit dem erwähnten Zerfall der Traditionellen Männlichkeit zusammen: Wenn sich eine richtungsweisende Idealvorstellung vom Mann-Sein wie die Traditionelle Männlichkeit langsam auflöst, können einzelne Männer natürlich darunter leiden.
Andersherum kann männliches Leiden langfristig dazu beitragen, eine Idealvorstellung von Männlichkeit infrage zu stellen: So rüttelt etwa das sich langsam verbreitende Bewusstsein für männertypische Gesundheitsprobleme wie Burn-out heftig an der traditionell-männlichen Leistungsorientierung. Allerdings hat die Traditionelle Männlichkeit für diese Fälle eine elegante Idee der Prävention entwickelt: Jegliches Scheitern eines Mannes bei dem Versuch, traditionelle Ideale zu erfüllen, wird grundsätzlich als individuelles Versagen betrachtet. So wird dann von den Männern nicht das Ideal als solches hinterfragt, sondern die Fähigkeit der Selbstoptimierung: »Yes, you can – if you only try harder!«
Bevor wir uns aber diese Krisen rund ums heutige Mann-Sein genauer anschauen können, müssen wir eine meines Erachtens zentrale Differenzierung des männlichen Leids vornehmen, nämlich die Unterscheidung von »MännerKrisen« und »MännerKatastrophen« (aufgrund der Bedeutung dieser Schlüsselbegriffe nutze ich erneut die Großschreibung). Zwei Unterschiede sind dabei besonders relevant:
Wer also die Traditionelle Männlichkeit stützt, mildert zwar die MännerKrisen ab, zementiert aber die MännerKatastrophen. Wer sich von der Traditionellen Männlichkeit abwendet, entfernt sich zunehmend aus den MännerKatastrophengebieten, muss sich aber verstärkt mit den MännerKrisen auseinandersetzen.
MännerKrisen sind zeitlich begrenzt, MännerKatastrophen nicht. Ich hatte schon erwähnt, dass der Begriff »Krise« bei allen Unterschieden in der Definition grundsätzlich eine durch akute Geschehnisse ausgelöste Zuspitzung bezeichnet, meist im Zusammenhang mit einer Entscheidungssituation. Das altgriechische Wort krisis