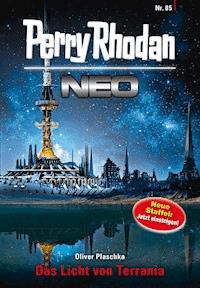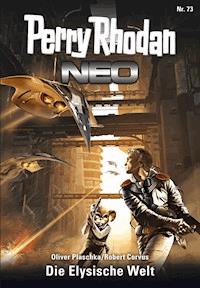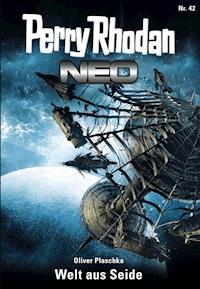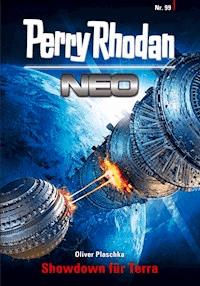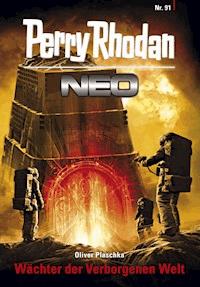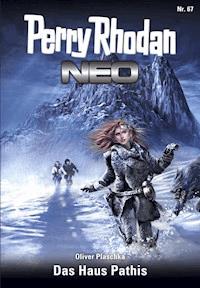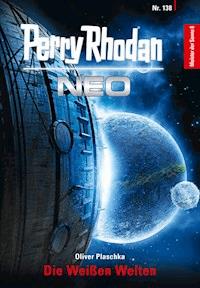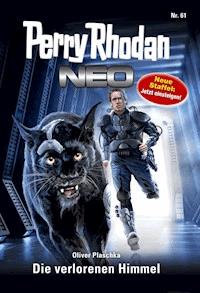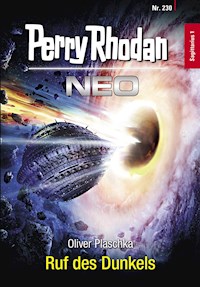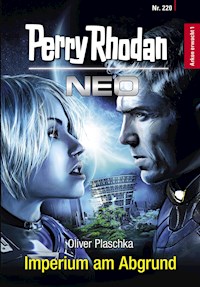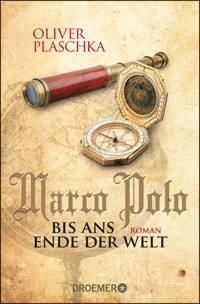
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein heldenhafter Abenteurer? Ein geistreicher Berater der Mächtigen? Oder doch nur ein einfacher Betrüger? Die einzige Romanbiografie über eine der schillernsten Figuren des Mittelalters: Marco Polo Ist dieser Mann ein Held, ein Genie oder nur ein Lügner? Diese Fragen gehen dem Geschichtenerzähler Rustichello durch den Kopf, als er der Erzählung seines Mitgefangenen Marco Polo lauscht. Hat dieser Marco es wirklich bis an den Hof des Kublai Khan geschafft? Doch diese Fragen verblassen mehr und mehr, je stärker der geschickte Geschichtenerzähler Marco seinen Zuhörer mit seinen Schilderungen gefangen nimmt. Und so reist Rustichello mit Marco zurück in die Vergangenheit, bestaunt mit ihm die Wunder Asiens, hört von dem Geschick, mit dem der Venezianer alle kulturellen Gräben überwinden und zu einem der wichtigsten Männer Chinas aufsteigen konnte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1117
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Oliver Plaschka
Marco Polo – Bis ans Ende der Welt
Roman
Computerkartographie Carrle
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Heldenhafter Abenteurer? Geistreicher Berater der Mächtigen? Oder doch nur einfacher Betrüger?
Diese Fragen gehen Rustichello durch den Kopf, als er 1298 im Gefängnis in Genua der Erzählung seines Zellennachbarn Marco Polo lauscht. Hat dieser Marco es wirklich bis an den Hof des Kublai Khan geschafft?
Doch diese Überlegungen verblassen mehr und mehr, je stärker der geschickte Erzähler Marco seinen Zuhörer mit seinen Schilderungen gefangen nimmt. Und so reist Rustichello mit Marco in die Vergangenheit, bestaunt mit ihm die Wunder Asiens, hört von dem Geschick, mit dem der Venezianer alle kulturellen Gräben überwinden und zu einem der wichtigsten Männer im Reich des Kublai Khan aufsteigen konnte …
Inhaltsübersicht
Karte
Stammbaum
Motto
Das Buch der Reise
I Der Venezianer
II Bilder der Serenissima
III Nicolò und Maffeo
IV Akkon
V Die Mitte der Welt
VI Die Macht der Geschichten
VII Das Wunder von Tabriz
VIII Ismael
IX Die Karaunas
X Datteln und Fisch
XI Der Priester Johannes
XII Die erloschene Flamme
XIII Die Vision im Traume
XIV Die Reise ans Ende der Welt
Das Buch Kithais
I Xanadu
II Der einsame Prinz
III Die zwei Städte
IV Der goldene Käfig
V Der Weg nach vorn
VI Anda
VII Khanbalik
VIII Die Khatun
IX Der Fall von Quinsai
X Besuche
XI Der silberne Baum
XII Drei magische Inseln
XIII Prinzessin Mondschein
XIV Wen die Götter beschützen
XV Bailo Ahmat
XVI Schattenspiel
XVII Verschwörer
XVIII Nacht am Palast
XIX Ein Sturm weißen Laubs
XX Geister unter den Sternen
XXI Abschied
XXII Das Reich Mien
XXIII Die Stadt des Himmels
XXIV Der späte Garten
XXV Die weiße Schlange
XXVI Die letzte Schlacht
XXVII Der Gang von Zeit und Welt
XXVIII Wie es endet
Das Buch der Heimkehr
I Der Brief
II Das Versprechen
III Die Geschichte von Sakyamuni Burkhan
IV Die Bawarij
V Der Fall
VI Antworten
VII Salbei und Hundefett
VIII Die neuen Polos
IX Il Milione (1)
X Der Sohn des Dogen
XI Das Wunder
XII Die Wahrheit (1)
XIII Der Vorschlag
XIV Die Wahrheit (2)
XV Il Milione (2)
Anhänge
1. Figurenverzeichnis
In Venedig
In Genua
Auf der Reise
Am Hof des Khans
In Kithai und Manzi
Sonstige Figuren
2. Historische Ereignisse
3. Ortsverzeichnis
4. Nachwort
5. Literatur (Auswahl)
6. Danksagung
In den Gärten funkelt manch emsiger Lauf
Wo Bäume reich vor Weihrauchduft erblühen
Und alt wie die Hügel die Wälder darauf
Umschließen sonnenhelles Grün
– Samuel Taylor Coleridge, Kubla Khan; or, A Vision in a Dream
Auf dem Bambus, gleich Jade zwischen dem Fels, schimmern Regentropfen
Und am Gebirgspass spielt der Wind in den Zedern wie auf einer Zither
– Kublai Khan, Eingebung während des freudigen Aufstiegs zum Frühlingsberg
Das Buch der Reise
1264–1273
IDer Venezianer
Genua, Oktober 1298
Als Rustichello da Pisa im Herbst des Jahres 1298 einen neuen Zellennachbarn bekam, hatte er die Hoffnung, in seinem Leben noch etwas anderes als das Gefängnis zu sehen, längst aufgegeben. Gewiss, der Palazzo del Capitano del Popolo war ein anständiges Gefängnis. Vielen tausend seiner Gefährten, die man nach der Schlacht von Meloria gefangen genommen hatte, war es schlechter ergangen. Dennoch ertappte er sich immer öfter bei dem Wunsch, den Palazzo lieber heute als morgen zu verlassen, und wenn schon nicht lebend, so doch wenigstens als toter Mann.
Beide Wünsche würden ihm verwehrt bleiben. Die Zukunft, die Rustichello da Pisa beschieden war, sollte eine seltsame und wunderbare sein.
Der Mann, der ihm die fast vergessene Welt jenseits der Mauern des Palazzos wieder vor Augen rief, in Farben leuchtender noch als die Träume, die in den grauen Wänden zu ihm kamen, wurde eines Montagmorgens in die Zelle neben seiner geworfen. Rustichello wusste, welcher Tag es war, weil das Essen montags immer spät kam und aus den aufgewärmten Resten vom Sonntag bestand. Das Jahr kannte er, weil man es ihm gesagt hatte, als sein letzter Zellennachbar gestorben war. Nur mit dem Monat war er sich nicht sicher – er hatte lange aufgehört, einen Kalender zu führen, denn die vielen in das Mauerwerk geritzten Striche hatten ihn an die Kratzspuren einer eingesperrten Bestie erinnert. Er musste aber bei gesundem Verstand bleiben. Das sagte er sich immer wieder, obwohl er kaum noch den Grund dafür wusste.
Die Palastdiener schleppten den Gefangenen in Ketten durch den Gang vor Rustichellos Zelle, schlossen die Tür zu seiner Linken auf, die seit dem Frühling nicht mehr geöffnet worden war, und warfen den Fremden unter zahlreichen Flüchen hinein. Dann schlugen sie die Tür wieder zu und schlurften missmutig davon. Die Palastdiener mochten den Keller nicht, weil es hier stank. Das wiederum wusste Rustichello noch aus eigener Erfahrung. Als er damals verlegt worden war, hatte sich ihm der Magen umgedreht von dem Geruch nach Unrat und Verzweiflung. Die Erinnerung daran war geblieben, auch wenn seine Sinne den Gestank nicht mehr wahrnahmen.
Früher, in den ersten Jahren, hatte er eine kleine Zelle im Erdgeschoss gehabt und man hatte ihm gelegentlich sogar Bücher zum Abschreiben gebracht. In dieser Zeit hatte er auch den spöttischen Namen aufgeschnappt, den die anderen Gefangenen den Wachen gaben: Palastdiener. Der Palazzo hatte einst dem für seine Volksnähe bekannten Guglielmo Boccanegra gehört. Doch nur zwei Jahre nach der Fertigstellung seines geschmackvollen Domizils hatte der tüchtige Capitano del Popolo sein Heil in der Flucht suchen müssen. Seither hatte man begonnen, den Palazzo als Gefängnis zu nutzen. Ein paar der Bediensteten waren noch dieselben wie zuvor, nur dass die Ansprüche an ihre Arbeit gesunken waren – und die Gefangenen sich einen Spaß daraus machten, sie als ihre Diener zu bezeichnen.
Rustichello liebte solche Anekdoten. Sie waren alles, was er noch besaß, und kostbarer denn je, seit er seine alte Zelle verloren und seine Reise abwärts in den hintersten Winkel des Kellers angetreten hatte, wo er von den anderen Häftlingen kaum noch etwas mitbekam. Er war ein Sammler des seltensten Guts, das den heutigen Bewohnern dieser Residenz geblieben war: Geschichten.
Einst, daran erinnerte er sich noch, hatten die Leute Gold und Silber dafür gezahlt, seine Geschichten zu hören. Und er hatte sie alle erzählt: Meliadus, Tristan, Palamedes. Heute war er mittellos, ein Trödler ohne Stand, der dankbar sein musste, dass man ihm noch das Gnadenbrot gab. Manchmal fragte er sich, was geschehen würde, wenn man ihn hier unten einfach vergaß.
Der Gefangene in der Zelle nebenan rasselte mit seinen Ketten.
»Messere?«, fragte Rustichello an die Wand zu seiner Linken gerichtet, in der sich auf Bodenhöhe ein kleines, verwinkeltes Loch befand. Das Mauerwerk des Kellers war weich und mit den Jahren löchrig geworden. Leider war es dennoch dick genug, dass die versteckten Verbindungen den Ratten des Palasts als ihre höchsteigenen Flure durch die Gemächer dienten. »Könnt Ihr mich hören?«
Ein undeutliches Stöhnen war die Antwort.
»Messere?«
»Wo … bin ich?« Der Mann hatte eine ruhige und angenehme Stimme, auch wenn ihm fast die Kraft zum Reden fehlte.
»Im Palazzo del Capitano del Popolo.«
Wieder das Stöhnen. »Dann habe ich den tiefsten Höllengrund erreicht.«
»Glaubt Ihr?«, fragte Rustichello interessiert. Er hatte den Palazzo in Gedanken von vielen Seiten betrachtet, doch die Idee, dass sein Gefängnis in Wahrheit die Hölle sein könnte, war ihm all die Jahre noch nicht gekommen.
»Heißt es nicht, die Gefangenen würden hier bei lebendigem Leibe verhungern? Ich hörte, man stecke sie in ein Loch und werfe den Schlüssel weg. Gute christliche Tradition.«
»Messere, noch seid Ihr nicht tot, und Ihr solltet nicht lästern«, tadelte Rustichello. »Wahrscheinlich seid Ihr Venezianer, nicht wahr?«
»Wie kommt Ihr darauf?« Die Stimme nebenan klang nun wacher.
»Weil niemand sonst solche Probleme hat, Leben und Tod voneinander zu unterscheiden. Und auch am rechten Glauben mangelt es Euch häufig, wie man sagt.«
Ein undeutliches Grunzen war die Antwort.
»Habe ich recht?«, fragte Rustichello erfreut. »Ihr kommt aus Venedig?«
»Wie steht es mit Euch?«
»Ich bin Pisaner«, stellte er sich vor. »Rustichello, zu Euren Diensten.«
»Dann scheint es, wir haben einander im Herzen unseres gemeinsamen Feindes gefunden, Rustichello da Pisa.« Er glaubte eine gewisse Befriedigung in der Stimme seines Nachbarn zu hören.
»Nun, Ihr gewiss …« Rustichello räusperte sich. Es schickte sich nicht, dass sein Nachbar sich noch nicht vorgestellt hatte, aber von einem Venezianer war unter diesen Umständen wohl nicht mehr zu erwarten. »Wahrscheinlich werdet Ihr bei Eurer Ankunft die Löwen bemerkt haben, die die Außenmauer des Palazzos zieren. Diese Löwen stammen von der venezianischen Botschaft in Konstantinopel … Ich wünsche Euch, dass das Wahrzeichen Eurer Heimat Euch einen kurzen Aufenthalt im Palazzo beschert.«
»Das ist sehr freundlich«, murmelte der Venezianer. »Insbesondere, da Euch dieses Glück anscheinend verwehrt blieb – so wie vielen Eurer Landsleute. Wahrscheinlich wisst Ihr, was man sich dort draußen lange Zeit über Pisaner erzählte?«
»Aber sicher doch.« Rustichello seufzte. »Dass sie keinen geraden Glockenturm bauen können, nehme ich an.«
»Das auch«, gab die Stimme zu. »Ich meinte aber etwas anderes.«
»Was?«, fragte Rustichello. »Was erzählte man sich über Pisaner?«
»Dass man schon nach Genua gehen müsse, um welche zu treffen.«
Rustichello schnaubte. »Es ist nicht sehr freundlich, Scherze mit einem Verdurstenden zu treiben.«
»Einem Verdurstenden?«
»Aber ja.« Er fühlte sich auf einmal sehr müde, trotz der unverhofften Gesellschaft. Vielleicht ängstigte ihn, was dieser Venezianer ihm noch alles erzählen könnte. Lange Jahre war die Zeit an ihm vorbeigeeilt. Sein Leben zerrann ihm unter den Fingern, als versuchte er, mit bloßen Händen den feinen Sand aus einem Stundenglas zu schöpfen. Manchmal wusste Rustichello nicht mehr, wie alt er eigentlich war. Dieser Fremde mochte es ihm in Erinnerung rufen.
»Ihr könnt es Euch vielleicht nicht vorstellen, denn Ihr seid erst seit kurzem hier. Doch mit der Zeit werdet Ihr erkennen, dass Euer ärgster Feind an diesem Ort Ihr selbst seid. Ihr seid alles, was Euch bleibt. Und Ihr werdet Euch zur Last fallen. Ihr werdet Euch danach verzehren, etwas anderes kennenzulernen als Euch selbst. Vielleicht wird Euch das Angst machen, und vielleicht werdet Ihr Euch selbst darüber verlieren, so dass Ihr irgendwann gar nichts mehr habt. Alles, was bleibt, ist diese Wüste aus Stein, in der man eines Tages Eure Gebeine finden wird. Das meinte ich, als ich von einem Verdurstenden sprach.«
Er hatte sich währenddessen auf den Rücken gedreht, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, unter ihm das schmutzige Stroh, über ihm die Decke mit ihren Landschaften aus Schatten und Schimmel.
»Wisst Ihr, wovon ich rede?«
Doch sein Mitgefangener gab keine Antwort mehr, und bald darauf war Rustichello eingenickt.
»Ich weiß sehr gut, wovon Ihr sprecht«, sagte der Venezianer, als Rustichello erwachte. Graues Licht fiel durch das schmale, vergitterte Fenster auf Kopfhöhe, das ihm zwar eine Ahnung des Wechsels von Tag und Nacht bescherte, aber lediglich den Blick auf ein paar Pflastersteine im Hof zuließ. Wie viel hätte er an manchen Tagen dafür gegeben, auch nur zwei Fingerbreit blauen Himmel zu sehen! Doch solange die Glocke der Kathedrale San Lorenzo nicht schlug, hatte er keinen Anhaltspunkt, wie viel Zeit er verschlafen hatte. Das passierte ihm immer öfter: Er döste ein und dämmerte wie unter einem Zauberbann dahin, bis er nicht mehr wusste, was Traum und was Wirklichkeit war.
Rustichello rieb sich die Augen und schaute sich um. Es hatte kein neues Essen gegeben, also konnte es noch nicht Dienstag sein. Das Dienstagsessen war einen Hauch frischer und weniger furchtbar als das vom Montag, doch auch das half nicht, die Erinnerung an richtige Mahlzeiten wach zu halten. Früher einmal hatte er den Geschmack von Honig oder Feigen gekannt. Vor ein paar Jahren noch hätte er in dunklen Stunden sein Seelenheil dafür verpfändet, diese Genüsse noch einmal zu kosten. Heute, da er vergessen hatte, was ihm einst so besonders daran erschienen war, kam ihm das alles sehr kindisch vor.
»Wovon haben wir denn gesprochen?«, fragte er benommen.
»Davon, dass ich mir zu Last falle«, sagte der Venezianer. »Dass ich mir selbst zu viel sei und gleichzeitig fürchten müsse, nichts anderes mehr zu haben. Und davon, dass man meine Gebeine dereinst in einer Wüste finden würde.«
»Ich muss mich für meine Worte entschuldigen«, murmelte Rustichello. »Es ziemt sich nicht, seinem Nachbarn so etwas zur Begrüßung zu sagen, und es ergibt auch wenig Sinn. So wie das meiste in meinem Leben.«
»Wieso seid Ihr hier?«, fragte der Venezianer.
»Man nahm mich in der Schlacht von Meloria gefangen.« Er winkte ab, auch wenn sein Nachbar es nicht sehen konnte. Es war eine jener Gesten, die er sich im Laufe langer Selbstgespräche angewöhnt hatte. »Ihr werdet davon gehört haben.«
»Das habe ich tatsächlich, aber nicht so ausführlich, wie Ihr vielleicht glaubt. Ich war lange fort, wisst Ihr.«
»Die Schlacht von Meloria«, murmelte Rustichello zerstreut und suchte nach den rechten Worten, bis sie ganz plötzlich über ihn hereinbrachen. Auch das passierte ihm immer häufiger. Manchmal kam er sich vor wie ein Mann, der auf seiner Suche nach einem bestimmten Weizenkorn auf einmal merkt, dass seine Schritte ihn in die Kornkammer geführt haben und dass er nicht zu wenig, sondern viel zu viel von dem Gesuchten hat.
»Die Schlacht von Meloria hätte die Entscheidungsschlacht zwischen Pisa und Genua werden sollen. Zwei alte Rivalen, in tödlicher Umklammerung – wie Drachen, die übereinander herfallen, die Fänge im Fleisch ihres Feindes …« Unwillkürlich hatten seine Arme einander gepackt, und seine Fingernägel bohrten sich in die Ballen. Er lockerte seinen Griff und holte Luft.
»Fahrt fort«, bat der Venezianer.
»Zweiundsiebzig Galeeren hatte Pisa aufgeboten. Es war der sechste August …«
»Der Sankt-Sixtus-Tag …«
»Der Nationalfeiertag meiner Heimat, ganz recht. Der Tag, an dem wir unsere Siege auf den Balearen und im Heiligen Land errangen. Geschichte schreibt man nicht an irgendeinem Tag. Heute zum Beispiel, wo nur die Konsistenz eines faden Breis mir Aufschluss über den Kalender zu geben vermag …« Er kratzte sich im Nacken. »Wo war ich?«
»Zweiundsiebzig Galeeren«, half der Venezianer aus.
»Dank Euch. Also hier drei Geschwader, und auf der anderen Seite nur zwei. Der Sieg hätte ein leichter sein sollen …«
»Und doch seid Ihr heute hier.«
»Wir wurden verraten«, sagte Rustichello bitter. »Es war eine große Schlacht – die Steine und die Pfeile flogen, als verdunkle eine biblische Plage den Himmel, und wir konnten mehrere Schiffe des Feindes aufbringen oder versenken. Dann griff auf einmal ein drittes Geschwader in den Kampf ein, das sich bis dahin hinter einer Landzunge versteckt gehalten hatte. Es traf uns völlig unvorbereitet, und im Handumdrehen hatte es unser Flaggschiff gekapert. Das war, wie Ihr Euch denken könnt, ein schwerer Schlag für die Moral. Schlimmer noch aber war, dass sich eines unserer eigenen Geschwader auf einmal zurückzog.«
»Es ließ die Flotte im Stich?«
Rustichello spuckte aus. »Dieses Geschwader stand unter dem Befehl von Ugolino della Gherardesca, Conte di Donoratico. Unsere restlichen Schiffe wurden geentert oder in Brand gesteckt. Fünftausend Tote, über zehntausend Gefangene! Ein schöner Sieg für den genuesischen Admiral, Oberto Doria. Nun wisst Ihr, weshalb ich mit solchem Gram auf Euren gestrigen Scherz über Pisaner in Genua reagierte. Man nahm unserer Stadt ihre Söhne – fünfzehntausend auf einen Streich.«
»Das war vor vierzehn Jahren«, sagte der Venezianer. »Viele hat man seither wieder freigelassen. Pisa hat sich erholt. Im Gegensatz zu Euch, wie mir scheint.«
»Vierzehn Jahre«, murmelte Rustichello.
»Ich würde Euch mein Mitgefühl aussprechen, doch fürchte ich, Euch damit zu beleidigen. Seid gewiss, ich weiß, wie es ist, seinen Mut an die Hoffnungslosigkeit der See zu verlieren. Ich habe ihn mehr als einmal verloren.«
»Ihr seid Seefahrer?«
»Ich habe ein Schiff kommandiert. In der Schlacht von Curzola. Eigentlich aber bin ich ein Kaufmann.«
»Curzola«, flüsterte Rustichello, und der Name war wie Honig auf seiner Zunge. »Von dieser Schlacht habe ich noch nie gehört – werdet Ihr mir davon erzählen?«
Der Venezianer zögerte. »Bedenkt, worum Ihr da bittet. Wie Ihr gestern so treffend bemerkt habt, ist mein Leben schon für mich selbst zu viel.«
»Dann lasst mich helfen, diese Last zu schultern.«
»Das ist ein Angebot, das unermesslich viel wertvoller ist, als Ihr zu diesem Zeitpunkt ahnt«, sagte der Venezianer. »Dennoch widerstrebt es mir, Euch in Eurer Geschichte zu unterbrechen.«
Rustichello schüttelte den Kopf. »Über mich ist längst alles gesagt …«
»Aber mitnichten. Ihr habt mich gefragt, ob ich Seefahrer sei – dasselbe möchte ich Euch fragen.«
»Ich bin ebenso wenig ein Seefahrer wie Ihr.«
»Und doch fanden wir beide unser Schicksal zur See.«
»Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn wir unser Handwerk besser verstanden hätten …«
»Ein berechtigter Einwand. Was seid Ihr denn, wenn kein Seefahrer?«
»Eigentlich bin ich Dichter. Ein Geschichtenschreiber und Erzähler.«
»Und wieso hält man Euch gefangen?« Der Venezianer klang verwundert. »Ist es so gefährlich, was Ihr zu erzählen habt?«
»Ich?« Rustichello lachte. »Ich habe gar nichts mehr zu erzählen. Nichts, aus dem sich noch schöpfen ließe … Dieser Brunnen ist vor langer Zeit versiegt.«
»Weshalb hat man Euch dann an diesem grimmen Ort eingesperrt und füttert Euch mit fadem Brei, wohingegen man so viele Eurer Landsleute von ihren Leiden erlöste oder wieder in die Heimat ziehen ließ?«
»Auch dafür gebührt die Ehre Conte Ugolino, nehme ich an. Seht Ihr, sein Verrat hat diesem Hund nicht geschadet, im Gegenteil. Pisa war am Boden, doch Pisas neue Herren waren seine Freunde. Aus Dank für seinen Verrat machte man ihn zum Podesta, und er regierte meine Heimat fünf lange Jahre.«
»Eine bittere Wendung. Doch was hat es mit Euch zu tun?«
»Man nahm wohl an, dass ich einen gewissen Wert für den Conte darstellte und er mich vielleicht zurückhaben wollte.«
»War dem denn so? Es klang, als wäre er ein ausnehmend übler Zeitgenosse gewesen. Auch von anderer Seite hörte ich Geschichten dieser Art.«
»Die Geschichten sind alle wahr.«
»Was verband Euch dann mit ihm?«
»Mit ihm war ich nie verbunden.« Rustichello seufzte. »Aber mit seiner Tochter.«
Der Venezianer schwieg.
»Wisst Ihr, wie das ist, eine Dame von Stand zu lieben?«
»Das weiß ich wohl«, sagte der Venezianer. »Glaubt mir, das weiß ich sogar sehr genau.«
»Ihr sagtet, Ihr hättet von Conte Ugolino gehört, und Ihr spracht in der Vergangenheit von ihm. Stimmt es denn, was ich vor langen Jahren hörte? Dass er tot sei?«
Der Venezianer zögerte. »Ich hörte, dass man ihn in einen Turm warf, gemeinsam mit seinen Söhnen. Dann warf man den Schlüssel fort.«
»Gute christliche Tradition«, murmelte Rustichello. »Und seine Tochter?«
»Wenn ich mich nicht täusche, hieß es, dass sie klug genug war, ihren eigenen Weg zu gehen und sich bald darauf zu vermählen. Mit einem Herrn von Stand, wie man sagt.«
Ein leichter Stich fuhr Rustichello ins Herz. »Ich danke Euch für Eure Offenheit. Nun, das erklärt so einiges, nicht wahr? Bitte habt Verständnis, dass ich kurz darüber nachdenken muss.«
»Natürlich«, sagte der Venezianer.
Kurz darauf war Rustichello abermals eingenickt.
Als er seine Augen das nächste Mal aufschlug, schien es ihm, als wäre sehr viel Zeit vergangen. Er hatte Hunger, und tatsächlich stand vor ihm eine Schale mit Brei. Allerdings stand sie dort wohl schon so lange, dass sie ebenso gut der kalte Rest des Dienstags wie der wenig hoffnungsvolle Bote des Mittwochs sein konnte. Rustichello war verwirrt. Er hatte geträumt, lebhafter als sonst, und schuld daran konnte nur die Erinnerung sein – an jene Schlacht vor vierzehn Jahren, an den, der daraus als Gewinner hervorging – und an dessen Tochter.
»Dieses Mal bin ich es wohl, der sich entschuldigen muss«, sagte der Venezianer, als er auf die Geräusche aus der Nachbarzelle aufmerksam wurde. »Ich hätte Euch nicht derart überrumpeln dürfen. Nach vierzehn Jahren muss es schwer für Euch sein, Euch der Vergangenheit zu stellen.«
»Habe ich im Schlaf geredet?«, fragte Rustichello.
»Das habt Ihr«, bestätigte der Venezianer.
»Ich habe es befürchtet. Manchmal wache ich auf und glaube, eben noch eine Stimme gehört zu haben, fast wie meine eigene. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Unsinn erzählt …«
»Im Gegenteil. Ihr habt mir einiges zum Nachdenken gegeben.« Der Venezianer klirrte mit seinen Ketten. Wahrscheinlich war er aufgestanden oder hatte sich gegen die Wand gelehnt. »Ihr sagtet, dass Ihr ein Geschichtenerzähler seid. Das ist ein ehrenwerter Beruf in vielen Ländern, die ich gesehen habe.«
»Dann müssen es sehr glückliche oder sehr verzweifelte Länder sein.«
»Beides«, gab der Venezianer zurück.
»Von welchen Ländern sprecht Ihr?«
Der Venezianer räusperte sich. »Ihr habt Euch als einen Verdurstenden bezeichnet«, wich er aus. »Und ich habe lange überlegt, ob ich nicht etwas habe, was Euren Durst stillen könnte. Wenn Ihr ein Dichter seid, dann sagt Euch sicherlich der Name Dante Alighieri etwas?«
»Natürlich tut er das. Er ist ein großer Dichter, einer der Größten vielleicht, selbst wenn er die alten Sprachen zugunsten seines toskanischen Dialektes verschmäht.«
»Ein glücklicher Umstand, denn sonst hätte ich seit meiner Rückkehr vielleicht noch gar nicht von ihm gehört. Dieser Vers aus seinem jüngsten Werk blieb mir im Gedächtnis.« Er holte Luft und zitierte mit seiner ruhigen, warmen Stimme:
»Des Weges ritt ich jüngst und dacht’ im Leide
Dass ich die Fahrt nur ungern unternommen.
Da sah ich meine Liebe mir entgegenkommen
Den Leib umhüllt mit leichtem Pilgerkleide …«
Er räusperte sich erneut. »Mag sein, dass ich es nicht ganz richtig wiedergebe.«
Rustichello schwieg. Er hatte Tränen in den Augen.
»Messere?«, fragte der Venezianer.
»Verzeiht.« Rustichello wischte sich die Tränen weg und schluckte schwer. »Mag sein, dass Eure Erinnerung Euch wirklich einen Streich spielt, denn das Versmaß Eurer dritten Zeile geht nicht auf. Dennoch danke ich Euch. Es bedeutet mir sehr viel, diese Worte zu hören.«
»Das freut mich. Aber wie steht es mit Euch? Gibt es nichts aus Eurer Feder, das ich auf meinen Reisen gehört haben sollte?«
Peinlich berührt stocherte der Pisaner in seinem Brei herum. »Sicher gibt es andere, die meine Geschichten mittlerweile besser erzählen als ich. Dichter wie Alighieri, die alte Legenden in moderne Worte kleiden …«
»So habt Ihr die alten Legenden erzählt? Ihr solltet Euer Licht nicht unter den Scheffel stellen.«
Doch Rustichello winkte ab. »Dieses Licht brennt schon seit langer Zeit und längst nicht mehr so hell wie früher. Achthundert Jahre ist es her, dass König Artus es entzündete. Ich lebte in diesem Licht und trug es vor mir her: Artus und seine Tafelrunde, Meliadus und der edle Guiron, die Geschichte des Sarazenen Palamedes …«
»Als Knabe habe ich diese Geschichten geliebt«, warf der Venezianer ein. »Wer weiß, vielleicht hätte ich ohne sie nie lesen und schreiben gelernt?«
»Es ist gütig, dass Ihr das sagt, aber wie Ihr schon bemerktet, sind es Geschichten, denen der Glanz des Knabenalters anhaftet. Sobald wir diesem Alter entwachsen, stellen wir fest, dass die Könige nicht wie die Könige in den Geschichten sind, nicht jede Schlacht so ruhmreich ist wie jene von einst. Und die großen Romanzen bleiben in der Wirklichkeit vor allem eines: unerfüllt.«
»Ihr klingt, als sprächet Ihr aus Erfahrung«, stellte der Venezianer fest.
»Tatsächlich hatte ich in meiner kurzen Zeit der Freiheit die Ehre, einige Herrschaften von königlichem Geblüt kennenzulernen. Und ich habe gelernt, dass sie sich ebenso nach dem Glanz der alten Tage verzehren wie wir. König Edward I. von England zum Beispiel – er lebt doch noch, nehme ich an?«
»So sagt man.«
»Edward war genauso groß, wie alle behaupten. Und das schon als Prinz! Wenn ich vor ihm stand und von Lancelot sprach, fühlte ich mich stets wie ein Kind, das seinen Vater mit Kunststückchen beeindrucken will. Doch was geschah, als er auszog, um große Taten zu vollbringen? Was wurde aus seinem Kreuzzug, seinem Versprechen, das Heilige Land zu befreien?«
Der Venezianer rasselte zustimmend. »Er wurde Vater und bald darauf König. Damit gab es Wichtigeres, um das er sich kümmern musste, nehme ich an. Also ging er wieder nach Hause.«
»Ihr sagt es.« Kopfschüttelnd schob Rustichello seine Schale mit Brei von sich fort. »Ihr habt Euch also mit der Geschichte Outremers befasst?«
»Ich war erst sechzehn, als Prinz Edward auszog; und im Gegensatz zu Euch habe ich ihn auch nie getroffen. Ich machte aber die Bekanntschaft seiner Frau – und die von Tebaldo Visconti, der, so leid es mir tut, hinter seinem Rücken nicht gut von ihm sprach.«
Rustichello schluckte. »Ihr kanntet die Prinzessin … und Visconti?«
»Gregor X., wie er sich dann später nannte. Aber ja. Ich habe gewissermaßen für ihn gearbeitet.«
»Seid Ihr ein Guelfe?«, fragte Rustichello vorsichtig. Venedig schlug sich politisch gerne auf die Seite des Papstes, denn die Gräben zwischen den neureichen Händlerfamilien und den alten Adelsgeschlechtern des Kaiserreichs waren zu groß.
»Dieser Konflikt hat mich nie interessiert«, wehrte der Venezianer ab. »Die Dienste, die wir für den Papst verrichteten, führten uns weit fort aus allen Ländern, in denen man von Ghibellinen oder Guelfen je hörte.«
»Mir scheint, ich habe unsere Zeit damit verschwendet, Euch von Dingen zu erzählen, die Euch längst bekannt sind. Es ist an der Zeit, dass Ihr mir etwas von Euch erzählt. Werdet Ihr das tun?«
Wieder das unverständliche Zögern seines Nachbarn. Wieso tat er das – ihm erst Hoffnung auf eine große Geschichte zu machen, nur um diese Hoffnung kurz darauf zu zerschlagen? Rustichello kam nicht umhin, Respekt für diesen Mann zu empfinden. Er hätte es verstanden, die Aufmerksamkeit der Damen bei Hofe zu fesseln.
»Ihr habt mich nun zweimal gebeten, mein Leben mit Euch zu teilen«, sagte der Venezianer. »Als Geschichtenerzähler solltet Ihr wissen, wie gefährlich es sein kann, einen Wunsch zum dritten Mal zu äußern. Um dieser Gefahr vorzubeugen, werde ich Euch einen kurzen Einblick in mein Leben geben. Vielleicht überlegt Ihr es Euch dann noch anders und schließt die Tür, die Ihr aufgestoßen habt, bevor es zu spät ist.«
»Weshalb sollte ich das tun?«
»Weil mir scheint, dass der Quell, nach dem Euch dürstet, nicht dort draußen zu finden ist, sondern in Euch selbst. Nicht die Geschichten sind es, die versiegt sind – sondern Euer Glaube daran.« Die Stimme des Venezianers war weiterhin freundlich, duldete jedoch keinen Widerspruch. »Ihr habt von Wahrheit und Dichtung gesprochen und wie die eine der anderen nicht gerecht werden könne. Doch Ihr täuscht Euch. Die Wahrheit, die ich gekannt habe, wurde von keinem Dichter des Abendlands je erahnt.
Ihr habt gesagt, es gebe keine wahrhaft großen Könige mehr, keine ruhmreichen Taten. Ihr habt gesagt, der Glanz der alten Tage sei vergangen.
Aber so ist es nicht – dieser Glanz strahlt noch hell. Ich sage, es gibt Länder jenseits der Levante, in denen Könige herrschen, gegen die unsere Kaiser sich wie Kinder ausnehmen. Und ob unerfüllt oder nicht – die Liebe, die ich gekannt habe, muss sich nicht scheuen, sich mit der Liebe eines Tristan oder Lancelot zu messen.«
Als der Venezianer diese Worte sprach, begann Rustichellos Herz heftig zu schlagen. Wer war dieser Mann, der sich in einem Atemzug mit Kaisern und Päpsten und den Heroen von einst nannte und so tat, als ob die Welt keine Geheimnisse vor ihm kannte? Hatte man seine Gebete erhört und ihm diesen Fremden geschickt, um ihm ein Fenster in die äußere Welt aufzustoßen, die er so lange vermisst hatte? Oder machte sich der Venezianer nur über ihn lustig und sprach von Dingen, die nur in seiner Einbildung existierten?
»Ihr scheut Euch nicht, die großen Namen in den Mund zu nehmen«, sagte er vorsichtig, denn er wollte seinen Nachbarn nicht erneut verprellen. »Doch noch habt Ihr mir nicht Euren eigenen Namen genannt. Alles, was ich von Euch weiß, ist, dass Ihr ein Kaufmann seid – und doch wollt Ihr ferne Länder bereist und Unglaubliches erlebt und gesehen haben. Sagt mir, Messere, mit wem habe ich die Ehre?«
»Mein Name ist Marco Polo«, sagte der Venezianer. »Und ich bin weiter gereist als je ein Mensch zuvor.«
IIBilder der Serenissima
Venedig, 1264–1269
Ich habe mein Leben nicht gewählt. Mein Leben wählte mich; und es kam an einem Tag zu mir, da alle Wege in die Zukunft vor mir ausgebreitet lagen wie das Wasser auf den Straßen der Serenissima.
Niemand, der nicht in Venedig geboren ist, kann wissen, was es heißt, ein Venezianer zu sein. Die Stadt ist ein Spiegel ihrer Bewohner: weltoffen, von keinen Mauern geschützt, verwinkelt und vielschichtig und untrennbar mit der See verbunden.
Wie keine andere Republik hatten wir es verstanden, kirchliche und weltliche Macht wie Gold und Edelsteine auf einer Waage zu balancieren. Seit die Reliquien meines heiligen Namensvetters, des Evangelisten Markus, ihren Weg von Alexandria an die Adria gefunden hatten, war unsere Stadt zu einer der wichtigsten Pilgerstätten der Christenheit geworden. Noch heute hält der Doge ein waches Auge auf die Basilika neben seinem Palast. Den Dogen wiederum behält der Große Rat im Auge. Dieser rekrutiert sich aus den nobelsten und angesehensten Familien, darunter auch meiner. Doch Ansehen und Noblesse unserer Stadt sind so groß, dass unser stetig wachsender Rat sie kaum mehr zu fassen vermag. Manche sagen, der Große Rat sei wie der Karneval – zu viele Augen und keine Gesichter; und auch das mag ein Spiegel unserer Stadt sein.
Venedig erhebt sich aus den Wassern wie die Gegenwart aus den Trümmern der Vergangenheit. Kaiserreiche erstehen und versinken wieder, Venedig aber bleibt. Wir bezwangen Byzanz und schufen an seiner statt für lange Zeit das Lateinische Kaiserreich – und wir werden noch da sein, wenn alle anderen Reiche längst vergessen sind. Ihre Säulen und Statuen schmücken unsere Straßen und Häuser, ihre einstigen Ländereien versorgen uns mit einem steten Fluss an Reichtümern, Geschichten und Sklaven.
In meiner Kindheit glaubten viele das lange kaiserlose Heilige Römische Reich dem Untergang geweiht. Sarazenen und Tartaren bedrängten das Abendland von Land und zu Wasser. Nie aber gab es einen Zweifel daran, dass die Serenissima bestehen würde, denn das Geld regiert die Welt, und alle Fiorini, Hyperpyra, Dinare und Bezanten fanden über früh oder lang ihren Weg durch unsere Banken und Wechselstuben, wo sie zu venezianischen Grossi wurden.
Als kleiner Junge schien mir diese Weisheit häufig bittere Wirklichkeit zu sein. Zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen gehört, wie ich mit meinem Onkel Giordano Trevisan an einem Tisch im Hinterzimmer unseres Hauses sitze und er mir die hohe Kunst beibringt, aus der Vielfalt von Münzen, die das Meer uns zutrug, echten Wert herauszulesen. Draußen glitzerte die Sonne auf den Kanälen Cannaregios, vor uns auf dem Tisch aber, stumpf und leblos im Vergleich, stapelten sich Gold und Silber und Edelsteine, die fremden Prägungen geordnet, das wilde Funkeln von Onkel Giordanos Rechenschieber und Waage gezähmt. Jeder Hafenjunge kann sich als Händler bezeichnen, wenn er jemandem einen Korb voll Fische für eine Handvoll Piccoli verkauft. Die wahre Macht des Händlers aber liegt weder in seinen Gütern noch seinem Geld, sondern in den Zahlen, die er in seine Bücher schreibt. So wie das geschriebene Wort Fundament von Glaube und Gesetz ist, ist die geschriebene Zahl das Mark der Serenissima. Jede Insel und jedes Haus in ihr ist Teil der großen Gleichung, die ihre Zukunft weissagt; jede Brücke, die sich über die Kanäle schlägt, ein Federstrich in ihrem Buch.
Der Zehnjährige, der damals an Giordano Trevisans Tisch saß, träumte natürlich nicht von Zahlen oder der Zukunft seiner Stadt. Er träumte vom Sonnenschein vor dem Fenster, und er vermisste seine Mutter.
Meine Mutter starb, als ich noch ganz klein war. Sie ist für mich nicht mehr als eine Wolke aus duftendem Haar und ein Lächeln im Sonnenschein; eine freundliche Seele, die über mich wachte und die Nächte nach ihrem Weggang finsterer und kälter werden ließ. Dann waren da nur noch Tante Bepina, ihre Schwester, und deren Mann Giordano, der Fattore unseres Unternehmens. Außerdem natürlich meine Cousinen Fiordelisa und Flora und ihre Schwestern sowie die Bediensteten und entfernten Verwandten, welche die Familiengeschäfte fortführten wie eine Maske, die nach dem Tod ihres Trägers weitergereicht wird, immerzu, bis das letzte Glied der Kette erreicht ist.
Wir Polos hatten uns den Platz im Großen Rat lange und redlich verdient. Vor knapp dreihundert Jahren aus Dalmatien eingewandert, hatte es unsere Familie durch geschickte Heiratspolitik verstanden, in die Reihen der Nobiluomini und Nobildonne aufzusteigen, und das ohne die Skandale anderer Familien oder deren Blut an unseren Händen. Dank des Geschäftssinns meines verstorbenen Großvaters hatten wir Niederlassungen in Konstantinopel und Soldaia gegründet.
Ich malte mir häufig aus, wie das Leben an diesen fernen Orten wohl aussehen mochte, doch erreichten uns von dort nur die Schiffe mit Waren und natürlich die Zahlen, die auf magische Weise ihren Weg von jenen fernen Büchern in unsere eigenen fanden; Wege und Wasserstraßen wie die Stäbe an Onkel Giordanos Abakus. Das große Netzwerk der Welt, das sich in Venedig zu einem lebendigen Teppich verwob …
»Hör auf zu träumen, und hör mir zu!«, schalt mich der Fattore. »Eines Tages wirst du die Geschäfte übernehmen müssen wie vor dir dein Vater und dessen Vater zuvor. Es sei denn, du hast vor, wie er dort draußen in der Welt verlorenzugehen!«
Mein Vater.
»Wieso sagst du, er sei verlorengegangen? Mutter sagte immer, dass er eines Tages zurückkommt …«
Mein Vater, die Legende, die ich nie kennengelernt hatte. Er hatte Venedig vor meiner Geburt verlassen, und hätten die Familien meiner Freunde mich nicht eines Besseren belehrt, ich hätte nicht gewusst, dass Kinder Mütter und Väter besitzen.
»Woher soll ich wissen, ob er je wiederkommt? Vielleicht war er nicht vorsichtig genug.« Giordano Trevisan rümpfte die Nase, dann nieste er vernehmlich. Der Fattore schätzte es nicht, wenn Leute unvorsichtig waren. Unvernunft bereitete ihm Unwohlsein wie anderen Leuten kaltes Wetter.
»Was kann ihm denn zugestoßen sein?« Natürlich kannte ich die Antwort. Für mich war das Leben meines Vaters ein einziges Abenteuer, eine Gutenachtgeschichte, die ich beliebig oft hören konnte, und allemal besser, als Dinare und Bezanten über den Tisch zu schieben.
»Das letzte Mal hörte man von ihnen, als sie unsere Niederlassung in Soldaia verließen, um Geschäfte mit den Tartaren zu treiben. Das war vor über drei Jahren.«
Sie: Mein Vater Nicolò und sein Bruder Maffeo. Ein Heldengespann in meiner kindlichen Vorstellung, so wie Aeneas und Hector, Gawain und Parsifal, Markus und Lukas. Die frommen Brüder in der Schule schalten mich stets, wenn ich so redete, aber für mich stand außer Frage, dass der Schutzpatron unserer Stadt und die anderen Evangelisten noch viel größere Taten vollbracht hatten, als uns vom Leben unseres Herrn Jesu Christi zu berichten. Wieso sonst hätten sie sich in einen Löwen, einen Stier, einen Adler verwandeln können?
»Wahrscheinlich sind sie tief in den Orient vorgedrungen«, fuhr Giordano Trevisan fort. »Und dort lauern alle möglichen Gefahren. Vielleicht fielen sie den Sarazenen in die Hände, wer weiß? Und die Tartaren sind die wildesten und grausamsten Menschen, die man sich denken kann.«
»In der Schule heißt es, sie kämen direkt aus der Hölle …«
»Das kann gut sein, denn schließlich liegen auch die Tore zur Hölle im Osten. Vielleicht sind deine Verwandten aber auch einem Fieber zum Opfer gefallen.«
Ich senkte betrübt den Kopf. Doch es ließ sich schwerlich etwas dagegen anführen – selbst Alexander der Große war angeblich einem Fieber erlegen.
»Sie wären nicht die ersten Händler, die den Weg in die Serenissima nicht mehr wiederfinden«, schloss der Fattore.
»Sie wären aber auch nicht die ersten, die wiederkommen, oder?«
»Auch das ist richtig.« Der Fattore nieste wieder. Dann räumte er seufzend die Münzen zurück in ihre Fächer. Offenbar hatte er eingesehen, dass meine Gedanken wieder einmal woanders waren. »Die Frage ist, was soll aus dir werden? In der Schule ist man unzufrieden mit dir. Du sollst doch eines Tages das Geschäft der Polos übernehmen! Deine Tante Bepina und ich, wir haben die Aufgabe, unser Bestes zu geben, dass aus dir einmal etwas wird. Dein Vater soll stolz auf dich sein – wo immer er ist.«
Ich nickte zögerlich. In Wahrheit hatte ich meine Zweifel. Ich sah die Sonne auf der Halbglatze meines Onkels schimmern, sah seine gepflegten Finger, mit denen er geschickt die Münzen sortierte, so flink wie ein Taschenspieler. Ich sah den Bauch, der ihm gewachsen war und den er mit teurer kalabrischer Seide garnierte. Giordano Trevisan ging es gut bei uns; so lange ich denken konnte, war er de facto das Oberhaupt der Polos in Venedig gewesen, und wenn ich tatsächlich einmal jemandes Nachfolger werden würde, dann wohl der seinige. Denn das Einzige, was Giordano Trevisan trotz seiner vier Töchter nicht besaß, war ein Sohn.
Ich wollte aber nicht sein Sohn sein.
Mit dreizehn Jahren hatte ich mich beinahe damit abgefunden, niemandes Sohn zu sein. Selbst den Karneval verbrachte ich zum ersten Mal nicht bei meiner Familie. Was ich von der Zukunft zu erwarten hatte – oder sie von mir –, das stand immer noch in den Sternen.
Der Karneval in Venedig ist eine alte Tradition, bei der man nicht nur des Sieges über den Patriarchen von Aquileia gedachte; natürlich nutzte man die verbleibenden Tage bis Aschermittwoch auch, um das Leben noch einmal in vollen Zügen zu genießen. Die Schlachttiere, die an diesen Tagen vom Dogen und seinen ausgesuchten Gästen verzehrt wurden, hatte Aquileia auch nach über hundert Jahren noch zu entrichten.
Mich faszinierten am Karneval weniger die üppigen Bankette als vielmehr die Tänzer und Masken, welche die Piazza San Marco in ein gefährlich-schönes Zauberland verwandelten. Schon damals konnte mir niemand eine einfache Antwort darauf geben, was hinter diesem Brauch stand: Die Zünfte hatten mit den Masken angefangen, die Edelleute hatten sie aus Spaß oder Höflichkeit übernommen, und die Diebe, Betrüger und Meuchelmörder der Serenissima hatten sehr schnell ihre praktische Seite erkannt. Während des Karnevals waren alle gleich, Doge, Ratsmitglieder und Gossengesindel.
Ich verbrachte den Abend auf Einladung meines Freundes Andrea in der Ca’ Dandolo. Die Dandolos waren eine der edelsten Familien und machten sich Hoffnung darauf, nach dem Ableben Reniero Zenos den nächsten Dogen zu stellen, der uns gegen den erstarkenden Einfluss Genuas verteidigen sollte. Hatte nicht ein Dandolo einst mit fast hundert Jahren, weise und doch blind, noch den entscheidenden Schlag gegen Byzanz geführt? Von den oberen Stockwerken des prunkvollen Hauses aus hatte man einen guten Blick auf die goldenen Pferde San Marcos, die Konstantin der Große einst aus Rom und Enrico Dandolo im vierten Kreuzzug aus Konstantinopel geholt hatte. Angeblich waren die vier Pferde mehr als tausend Jahre alt.
Ich hatte Andrea auf der Klosterschule kennengelernt, und der Fattore lag mir oft damit in den Ohren, dass ich mich glücklich schätzen solle, in Kreisen zu verkehren, die so erlesen waren wie die meines Freundes. Für mich hingegen war Andrea vor allem der ungeduldige Junge mit dem lockigen schwarzen Haar, der die sieben freien Künste mit derselben Verbissenheit zu meistern versuchte wie der Fattore seine verschiedenen Münzen und doch für die Musik nicht mehr Talent besaß als die Katzen an der Piazza.
Dieses Talent war dafür seiner Schwester Beatrice zugefallen – ganz ohne Schulbildung, wie ihr Bruder oft grimmig bemerkte –, und sie stellte es in eben diesen Stunden unter Beweis, als eine wilde Carola durch die Gemächer der Ca’ Dandolo zog, angeführt von einer maskierten Schönheit mit einem Tamburin. Wir jungen Söhne lümmelten am Fenster herum und versuchten, hinter die Masken der singenden Gäste zu schauen. Beatrice zu erkennen fiel uns trotz ihrer farbenfrohen Verkleidung nicht schwer, sobald ihre glockenhelle Stimme sich wie Silberfäden durch die Luft spann. Ein lebendiger Teppich wie die Wasserwege der Stadt, und die Schläge des Tamburins ein Weberschiffchen, das darunter hindurchtauchte …
Ich hatte Mädchen bislang nie als Teil dieses Netzwerks gesehen, aus dem ich meine Zukunft deuten sollte. Beatrice war die Erste, die mir dieses Versäumnis vor Augen führte.
»Siehst du, wie sie die Carola von einem Moment auf den nächsten anführt?«, riss mich Andrea aus meinen Tagträumen. In seiner Stimme mischten sich grenzenlose Liebe und grenzenloser Neid. »Wenn mir nur alle folgen würden wie ihr, ich würde den nächsten Kreuzzug befehligen.«
Peinlich berührt wandte ich den Blick von seiner Schwester ab. Ich vermutete, dass Männer sich von Frauen mit ihren Reizen einen Lohn für ihre Gefolgschaft versprachen, den Andrea nicht zu zahlen bereit wäre, hielt es aber für unklug, meinen reichen und angesehenen Freund darauf hinzuweisen.
»Ist es das, was du willst?«, fragte ich stattdessen. »Ein Heer befehligen?«
Erst gab er keine Antwort, und ich brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, dass ihm die Frage unangenehm war. »Ich möchte, dass mein Vater stolz auf mich ist«, sagte er dann. »Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst.«
Tatsächlich verstand ich das nur zu gut, konnte meine Gefühle aber schwer in Worte fassen. Schließlich hatte man von meinem Vater vierzehn Jahre lang außer ein paar knappen Briefen – erst aus Konstantinopel, dann aus Soldaia – nichts mehr gesehen oder gehört.
»Woher weißt du, was dein Vater von dir erwartet?«, fragte ich.
Andrea schnaubte. »Glaub mir, das lässt er mich spüren – jeden einzelnen Tag. Er wird vielleicht der nächste Doge. Das Mindeste, was ich tun kann, ist, seinem Vorbild zu folgen. Vielleicht gehe ich nach Bologna und studiere die Rechte. Was hältst du davon?«
Ich zuckte die Schultern. Ich wusste nicht, ob ein solches Studium für mich als Kaufmann allzu vorteilhaft wäre. Genauso wenig vermochte ich zu sagen, ob es ihm als Dogen nützen würde. »Zumindest unterrichten sie dich dort wahrscheinlich nicht in Musik.«
Er lachte. »Da hast du wohl recht! Der Punkt ist: Ich werde alles tun, um eines Tages, falls das Los mich trifft, zum Führen bereit zu sein – so wie er.« Er deutete mit dem Kinn in Richtung der ausgelassenen Tänzer. »Das bin ich ihm und ihnen allen schuldig. Findest du nicht?«
Und ich schaute in die maskierten Gesichter der Feiernden, eine fröhliche Geisterschar, und stellte mir vor, ich wäre für jedes dieser Leben verantwortlich. Ich merkte, dass mir diese Verantwortung nicht zusagte. Dann schaute ich aus dem Fenster auf die Piazza, auf welcher der Karneval in vollem Gange war, all die Laternen und Stimmen und Gesichter, jedes einzelne von einer Maske verdeckt, und stellte mir vor, ihr Doge zu sein und die schwerste Maske von allen zu tragen. »Ich finde nicht, dass ich meinem Vater irgendwas schuldig bin«, sagte ich schließlich. »Wenn überhaupt, dann ist er mir etwas schuldig.«
Andreas Vater wurde nicht der nächste Doge. Um Betrug und Bestechung vorzubeugen, hatte man ein kompliziertes System eingeführt, bei dem ein kleiner Junge auf der Piazza durch Loswahl Wahlmänner bestimmte, die wiederum durch das Los reduziert wurden, neue Wahlmänner bestimmten und immer so fort; und als die endgültigen Wahlmänner zum Höhepunkt des Spektakels ihre Stimmen abgaben, ging Lorenzo Tiepolo als Sieger hervor.
Die meisten Familien sahen seine Wahl als eine glückliche an, obwohl er zu dem Zeitpunkt nicht einmal in der Stadt weilte. Kurz nach seiner Amtseinführung fachte er einen Konflikt mit einer Allianz konkurrierender Städte an, der schließlich in einen Seekrieg mit Bologna mündete und Andreas Studienpläne bis auf Weiteres hinfällig machte. An Andreas Überzeugung, sich seinem Vater beweisen zu müssen, änderte es jedoch nichts.
Ich traf mich nun regelmäßig mit ihm, und gelegentlich tauschte ich bei meinen Besuchen auch ein paar freundliche Worte mit seiner Schwester. Viel mehr ergab sich allerdings nicht – bis Christi Himmelfahrt, der Festa della Sensa.
Ich denke, es sagt einiges über unsere Stadt aus, dass es sich hierbei um den wichtigsten Feiertag im Jahr handelt, und zwar nicht aufgrund der Himmelfahrt selbst, sondern wegen der traditionellen Vermählung des Dogen mit dem Meer. An diesem Tag war ganz Venedig auf den Beinen, Bürger, Klerus, Kaufleute, und gedachte jenes Tages im Jahre 1000, an dem Pietro Orseolo die dalmatinischen Küstenstädte von der Schreckensherrschaft der Piraten befreit und Venedig damit zur unangefochtenen Herrin der Adria gemacht hatte. Und dieses Jahr war das Fest prunkvoller denn je. Es war die erste dieser Vermählungen für unseren neuen Dogen – und für mich das erste Treffen mit Beatrice ohne ihren Bruder.
Ursprünglich hatte ich Andrea gefragt, ob er mich zum Fest begleiten wolle, doch als er mir überraschend absagte, während seine Schwester fast im selben Augenblick meine Einladung annahm, war ich mir selbst nicht mehr sicher, was eigentlich Grund und was Vorwand für meine häufigen Ausflüge zur Ca’ Dandolo war.
Vielleicht wusste Beatrice es damals schon besser. Wir waren jetzt vierzehn, sie und ich.
Dank ihrer Eltern hatten wir für das Spektakel einen der besten Plätze am Rande der Piazzetta ergattert, fast direkt am Ufer zwischen den Säulen des Heiligen Markus – in Gestalt eines geflügelten Löwen, der angeblich älter war als der Evangelist selbst –, und der des Heiligen Theodorus, des Drachentöters und ehemaligen Stadtpatrons. Die beiden Granitsäulen – die eine rötlich, die andere grau – waren gerade erst errichtet worden, an genau dem Ort, der seit jeher als Hinrichtungsstätte diente und an dem künftig auch Glücksspiel erlaubt sein sollte. Es war ein magischer Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft einander trafen und gleichsam eine sonderbare Hochzeit eingingen.
Aus dem dichten Gedränge heraus verfolgten wir, Beatrice und ich, wie der Doge seine Goldene Barke bestieg, ein strahlendes Chimärenschiff, das unter der Last des Prunks beinahe zusammenbrach. Auf diesem wurde er samt seinem Hofstaat zum Lido hinausgerudert, um dem Meer dort einen goldenen Ring zu überantworten. So war es seit beinahe hundert Jahren Tradition. Der erste dieser Ringe war dem Dogen vom Papst als Dank für den Sieg gegen Kaiser Barbarossa geschenkt worden, der an derselben Stelle seine Niederlage eingestanden hatte. Siege zu Land aber galten dem Dogen nichts. Also warf er den Ring ins Wasser mit den Worten: »Wir heiraten dich, oh Meer, zum Zeichen unserer wahren und beständigen Herrschaft.«
»Es ist ein seltsamer Brauch«, sagte Beatrice kopfschüttelnd, während die Barke hell wie die Sonne davonfuhr und sich die ersten Schiffe aus dem Canal Grande lösten und ihr nachfolgten – die Seeleute ganz in Weiß, jungfräulich wie die Stadt am Tag der Vermählung; die Vertreter der Zünfte in goldbesetzten Gewändern und mit Olivenkränzen gekrönt; und scharlachrot die Glasbläser, denen der Tod drohte, falls sie ihre Geheimnisse jemals einem Fremden verrieten – sie alle schlossen sich der großen Prozession an. »Siehst du die Dogaressa, dort drüben?«
Ich folgte ihrem Fingerzeig und entdeckte tatsächlich Agnese Ghisi vor dem Palast. Die Zeremonie war ihr noch fremd, und so hatte sie sich entschlossen, der Hochzeit ihres Mannes mit einer anderen nicht beizuwohnen. Stattdessen blickte sie der Goldenen Barke hinterher, als bräche diese zu einer Fahrt ohne Wiederkehr auf. Die Venezianer liebten sie schon jetzt für ihre Bescheidenheit und nannten sie La Donna Misericordia – denn sie hatte den Krankenhäusern der Stadt viel Geld geschenkt. Nichts aber verschaffte ihr in dieser Stunde mehr Respekt, als dass sie ihren Mann kampflos ziehen ließ.
Dann schlug auf dem fernen Lido die Glocke der Kirche von San Nicolò, und wir wussten, dass der Doge den Ring in die Fluten geworfen und seinen Eid auf ein weiteres Jahr erneuert hatte. Die Menschen brachen in Jubel aus, das Gesicht der Dogaressa aber war wie aus Stein gemeißelt.
»Was nützt einem ein Mann, der mit dem Meer verheiratet ist?«, fragte Beatrice.
»Immerhin ist sie die Dogaressa«, gab ich zu bedenken. »Sie wohnt im Palast, hat Kleider und Gold …«
»Und du glaubst, das macht es leichter?« Sie sah mich herausfordernd an. »Menschen sind wichtiger als Gold, Marco. Meinst du nicht?« Sie hatte dieselben dunklen Augen wie ihr Bruder, aber es lag von Jahr zu Jahr mehr Leben darin.
Mit klopfendem Herzen sah ich hinaus auf die See, die an diesem Tag friedfertig, fast erwartungsvoll in der Lagune schimmerte – eine Braut, die sich zurechtgemacht hatte.
»Ich glaube, es ist für keinen von beiden leicht«, wand ich mich. »Er hat sich diese Hochzeit nicht ausgesucht …«
»Aber er ist der Doge«, gab sie zurück.
»Ich möchte nicht mit ihm tauschen.«
Sie hob erstaunt die Brauen und rückte etwas näher. Auf einmal schien mir die Maisonne noch heißer als zuvor.
»Damit du dich nicht mit der See vermählen musst?«, hakte sie nach.
»Wer sagt, dass ich mich überhaupt vermählen muss?«, gab ich im Übermut zurück, und da hätte sie mich fast in die Lagune gestoßen.
»Was erwarte ich von einem Polo!«, rief sie mit gespielter Verzweiflung. »Einer Familie, die mit der ganzen Welt verheiratet ist! Weißt du eigentlich selbst, was du willst?«
Sie sagte es im Spaß, doch ich kam nicht umhin, an das starre Witwengesicht der Dogaressa zu denken und mich zu fragen, ob meine Mutter, als sie noch lebte, mit demselben Blick auf das Meer hinausgesehen hatte.
»Komm, gehen wir uns die Fiera anschauen«, sagte ich und nahm sie an der Hand.
Auf der Piazza, im Schatten des dreihundert Fuß hohen Campanile, wurde zur Stunde ein großer Markt eröffnet. Später, wenn die Goldene Barke von ihrer Reise zurückkehrte und der Doge seine Gäste und die Ruderer aus der Werft zu einem großen Festmahl lud, würde der Platz so überfüllt sein, dass man keinen Schritt mehr tun konnte. Ich versuchte, Beatrice zu versöhnen, indem ich einige exotische Zuckerwaren und kandierte Früchte mit ihr teilte und ihr deren Ursprungsländer benannte. Später schauten wir uns noch die Regatta an. Doch obwohl es mir gelang, Beatrice noch das eine oder andere Lachen zu entlocken, das ich so an ihr liebte, behandelte sie mich den Rest des Tages mit derselben skeptischen Distanz, mit der mich sonst nur Flora, meine jüngste Cousine, bedachte.
Die kommenden Wochen und Monate versuchte ich, es allen recht zu machen: in der Schule den frommen Brüdern, zu Hause Tante Bepina und Onkel Giordano und in den wenigen Stunden, die mir dazwischen blieben, ganz besonders Beatrice Dandolo – was vielleicht genau ihre Absicht gewesen war. Mehr denn je fühlte ich mich gefangen in einem Netz widerstreitender Erwartungen – und auf seltsame Weise schienen sie allesamt so willkürlich zu sein. Eine Zukunft war nicht besser als die andere, kein Leben plausibler als der Rest. Ich war immer Venezianer und werde immer Venezianer bleiben; dennoch fühlte ich mich fremd in meiner eigenen Stadt, als fehlte mir die besondere Gabe, die meine Mitmenschen befähigte, sich im Labyrinth der Kanäle und Gassen zu verlieren, die Welt da draußen zu vergessen und einfach dazuzugehören.
Eines Tages, ich war inzwischen fünfzehn, war ich in San Polo unterwegs, um ein Geschenk für Beatrice zu erstehen. Ich hatte gründlich über ihre Frage nachgedacht – weißt du eigentlich selbst, was du willst? – und hielt es für geboten, meine Absichten zu unterstreichen. Ich wusste bloß noch nicht, wie.
»Für wen soll es denn sein?«, fragte der Blumenhändler, vor dessen Stand ich innegehalten hatte.
»Für ein Mädchen«, brachte ich hervor und wurde rot, als der Händler ein verschmitztes Grinsen aufsetzte.
»Wie wäre es hiermit?« Er präsentierte mir einen Strauß prächtiger Lilien.
»Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie Blumen mag …«
»Das wird sie, vertrau mir! Schon die alten Griechen kannten Blumen als Liebesbeweis, und Könige schätzen die Lilie bis heute. Da sollte sie auch deiner Teuren gut genug sein, oder nicht?«
»Sie ist nicht wie andere …«
»Ein besonderes Geschenk für ein besonderes Mädchen, ich verstehe schon. Aber siehst du, hiermit beweist du einen gleichermaßen anständigen wie ausgefallenen Geschmack: Einerseits gilt die Lilie als Symbol der Reinheit, andererseits …« Er wies bedeutungsvoll auf den enormen Stempel der Blume. »Die Kirche hat ihr abschließendes Urteil in dieser Angelegenheit noch nicht gefällt. Aber gerade darin liegt doch der Reiz, oder nicht?« Er drückte mir den Strauß in die Hand. »Außerdem sind die Blumen unvergleichlich günstig, wenn du dich schnell entscheidest.«
Der Preis spielte für mich keine Rolle; mir gefiel vor allem der Duft des beeindruckenden Gebindes, mit dem ich mich nun auf den Rückweg machte. Ich hoffte, dass mein Geschenk Beatrice freute, und stellte mir ihr silberhelles Lachen vor.
Ich überquerte gerade die hochklappbare Holzbrücke über den Canal Grande, die den Rialtomarkt mit den Handelszentren der östlichen Sestieri verband, als mir meine Cousine Flora entgegengerannt kam.
»Marco!«, keuchte sie. Sie war ganz außer Atem.
»Was ist denn los?«, fragte ich besorgt. »Ist etwas passiert?«
Sie wedelte ungeduldig mit den kleinen Armen. »Du musst sofort kommen! Marco – sie sind zurück!«
»Wer?«, fragte ich verständnislos. »Wer ist zurück?«
»Dein Vater!«, rief sie. »Dein Onkel! Dein Vater! Sie sind …«
Doch da hörte ich schon kaum noch zu. Alles, was ich hörte, war das Klappern meiner Schritte auf der Brücke, das sich mit dem dumpfen Schlag meines Herzens verband, als ich Flora bei der Hand nahm und rannte.
»Sie waren bei den Tartaren am Ende der Welt! Sie waren beim Papst und im Krieg, und es gab Hochwasser und Edelsteine, und sie sind auf wilden Tieren geritten, bis nach Kithai – das ist das größte Königreich der Welt, wo es Städte größer als Venedig gibt, und Berge aus Gold, und Löwen und Elefanten …«
Das Blut rauschte mir in den Ohren. Konnte es wirklich wahr sein? War mein Vater nach all den Jahren – meinem ganzen Leben! – zurückgekehrt? Wieso gerade jetzt? Was war ihm widerfahren? Wenn er wirklich in Kithai gewesen war, wie Flora behauptete, war er weiter gereist als je ein Mensch zuvor. Konnte man so weit überhaupt reisen?
Auf einmal kamen mir die Gassen meiner Heimatstadt so winzig vor. Ich stieß mit mehreren Händlern und Einkäufern zusammen, die mir hinterherschimpften, doch ich beachtete sie nicht. Sie schienen gar nicht real zu sein – wie die Maskenträger zum Karneval.
Wie von selbst trugen mich meine Füße vor die Tür unseres Hauses. Noch ehe ich oder die atemlose Flora klopfen konnten, schwang die Tür auf. Drinnen standen meine Tante und mein Onkel. Tante Bepina war ganz bleich. Sie erinnerte mich an die Dogaressa. Giordano Trevisan machte ein grimmiges Gesicht und rieb sich nervös die Nase.
Dann sah ich die beiden Männer hinter ihnen, die nun langsam vortraten und mich mit ernster Miene musterten.
Auf einmal merkte ich, dass ich immer noch Beatrices Lilien in der Hand hielt. Die Blumen waren von der wilden Rennerei ganz zerrupft. Mir war, als ob ich mich in einem Traum wiederfände, und alles, was zur Welt des Wachens gehört hatte, verblasste: die Schule, die Ausbildung zu einem tüchtigen Kaufmann, Andreas Welt der Politik, selbst Beatrice … all das war nicht länger Teil meiner Wirklichkeit. Ich würde weder ein Unternehmen führen noch eine Universität besuchen. Hier war mein Vater, der sich meiner erinnert hatte, der zurückgekehrt war, um mir einen anderen, neuen Weg zu weisen. Und nun trat er näher und lächelte mich an.
Er allein war wirklich. Er war ich.
Ich löste meine verkrampften Finger. Eine nach der anderen fielen die Lilien zu Boden.
Ich habe mein Leben nicht gewählt – mein Leben wählte mich.
IIINicolò und Maffeo
Ihr sprecht fast wie ein Mann des Glaubens oder ein Ritter, nicht wie ein Kaufmann«, merkte Rustichello nach einer Weile an. »Auch verfügt Ihr über eine feine Beobachtungsgabe und ein großes Geschick im Umgang mit Worten, Messere.«
»So sagt man.«
»Man macht Euch dieses Kompliment nicht zum ersten Mal?«
Er hörte leises Kettenrasseln. »Ich mache mir nichts daraus. Es ist keine Leistung, die ich erbracht, keine Befähigung, in der ich mich geübt hätte.«
»Glaubt Ihr das wirklich?«, hakte Rustichello nach. »Dass den Menschen bestimmte Gaben einfach zufliegen? Dass dem einen ein Leben als Seefahrer bestimmt ist und dem anderen das eines Zimmermanns? Dass der eigene Lebensweg von höheren Mächten gelenkt wird?«
»Wollt Ihr mich wieder auf meinen Glauben hin testen?«
»Vielleicht habe ich mir die letzten vierzehn Jahre bloß zu viel Gedanken darüber gemacht, was Gott wohl mit mir vorhat oder welche meiner Entscheidungen mich an diesen Ort führte. Wurde der Mensch von Gott nicht mit einem freien Willen ausgestattet, damit er falsch und richtig unterscheiden kann?«
»Wenn Ihr mich danach fragt, was mich die Erfahrung hierzu gelehrt hat, so muss ich sagen: Es nimmt selten ein gutes Ende, wenn der Mensch seinen Willen über alles andere stellt.«
Rustichello brummte zustimmend. »Und doch heißt es, der Herr helfe denen, die sich selbst helfen.«
»Wenn es sich so verhält«, sagte der Venezianer, »dann sind wir verloren.«
»Seid versichert, ich war bereits mehr als einmal kurz davor, alle Hoffnung zu verlieren. Und doch verirrt sich immer wieder ein Lichtstrahl in diese Finsternis.« Er holte tief Luft. »Ihr zum Beispiel! Wisst Ihr, was es mir bedeutet, endlich wieder ein gutes Gespräch mit einem anderen Menschen zu führen? Zu lange habe ich darauf gewartet, dass irgendein Edelmann sich meiner erinnert, sich ein Herz fasst und mich aus diesem Verlies befreit. Doch vielleicht seid Ihr in Wahrheit die Hilfe, die mir bestimmt ist. Schon spüre ich meine Lebensgeister zurückkehren. Und ich beschwöre Euch: Gebt nicht auf! Lasst mich Euer Licht in der Nacht sein, so wie Ihr das meine seid. Und hört nicht auf, zu erzählen. Da habt Ihr’s – nun habe ich Euch ein drittes Mal darum gebeten. Damit seid Ihr gemäß allen Regeln der Kunst daran gebunden, meinem Wunsch Folge zu leisten. Ihr steht nun in meinen Diensten, Messere.«
Da lachte der Venezianer, und Rustichello brauchte einen Moment, bis er sicher war, dass er richtig gehört hatte, denn er hatte schon so lange nicht mehr das Lachen eines anderen Menschen vernommen. Dann stimmte er ein. Er spürte, dass es ihm endlich gelungen war, zu seinem Zellennachbarn durchzudringen. Der unsichtbare Damm, den der Venezianer um sich errichtet hatte, war gebrochen.
»Keine Sorge, ich bin mir meiner Pflicht bewusst – denn seht Ihr, das passiert mir nicht zum ersten Mal. Und ich werde nicht aufhören. Nicht, wenn mich ein großer Geschichtenschreiber wie Ihr so wortgewandt darum bittet. Was haben wir anderes als Worte, nachdem man uns unser Leben nahm? Seid gewiss: Ich habe genug Geschichten für viele Jahre.«
»Als ich meinen Vater an jenem Tag das erste Mal traf«, fuhr der Venezianer fort, nachdem die Palastdiener ihnen ihr freudloses Mahl gebracht hatten, in dem Rustichello nun deutliche Anzeichen des Mittwochs erkannte, »begriff ich wohl zum ersten Mal, was ich all die Jahre vermisst hatte. Man muss etwas erst kennen, um es missen zu können – so wie meine Mutter.
Mein Vater dagegen war für mich stets eher eine Idee gewesen, das vage Gefühl, dass mir etwas zustand – so wie Andrea spürte, dass ihm eines Tages das Erbe der Dandolos zuteilwürde, ob er es wollte oder nicht. Mir hatte das Leben einen Vater bislang vorenthalten, und manchmal, wie an jenem Abend in der Ca’ Dandolo, war ich wütend darüber und machte ihm Vorwürfe, so wie andere Menschen mit Gott hadern, wenn sie sich von ihm im Stich gelassen fühlen.
Als er aber endlich vor mir stand …« Er suchte nach den passenden Worten. »Da begriff ich zum ersten Mal, dass er ein echter Mensch war, so wie Ihr und ich, mit seinen eigenen Gefühlen und Ansichten – und was es bedeutete, einen solchen Menschen in seinem Leben zu haben. Der einen beschützen oder bestrafen konnte, stolz oder enttäuscht sein mochte. Und in diesem ersten Moment wusste ich nicht, was davon der Wahrheit näher kam. Da waren so viele widerstreitende Gefühle in seinem Blick …«
»Ich erinnere mich noch, wie es war, einen strengen Vater zu haben«, pflichtete Rustichello ihm bei.
»Ich würde nicht sagen, dass er streng war«, sagte der Venezianer. »Das ist es ja: Ich wusste es nicht. Ich wusste gar nichts über ihn, weil er ja nicht da gewesen war …«
»Fahrt fort«, ermunterte ihn Rustichello, denn er hatte Angst, dass der Venezianer es sich anders überlegen könnte. »Was war er denn für ein Mann?«
»Ihr redet von ihm, als wäre er tot«, stellte der Venezianer fest.
»Bitte verzeiht«, sagte Rustichello erschrocken. »Ich ging davon aus … Er lebt also noch?«
»Nein«, sagte der Venezianer. »Er ist tot.«
»Ich verstehe nicht …«
»Grämt Euch nicht, denn manchmal verstehe ich es selbst nicht ganz. Dann kommt es mir vor, als ob er lebte und doch tot wäre. Sucht es Euch aus.«
»Aber Messere!«, protestierte Rustichello.
Nur das Rasseln von Ketten aus der Nachbarzelle antwortete ihm.
»Eure Verwirrung ist nur verständlich«, versuchte Rustichello die Wogen zu glätten. »Für uns Kinder sind unsere Eltern wie Helden oder Könige. Um sie zu verstehen, müssen wir erst lernen, uns selbst zu verstehen … und ihr Dahinscheiden trifft uns schwer.«
»Da habt Ihr recht.« Abermals verging ein Moment. Dann fuhr der Venezianer fort. »Mein Vater sah damals noch recht jung aus. In jedem Falle war er deutlich jünger als Giordano Trevisan und wirkte auch ein wenig jünger als sein Bruder. Der Eindruck wurde auch dadurch verstärkt, dass er sich frisch rasiert hatte und ein schlichtes, sauberes Hemd trug. Er und mein Onkel mussten bereits länger in der Stadt geweilt haben, als man uns Kinder hatte wissen lassen, oder sie hatten erst gebadet und sich umgezogen, ehe sie nach Hause gingen. Ergibt das für Euch Sinn? Wohin würde Euch Euer Weg zuerst führen, wenn Ihr nach sechzehn Jahren endlich in Eure Heimatstadt zurückkehrt?«
»Ich weiß es nicht«, gestand Rustichello.