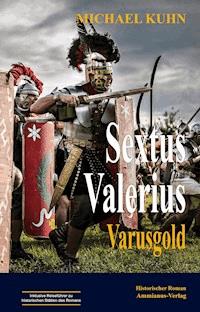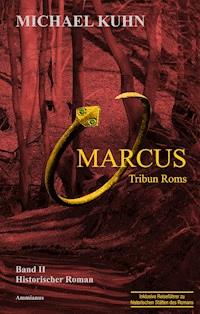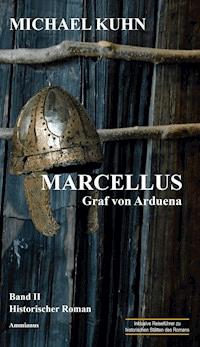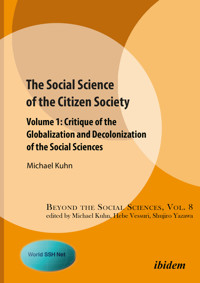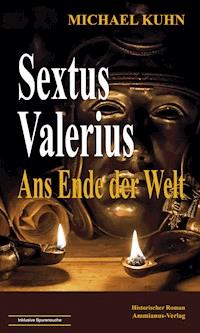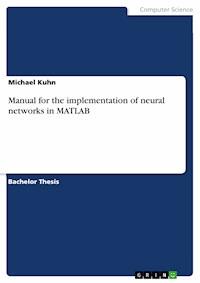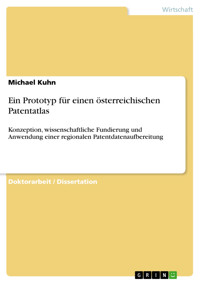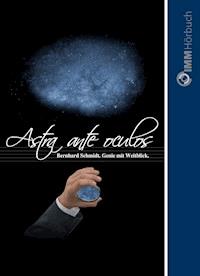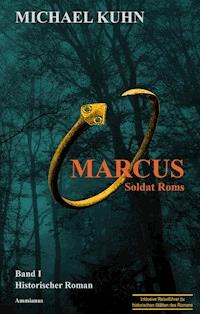
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ammianus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Marcus-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Wir schreiben das Jahr 355 nach Christus. Schwer verwundet rettet sich der Centurio Marcus Junius Maximus mit einer wichtigen Botschaft aus dem brennenden Kastell Gelduba und schlägt sich mit wenigen Getreuen nach Aachen durch. Die Kunst der Ärzte rettet sein Leben, und endlich genesen, kann er den gefahrvollen Heimweg durch die unwegsamen Wälder der Eifel in die Heimat antreten. Mit dem wegekundigen Galerius, seinem treuen Führer und Begleiter, meistert er aufregende Abenteuer und entkommt nur mit knapper Not den plündernden Horden der Franken. Er erreicht voller Glück das väterliche Weingut in der Nähe von Trier und muss leidvoll erleben, dass der Krieg ihm gefolgt ist. Es beginnt ein gnadenloser Kampf um die Heimat, und er erkennt, dass er durch den Besitz seines persönlichen Schutzzaubers, einen golden Armreif, in schicksalhafte Vorgänge verstrickt ist, deren Ursprünge weit in die Vergangenheit reichen. Tapferkeit, Liebe, Treue und die fromme Hingabe zu den alten Göttern lassen ihn gegen eine Welt bestehen, in der die ehrwürdigen Tugenden Roms verblassen und das Christentum seinen Siegeszug angetreten hat. Ein tolles Extra ist der zweite Teil des Buches, der dem Leser die Gelegenheit gibt, sich selbst an die zum Teil noch gut erhaltenen historischen Stätten zu begeben. Mit wissenschaftlicher Akribie hat der Autor, selber Historiker und seit Jahren in der Archäologie tätig, die Lebensumstände und politischen Ereignisse des vierten Jahrhunderts recherchiert. Das Ergebnis ist ein von der Fachwelt anerkanntes Werk, das durch die Detailgenauigkeit der Lebensumstände und die genaue Kenntnis der historischen Vorgänge an Rhein und Mosel in der Spätzeit der römischen Herrschaft besticht. Der Leser wird eingeladen, eine Zeitreise voller Spannung und Information anzutreten, und fühlt sich gleichsam in das vierte nachchristliche Jahrhundert zurückversetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Ammianus-Verlag
Das römische Germanien im 4. Jahrhundert
Antunacum Andernach
Aquae Mattiacorum Wiesbaden
Aquis Aachen
Beda Bitburg
Belgica Euskirchen-Billig
Bingium Bingen
Bodobrica Boppard
Bonna Bonn
Colonia Köln
Confluentes Koblenz
Coriovallum Heerlen (NL)
Gelduba Krefeld-Gellep
Icorigium Jünkerath
Juliacum Jülich
Mogontiacum Mainz
Novaesium Neuss
Quintum Quint
Rigomagus Remagen
Tolbiacum Zülpich
Treveris Trier
Tricensima Xanten
Varnenum Aachen-Kornelimünster
Mosella Mosel
Rhenus Rhein
Der Autor
Michael Kuhn M.A., Jahrgang 1955, studierte in Aachen Geschichte und Politische Wissenschaften. Im Anschluss war er in unterschiedlichen historischen Projekten involviert und organisierte in eigenen Unternehmen geschichtliche Events. Zurzeit arbeitet er neben seiner Tätigkeit als Autor in der Archöologie.
Das Anliegen, bei seinen Mitmenschen Interesse und Verständnis für die faszinierende Welt der Geschichte zu wecken, durchzieht seine bisherige Vita wie ein roter Faden.
So steht der vorliegende Band am Beginn einer Buchreihe, die den Leser mit Spannung und Information auf eine Zeitreise in die aufregendsten Epochen unserer Vergangenheit mitnimmt.
Zurzeit schreibt Michael Kúhn an der Fortsetzung der abenteurerlichen Lebensgeschichte des römischen Offiziers Marcus Junius Maximus.
Michael Kuhn
Marcus - Soldat Roms
Band I
Impressum
Zweite überarbeitete Auflage von 2010
Copyright © by Michael Kuhn Ammianus Verlag, Aachen Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, Tonträger jeder Art, fotomechanische Wiedergabe und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten. Soweit durch Hinweis oder Verlinkung auf andere Websites zusätzliche Informationen zugänglich gemacht werden, erfolgt hiermit der Hinweis darauf, dass keine Inhaltskontrolle stattfindet und jegliche Haftung für den Inhalt dieser Seiten ausgeschlossen ist. Umschlaggestaltung und Bildbearbeitung: Thomas Kuhn Zeichnungen: Hannelore Kuhn Fotos: Michael Kuhn, Veronika Geerling Kartenerstellung: Till StoletzkiE-Book-Gestaltung: Michael Mingers
Danksagung
Vorab möchte ich all denen Dank sagen, die am Gelingen des Buches ihren Anteil hatten.
Thomas Kuhn gebührt der Verdienst, dem vorliegenden Werk mit der künstlerischen Gestaltung des Umschlages und der Bearbeitung des Fotomaterials seine endgültige Gestalt gegeben zu haben.
Hannelore Kuhn erstellte in mühevoller künstlerischer Kleinarbeit die Zeichnungen, die dem Leser in anschaulicher Art und Weise die provinzialrömische Wirklichkeit nahe bringen.
Das Kartenmaterial wurde von Till Stoletzki entworfen.
Helga Seiler hatte die wichtige Aufgabe des Lektorats.
Heike Breimes, Sabine und Torsten Goesch, Rainer Schulz, Ines Grohmann und Tanja Baumgart wurden nicht müde, durch wiederholtes Lesen viel zum Gelingen des Buches beizutragen.
Andreas Schaub übernahm als Aachener Stadtarchäologe das wissenschaftliche Lektorat für den Teil des Buches, der sich mit der Stadt Aachen und seiner näheren Umgebung auseinandersetzt.
Danken möchte ich zum Schluss auch Dr. Cornelius Ulbert, Dr. Peter Henrich und Dr. Iris Hofmann-Kastner, die mir wichtiges Material zur provinzialrömischen Geschichte zur Verfügung gestellt haben und all denen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die immer wieder Passagen des Buches gelesen und mich ermutigt haben, in meinem Schaffenseifer nicht nachzulassen.
Für meine Tochter Jenny
und
ihre Cousinen Hannah und Sarah
Dramatis Personae
Marcus Junius Maximus: römischer Tribun und Herr der Villa Vineta
Bissula: eine Alemannin aus dem Taunus
Galerius: Verwalter der Villa Vineta, Freund von Marcus
Charietto*: Tribun fränkischer Abstammung und Anführer einer Spezialeinheit
Ulf: ein fränkischer Krieger
Flavius Claudius Julianus*: Caesar des Westens und späterer Kaiser
Constatius II.*: Kaiser
Severus*: Magister Equitum, Reitergeneral
Germanus: Reiteroffizier alemannischer Abstammung, Bissulas Vetter
Titus Venator: Reiteroffizier (Centenarius)
Rufus: Soldat mit fränkischen Wurzeln
Gaius Aelius Viatorinus: Kommandant der Festung Noviomagus. Verschwörer
Secundinus: Medicus
Maximus: Verwalter der Villa Vineta
Secundus: Fischer bei der Villa Vineta
Flavia: junge Alemannin in der Villa Vineta
Gaius Lucius Tiburinus: Senator, Herr der Villa Urbana
Marcus Sidonius Rufus: Freund von Galerius
Decimus Magnus Ausonius: Dichter, Rhetor, Konsul
Valerius Aurelius Ambrosius*:Sohn des Statthalters und späterer Kirchenvater
* Historische Persönlichkeiten
Prolog
Es geschah im 18. Jahr der Herrschaft des Imperators Constan-tius II., als die Provinzen im Nordwesten des Imperiums unter dem Ansturm von Franken und Alemannen zu zerbrechen drohten.
Vor Stunden war die Nacht hereingebrochen und der Herbststurm peitschte niedrige Wolken über die Ebene, aus denen Regenschleier herabwehten. Unheimlich rauschten und gurgelten in der Dunkelheit die Fluten des Rhenus, der sich keine hundert Schritte entfernt dem Nordmeer entgegenwälzte.
Verzweifelt kämpften in dieser Nacht einige hundert Legionäre auf den Mauern der Festung Gelduba um ihr Leben. Die Lage schien hoffnungslos, denn unentwegt stürmten fränkische Krieger bei Tag und Nacht gegen die Wälle. Schulter an Schulter standen die Überlebenden der Lagerbesatzung neben den Resten der „Legio Tricensimae“ und versprengten Kampfgruppen des Bewegungsheeres, die sich zum Kastell durchgeschlagen hatten. Das war alles, was im Umkreis von fünfzig Meilen von der ehemals starken Grenzsicherung übrig geblieben war. Bis jetzt hatten sie den anstürmenden Franken standgehalten, die nach dem Fall der Großfestung Tricensima diesen letzten Sperrriegel auf dem Weg zu den großen Städten im Süden vor dem Beginn des Winters erobern wollten.
Auf den Wällen flackerten in eisernen Becken gespenstische Feuer, in deren Licht die Bedienungsmannschaften der Wurfgeschütze und Ballisten ihre tödliche Ladung gegen den Feind schleuderten. Wer dabei war und überlebte, sollte nie mehr das Sirren und Sausen der Geschosse, die Schreie der Kämpfer und das Stöhnen der Verwundeten vergessen.
Gelbrot loderten im Halbkreis die Lagerfeuer der Franken um das belagerte Kastell. Ohne Unterbrechung krachten Steine und Feuertöpfe auf die Deckungen und Behausungen der Verteidiger. Längst hatte der Feind gelernt, Schleudergeschütze und Ballisten selber herzustellen und wirkungsvoll einzusetzen. Die Festung lag im Würgegriff, und niemand hätte den Einschließungsring unbeschadet durchdringen können.
Seit Wochen starrten deshalb die Wachtposten angespannt über die Fluten des Rhenus, denn Rettung oder Entsatz wäre nur über den Wasserweg möglich gewesen. Eine vergebliche Hoffnung, weil sie nicht wissen konnten, dass überall längs des Flusses die Legionen im verzweifelten Abwehrkampf standen. Sie waren nicht in der Lage Hilfe zu schicken. Selbst in den Gefechtspausen fanden die Verteidiger keine Ruhe, wenn aus dem Dunkel, Angst und Schrecken verbreitend, die wilden Kampfgesänge der Barbaren dröhnten.
Wieder setzten rhythmisch die Trommeln ein, die den an- und abschwellenden Gesang aus tausend rauen Kehlen begleiteten. Besorgt musterten die erfahrenen Truppführer ihre Rekruten, wobei sie besonders auf flackernde Blicke und fahrige Bewegungen achteten. Sie wussten aus Erfahrung, was geschehen konnte, wenn die ersten Anzeichen der Panik übersehen wurden. In der vergangenen Nacht hatten drei Legionäre die Nerven verloren, waren den Wall hinunter gesprungen und in ihrer Verwirrung dem Feind direkt in die Arme gelaufen. Die Köpfe der Unglücklichen spießten die Franken auf Holzstangen, die sie in Sichtweite der Belagerten in den Boden rammten. Bei Anbruch der Dämmerung hatten sie Fackeln entzündet, damit die verzerrten Gesichtszüge der geschlachteten Kameraden weithin sichtbar blieben.
Kaum noch fähig, sich auf den Beinen zu halten, lehnte eine Kampfgruppe an der Brustwehr der flussseitigen Kastellmauer. Voller Angst blickten Offiziere und Legionäre über die zerstörten Innenbauten des Kastells zur gegenüberliegenden Seite der Festung, wo diesmal der Angriff der sturmreif geschossenen Toranlage galt. Müde blickten die Augen aus den grauen und unrasierten Gesichtern der Männer, die seit Tagen nur wenige Stunden geschlafen hatten.
Der Nieselregen rann von den Helmen auf Kettenpanzer und zerschlissene Uniformen. Die an der Brustwehr lehnenden Schilde und Lanzen befanden sich wie die übrigen Waffen in einem schlechten Zustand, da keine Zeit blieb, sie auszubessern.
Eine Stunde war vergangen, seit sie einen Angriff auf ihren Verteidigungsabschnitt mit letzter Kraft abwehren konnten. Der Feind hatte mit Leitern die Mauer erklettert und musste im Nahkampf von der Brustwehr geworfen werden, wobei drei Kameraden ihr Leben ließen. Einer von ihnen lag noch auf dem Wehrgang, wo ihm die Wurfaxt eines Franken den Schädel gespalten hatte. Viele waren verletzt und in Ermangelung sauberen Verbandmaterials hatte der Medicus die Wunden mit zerrissenen Bekleidungsfetzen umwickelt.
Abseits seiner Männer kauerte, mit dem Rücken an die Brustwehr gelehnt, ein Centurio auf dem Boden des Wehrgangs. Er hatte den Bügelhelm abgenommen, so dass sein dunkel-blonder Haarschopf dem Regen ausgesetzt war. Mit seinen ebenmäßigen Gesichtszügen, der geraden Nase, den graublauen Augen und der wettergegerbten Haut glich er eher einem eingeborenen Provinzialen als einem reinblütigen Römer aus den Kernprovinzen des Imperiums. Erste Falten und Linien um Augen und Mundpartie, die das Leben eingetieft hatte, ließen auf ein Alter Ende der dreißig schließen. Rasiert und vom Dreck befreit hätte man ihn als gut aussehend bezeichnen können, was sein hoch gewachsener und vom Militärdienst gestählter Körper noch unterstrich.
Vor wenigen Stunden waren er und die anderen Truppführer zu einer letzten Lagebesprechung in die Principia befohlen worden. Mit fahlem Gesicht und flackerndem Blick hatte ihnen der Vicarius dargelegt, dass der Fall der Festung unmittelbar bevor stand.
Der Centurio und zwei seiner Kameraden hatten jeweils einen auf Pergament geschriebenen Bericht über die Vorgänge bis zum Fall der Festung und eine Liste der abzuschreibenden Truppenteile ausgehändigt bekommen. Müde und schicksalsergeben hatte der Vicarius seine obersten Offiziere aus verschatteten Augenhöhlen angefleht, die Schreiben der Kanzlei des Magister Equitum per Gallias, zukommen zu lassen.
Die Rechnung war einfach. Wenn die Lage hoffnungslos wurde, sollten sie sich befehlsgemäß absetzen und versuchen, durch die fränkischen Linien zu entkommen. Schaffte es einer der drei, würde die Nachwelt einen Beweis von der Tapferkeit und Pflichterfüllung des Kommandanten und seiner Untergebenen in den Händen halten. Ihren Familien bliebe somit der Makel der unehrenhaften Niederlage erspart. Zusätzlich hatte man sie mündlich informiert, an welcher Stelle die zusammengeschmolzenen Geldmittel der Lagerverwaltung vergraben worden waren, um sie bei der Wiedergewinnung der verlorenen Grenzgebiete weiter verwenden zu können. Zum Schluss musste sich jeder der drei den Inhalt des Schreibens genau einprägen, damit er die Botschaft zur Not mündlich überbringen konnte. Ein Händedruck aus einer kraftlosen Hand und sie waren, das Schreiben in einem unter der Tunika getragenen Leibgurt verborgen, an ihre Plätze zurück geeilt.
Der Centurio starrte gedankenverloren auf einen goldenen Armreif, den er am linken Unterarm trug. Fortgesetzt drehte er das Schmuckstück mit der Rechten um das Handgelenk. Endlich hielt er inne und wischte das von Schmutz und Regentropfen benetzte Kleinod sorgfältig sauber, worauf eine sich windende Schlange mit smaragdbesetzten Augen sichtbar wurde.
In diesem Augenblick stieg wildes Triumpfgeheul in den Nachthimmel. Zu Hunderten ergossen sich die Feinde durch das zerbrechende Lagertor in den Innenbereich der Festung. Die wenigen, die, von Pfeilen und Speeren getroffen, im Lauf zusammensackten, brachten die Hintermänner zum Straucheln, den Ansturm aber nicht zum Stehen.
Bis auf den Centurio schreckte die Kampfgruppe auf dem Rhenuswall hoch. Die Männer rückten zitternd ihre Kettenpanzer oder Helme zurecht und rissen hastig die Schutzschilde hoch.
„Bei allen Göttern, Marcus, das ist das Ende“, schrie einer der Legionäre seinen Centurio an. Der Offizier riss sich gewaltsam vom Anblick seines Armreifs los und kam mit einem Satz auf die Beine.
„Verdammt!“, fluchte der mehr zu sich selbst als an seine Männer gewandt. „Wer hat bloß die Bataver an das Tor gestellt?“
Im gleichen Moment wusste er, dass der Vorwurf unberechtigt war und sie alle in wenigen Minuten tot sein würden, wenn die Götter kein Wunder geschehen ließen.
Fieberhaft arbeitete sein Kopf, bis er die Aussichtslosigkeit der Lage erfasste und er sich entschloss, den letzten Befehl des Vicarius auch auf seine Männer auszuweiten. Gelduba war gefallen und ihr Heldentod würde daran nichts ändern. Er hatte einen Fahneneid geschworen, der nicht verlangte, seine Untergebenen sinnlos zu opfern. Das Imperium brauchte auch morgen noch jeden Mann, der eine Waffe führen konnte.
„Raus hier!“, brüllte er seine Männer an, „Verschwindet über die Mauer und dann zu den Kähnen im Hafen.“
Die Hoffnung auf Rettung setzte bei den Männern, die eben noch ihr sicheres Ende vor Augen hatten, die letzten Kräfte frei. Sie warfen Waffen und Schilde über die Brustwehr, schwangen sich hoch und glitten die regennasse Feldseite der Mauer hinab, nicht der Spitzen und Kanten achtend, die Kleidung und Haut zerrissen. Die aufgeweichte Erde dämpfte ihren Aufprall, so dass sich alle unverletzt erhoben und auf das Flussufer zuliefen. Sie hatten den ersten Holzkahn fast erreicht, als die Pfeile der Feinde über sie hinweg in die Nacht surrten.
Plötzlich wankte der Centurio und stürzte mit einem wütenden Aufschrei zu Boden. Zwei Legionäre rissen ihren Offizier hoch, in dessen Rücken ein Pfeil steckte und hievten den Verletzten ins Boot. Über die Schultern zurück schauend, schoben die Männer den Kahn in den Fluss, bis das Wasser ihre Knie umspülte, sprangen hinein und suchten hinter der Bordwand Deckung.
Die Franken hatten mittlerweile das Ufer erreicht und schickten den Fliehenden einen Hagel von Pfeilen hinterher. Diese schwirrten über sie hinweg oder krachten mit ihren Eisenspitzen in die Holzplanken des hochgezogenen Hecks.
Die Strömung erfasste das Boot, und riss das sich immer schneller um die eigene Achse drehende Gefährt vom Ufer weg in die Mitte des Flusses. Kurz darauf waren die Fliehenden in der Dunkelheit verschwunden und vorerst gerettet.
An den Pforten der Unterwelt
Mein Name ist Marcus Junius Maximus, geboren auf dem väterlichen Weingut in der Nähe der Kaiserstadt Treveris im 14. Jahr der Herrschaft des Großen Constantinus. Im Alter von neunzehn Jahren hatte ich meinen Dienst bei der ruhmreichen XXX. Legion in Tricensima angetreten, wurde in den Grenzkriegen mehrfach ausgezeichnet und zum ranghöchsten Centurio meiner Einheit befördert. Als Tribun und Freund des göttlichen Imperators Julian, dessen früher Tod ein neues Zeitalter verhinderte, war ich maßgeblich an dem blutigen Sieg über Franken und Alemannen und der Rückgewinnung der verlorenen germanischen Provinzen beteiligt.
Ich beginne meinen Bericht mit meiner befehlsgemäßen Flucht aus der untergegangenen Festung Gelduba, bei der ich durch einen Pfeilschuss in den Rücken schwer verwundet wurde.
Unser überladenes Boot schwankte stark in der Strömung, und zwei Kameraden waren die ganze Nacht beschäftigt, das über die Bordwand hinein flutende Wasser mit ihren Helmen herauszuschöpfen. Glücklicherweise hatten sich an Bord ein paar Ruder befunden, so dass wir dem reißenden Fluss nicht steuerlos ausgeliefert waren.
Als der Schock der Verwundung nachließ, begann meine Schulter heftig zu schmerzen und hilflos musste ich meinen Kameraden bei ihren verzweifelten Bemühungen zuschauen, das Boot auf Kurs zu halten und vor dem Kentern zu bewahren.
Sobald wir ruhigeres Wasser erreichten, zog mir ein Soldat mit einem heftigen Ruck den Pfeil aus der Wunde und der Medicus legte einen notdürftigen Verband an. Das Geschoß hatte den Kettenpanzer durchschlagen und steckte unterhalb des Schulterblattes im Fleisch, ohne einen Knochen verletzt zu haben. Das war die einzige positive Erkenntnis, denn die Widerhaken hatten beim Entfernen der Spitze die Wunde weit aufgerissen und mir war schwarz vor den Augen geworden.
Danach dämmerte ich im Halbschlaf dahin, während als erste Anzeichen des beginnenden Wundfiebers heiße und kalte Schauer in Wellen durch meinen Körper fluteten.
„Hoffentlich war das Geschoß nicht vergiftet“, hörte ich aus weiter Ferne die Stimme des Medicus. „Es gibt Stämme, die ihre Pfeil- und Lanzenspitzen in den Leichensaft verwesender Tiere tauchen und damit auch die kleinste Verwundung zu einer tödlichen Gefahr machen.“
Mühsam stemmte ich meinen Oberkörper über den Bootsrand und erbrach mich unter Krämpfen, bevor eine gnädige Ohnmacht meinem Leiden zunächst ein Ende setzte. Mitleidvoll ruhten beim Erwachen die Blicke der Gefährten auf mir, von denen keiner einen Follis auf mein Überleben gesetzt hätte. Ich hatte es allein meiner kräftigen Konstitution zu verdanken, dass ich die Nacht überlebte.
Im Morgengrauen legten wir an einer Sandbank an, und die Männer schleppten mich das Ufer empor, während sie unser Fluchtgefährt dem Fluss überließen. Führerlos auf den Wellen tanzend, war das Boot bald unseren Blicken entschwunden, und nichts konnte mehr unseren Aufenthaltsort an einen zufällig vorbei kommenden Feind verraten.
Wir schlugen das Lager in einem Waldstück auf, das wir aus Angst vor Entdeckung zwei Tage nicht verließen. Es war ein ungemütlicher und nach modriger Verwesung stinkender Ort, den wir uns ausgesucht hatten. Schwarzes Laub, in dem ekliges Gewürm und huschende Asseln hausten, bedeckte den Boden des aus Weiden und vereinzelten Buchen bestehenden Wäldchens. Brombeerranken krallten sich bei jeder Bewegung in die Kleidung, und es kostete viel Mühe, den Boden von Unterholz und Blattlaub zu befreien.
Den ganzen Tag dämmerte ich im unruhigen Halbschlaf dahin.
Am Abend gelang es einem meiner Kameraden mit Feuerstein, Stahl und etwas trockenem Zunder ein kleines Feuer zu entzünden, das notdürftig wärmte und die feuchten Kleider trocknete. Wegen der starken Rauchentwicklung des nassen Holzes unterhielten wir es erst nach Einbruch der Dämmerung mit einer größeren Flamme.
Nach dem kargen Abendessen, das aus angefeuchteten Resten der Tagesration bestand, die sich in unseren Proviantbeuteln fanden, trat der Medicus an mein Krankenlager.
„Wie geht es dir, Centurio?“, fragte er und fingerte an dem klammen Mantel, der über die Laubauflage meiner provisorischen Bettstatt gebreitet war.
„Mir ist heiß und es pocht in der Schulter“, presste ich heraus und sank stöhnend zurück.
Über der Nasenwurzel des Medicus bildete sich eine Sorgenfalte, als er die Hand auf meine Stirn legte.
„Du hast hohes Fieber, lass mich die Wunde anschauen.“
Ächzend richtete ich den Oberkörper auf und zuckte bei der leisesten Berührung vor Schmerz, als die Binden entfernt wur-den.
„Verdammt“, fluchte der Medicus und legte mich sachte zurück. „Die Wundränder haben sich verfärbt, Centurio. Wenn wir nichts tun, wirst du an der Entzündung sterben und die Nacht nicht überleben. Ich muss schneiden, den Eiter entfernen und die Wunde ausbrennen.“
Verzweifelt stöhnte ich auf. „Lasst mich sterben, ich bin euch sowieso nur eine Last.“
„Das Fieber spricht aus dir, Centurio. Es sieht nicht gut aus, aber du solltest jede Möglichkeit nutzen. Füge dich in das Unvermeidliche und lass mich meine Arbeit tun.“
Rote Schleier tanzten vor meinen Augen und ich verlor kurz das Bewusstsein, als der Medicus zum Feuer schritt und seinen Dolch in die Glut legte.
Ich erwachte aus der Ohnmacht, als zwei Männer mich auf den Bauch drehten und mir ein Stück Holz zwischen die Zähne klemmten. Voller Panik drehte ich den Kopf und schaute über die Schulter zum Feuer, von dem aus sich ein großer Schatten auf mich zu bewegte, der etwas rot Glühendes in den Händen hielt. Ich stöhnte wie ein wundes Tier, als man mich packte und auf dem Boden fixierte.
„Ruhig Centurio“, klang über mir die beruhigende Stimme des Medicus. „Wenn du leben willst, musst du das ertragen.“
Mein Körper entspannte, und ich ergab mich in stumpfer Verzweiflung in die Hände des fremden Mannes, der mein Leben retten wollte.
Ein schrecklicher Schmerz, grell wie ein Blitz, tobte durch meinen Körper, als die glühende Klinge in mein Fleisch schnitt und jeden Augenblick zur Ewigkeit werden ließ.
„Es ist gleich vorbei, Centurio“, drang eine Stimme durch eine rote Wolke in mein Bewusstsein, während das Holzstück im gleichen Augenblick mit einem Krachen zwischen meinen Zähnen zerbrach.
Wieder durchzuckte mich der Schmerz, Feuerräder tanzten vor den Augen, und es roch nach verbranntem Fleisch.
„Lasst mich endlich in Ruhe“, stieß ich gequält hervor.
„Du bist tapfer“, lobte eine Stimme.
Als ich verbunden wurde und der Medicus Heilkräuter auf die ausgebrannte Wunde presste, verlor ich das Bewusstsein.
Fiebernd und phantasierend verbrachte ich die Nacht und spürte kaum die helfenden Hände, die mir den Schweiß vom Gesicht wischten und mich mit Flüssigkeit versorgten. Im Morgengrauen fiel ich in einen tiefen Erschöpfungsschlaf und durchlebte einen Fiebertraum, der sich bis auf den heutigen Tag mit allen Einzelheiten in meine Erinnerung eingebrannt hat.
Die Welt stand in Flammen und aus der Glut erhob sich schlängelnd und züngelnd eine riesige Schlange, die bis zu den Sternen emporwuchs und schließlich Himmel und Erde ausfüllte. Langsam wand sie mir ihr Antlitz zu, und ich versank in ihren smaragdgrünen Augen. Sie schien mich anzulächeln, als sie das Maul öffnete und mir ihre schrecklichen, Blut triefenden Giftzähne zeigte. Das Untier war das genaue Abbild der Schlange auf meinem Armreif.
Fast hätte ich es nicht geschafft. Ich stand am Ufer eines grauen Gewässers und ein dunkler Kahn glitt langsam auf mich zu, den ein hagerer Mann in weitem Kapuzenmantel steuerte. Gebannt starrte ich in ein gesichtsloses Antlitz und erschauerte, als der Fährmann seinen Arm hob und mir zuwinkte. Die Angst löste sich, die Schmerzen wichen und leicht und kühl durch-rieselte es meinen fieberverzehrten Körper.
„Loslassen“, sehnte meine geschundene Seele, „endlich los-lassen.“
Da schob sich eine Nebelwand vor den Nachen und der Fährmann entschwand im Dunst. Dumpf kroch der Schmerz in den Körper zurück, bis Qualen und Elend der ganzen Welt auf meinem gemarterten Körper lasteten. Ich hatte es geschafft und sollte leben.
Ich schlief durch bis zum Abend, als mir die Strahlen einer tief stehenden Sonne, die ein letztes Mal eine Wolkenlücke gefunden hatten, direkt in die Augen schienen. Obwohl matt und schwach wie noch nie in meinem Leben, fühlte ich mich besser und verspürte Hunger und brennenden Durst.
„Willkommen bei den Lebenden“, spürte ich die beruhigende Wärme einer kräftigen Hand auf meiner Stirn. „Du hast Glück gehabt und das Fieber hat sich ausgetobt“, erkannte ich die Stimme des Medicus, der neben mir auf dem Boden saß und mir mit sanften Bewegungen den Verband abnahm.
„Als ich deine Wunde öffnete, war die Fäulnis schon eingedrungen, und ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass du es schaffen könntest.“ Er zog sein Messer und fing mit der blitzenden Klinge einen Sonnenstrahl ein, bevor er fortfuhr.
„Du musst die Nerven eines Ochsen haben, denn du hast kaum einen Laut von dir gegeben, während ich die Wunde ausbrannte.“ Er beugte sich über meine Schulter und schnalzte mit der Zunge.
„Sie verheilt wunderbar, du Liebling der Götter, aber es wird eine kräftige Schramme zurückbleiben.“ Daumen und Zeigefinger des Mannes zeigten die Größe der zu erwartenden Narbe an, die nicht die letzte in meinem Leben bleiben sollte. Er packte eine frische Lage Heilkräuter auf die operierte Stelle und legte einen neuen Verband an.
„Ich werde weiter nach dir sehen“, wandte er sich zum Gehen, „und wenn dich jemand fragt, wer dein Leben gerettet hat, dann antworte, dass es der Wundarzt Gaius Secundinus aus Coriovallum war.“
Ich schaute dem Medicus nach, und mir fiel auf, dass ich den Mann, dem ich so viel verdankte, zum ersten Mal in meinem Leben genauer betrachtet hatte. Er war groß, mehr als sechs Fuß, und wie ein Athlet gebaut. Erstaunlich für einen Mann über vierzig, dass nicht eine einzige graue Strähne das bis auf die Schultern herab wallende, dunkle Lockenhaar durchzog. Die lebhaften Augen unter buschigen Brauen und die energische Mundpartie standen für Tatkraft und Durchsetzungsvermögen, während der höckerige Nasenrücken sein Aussehen der Faust eines eifersüchtigen Tribunen verdankte. Auffällig waren die für seine Statur feingliedrigen, langen Hände, die mich so behutsam versorgt hatten.
Ich aß etwas von dem Fisch, den einige Männer in einem Tümpel gefangen hatten, kaute bittere Waldnüsse und trank in gierigen Zügen das saubere Wasser aus dem Fluss.
Einer nach dem anderen kamen die Gefährten an mein Lager und drückten in ehrlicher Anteilnahme ihre Freude zu meiner Rettung aus. Sie hatten die Muße des vergangenen Tages genutzt und aus Ästen und Stoffstreifen eine improvisierte Trage gebaut, die mich in den nächsten Tagen befördern sollte.
Im Morgengrauen brachen wir auf. Ich vermied es, den Männern in die Augen zu schauen, die mich auf die Trage hoben und sorgsam aus dem Wäldchen heraus schleppten.
„Wir tun das gerne für dich, Centurio“, bekräftigte ein Legionär, der meinen Gemütszustand richtig deutete. Es war mir peinlich, von meinen Männern wie ein unnützer Krüppel getragen zu werden.
„Centurio, ruh dich aus und genieße es, denn ohne dich wäre keiner von uns lebend aus Gelduba heraus gekommen. Man hätte uns an Ort und Stelle massakriert oder später zu Ehren irgendeines germanischen Gottes geschlachtet.“ Die um die Trage herum stehenden Legionäre bestätigten die Aussage ihres Kameraden mit beifälligem Gemurmel.
Wir bewegten uns im Tageslicht über offenes Gelände, ohne Angst haben zu müssen, von einer fränkischen Streifschar gesichtet zu werden. Vorsicht war nicht angebracht, da wir seit unserer Flucht niemanden gesehen hatten. Mit unserem Boot waren wir weit den Rhenus herab getrieben und der Feind hatte diesmal darauf verzichtet, in das ungeschützte Hinterland einzufallen. Wir ahnten, dass sie dieses Mal ernst machten und alle Kräfte zusammenfassten, um stromaufwärts die Befestigungen und Siedlungen anzugreifen, die sie vor dem Frost erreichen konnten. Ehe wir uns nach Süden wandten, mussten wir nur lange genug Richtung Westen marschieren, um aus dem gefährdeten Gebiet herauszukommen.
Anfangs kamen wir langsam voran, weil die trotz der kühlen Witterung schwitzenden Männer meine Trage durch sumpfige Wiesen und schlammige Bruchwälder schleppen mussten. Wir benötigten zwei Tage, bis wir uns zur Straße durchgeschlagen hatten, die Tricensima mit Coriovallum verband. Auf der geschotterten Straßendecke kamen wir besser voran, denn erst vor wenigen Jahren waren der Kiesbelag ausgebessert und die Abwassergräben freigelegt worden. Wie an der Schnur gezogen verlief die Straße durch die niedergermanische Ebene, und endlos erstreckten sich zu beiden Seiten die dunklen und sumpfigen Wälder des Tieflandes.
Als wir am dritten Tag hügeliges Gelände erreichten, war ich so weit wieder zu Kräften gekommen, dass ich, anfangs nur kurz und später auch längere Zeit, die Trage verlassen konnte.
Sorgsam wurde ich von Secundinus betreut, der mich ermahnte, vorsichtig mit meinen wieder gewonnenen Kräften hauszuhalten. Er wechselte täglich meinen Verband und achtete darauf, dass ich ausreichend Nahrung und Flüssigkeit zu mir nahm.
Am meisten machte uns in der ersten Woche der Dauerregen zu schaffen, der in dünnen Schleiern aus der tief hängenden Wolkendecke herunter wehte und bis zum Abend jede Faser unserer Kleidung durchfeuchtet hatte. Die Wärme der Lagerfeuer reichte nicht aus, Tuniken, Mäntel und Stiefel bis zum nächsten Morgen durchzutrocknen, was bei den meisten Männern Erkältungen nach sich zog, die unser Marschtempo verlangsamten.
Die Vorratsbeutel mit der Lagerverpflegung waren längst aufgezehrt, und wir ernährten uns von dem, was auf dem Marsch der Natur abgetrotzt werden konnte: späte Pilze, Nüsse, Bucheckern und, wenn wir Glück hatten, Fische aus einem Tümpel oder einen unvorsichtigen Hasen. Einmal gelang es einem Bogenschützen, einen Rehbock zu schießen, dessen Fleisch uns zwei Tage ernährte.
Im Abstand von zehn Leugen verteilten sich die Straßenstationen entlang des Verkehrsweges, der vor 200 Jahren als rückwärtige Verbindung zur Limesstraße ausgebaut worden war. Mediolanum, Sablones und Medriacum waren von ihren Bewohnern aus Angst vor den Franken verlassen worden. Trotzdem waren wir froh, in der Nacht ein Dach über dem Kopf zu haben, in dessen Schutz wir uns am Feuer aufwärmen und eine heiße Mahlzeit kochen konnten.
In den Nächten wurde es kalt, und wir schliefen dicht aneinandergedrängt neben dem Lagerfeuer. Am Morgen bedeckte eine dünne Eisschicht das Wasser der Pfützen und Wasserlöcher, Raureif lag auf Wiesen und Wäldern und die Atemluft kondensierte in weißen Schleiern. Den Göttern sei Dank, hatte es aufgehört zu regnen und die Temperaturen stiegen am Tag so weit an, dass wir auf dem Marsch nicht froren.
In Teudurum trafen wir erstmals auf Menschen, die uns begierig ausfragten und herzlich bewirteten, als wir erzählt hatten, wo wir herkamen.
Ab hier traten die Wälder zurück und machten Ackerfluren Platz, die weit vor unserer Zeit auf den fruchtbaren Böden angelegt worden waren. Wir hatten die Kornkammer Niedergermaniens erreicht, die sich nördlich von Aquis bis zum Rhenus bei Novaesium und hinunter nach der Colonia und dem Legionslager von Bonna erstreckte. Im Gegensatz zu den dünn besiedelten Fluren der nördlichen Germania Secunda, wo Viehzucht betrieben wurde, prägten unzählige Einzelgehöfte das Bild der Landschaft, auf deren Ländereien das Getreide und die Feldfrüchte für die großen Städte und Garnisonen am Rhenus angebaut wurden.
Seitdem wir uns durch bewohntes Gebiet bewegten, verkleinerte sich unsere Gruppe zusehends. Drei Männer hatten Familien im Hinterland und verließen uns, um ihre Angehörigen vor den vielleicht nachdrängenden Franken in Sicherheit zu bringen. Zwei andere waren am Morgen einfach nicht mehr da. Ordnung und Disziplin lösten sich auf, und ich konnte die Männer verstehen, die mit dem militärischen Zusammenbruch alles verloren hatten, was ihr Leben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten bestimmt hatte. Was hätten sie auch tun können, als sich und ihre Familien zu schützen?
Die Nachrichten, die wir von den wenigen Menschen, die uns begegneten, in Erfahrung brachten, waren nicht gut. Wie es schien, waren die germanischen Provinzen verloren, und jeder nur darauf bedacht, seine Haut zu retten.
Auch ich hatte begonnen, darüber nachzudenken, wie meine schriftlichen und mündlichen Botschaften an ihren Bestimmungsort gelangen konnten. Dabei wurde mir bewusst, dass ich in der Erfüllung meines Auftrages die Heimat wiedersehen und zu Hause nach dem Rechten sehen konnte. Voller Sehnsucht und Heimweh stiegen vor meinem geistigen Auge das Vaterhaus und die sanften Rebenhänge über den Ufern der Mosella empor. Zuerst musste ich aber gesund werden, denn selbst, wenn ich es gewollt hätte, wäre es in meinem angeschlagenen Zustand und ohne Begleitung und Hilfe unmöglich gewesen, bis nach Hause durchzukommen.
Die letzten Gefährten und mit ihnen der Medicus Secundinus verließen mich in Coriovallum.
„Bleib einige Tage in meinem Haus, Centurio und ruh` dich aus. Meine Familie wird dich willkommen heißen“, wies er einladend auf die Gebäude des nahen Ortes. „Coriovallum ist eine hübsche Landstadt mit einer bekannten Therme.“
„Hab Dank, Secundinus“, schüttelte ich den Kopf. „Du hast viel für mich getan und dafür danke ich dir. Versuch nicht, mich zum Bleiben zu bewegen. Bis Aquis ist es nicht weit und dort finde ich alles, was ich brauche, um gesund zu werden.“
„Das findest du bei mir auch, Centurio“, widersprach der Medicus.
„Secundinus, in Aquis liegt vielleicht Militär zum Schutz der Lazarette. Die haben Verwendung für mich, und ich muss mich dort melden und sehen, wie es weiter geht.“
Ich sah Tränen in den Augenwinkeln meines Lebensretters aufblitzen, als er nach meiner Hand griff.
„Die Götter mögen mit dir sein, Centurio, und lass dich den Winter über gesund pflegen. Wie es meine Zeit erlaubt, werde ich kommen und nach dir sehen.“
In diesem Augenblick tauchte ein zweirädriger Bauernkarren zwischen den letzten Häusern des Ortes auf.
„Siehst du, jetzt kann ich doch noch etwas für dich tun.“ Behende eilte Secundinus dem Karren entgegen und gebot dem Fahrer mit erhobenen Armen zu halten. Ängstlich zügelte der Bauer sein Ochsengespann und griff nach einem Knüppel, der hinter ihm auf der Ladefläche lag.
„Was wollt ihr von mir?“, stammelte der Mann, der sich unversehens zwei zerlumpten und verwahrlosten Gestalten gegenüber sah, die eine Spatha am Gürtel trugen.
„Bei allen Göttern, Secundinus“, warf der Bauer den Knüppel hinter sich und ein Lächeln überzog das derbe Gesicht.
„Das wurde aber Zeit Fabius, habe ich mich so verändert?“
„Du bist schmal geworden, Medicus“, entschuldigte sich der Landmann, „und warst mehr als ein Jahr fort. Schön, dass du wieder hier bist, wir brauchen dringend einen Arzt im Ort.“
„Fabius, nimm diese Münzen und fahr den Offizier nach Aquis.“
Während der Bauer erfreut die Münzen in seiner Hand wog, half der Wundarzt mir auf die Lagefläche und deckte mich mit meinem Mantel zu. Ein letzter Händedruck, und ächzend setzte sich der Karren in Bewegung.
Durchgeschüttelt und von Hitzewellen und Schüttelfrost zermürbt, rumpelte ich Stunden später auf meinem Gefährt nach Aquis hinein. Die Bäume hatten in den letzten Tagen alle Blätter abgeworfen, und die ersten Schneeflocken taumelten aus winterdunklen Wolken auf die Erde herab.
Die Wasser des Grannus
Der Bauer setzte mich vor dem Eingang einer der beiden Thermenanlagen des Ortes ab, die in ein Behelfslazarett umgewandelt worden war.
Obwohl mir als Offizier ein Einzelzimmer zustand, musste ich froh sein, für ein entsprechendes Geldgeschenk ein Bett in einem Bretterverschlag des ehemaligen Caldariums zu bekommen. Ein Luxus, weil in diesem Teil des Gebäudes die Heizungsanlage noch intakt war. Dagegen hatte man in den übrigen Räumen die Menschen auf stinkende Strohsäcke gebettet. Um zusätzlichen Platz zu schaffen, waren die großen Wasserbecken mit dem Schutt der bröckelnden Innenausstattung verfüllt und mit einem groben Dielenboden abgedeckt worden.
Hunderte Verletzte und Kranke drängten sich in den ehemals prächtigen Hallen der Badeanlage, durch die nicht mehr der Wohlgeruch erlesener Duftöle zog. Der Gestank von fiebrigem Schweiß und faulendem Eiter erfüllte die Gewölbe bis in die letzte Nische. Nur die Liegeplätze der Schwerkranken und Sterbenden waren den Blicken der Leidensgenossen durch eilig gespannte Laken und Vorhänge entzogen.
Es verging kein Tag, an dem die Knechte nicht wenigsten einen Toten herausschafften und neues Strandgut des Krieges in die Therme gespült wurde. Die Zahl der Unglücklichen, deren Leichen in der Einsamkeit der Wälder und Sümpfe Niedergermaniens vermoderten, wird dagegen niemand erfahren.
Durch die zerbrochenen und nicht ersetzten Fensterscheiben wirbelte der Wind Regen und welkes Laub, das sich in den Ecken häufte. Rückzugsort für Wanzen und anderes Getier, das die Wehrlosen in der Nacht heimsuchte.
Wie ein Schlag hatte es mich getroffen, als ich in einen Spiegel schaute. Aus tiefen Augenhöhlen starrte mich ein Gespenst an, das nicht der Offizier sein konnte, der immer auf sein Äußeres geachtet hatte. Mein Körper hatte die letzten Reserven mobilisiert, um hierhin zu kommen, und war dann einfach zusammengebrochen.
Tagelang war ich nicht in der Lage, mein Lager zu verlassen, und musste von einem Pfleger auf die Latrine geschleppt und gefüttert werden, und obwohl ich Tag und Nacht schlief, verspürte ich keine Erholung.
Jeder Neuankömmling schien eine andere Krankheit mitzubringen, die nach wenigen Tagen Eingang in meinen geschwächten Körper fand. Wieder war mein Leben bedroht, als der Medicus eine Entzündung meiner Lungen diagnostizierte.
Trotzdem gelang es der Kunst der Ärzte, meinen Körper am Leben zu halten, und die nach Schwefel riechenden Wasser des Gottes Grannus stellten mich nach langen Wochen soweit her, dass keine Gefahr mehr bestand, vor den Mauern des Ortes in einem Massengrab verscharrt zu werden.
Aber mein Geist gesundete nicht. Tagsüber lag ich in meinem Bretterverschlag auf dem Lager und starrte die Decke an, während ich in der Nacht keinen Schlaf fand und mich unruhig hin und her wälzte.
Meinen Auftrag, die letzte Botschaft des Vicarius nach Treveris zu bringen, hatte ich längst in den hintersten und dunkelsten Teil meines Bewusstseins verdrängt.
Hoffnungslosigkeit und Untergangsstimmung wurden zu Ratgebern und Begleitern dieser schlimmen Zeit.
Der fränkische Giftpfeil konnte mich nicht umbringen, aber er hatte meine Seele verletzt. Was sollte aus mir werden und wie sollte es weiter gehen, wenn die letzten Plätze Niedergermaniens erstürmt waren und danach meine Heimat an der Mosella an die Reihe kam? Meine Welt war zusammengebrochen und der Krieg verloren. Vor 80 Jahren hatten Franken und Alemannen schon einmal die Grenzen überrannt und Gallien bis ans Meer verwüstet. Aber dem Imperium erwuchsen geniale Heerführer und kraftvolle Kaiser, die unter immensen Schwierigkeiten und Mühen die Krise meisterten. Und heute?
Der Imperator Constantius war mit der Welt zerstritten und mehr darauf bedacht, mögliche Konkurrenten seiner Herrschaft auszuschalten, als die Grenzprovinzen wirkungsvoll zu verteidigen. Die Legionen setzten sich zum überwiegenden Teil aus angeworbenen Barbaren zusammen, weil die Römer nicht mehr kämpfen wollten und jede Gelegenheit ergriffen, dem Dienst an der Waffe zu entgehen. Um das Maß voll zu machen, verdrängten die Christen mit Unterstützung des Kaisers die Anhänger des alten Glaubens aus Staat und Armee und zerstörten die traditionellen Werte und Tugenden. Meine Welt schien dem Untergang geweiht und damit alles, was mir lieb und teuer war. Ich trauerte um Rom, und ich trauerte um mich.
Eines Nachmittags lag ich lange wach, bis ich endlich einnickte und ein Traum mir keine Ruhe ließ, in dem ein Schatten, die untergehende Sonne im Rücken, mit Gewalt an meinen Schultern rüttelte. Ich wollte den lästigen Plagegeist loswerden und wand mich immer wieder vergebens aus seinen Armen. Schweißüberströmt wachte ich auf, öffnete die Lider und blickte in die Augen des Wundarztes aus Coriovallum. Mein Freund Secundinus war gekommen.
Behutsam legte er mir die Hand auf die Stirn und fühlte meinen Puls.
„Centurio, du bist nicht mehr krank, siehst aber aus wie ein Leichnam.“
Schwerfällig richtete ich mich auf, die durchschwitzte Decke wie einen Schutzpanzer um meinen Körper schlingend. Mit dem Rücken an die Wand gelehnt, saß ich mit angezogenen Knien auf der Bettstatt und wich den Blicken des Freundes aus.
„Marcus, hier stinkt es wie in einem Dachsbau, wann hast du dich das letzte Mal gewaschen?“
Meine Antwort bestand aus einem Grummeln, das Secundinus ignorierte.
„Centurio, wo ist dein Stolz geblieben?“ stichelte der Medicus. „Mach einen Menschen aus dir, und wenn du zurück bist, gibt es etwas Ordentliches zu essen“, fuhr er fort, ohne meine Antwort abzuwarten, und klopfte auf einen Weidenkorb, aus dem der Hals einer kleinen Weinamphore hervorschaute.
Eine Stunde später war ich gewaschen, trug eine frische Tunika, die Secundinus mitgebracht hatte und langte kräftig zu.
„Zeit für einen Spaziergang“, kommandierte der Medicus, und zum ersten Mal seit meiner Ankunft verließ ich das Lazarett.
Tief sog ich die Luft des Vorfrühlingstages in meine Lungen und musste mich sogleich setzen, da mir schwindelig wurde.
„Man kann sich an die schlechte Luft gewöhnen“, spottete Secundinus und schritt voran.
Zuerst mit Mühe und dann kräftiger Fuß vor Fuß setzend, folgte ich meinem Führer durch die Gassen und Plätze des Ortes.
Unser Rundgang begann an der umlaufenden Säulenportikus, welche die beiden Thermenanlagen des ehemaligen Militärbades verband und die Heiligtümer des Apollo Grannus und anderer lokaler Gottheiten vom Getriebe der Stadt abschirmte.
Drei Jahrhunderte hatten Legionäre und Offiziere die An-nehmlichkeiten der hiesigen Thermen genossen, und es war nicht zu übersehen, dass Aquis bessere Tage gesehen hatte. Die Repräsentationsbauten wurden in den letzten Jahren nur notdürftig unterhalten und die Badeanlagen nicht mehr genutzt. Ein Badekomplex wurde zu meinem Lazarett umgerüstet, während die andere Therme geschlossen war. Zum Schutz vor streunendem Gesindel hatte man die Türen vermauert und die Fensteröffnungen mit Brettern vernagelt.
Das Zentrum des Ortes befand sich oberhalb von Tempelbezirk und Thermen auf einer flachen Erhebung. Hier standen die öffentlichen Gebäude und trafen sich die Straßen, die den Ort mit der Welt verbanden. Den Hügel abwärts erstreckten sich zu allen Seiten die Wohn- und Handwerkerviertel, bis sumpfige Niederungen und Bachläufe ihrer Ausdehnung ein Ende setzten. Bescheiden wirkten die auf Steinfundamenten ruhenden, ein- oder zweigeschossigen Fachwerkhäuser neben der verblichenen Pracht des Kurbezirkes. Auffallend viele Tavernen verteilten sich über die Wohngebiete. Dienten sie früher Kurzweil und Unterhaltung der Badegäste, verdienten die Wirte heute an den versprengten Legionären des Grenzheeres und den Flüchtlingen, die aus ihren zerstörten Dörfern und Städten bis hierher an den Rand der Silva Arduenna geflohen waren.
Um mich zu schonen kehrten wir zum Kultbezirk zurück und lagerten uns auf den Stufen des Säulenumgangs. Der Frühling schien früh zu kommen und wohlig sog ich die Wärme der von der Sonne beschienen Steinquader auf. Ich lehnte mich zurück und schloss die Augen, als mich die Stimme des Medicus aus den Gedanken riss.
„Wir werden uns so bald nicht wieder sehen, Centurio, weil ich die Germania Secunda verlasse.“
„Das kann er nicht mit mir machen“, schoss es mir durch den Kopf. „Erst rettet er mein Leben, holt mich aus dem Dreckloch raus und macht sich dann einfach davon.“ Ein „Warum?“ war das einzige Wort, das mir über die Lippen kam.
„Weil ich ein gutes Angebot erhalten habe und hier weg will, Centurio. Ein Bruder meines Vaters“, fuhr Secundinus fort, „ist in Burdigala verstorben. Er hatte sich dort als Arzt niedergelassen, und ich kann seine Patienten übernehmen, alles reiche Unternehmer und Beamte.“ Der Medicus schaute mir verständnis- suchend in die Augen.
„Marcus, meine Familie will nicht ständig um Leben und Besitz bangen. In den letzten Wochen sind marodierende Frankenbanden bis in die Nähe von Coriovallum und Aquis gekommen und haben die Gegend unsicher gemacht. Sie sind noch nicht zahlreich genug, einen Vicus oder eine Stadt anzugreifen, aber in der Nacht sind die Feuer der brennenden Höfe zu sehen. Meine Frau möchte nicht warten, bis Coriovallum niedergebrannt wird oder ich auf dem Weg zu einem einsamen Patienten in die Hände der Feinde falle. Seit Wochen macht das Leben keine Freude mehr, weil es an den nötigsten Dingen fehlt. Es kommen keine Waren mehr durch, und die Läden der Händler sind leer.
Ich bin gekommen, weil mir der Abschied von dir wichtig ist, und ich mich bis Aquis einer bewaffneten Wagenkolonne anschließen konnte.“
Obwohl ich die Beweggründe des Medicus nachvollziehen konnte, lehnte sich mein Innerstes mit aller Kraft dagegen auf. Hatte mich Secundinus in jenem finsteren Wäldchen am Leben erhalten und heute aus dem stinkenden Lazarett gezogen, um mir mitzuteilen, dass ich alleine klar kommen sollte? Wie ein schwarzer Schatten verdunkelten Bitternis und Missgunst mein Denken.
Um in der Erregung nichts Falsches oder Unüberlegtes zu sagen, nahm ich mir Zeit, die korinthischen Blattkapitelle und verzierten Archivolten der Bogenarchitektur zu betrachten, ehe ich antwortete.
„Secundinus, findest du es richtig, dass die Besten gehen und die Sache Roms im Stich lassen?“, fiel meine Entgegnung schroffer als beabsichtigt aus.
„Ich habe genug getan, Centurio“, polterte mein Freund los, während seine Augen im Zorn blitzten. „Weißt du, wie viele Jahre ich als Arzt bei der Legion war und dabei Gesundheit und Leben riskiert habe? Kannst du Gelduba vergessen?“
„Nein“, bestätigte ich mit einem Schütteln des Kopfes
„Es gäbe keine Probleme, Centurio, wenn alle meinen Einsatz gezeigt hätten. Es ist genug, und jetzt müssen Frau und Kinder zu ihrem Recht kommen. Wünsche mir Glück, mein Freund.“
„Du hast Recht“, lenkte ich kleinlaut ein, „gerade ich darf dir keine Vorhaltungen machen. Ich hänge hier untätig herum, obwohl ich einen dringenden Auftrag zu erledigen hätte.“
„Und der wäre?“, musterte mich Secundinus von der Seite.
„Ich trage ein Schreiben des Vicarius mit mir“, sprach ich mehr zu mir als zu meinem Freund, „das dringend nach Treveris an seinen Bestimmungsort muss. Was rätst du mir, was ich tun soll?“
Mit zusammen gekniffenen Lidern musterte mich mein Freund, bevor er mir den Arm um die Schulter legte.
„Als erstes verlässt du das Lazarett und besorgst dir eine Unterkunft, denn du brauchst noch ein wenig Pflege und Erholung.
Hast du noch Geld?“
„Ja“ antwortete ich, „wenn ich sparsam bin, reicht es für ein paar Monate. Ich bin nicht wie viele andere im Lazarett bestohlen worden, weil ich den Gürtel, in dessen Innentasche mein Geld verborgen ist, niemals abgelegt habe. Außerdem steht mir noch Sold zu“, fügte ich hinzu.
„Sehr gut.“ Secundinus schlug mir die Hand auf ein Knie. „Gehe zur Kommandantur und mache deine Ansprüche geltend, die einem Offizier, der zurück zur Truppe muss, nicht vorenthalten werden können. Und dann überleg genau, was du tun wirst. Entweder suchst du dir in Aquis ein Kommando und siehst zu, dass deine Botschaft sicher nach Treveris gelangt, oder du gehst selber und schaust zu Hause vorbei.“
Mein Freund schwieg eine Weile, und ich sah einem verfrühten Zitronenfalter zu, der über mir die Säulen der Portikus umflatterte.
„Beim Mars, Centurio“, drang Secundinus wieder in mich, „wenn du dich hängen lässt, gehst du hier vor die Hunde.“
Es blieb noch ein wenig Zeit bis zum Aufbruch meines Freundes, so dass er mir beim Umzug zur Seite stehen konnte. Ein Lazarettgehilfe brachte in einer hölzernen Lade meine persönliche Habe, die ich sofort auf ihre Vollständigkeit überprüfte. Zu meiner Freude fehlte nichts, und nach langer Zeit bog ich meinen goldenen Schlangenarmreif wieder um mein Handgelenk. Es sprach für meine desolate Verfassung in jenen Tagen, dass ich den Talisman nicht vermisst hatte. Schuldbewusst wischte ich den Staub von dem Begleiter eines halben Soldatenlebens, worauf die Smaragdaugen aufblitzten, und die einzelnen Schuppen des Schlangenleibes deutlich hervortraten.
Secundinus war in der Zwischenzeit in ein Gespräch mit dem herbeigeeilten Arzt vertieft, dessen Können mich auf die Beine gebracht hatte.
Ich unterbrach die beiden, drückte dem Mann meine Dankbarkeit aus und überreichte ihm ein üppiges Geldgeschenk von mehreren Silberdenaren, das er freudestrahlend in Empfang nahm.
„Centurio“, ergriff der Arzt das Wort, „ich habe meinen Kollegen Secundinus über alles in Kenntnis gesetzt, was für deine Krankengeschichte von Belang ist. Wie dein Freund sehe ich keine Notwendigkeit, dass du weiter hier bleibst. Gehe es nicht zu schnell an und suche mich auf, wenn dein Zustand sich verschlechtern sollte.“
„Das mögen die Götter verhindern“, lachte ich das erste Mal seit Wochen.
„Ein Bruder meiner Frau betreibt in Aquis eine Bäckerei“, warf der Arzt ein „und wenn du ihm sagst, dass ich dich schicke, wird er dir ein sauberes Zimmer zu einem annehmbaren Preis überlassen.“
Wir suchten die angegebene Adresse auf, und ich bezahlte vorerst für einen Monat die Miete. Der Bäcker machte einen ehrlichen Eindruck, und man sah ihm an, dass er froh war, in diesen Zeiten einen Offizier zum Untermieter zu bekommen.
Das Zimmer lag im hinteren Teil des Hauses, weit genug vom Lärm der Straße und dem Trubel des Verkaufsraumes entfernt. Die geweißten Wände waren am Sockel und Deckenansatz mit gemalten Blumenornamenten verziert, ein gemauerter Ofen mit Abzug ersetzte die Heizung und das Fenster öffnete sich zum Garten. Die Latrine befand sich im kiesgepflasterten Hof und war bequem durch die Hintertür zu erreichen. Eine Schlafstatt, bestehend aus Holzrahmen und Pferdehaarmatratze, und eine Holzkiste für meine Habseligkeiten, in die ich meine während der Bettlägerigkeit vom Lazarettpersonal gewaschene Kleidung verstaute, vervollständigten die einfache Einrichtung. Ich hatte es gut angetroffen, denn ich wohnte im Zentrum des Ortes und hatte meine Ruhe.
Viel zu früh wurde es für Secundinus Zeit zu gehen, da der Wagenzug, mit dem er gekommen war, Richtung Coriovallum aufbrach.
Ich begleitete den Freund bis auf die Straße und umarmte ihn herzlich, während mir die Tränen die Wangen herabliefen.
„Viel Glück und der Segen der Götter mit dir, Secundinus. Ich werde dich und was du für mich getan hast, niemals vergessen.“
„Auch dir Glück und Segen“, wünschte der gerührte Freund. „Mach alles so, wie wir es besprochen haben und lass dich nicht hängen. Sollte ich nach Treveris kommen, werde ich nach dir fragen und dich besuchen. Wenn die Götter es wollen, sehen wir uns wieder, Centurio.“
Mit feuchten Augen sah ich dem Freund nach, bis er um die Ecke der zur Hauptstraße führenden Gasse verschwunden war.
Nachdem ich Secundinus verabschiedet hatte, erstand ich im Verkaufsraum meines Vermieters etwas Brot und legte mich dann in meinem Zimmer auf das Bett, um den ereignisreichen Tag an mir vorüberziehen zu lassen. Ich muss augenblicklich in den Kleidern eingenickt sein und den Rest des Tages und die Nacht verschlafen haben, denn als ich erwachte, schienen die Strahlen der Morgensonne durch das Fenster.
Erfrischt wie seit langem nicht mehr, sprang ich tatendurstig von meinem Lager und machte mich nach Frühstück und Toilette auf dem Weg zur Ortspräfektur. Über Ausgehtunika und Bronze beschlagenem Militärgürtel trug ich meinen Mantel, den an der Schulter eine breite Silberfibel schloss, die mir in Tricensima anlässlich meiner Beförderung zum Centurio als Auszeichnung verliehen worden war.
Mit Schwung betrat ich das Vorzimmer des Vicarius, des Orts-kommandanten, und ließ die Türe hinter mir ins Schloss knallen.
Mit einem Satz schoss der wachhabende Legionär von seinem Stuhl hoch und fing mit einer geschickten Handbewegung die Kupfermünze, die ich ihm zugeworfen hatte.
„Noch eine, wenn du mich sofort zu deinem Offizier bringst!“, bestach ich den Mann nach den ungeschriebenen Gesetzen der Militärverwaltung. Der Soldat schaute auf die Münze, salutierte und öffnete die Tür zum Dienstraum seines Vorgesetzten.
Ich trat ein und sah mich einem beleibten Mann gegenüber, der in seinem Lehnstuhl sitzen blieb und mich aus großen Augen anstarrte.
Schweißperlen rannen von der Stirn des fetten Mannes in den Fünfzigern, den eine behaarte Warze neben dem linken Nasenflügel entstellte und dessen Glatze im Licht der durch die milchigen Scheiben dringenden Sonne glänzte. Hastig räumte er ein Tablett zur Seite und bedeckte es mit einem fleckigen Tuch, während der Geruch von Wein und Gebratenem herüber wehte.
Verärgert musterte mich der Vicarius, bis sein Blick an meiner Silberfibel haften blieb, und er mich jovial mit einer herablassenden Bewegung seiner fetten Hand heranwinkte. Seine Augen verengten sich zu Schlitzen, als sie in plötzlichem Verstehen aufleuchteten
„Du scheinst der verwundete Centurio aus Gelduba zu sein, den die Lazarettverwaltung gemeldet hat, und es scheint dir besser zu gehen“, dröhnte sein Wohlwollen heischendes Lachen durch den Raum „Was kann ich für dich tun?“
Mein Selbstvertrauen und der Schwung, mit dem ich den Tag angegangen war, gerieten vor dem selbstherrlichen Verwaltungsoffizier ins Straucheln. Diese Schreibstubenstrategen, die seit Jahren keine Waffe mehr geführt hatten und einen fränkischen Krieger nicht von einem Fuhrknecht unterscheiden konnten, waren mir seit meinem Dienstantritt verhasst.
Mir wurde mit einem Schlag bewusst, dass ich den Mann reden, mir aber nicht das Gespräch aus der Hand nehmen lassen durfte, wenn ich etwas erreichen wollte.
„Das hängt von der militärischen Lage ab“, antwortete ich wohlüberlegt, „und ich habe einiges aufgeschnappt, was kein genaues Bild ergibt.“
„Sagen wir mal, die Lage hat sich auf einem tiefen Stand stabilisiert“, räusperte sich der Vicarius und stocherte mit einem Holzspan in seinen Zähnen herum. „Die Götter sind uns nicht gewogen, aber sie lassen uns auch nicht gänzlich im Stich.“
Wieder dröhnte sein Lachen durch den Raum.
„Die Garnisonen am Rhenus sind überrannt worden, und wer sich wie du nicht ins Hinterland hat durchschlagen können, ist tot oder gefangen. Auf einer Breite von 30 Meilen ist westlich des Grenzstromes alles verwüstet. Und das Schlimmste zuletzt: Vor zwei Monaten ist die Colonia gefallen.“
Er schwieg und genoss es, die Wirkung seiner Worte in meinem Mienenspiel zu beobachten.
„Im Moment“, fuhr er fort und schnippte den Holzspan weg, „ich wiederhole, im Moment scheint ihnen die Kraft ausgegangen zu sein. Trotzdem brechen kleinere Banden immer noch bis an die Mosella und nach Gallien durch, die aber einen befestigten Platz oder einen größeren Ort nicht gefährden können. Da man aber auf den Straßen nicht mehr sicher ist, liegen Verkehr, Handel und Landwirtschaft am Boden, und wenn die Götter kein Wunder geschehen lassen, wird Niedergermanien bald hungern.“
Der Vicarius setzte sich auf und stützte die Ellbogen auf die Tischplatte.
„Es gibt Gerüchte, dass der Imperator Constantius seinen Vetter Julian zum Caesar ernannt hat, der als sein Stellvertreter die Karre aus dem Dreck ziehen soll.“
Langsam sank mein Gegenüber wieder in seinen Lehnstuhl zurück.
„Wie gesagt, ich weiß nichts genaues, weil die Verbindung nach Treveris unterbrochen ist. Ich warte auf Anweisungen und versuche die Lage in Aquis so gut es geht zu bewältigen, wobei meine finanziellen Mittel beschränkt sind und wir von der Hand in den Mund leben. Ich weiß zum Beispiel nicht, wo ich den Sold für die kommenden Monate her nehmen soll. Brauchst du etwa Geld, Centurio?“
Der Vicarius war ein Fuchs. Er hatte das Gespräch unmerklich an sich gezogen und den Grund meines Besuches erahnt. Wie einem Schiff auf hoher See die Flaute, so hatte er mir den Wind aus den Segeln genommen.
Lauernd ruhte sein Blick auf mir, als ich begann, mein Gesuch vorzutragen.
„Ich bin gesund und möchte mich als kampferfahrener Offizier zum Dienst melden.“
Gelangweilt betrachtete der Mann im Lehnstuhl seine Fingerspitzen, und ich begann langsam die Fassung zu verlieren.
„Ich habe seit Monaten keinen Sold bekommen“, hing meine Stimme im Raum, und ich fragte mich, ob ich es war, der die Worte ausgesprochen hatte.
„Aha“, war das einzige, was mein Gegenüber von sich gab, und langsam wanderte sein Blick zu meiner Auszeichnung. „Die Stadt ist voll versprengter Truppen, und wir haben hier keinen Bedarf an Helden, die ich mir schlichtweg nicht leisten kann.“
„Aber“, begehrte ich auf, „du kannst doch einen erfahrenen Offizier nicht wegschicken.“ Mehr bittend als fordernd hatte ich meinen Einwand formuliert und stellte erschreckt fest, dass ich zu Wachs in den Händen des Vicarius geworden war, der mit mir spielte.
„Und wie ich das kann“, fuhr der Mann mich an. „Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Kommst nach Aquis und legst dich erst einmal zwei Monate ins Bett.“
Ich fühlte, wie ich dem Tiefpunkt meiner Selbstachtung entgegensteuerte.
„Und kaum fühlst du dich besser“, fuchtelte mein Gegenüber mit den Händen in der Luft herum, „kommst du zu mir und forderst ein Kommando und den Sold der letzten Monate.“
Der Vicarius blies die Backen auf, bevor er fortfuhr.
„Aquis ist keine Festung wie Juliacum oder Traiectum, sondern eine hübsche Kleinstadt, die Wohlstand und Existenz den Thermen und der damit verbundenen Betreuung und Pflege der niedergermanischen Truppen verdankt. Hier gibt es nichts zu verteidigen, sondern nur zu verwalten, und wenn die Franken in den Talkessel herabsteigen, packe ich meine Sachen und setze mich mit meinen Leuten ab.“
Wie um mich zu besänftigen, breitete er die Arme aus.
„Bleibe und kämpfe, wenn es zum Äußersten kommt und jeder Mann gebraucht wird, oder schlag dich nach Treveris oder weiter nach Westen durch, wo es ruhiger ist und du den Sommer abwarten kannst, bis Julian mit Geld und Legionen kommt und alles besser wird.“
„Und was ist damit?“, knallte ich den Brief des Kommandanten von Gelduba auf den Tisch. Während des Monologes des Vicarius hatte ich einen Teil meiner Selbstachtung in dem Maße zurück gewonnen, wie in mir die Wut auf diesen selbstgefälligen Fettwanst hochgestiegen war.
„Nichts da“, legte ich meine Hand auf das zusammen gefaltete und versiegelte Pergament, das der Vicarius an sich nehmen wollte. „Das ist eine Botschaft an den Magister Equitum per Gallias vom Kommandeur der Festung Gelduba, die ich überbringen muss.“
Mein Gegenüber zuckte zurück und schien unmerklich unter meinem herausfordernden Blick zu schrumpfen, bis er den Augenkontakt abbrach, die Lade des Tisches aufzog und eine Holzkassette heraushob. Behutsam öffnete er den Deckel und zählte mit spitzen Fingern einige Münzen auf die Tischplatte.
„Quittier` mir das als Abschlag auf deinen ausstehenden Sold, denn ich muss dir als Centurio genau diesen Betrag als Reisegeld aushändigen. Das wird dir helfen, hier wegzukommen, wenn du sparsam bist und nicht alles in den Tavernen von Aquis vertrinkst.“
Mit einem Knall und zurückgefundener Überheblichkeit schlug er den Deckel der Kassette zu, schob sie in die Lade zurück und betrachtete aufreizend abschätzend meinen Armreif.
„Eine schöne Arbeit, Centurio“, lobte er meinen Talisman.
Ich sah, wie sich seine kurzen Fettfinger auf der Tischplatte krümmten und unverhohlen die Gier aus seinen Schweinsaugen brach.
„Wenn du nichts mehr hast, komm mit deinem Armreif zurück, für den ich dir ein gutes Angebot machen werde.“
Zum ersten Mal erhob sich der Vicarius, der mir gerade bis zur Schulter reichte, aus seinem Lehnstuhl und reichte mir die Hand, womit ich entlassen war.
„Centurio, ich bekomme noch eine Münze von dir“, verstellte mir der Wachsoldat im Vorzimmer den Weg und verzog enttäuscht das Gesicht, als ich ihn mit einem Kupferfollis abspeiste.
„Was war denn das, Marcus“, sprach ich zu mir, als ich mich, die Münzen des Vicarius in der Hand, auf der Straße wiederfand. „Du hast dich von diesem Kerl wie einen unbequemen Bittsteller abspeisen lassen.“ Ich ballte beide Fäuste und schluckte die aufwallende Wut herunter.
„Eher krieche ich auf allen Vieren nach Hause, als dass dieser fette Kriegsgewinnler meinen Armreif bekommt.“
Auf der Bettstatt meiner Unterkunft teilte ich meine Barschaft und das Geld des Vicarius in kleine Häufchen, eines für die Bleibe, das andere für die täglichen Ausgaben und das letzte für meine sonstigen Bedürfnisse. Ich rechnete hoch, dass meine Mittel für ein halbes Jahr reichen würden, genug, um mich zu erholen und in Ruhe auf eine Gelegenheit zu warten, nach Hause zu kommen, wo ich geachtet und gebraucht wurde.
Am nächsten Tag kehrte der Winter mit Schnee und Kälte zurück, und ich versank wieder in Gleichgültigkeit und Lethargie. Täglich grübelte ich über der Frage, wie es mit der Erfüllung meines Auftrags weitergehen sollte, und wanderten meine Gedanken in die Heimat zu den Ufern der Mosella.
Mehr als drei Jahre waren vergangen, dass ich Eltern und Freunde das letzte Mal gesehen hatte. Meinen letzten Urlaub hatte ich kurz vor der Empörung des Magnentius bewilligt bekommen, und keiner hatte damals an einen drohenden Germanenkrieg geglaubt. Ich genoss die Zeit in der Sonne eines goldenen Spätsommers und fuhr mit meinem Vater die Traubenernte ein, die wir im Keller auf Fässer zogen. Der letzte Brief aus der Heimat hatte mich vor einem Jahr erreicht, in dem meine Mutter mich bat, nach Hause zu kommen, da es meinem Vater nicht gut ging und er seine Angelegenheiten ordnen wollte. Leider konnte ich ihr diesen Wunsch nicht erfüllen, weil Franken und Alemannen den Rheinlimes durchbrochen, die Festung Tricensima zerstört hatten und mit Feuer und Schwert in die Grenzprovinzen eingefallen waren. Es grenzte an ein Wunder, dass der Brief mich überhaupt erreicht hatte.
Ich hatte in Aquis nichts mehr verloren, war wieder gesund und hätte längst die Botschaft des Vicarius überbringen müssen.
So oft ich auch nachfragte, bekam ich doch keine verlässlichen Auskünfte, ob die Treveris und das Land der Mosella vom Krieg verschont worden waren.
Unerträglich wurde es, wenn mir bewusst wurde, dass ich als Offizier untätig meine Tage in einer fremden Stadt verbrachte. In Treveris gab es wenigstens eine Möglichkeit, mich in meinem Beruf nützlich zu machen und die Ankunft des neuen Caesars abzuwarten.
Unzählige Male nahm ich mir abends vor, am nächsten Tag aufzubrechen, der dann einen triftigen Grund lieferte, in Aquis zu bleiben. Zum einen war es das Wetter, das sich verschlechtert hatte, oder es gab Nachrichten über Plünderer, die in der Silva Arduenna ihr Unwesen trieben. Einmal hätte ich es fast geschafft, aber die aus mehreren Bewaffneten bestehende Gruppe verlief sich kurz vor dem Abmarsch.
Mir wurde bewusst, dass mir der Antrieb fehlte, das Risiko der Reise gegen alle Widrigkeiten auf mich zu nehmen, was mich noch tiefer in meine Lethargie hinein stieß. Ich gab mich damit zufrieden, auf eine Eingebung oder ein Ereignis zu warten, das diesem Zustand ein Ende bereiten würde.
Die Abende verbrachte ich, die Mahnung des Vicarius missachtend, bei Wein und Bier in den Tavernen der Stadt. Kein Wirt, der mich nicht beim Eintritt freudig begrüßte und mir unaufgefordert einen gefüllten Becher oder einen Krug auf den Tisch stellte. Meinen Rausch schlief ich dann bis zum Mittag des nächsten Tages aus. Kaum konnte ich es erwarten, mit versprengten Legionären und vertriebenen Provinzialen um einen Tisch zu hocken und die Neuigkeiten und Gerüchte zu besprechen, die täglich von Neuankömmlingen und Flüchtlingen in die Stadt getragen wurden. Wenn der Rausch die Köpfe der Männer vernebelt hatte, kam es oft zum Streit, der mit Fäusten und manchmal auch mit Messern ausgetragen wurde. Den Göttern sei Dank, gelang es mir, mich aus solchen Raufhändeln herauszuhalten, und ich lauschte den Erzählungen vom Untergang der Colonia und den Aufschneidereien der Verteidiger, die sich nach Aquis durchgeschlagen hatten. Wären diese Maulhelden dabei gewesen und hätten sie nur einen Bruchteil ihrer Heldentaten vollbracht, wäre die Stadt niemals erobert worden.
Meist endeten die Abende damit, dass ich versuchte, mit einem Mädchen ins Gespräch zu kommen, um die Nacht nicht alleine zu verbringen. An Gelegenheiten herrschte kein Mangel, denn es war Krieg und die Not hatte die Sitten gelockert. Viele hatten sich in die Sicherheit von Aquis geflüchtet, nachdem ihnen die Franken den Hof über dem Kopf angezündet und ihre Familien in alle Richtungen verstreut hatten. Es waren keine Huren, wie sie in den Tavernen der großen Städte anzutreffen sind, sondern naive, hübsche Dinger mit breiten Bauerngesichtern unter ihren flachsblonden Haarschöpfen und drallen Figuren, deren Rundungen die ausgeschnittenen, engen Kleider betonten. Ohne Mann und Familie waren sie darauf angewiesen, mit den Vorzügen ihrer Weiblichkeit das Leben zu fristen, und darauf zu hoffen, einen redlichen Mann kennen zu lernen, der sie aus ihrem Elend erlösen, oder ihnen wenigstens ein paar sorgenfreie Tage ermöglichen würde.
Mit Flavilla, einer Bauernmagd aus der Nähe von Novaesium, wohnte ich mehrere Wochen zusammen, und ich bedauerte den Tag, als sie einen Legionär kennen lernte, der es ehrlich mit ihr meinte und sie auf seinen Bauernhof bei Atuatuca mitnahm. Ich vermisste ihren üppigen Körper, den aufreizend eine knapp sitzende und weit ausgeschnittene Tunika verhüllte, bis ich Claudia aus Juliacum kennen lernte, die mich über den Verlust hinwegtröstete.
Auf den Frost folgte der Regen, und bald blühten die ersten Blumen, und die Knospen der Bäume brachen auf, bis die Wälder auf den Höhen rings um Aquis im frischen Grün erstrahlten.
Ich hatte begonnen, mich in der Stadt wohl zu fühlen, und genoss das sorgenfreie Leben in vollen Zügen, als mir bewusst wurde, dass meine finanziellen Mittel bald aufgezehrt sein würden. Sofort stellte sich das schlechte Gewissen darüber ein, dass ich meine Abreise so weit aufgeschoben hatte und immer noch hier war.
In einer der folgenden Nächte saß ich in der drangvollen Enge einer Schankwirtschaft, die trotz des geöffneten Fensters von den Ausdünstungen der Gäste, dem Rauch des Herdfeuers und dem Qualm der Öllämpchen vernebelt wurde.
Ich war nicht in Stimmung und beteiligte mich nicht am Ta-vernengeschwätz, sondern drehte verdrossen meinen Tonhum-pen zwischen den Händen, den die Schankmagd schon vier Mal mit frisch angesetztem Bier aufgefüllt hatte. Ich hatte mich in den letzten Wochen an das Getränk der Legionäre und Bauern gewöhnt, weil es billiger als Wein war und damit meine Bar-schaft schonte.
„Ich wünsche dir einen schönen Abend, junger Offizier“, sprach mich eine angenehm weiblich klingende Stimme von der Seite an. „Darf ich mich zu dir setzen?“
Wie selbstverständlich rückte eine Frau einen Schemel an meinen Tisch und setzte sich.