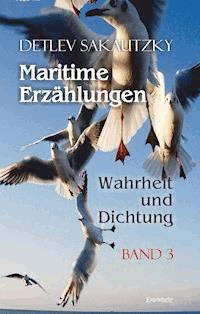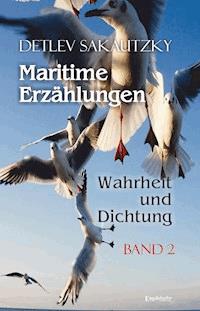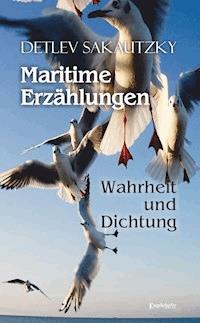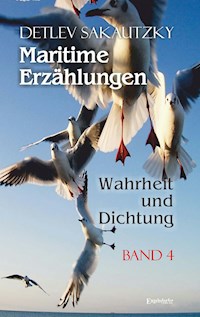
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichten im Buch beruhen auf wahren Begebenheiten. Die Episoden erzählen aus dem Alltagsleben und der schweren, gefahrvollen Arbeit der Hochseefischer. Erzählt wird über eine unerwartete Schwangerschaft, eine Zahnschmerzbehandlung, eine Beförderung, die Frischegradbestimmung von Schwarzem Heilbutt im Fischereihafen, eine traurige Nachricht, der Entscheidung für den Dienst in der Fremdenlegion, einer Monsterwelle während der Heimreise und von einer Übung mit dem Rettungsfloß und Rettungsboot. Außerdem geht es um eine untreue Seemannsfrau, einen Unfall beim Segeln, einen Arbeitsunfall mit tödlicher Folge, einen Sturz aus den Wanten und um einen vergessenen Pudel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Detlev Sakautzky
Maritime
Erzählungen
Wahrheit und Dichtung
Band 4
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2019
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2019) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
ISBN 9783961458080
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
E-Book-Herstellung Zeilenwert Gmbh, Rudolstadt
www.engelsdorfer-verlag.de
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Roswitha bleibt an Land
Notbehandlung an Bord
Sturz aus den Wanten
Der Kapitän hat sich geirrt
Die Finger gebrochen
Untreue
‚Strolch‘ wird Seemann
Vom Landgang nicht zurück
Die ‚Helena‘ hat Halbmast geflaggt
Die Monsterwelle
Wasser im Rettungsboot
Eine traurige Nachricht
Gekentert
Frischegradbestimmung des Schwarzen Heilbutts
Beim Segelmanöver verletzt
ROSWITHA BLEIBT AN LAND
Jahrzehntelang wurde mit Seitentrawlern, Loggern und Kuttern der Fischfang in der Großen Hochseefischerei mit Grund- und Pelagischen Schleppnetzen, Treibnetzen und Ringwaden betrieben. Der Fang und die Bearbeitung der Fische bei Sturm, Kälte und hohem Seegang war für die Decksleute immer eine schwere gefährliche Arbeit und Herausforderung gewesen. Geschlachtet, gekühlt oder gesalzen wurde der Fang angelandet und vermarktet. Durch den Einsatz von Fang- und Verarbeitungsschiffen veränderten sich die Fangmethode und die Bearbeitung des Fanges an Bord. Das Fanggeschirr wurde über die Heckaufschleppe mit Winden an Deck gezogen.
Der volle Steert wird über die Heckaufschleppe an Deck gezogen
Der Fisch wurde direkt aus dem Steert in den Auffangbunker geschüttet und unter Deck von Fischwerkern zu Frostfisch und Fischmehl verarbeitet. Die Decksleute waren in der Regel nur mit der Handhabung des Fanggeschirrs, der Überwachung des Aussetzens und Einholens des Netzes, dem Öffnen des Steertknotens und der Reparatur des Netzes beschäftigt. Die Fischwerker bearbeiteten unter Deck, im Bearbeitungsraum, den gefangenen Fisch. Der im ‚Bunker‘ vorgelagerte Fisch wurde sortiert, gewaschen, geköpft, geschlachtet, filetiert, enthäutet, in Schalen gepackt, gefrostet, glasiert und in Kartons verpackt. Diese wurden verschnürt und in den Stauraum befördert. Nicht alle Fische ließen sich maschinell bearbeiten, einige Fischarten wurden mit der Hand filetiert. Für die manuelle Bearbeitung waren Handfiletiertische eingerichtet worden. Es waren Steharbeitsplätze, an denen mit scharfen Filetiermessern das Filet aus dem Fisch durch die Fischwerker geschnitten wurde. Der Maschinenlärm war hoch und lag im Grenzbereich, sodass Gehörschutzwatte oder Stöpsel getragen werden mussten. Das Krängen, Stampfen und Schlingern des Schiffes, die Feuchtigkeit und Nässe im gesamten Bearbeitungsraum erschwerten die Arbeit und verursachten den Eintritt von Arbeitsunfällen. Die Fischwerker rutschten häufig bei großen Schiffsbewegungen auf den Lichtgitterrosten der Verkehrswege aus und erlitten dabei Verstauchungen, Fußbrüche und Prellungen. Die lange Arbeitszeit und die sich wiederholenden Tätigkeiten minderten die Konzentrationsfähigkeit der Fischwerker bei der Bearbeitung der Fische. Nicht selten erlitten sie Schnittverletzungen an den Fingern und in den Handflächen.
Mit der Indienststellung von Fang- und Verarbeitungsschiffen bewarben sich zunehmend Frauen, einige davon waren gelernte Fischwerkerinnen, für die Bearbeitung der Fische an Bord.
Zu Beginn hatten die Männer Vorurteile gegenüber die fleißig arbeitenden Frauen. Sie zweifelten an ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten. Nach geraumer Zeit mussten auch sie sich eingestehen, dass die Tätigkeit der Frauen in der Fischbearbeitung an Bord möglich war und sie eine gleich gute Arbeit wie die männlichen Kollegen leisteten.
Das Vorhandensein von Weiblichkeit hatte Einfluss auf den traditionellen Männerberuf. Es gab Annäherungsversuche mit mehr oder weniger Erfolg. Einige verliebten sich und gründeten den Bund fürs Leben. Durch die Anwesenheit von Frauen änderte sich der soziale und kulturelle Umgang in der sonst ruppigen Männerwelt an Bord eines Fabrikschiffes. Es wurde in zwei Schichten gearbeitet. Nach einer zwölfstündigen Arbeitszeit wurde gewechselt. Den Bearbeitungsprozess und die Qualität des bearbeiteten Fisches überwachten und organisierten hierfür qualifizierte und berufserfahrene Meister. Die Reparatur der Maschinen erfolgte durch befähigte für diese Tätigkeit spezialisierte Schlosser.
*
Peter Apel hatte den Beruf eines Fischwerkers gelernt. Seit der Indienststellung der ‚Marie Luise‘ fuhr er auf diesem Schiff. Apel hatte schon an allen wichtigen Arbeitsplätzen Fische bearbeitet und war in der Lage, alle Maschinen zu bedienen und zu warten. Gegenwärtig fing das Schiff auf den Fangplätzen vor Westgrönland große Mengen Kabeljau. Es wurde überwiegend Filet produziert. Vor dem Einlegen des Kabeljaus in die Filetiermaschine wurde dieser maschinell geköpft.
Die Filetiermaschinen trennten durch eine spezielle Schnittführung das Fleisch der Fische von den Rücken- und Bauchgräten.
Der Schnittverlauf und die Schnitttiefe wurden beim Durchlauf der Fische in den Filettiermaschinen selbsttätig gesteuert. Große Fische wurden mit der Hand filetiert. Die Filets wurden den Enthäutungsmaschinen zugeführt. Die enthäuteten Filets wurden durch die Fischwerker oder Fischwerkerinnen mit der Hand in Gefrierschalen gepackt.
Filets werden in die Gefrierschalen gepackt.
Manuela war eine von den vier Frauen auf diesem Schiff, die in der Fischbearbeitung tätig waren. Sie war mit dem Schiffselektriker, Lothar Martens, verheiratet. Beide bewohnten eine ‚Zwei-Mann-Kammer‘. Gemeinsam mit Roswitha Lange packte sie die enthäuteten Fischfilets in Gefrierschalen. Peter Apel beschickte diese in den Gefriertunnel zum frosten.
Dieser bestand aus Gefrierstraßen mit übereinander liegenden Gleitbahnen. In den Gefrierstraßen befanden sich Rohrsysteme, in denen Ammoniak verdampfte und die Luft abkühlte. Die Beschickungs- und Entnahmeseiten waren während des Frostprozesses mit isolierten Türen verschlossen.
Ein Durchlauf dauerte drei Stunden bei minus zwanzig Grad Celsius. Peter Apel zog nach der technologisch festgelegten Zeit die gefrosteten Schalen aus dem Gefriertunnel und legte sie auf ein Förderband.
Der Gefriertunnel wird beschickt
Dieses transportierte die Gefrierschale zu einem mit Wasser gefüllten Glasierbecken. Dort wurden sie durch Fred Sober, einen großen kräftigen Fischwerker, ins Wasser getaucht. Der gefrostete Fisch löste sich aus den Schalen und glasierte. Er wurde danach durch Sober auf eine Rutsche gelegt und über eine Rollbahn zum Packtisch befördert. Hier verpackte und wog Klaus Mach, auch ein gelernter Fischwerker, das glasierte Kabeljaufilet.
Glasiertes Kabeljaufilet wird verpackt
Über ein System von Rutschen gelangten die Frostpakete in den Tiefkühlladeraum. Dort wurden diese durch Hans Sommer in Schichten gestaut.
Gefrostete Pakete werden gestaut
*
Nach der Indienststellung der ‚Marie Luise‘ wurde die Frostkapazität weiter erhöht und ein Horizontal-Plattenfroster im Bearbeitungsraum zusätzlich installiert. Bei diesem Gefriergerät wurden Metallplatten durch Ammoniakverdampfung gekühlt. Die gefüllten Gefrierschalen schob der Beschicker zwischen die Metallplatten. Diese wurden danach hydraulisch zusammengefahren, die Türen verschlossen und der Gefriergang eingeleitet. Nach der vorgesehenen Gefrierzeit wurden die Türen auf der Entnahmeseite geöffnet und die Metallplatten hydraulisch auseinandergefahren. Das Gefriergut wurde entnommen, glasiert, verpackt und im Frostraum gestaut.
*
Der Laderaum der ‚Marie Luise‘ füllte sich täglich mit verpacktem Kabeljaufilet von hoher Qualität. Das Ende der Reise war abzusehen. Eine Übergabe der Frostware an ein Kühlschiff war nicht vorgesehen. Der verantwortliche Meister, Rudi Weste, hatte heute nach Schichtende die gesetzlich monatlich vorgeschriebene Arbeits- und Brandschutzbelehrung geplant. Die Fischwerker und Fischwerkerinnen hatten sich alle in der Mannschaftsmesse versammelt.
„Thema der heutigen Belehrung ist das richtige Verhalten bei einem Ammoniakausbruch. Ihr alle wisst, Ammoniak wird bei unseren Gefriergeräten als Kältemittel verwendet“, so begann der Meister seine Belehrung und schaute konzentriert auf sein vorbereitetes Konzept.
„Manuela“, im Bereich der Bearbeitung sprachen sich alle mit dem Vornamen an, „welche Gefahr geht im Havariefall vom Ammoniak aus?“, fragte der Meister im kollegialen Ton die Fischwerkerin.
„Ammoniak ist giftig und hat einen stechenden, zu Tränen reizenden Geruch“, war ihre Antwort.
„Wer kann die Aussage von Manuela noch ergänzen und bestätigen?“, fragte der Meister.
Die Frage war an alle gerichtet. Peter Apel kannte das Kältemittel am besten. Er beschickte während jeder Fangreise den Frosttunnel und den Plattenfroster mit gepackten Gefrierschalen. Es muffelte immer etwas nach Ammoniak.
„Der Geruch ist schon beim Austritt kleinerer Mengen wahrnehmbar. In flüssiger, in konzentrierter wässriger Lösung und gasförmiger Form wirkt es in höherer Konzentration auf der Haut, den Schleimhäuten und Augen stark ätzend. In flüssiger Form kann Ammoniak bei Hautkontakt zu Erfrierungen führen. Das austretende Ammoniak wird wie ‚Nebel‘ beim Kontakt mit der Luftfeuchtigkeit sichtbar. Dieser sammelt sich in Bodennähe“, sagte Peter Apel, der praktische Erfahrungen beim Austritt von Ammoniak gemacht hatte.
Rudi Weste berichtete über eine Havarie auf einem Fabrikschiff, wo der Ammoniakausbruch zu tödlichen Unfällen geführt hatte.
„Jeder hat seine Atemschutzmaske mit Ammoniakfilter im Bearbeitungsraum bei sich zu tragen und am Arbeitsplatz in der dazugehörigen Tragetasche in Griffweite aufzubewahren. Alle Bartträger müssen sich im Halsbereich rasieren, damit die Maske wirksam abdichtet“, belehrte der Meister die anwesenden Fischwerker.
Atemschutzmaske mit Bänderung und Filter
Er erklärte den richtigen Sitz der Maske und demonstrierte das richtige Anlegen. Rudi Weste forderte Petra auf, die von ihm gereichte Maske vorschriftsmäßig anzulegen. Sie legte schnell und richtig die Maske an. Ihren ‚Pferdeschwanz‘ versteckte sie gekonnt unter der Bänderung.
„Petra, was hast du für schöne große Augen?“, spaßte Timo, der in ihrer Nähe stand.
„Damit ich dich auch nachts besser sehen kann“, antwortete sie zur Freude der Fischwerker.
„Das hast du gut gemacht“, lobte sie Rudi Weste. „Was ist beim Anpassen der Atemschutzmaske zu beachten?“, fragte der Meister Roswitha Lange. Sie wusste es nicht. „Es sind die Kinnstütze und die Kopfbänder einzustellen. Die Maske muss voll an der Gesichtspartie abdichten“, erklärte der Meister und zeigte auf die Maskenteile.
Er beauftragte Roswitha ihre Maske einzustellen und anzulegen. Rudi Weste war mit der Demonstration zufrieden.
„Artur, in der letzten Schicht hattest du deine Maske auf der Toilette vergessen. Im Havariefall wäre es zur Verätzung deiner Atemwege gekommen. Denk an die Folgen“, mahnte der Meister. „Was ist beim Ausbruch von Ammoniak unbedingt durch jeden im Bearbeitungsraum Tätigen zu tun?“, wandte er sich jetzt an Roswitha, die in der letzten Schicht am Handtisch Kabeljau filetiert hatte.
„Es ist Alarm auszulösen, die Maske anzulegen, der Verarbeitungsraum über die Fluchtwege zu verlassen und der Stellplatz an Deck aufzusuchen“, antwortete Roswitha, wie aus der Pistole geschossen.
„Welche Aufgabe erfüllt der ‚Wasservorhang‘ am Plattenfroster beim Ammoniakausbruch?“, fragte der Meister weiter und schaute zu Peter Apel.
„Bei der Betätigung des Alarmknopfes wird der ‚Wasservorhang‘ funktionstüchtig. Das austretende Ammoniak wird durch das gesprühte Wasser gebunden und außenbords gespült“, antwortete Apel.
Rudi Weste hatte sein Belehrungskonzept abgearbeitet. Jeder Fischwerker bestätigte die Belehrung mit seiner Unterschrift. Einige der Fischwerker blieben nach der Belehrung noch in der Mannschaftsmesse, um Skat zu spielen, andere gingen in ihre Kammer, um zu schlafen oder zu lesen.
Manuela wartete auf ihren Mann. Beide hatten sich mit Steffen und Kerstin verabredet. Steffen hatte heute Geburtstag und der Koch hatte für ihn einen Rührkuchen gebacken. Die kleine Geburtstagsfeier war für sie eine schöne Abwechslung im alltäglichen und straff organisierten Bordleben.
*
In den letzten drei Tagen waren wieder große Mengen Kabeljau gefangen worden.
„Der Laderaum ist bald voll, dann geht es nach Hause“, sagte Kapitän Andreis zufrieden zum Schichtmeister. „Den Rest der Kartonage geben wir an die ‚Eva Maria‘ ab. Dort wird das Verpackungsmaterial noch gebraucht. Lass es heute noch an Deck bringen. Es wird mit dem Schlauboot abgeholt“, war die Order des Kapitäns.
*
Kurz vor Schichtende kam es bei der Entnahme der vollen gefrosteten Gefrierschalen aus dem Plattenfroster unerwartet zum Ausbruch von Ammoniak. Peter Apel drückte sofort den Alarmknopf, legte schnell die Maske an und rannte aus dem Bearbeitungsraum in Richtung Stellplatz. Mit der Auslösung des Alarms wurde der ‚Wasservorhang‘ in Betrieb gesetzt. Aus einer an der Decke angebrachten, mit Düsen versehenen Wasserleitung sprühte Wasser und absorbierte das Ammoniakgas. Alle Fischwerker im Raum verließen eilig über die Fluchtwege den Bearbeitungsraum. Roswitha Lange war die Letzte. Sie rutschte auf dem Lichtgitterrost vor der Enthäutungsmaschine aus, fiel hin und spürte fürchterliche Schmerzen im rechten Fußgelenk. Sie konnte alleine nur unter Schmerzen aufstehen und nicht mehr weitergehen. Roswitha hielt sich an der Enthäutungsmaschine fest und wartete auf die Hilfe ihrer Kollegen. Im Bereich der Lichtgitterroste bildete sich Ammoniaknebel, der sich langsam im gesamten Raum ausbreitete. „Die Maske ist dicht. Ein Glück, die Bänderung ist gut eingestellt. Dem Meister sei Dank“, dachte Roswitha. Sie spürte bei der Belastung des rechten Fußes und der Krängung des Schiffes große Schmerzen.
„Hoffentlich holt man mich nach oben“, sprach sie ängstlich zu sich selbst. Die Angst umzukommen, war größer als die zunehmenden Schmerzen.
Bei der Überprüfung der Anwesenheit auf dem Stellplatz an Deck wurde ihr Fehlen festgestellt. Der Aufklärungstrupp, ausgerüstet mit Pressluftatmern, wurde beauftragt, nach ihr zu suchen. Der Truppführer, Bernd Boll, sah Roswitha an der Enthäutungsmaschine gebückt, sich an der Maschine festhaltend, stehen. Schnell bewegte sich der Trupp zur Unfallstelle. Roswitha legte ihre Arme um die Schultern der Retter. Diese trugen sie über den Niedergang hoch zum Stellplatz an Deck. Der Schiffsarzt leistete sofort die Erste Hilfe.
„Frau Lange hat sich den linken Fuß verstaucht“, sagte Doktor Mirde, der Schiffsarzt, dem Einsatzleiter, nachdem er Roswitha am schmerzenden Fuß untersucht hatte. „Bringt sie in die Krankenkammer. Ich werde sie dort weiter behandeln“, wandte er sich an den Truppführer, der Roswitha mit schmerzverzerrtem Gesicht in den Krankenraum trug und auf das bereitstehende Krankenbett legte.
Doktor Mirde zog ihr die kontaminierte Kleidung aus und spülte die mit Ammoniak benetzten Körperstellen mit Wasser ab. Der schmerzende Fuß wurde hoch gelagert und gekühlt.
„Sie bleiben noch zwei Tage zur weiteren Behandlung im Krankenraum“, sagte der Arzt und eilte zurück zum Stellplatz.
*
Durch die Kältemaschinisten wurde die Kältemittelzufuhr unterbrochen und das Ammoniak im System abgesaugt
Der Kältemaschinist suchte nach der Schadstelle im Plattenfroster. Eine flexible Verbindung war brüchig geworden und Ursache des Ammoniakausbruches. Sie wurde ausgewechselt. Danach füllte der Kältemaschinist das System wieder mit Ammoniak auf. Die Druckprobe ergab keine Mängel. Der Bearbeitungsraum wurde be- und entlüftet. Die Bearbeitung des gefangenen Fisches wurde fortgesetzt
Der Auffangbunker war gefüllt mit frisch gefangenem Kabeljau. An Deck befand sich ein weiterer noch nicht geleerter voller Steert. Die Decksleute und die Männer aus dem Maschinenraum unterstützten jetzt die Fischwerker im Bearbeitungsraum. Der Fang musste so schnell wie möglich bearbeitet werden.
*
Am Sonntagabend wurde die Fangtätigkeit eingestellt. Die Laderäume waren bis unter den Lukenrand voll gestaut mit bearbeiteten Kabeljau und Fischmehlsäcken. Nach fünfundvierzig Fangtagen trat die ‚Marie Luise‘ die Heimreise an. Die Decksleute waren jetzt im Wach- und Decksdienst tätig. Die Fischwerker reinigten und warteten den Maschinenpark im Bearbeitungsraum im Tagesdienst.
‚Marie Luise‘ auf der Heimreise
*
Der Arzt hatte Roswitha einen elastischen Verband um den Fuß gelegt. Sie durfte die Krankenkammer verlassen und war froh, dass sie keine Verletzungen durch das Ammoniak erlitten hatte. Im Moment hatte sie andere Sorgen. Ihre Regel war ausgeblieben. In den letzten Tagen hatte sie keinen Appetit mehr, ab und zu war ihr übel, manchmal musste sie erbrechen. Sie sprach mit dem Schiffsarzt über ihre Beschwerden.
„Es sind die Symptome einer normalen Schwangerschaft“, sagte der Schiffsarzt ohne Umschweife. „In sechs Tagen sind wir wieder im Fischereihafen. Ich gebe Ihnen eine Überweisung für den Frauenarzt. Bis dahin werden Sie von der Arbeit befreit“, sagte der Arzt und gab ihr Tabletten gegen die Übelkeit. „Sollte sich die Schwangerschaft bestätigen, sind Sie auch nach der Gesundung ihrer Fußverletzung seeuntauglich und müssen an Land bleiben“, erklärte er noch.
Roswitha humpelte, sich festhaltend an den Handläufern der Betriebsgänge, in ihre Wohnkammer. Sie teilte sich mit Petra während dieser Reise die Kammer. Beide verstanden sich gut. Da sie in der gleichen Schicht arbeiteten, ergänzten und unterstützten sie sich bei der Erfüllung von persönlichen Alltagsaufgaben.
Roswitha hatte sich am letzten Tag ihrer Freizeit in Rostock bei ihren Eltern mit Felix Sand verlobt. Beide hatten sich während der Berufsausbildung kennengelernt. Er hatte auch den Beruf des Fischwerkers erlernt und arbeitete auf einem anderen Fabrikschiff. Beide wollten noch in diesem Jahr heiraten und gemeinsam auf einem Fang- und Verarbeitungsschiff zur See fahren. „Sollte ich schwanger sein, muss ich an Land bleiben. Schwangere Frauen erhalten keine ‚Seetauglichkeit‘ mehr“, dachte Roswitha.
Sie musste sich bald entscheiden. Mit Felix konnte sie ihre Sorgen nicht teilen. Sein Schiff fischte vor Labrador. Sie schickte Felix ein Brieftelegramm und teilte ihm ihre mögliche Schwangerschaft mit.
„Ein Schwangerschaftsabbruch ist noch möglich“, sagte Petra, der sie ihr Geheimnis anvertraut hatte.
„Sollte ich schwanger sein, behalte ich das Kind. Gemeinsam werden wir einen Weg finden. Das habe ich auch Felix im Brieftelegramm mitgeteilt“, antwortete Roswitha und war sich ihrer Entscheidung bewusst.
„Eine Schwangerschaft ändert auf jeden Fall deine jetzige Lebensplanung. Du hattest dir ja viel vorgenommen“, sagte Petra zögernd. „Eine Wohnung habt ihr auch nicht“, ergänzte sie ihre Gedanken.