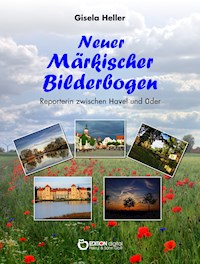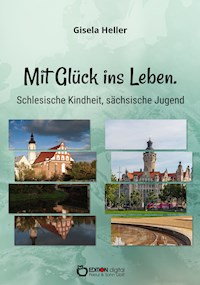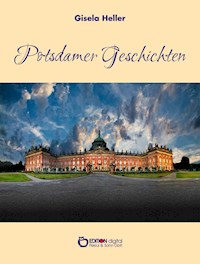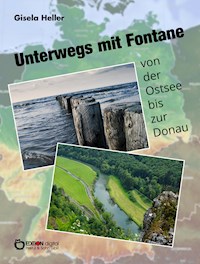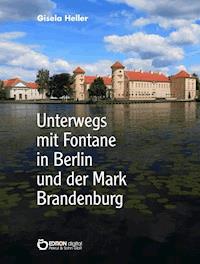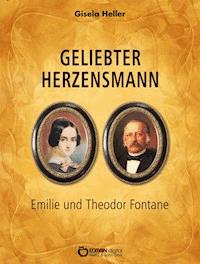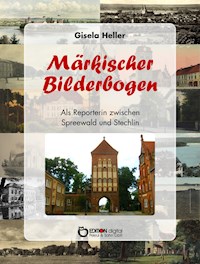
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Durch diese Gegenden ist einst Fontane gewandert, um Land und Leute zwischen Oder und Elbe, Spreewald und Stechlin zu beschreiben, und es hat schon seinen besonderen Reiz, heute, hundert Jahre später, seinen Spuren nachzugehen. Gisela Heller hat sich in den märkischen Städten und Dörfern umgesehen und vieles entdeckt, was dem Auge des zufälligen Besuchers meist verborgen bleibt. In dreißig Reportagen berichtet sie von den Stätten, wo Bettina von Arnim, Fontane, Einstein, Brecht gelebt haben, von Begegnungen mit interessanten Menschen aus unseren Tagen, Wissenschaftlern und Künstlern, Arbeitern, Handwerkern und LPG-Mitgliedern, von den Käuzen, auf die man überall trifft. Wir hören Historien aus oft sagenumwobener Vergangenheit und lesen erschüttert die nüchternen Tatsachen aus der jüngeren Geschichte, vom Kampf um die Seelower Höhen, von der Kesselschlacht bei Halbe. Vor dem Hintergrund geschichtlicher Traditionen entsteht so ein lebendiger Eindruck von den großen gesellschaftlichen Veränderungen, die sich vor allem in den letzten dreißig Jahren in diesen wirtschaftlich früher meist vernachlässigten Gebieten der heutigen Bezirke Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) vollzogen haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Buckow – Märkische Schweiz
Bernau
Eden
Schorfheidestadt Joachimsthal
Lychen
Stechlin
Rheinsberg
Putlitz
Kyritz
Neuruppin
Fehrbellin
Wustrau
Paulinenaue
Premnitz
Niemegk
Lehnin
Wilhelmshorst
Beelitz
Trebbin
Wiepersdorf
Ludwigsfelde
Teltow
Mittenwalde
Wildau
Märkisch Buchholz und Halbe
Spreewald
Luckau
Oderbruch
Frankfurt (Oder)
Gisela Heller
E-Books von Gisela Heller
Impressum
Gisela Heller
Märkischer Bilderbogen
Als Reporterin zwischen Spreewald und Stechlin
ISBN 978-3-95655-824-5 (E–Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals1976 im Verlag der Nation, Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2019 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E–Mail: verlag@edition–digital.de
Internet: http://www.edition–digital.de
Buckow – Märkische Schweiz
An den wald- und schilfreichen Ufern des Schermützelsees scheinen die sonst recht zurückhaltenden märkischen Musen ihre Küsse freigebiger zu verschenken als anderswo. Adelbert von Chamisso schrieb hier in einem mückenreichen Sommer die wunderbare Geschichte des Peter Schlemihl, Eichendorff fand hier schöne, volksliedhafte Verse. Und wer heute durch die Silberkehle wandert, deren heller Quarzsand im Sonnenschein glänzt, wer zwischen hoch aufragenden oder vom Alter gefällten Buchen zum Dachsberg hinaufklettert und zum verträumten Kleinen Tornowsee hinabschaut, dem kommen von selbst die Eichendorffschen Strophen wieder in den Sinn, die er – lang, lang ist’s her – einmal auswendig lernen musste. Man möchte an diesem Ort wenigstens zwei kurze Sommerwochen lang leben wie der romantische Taugenichts. Fontane sah diesen Landstrich bei aller Schwärmerei wesentlich realistischer. „Allen Respekt vor der Gegend Buckows, aber Vorsorge gegen die Stadt. Seine Häuser kleben wie Nester an Abhängen und Hügelkanten, und sein Straßenpflaster, um das Schlimmste vorwegzunehmen, ist lebensgefährlich. Es weckt in seiner hals- und wagenbrecherischen Passage die Vorstellung, als wohnten nur Schmiede und Chirurgen in der Stadt, die schließlich auch leben wollen.“
Jeder Buckower kennt Fontanes Worte und bestätigt sie mit stillem Seufzen, denn das Pflaster ist bis auf den heutigen Tag über weite Strecken unverändert geblieben. Solider Granit, in der Eiszeit von Skandinavien aus peu à peu hierhergeschoben, in kleineren und größeren Stücken überall verstreut, schließlich von Menschenhand behauen und zum Straßenpflaster zusammengefügt; lauter kleine Buckel, manche rosa von Feldspat, andere mehr weiß von Quarz. Das ist hübsch anzusehen, wenn man nur einen Propeller am Gürtel hätte, um zehn Zentimeter über dem Erdboden darüber hinwegzuschweben … Seit Jahrhunderten bemühten sich die Buckower um bessere Straßen. Erst Walter Kruber, der fünfzehnte – oder war’s der siebzehnte? – Bürgermeister, der nach 1945 die Geschicke des Ortes lenkte, brachte genügend Hartnäckigkeit und Humor mit, um bei den zuständigen Stellen Mittel für zwei neue Straßen herauszuschlagen. Zwei Straßen, das hört sich nicht gerade großartig an, doch viel mehr als die Hauptstraße und die Bertolt-Brecht-Straße hat Buckow auch heute nicht aufzuweisen.
Die Eiszeit hat hier, mitten im flachen Lande am Rand des Oderbruchs, ein paar Mini-Alpen aufgetürmt. Durch diese Gebirge schlängeln sich nun die Straßen buckelauf, buckelab und um Buckel herum. Die Gehsteige sind nur schrittbreit, die Häuser, so scheint’s jedenfalls, klettern die Buckel hinauf oder hinunter zu einem der sieben Seen, überall schimmert’s uns grünlich oder bläulich entgegen. Ein Fremder fragt sich dabei verwirrt, ob dies nun der Schermützel-, der Buckow-, der Große oder der Kleine Tornowsee, der Griepen-, der Weiße oder der Abendrothsee sei. Viele alte Leute sitzen auf der Bank vor ihrem Haus und lassen die Scharen von Urlaubern am Gartenzaun vorbeiflanieren. Die Häuser präsentieren sich in Weiß, Grün, Hellgrau, eines mit Stufen und Vorlaube, eines zu ebener Erde, eines mit Türmchen, ein andres mit Dachgarten, winzige Fachwerkhütten darunter, von wildem Wein überwuchert, und hoch aufragende Bergschlösschen.
Zweitausend Einwohner und eintausend Urlauber. Letztere erkennt man auf den ersten Blick an der geruhsameren Gangart. Kaum glaublich, wie schnell sich so viel Fremde verlaufen. Am Springbrunnen im weitläufigen Stadtpark trifft man nur noch schlendernde Grüppchen, auf dem Poetensteig oder in der „Hölle“ begegnet man kaum einer Menschenseele. Alles ballt sich in den beliebten Ausflugsgaststätten auf der Bollersdorfer Höhe, am Buchenfried oder in der Fischerkehle zusammen. Dort behaupten die Urlauber die eroberten Gartenstühle und ziehen die Stirne kraus, wenn der viel beschäftigte Ober nicht unverzüglich angeflitzt kommt. Sechs schwere Platten mit duftendem Wildragout balanciert er auf einmal. Wenn ihm die Promenadenmischung vom Nachbartisch zwischen die flinken Beine geriete, gäbe es eine Katastrophe. Doch es scheint ein geheimes .Ausweichsystem zwischen beiden zu bestehen. Nie kreuzen sich ihre Wege.
Es soll wohl vorkommen, dass jemand zwei Urlaubswochen in Buckow verbringt und am Ende nicht mehr kennt als die Öffnungs- und Schließzeiten der Lokale und deren Speisekarten. Dabei kann man sich für eine Mark die ganze Märkische Schweiz im Brockhaus-Wanderheft kaufen bei Frau Sirch im einzigen Buchladen der kleinen Stadt. Oder man heftet sich nach Ladenschluss an ihre Fersen, wenn sie, mit einem Dia-Kasten unterm Arm, eines der vielen großen Erholungsheime ansteuert. Dort lässt sie in bunten Bildern die Buckower Geschichte im Zeitraffertempo abrollen.
Am Hopfen hing, zum Hopfen drängte alles. Er gedieh hier vor Jahrhunderten so gut wie nirgendwo in diesen Breitengraden. Die Buckower Urväter exportierten erhebliche Mengen, behielten aber auch ein gewaltig Maß für den eigenen Durst zurück. Allerdings ohne Braupfanne kein Bier. Die Braupfanne gehörte der Kirche. Von Ernte zu Ernte steigerte sie die Leihgebühr. Als sie im Jahre 1669 bei sechs Silbergroschen angelangt war, kam es zum Krawall. Denn es blieb ja nicht bei den sechs Silbergroschen: Wer Hopfen verkaufen wollte, musste ihn – gegen Entgelt natürlich – auf einem geeichten Hopfenscheffel wiegen lassen. Der Scheffel gehörte der Kirche. Und für jeden gemessenen Wispel Hopfen waren laut Visitationsregister wiederum sechs Silbergroschen zu entrichten. Den vierten Teil bekam der Kirchenvorsteher für die Mühe, den Scheffel aufzubewahren. Er war gnädig und nahm auch flüssige Währung entgegen.
Die Hopfenzeit galt als das goldene Zeitalter Buckows und währte bis zum Siebenjährigen Krieg. Dann brach der Mehltau, dieser gefürchtete gräuliche Imperator, herein, gleichzeitig stieg die königliche Akzise so hoch, dass sich die Buckower sagten: Wozu sollen wir den Hopfen vorm Mehltau retten, wenn wir ihn hernach doch in die bodenlose königliche Schatulle werfen müssen? Seitdem verschwand der Hopfen aus der Buckower Gegend und mit ihm der bescheidene Wohlstand der Stadt.
Als man auch die kärglichen Braunkohlenflöze abgebaut hatte, war nichts mehr geblieben als gute Luft und sieben Seen. Manche Leute hielten sich über Wasser, indem sie Blutegel sammelten zu medizinischen Zwecken, andere trockneten Heilkräuter, aber reich wurde davon nicht einmal der Apotheker Hoffacker. Weil weder eine Eisenbahn noch eine genügend befestigte Landstraße an Buckow vorbeiführte, musste der Herr Apotheker abwechselnd mit seinem Faktotum, Ramms Karl, die gesammelten Kräuter auf dem Schiebekarren nach Berlin transportieren, meilenweit durch märkischen Sand.
Selbst die Post kam nur bis Müncheberg. Erst als der Schöpfer der einheitlichen deutschen Post und Erfinder der Postkarte, Generalpostmeister Stephan, als Jagdgast in Buckow weilte und seine Spürnase ihm sagte, dass aus diesem paradiesischen Winkel etwas zu machen sei, wurde in Buckow ein Postamt etabliert. Das ist hundert Jahre her und war der erste Schritt zum Anschluss an die große Welt. Den zweiten tat der damals als Balladendichter bekannte Theodor Fontane. Er schilderte seinen Lesern die Schönheiten der Natur, schrieb über die Buckower, die sich seit Generationen abstrampelten und dennoch arm blieben wie die Kirchenmäuse, und war sich wohl bewusst, dass er damit keinen der satten „Kreuz-Zeitung“-Leser würde hinter dem Ofen hervorlocken. Um aber auch die wohlhabenden Bürger für diese Gegend zu interessieren, griff er zu einer List und schilderte die Silberkehle, den Poetensteig und die umliegenden Wälder als „das Werk einer großartigen, exzentrischen, aber unerhört praktischen Frau“, er schrieb die Geschichte der Frau von Friedland, die stundenlang im Galopp über Dämme und Gräben setzte, immer ein halb Dutzend Verwalter und Schreiber neben sich. „Sie hatte nicht nur Organisationstalent, sondern auch die Gabe, Leute aus dem Bauernstande zu tüchtigen Verwaltern, Förstern und Jägern heranzubilden. Man kann diese Frau schwerlich überschätzen.“ Frau von Friedland galt als eine Sensation, und die animierten Leser kamen in Droschken und Equipagen, um das Werk dieser „großartigen, exzentrischen“ Frau zu sehen, verliebten sich in die reizvolle Landschaft und kehrten mit Verwandten und Bekannten wieder. Fontane hatte erreicht, was er erreichen wollte: Berlin hatte Buckow entdeckt.
Inzwischen ist viel Wasser den Stobber hinabgeflossen. Das ist ein merkwürdiger Bach, er teilt sich im Roten Luch und fließt einmal der Oder zu und damit in die Ostsee, der andere Arm aber wendet sich nach Südwesten und schickt seine Wasser über Löcknitz, Spree, Havel und Elbe zur Nordsee.
Meilenweit hat sich das vierzig Quadratkilometer große Landschaftsschutzgebiet des Buckower Buckelgebirges, dieses Herzstück der Märkischen Schweiz, seine Ursprünglichkeit bewahrt, ungeachtet der Tatsache, dass nun die Chaisen der erholungsuchenden Berliner mit fünfzig oder fünfundsiebzig PS durch die Gegend preschen. Seitab bleibt noch genügend Raum für ungestörte Idylle.
Als Buckow zu einem der vier großen Erholungsgebiete für Berlin erklärt wurde, ging ein warmer Regen von anderthalb Millionen Mark auf die kleine Stadt nieder. Noch nie war die Stadtverwaltung so reich gewesen. Nun hieß es, das Geld klug zu nutzen. Der Rat beschloss, es nicht zu verkleckern, sondern die Häuser an der Hauptstraße von Grund auf so zu erneuern, dass sie noch in den Buckower Rahmen passten, aber den Bewohnern allen Komfort boten, den man heute erwarten kann. Die Gewerke sollten Hand in Hand arbeiten, um in vier Monaten die Verjüngungskur beendet zu haben.
Sprangen die Betroffenen, die nun endlich aus ihren verwohnten Stuben herauskamen, vor Freude an die niedrige Decke? Dankten sie dem Organisator, dass sie nicht mehr bei Wind und Wetter übern Hof zu dem Herzhäuschen pilgern mussten? O bewahre! Sie verschanzten sich hinter Vertiko und Goldfischglas und wollten nicht raus. Den Stadtvätern verschlug’s die Sprache. Schließlich krempelten sie die Ärmel hoch, packten Vertiko und Goldfischglas zusammen und transportierten alles – kostenlos – in die Turnhalle. Die Bewohner krochen derweil bei Verwandten und Bekannten unter. Als sie nach drei oder vier Monaten zurückkehrten, erkannten sie die muffigen Löcher von einst nicht wieder und strahlten, als hätten sie das Große Los gezogen. Die Nachbarn aus den winkligen Seitengassen beneideten sie nach Kräften.
Wer Buckow vor zehn Jahren das letzte Mal sah, wird es kaum wiedererkennen. Es ist im Begriff, seinem Wappen alle Ehre zu erweisen, das eine grün umrankte Rose mit goldenen Butzen zeigt.
In jedem Sommer wird nun drei Tage lang das Fest der Rosen gefeiert. Das ist Gerhard Brunnerts heißeste Jahreszeit, denn da muss er hundert Fäden in der Hand haben: berühmte Künstler, die er aus der Ferne herbeiholt, und weniger berühmte, die er in der Nähe entdeckte und um sein Kulturhaus geschart hat, die Singegruppe der Schüler und Lehrlinge und die Mandolinengruppe, von dem wackeren Wilhelm Körnchen geleitet, die Philatelisten, die Ornithologen, die Chorsänger und die Heimatfreunde, die Künstler in Tusche, Leder und Emaille und die jungen Schachspieler, die Tiede-Jünger, Schrecken aller Wettkämpfe im Bezirk Frankfurt, man sagt, sie hätten den ersten Platz abonniert.
Zu den Rosentagen werden vor allem lautstarke auswärtige Orchester eingeladen, damit die bequemen Buckower, die den Weg zur Freilichtbühne scheuen, aus Fenstern lehnend und auf Dachfirsten hockend, auch noch etwas abbekommen. Für den „Hausgebrauch“ hat Gerhard Brunnert eigene Gruppen zusammengestellt. Etwa die vier jungen Leute, die sich schon aus ihrer Lehrzeit im Halbleiterwerk Frankfurt her kannten und über Studium und Dienstzeit bei der NVA hinaus zusammenhielten. An den Wochenenden trafen sie sich im Buckower Kulturhaus zu den Proben. Der Hausmeisterin passte das anfangs gar nicht, wenigstens einmal in der Woche wollte sie ihre Ruhe haben. Doch bald gewöhnte sie sich an die „Colectras“, und heute gehören sie fast zur Familie.
Den Jungens vom Omikron-Trio verhalf der Musiklehrer der Bertolt-Brecht-Oberschule zu einem glänzenden Start. Durch ihn theoretisch ausgebildet und von Hause aus hochmusikalisch, stiegen sie kometenhaft auf in den Starhimmel einer begeisterten und tanzfreudigen Jugend.
Sie alle hat Gerhard Brunnert organisatorisch unter seine Fittiche genommen. Er lebt gewissermaßen in Bigamie. In Hoppegarten ist er verheiratet mit seiner Frau und in Buckow mit dem Kulturhaus. Das schmalste und einfachste Zimmer ist sein Büro, einziges Schmuckstück: eine Urkunde, vom Minister für Kultur persönlich überreicht. „So etwas kriegt man nicht von ungefähr in die Hand gedrückt.“ Er lächelt bescheiden und schiebt dabei den Unterkiefer vor, was ihm etwas Verschmitztes gibt. „Das hab ich meinem Fahrrad zu verdanken. Ich wohne doch in Hoppegarten und strample bei schönem Wetter täglich zehn Kilometer hierher und zehn zurück. Dabei kommen mir die besten Gedanken.“
So einfach ist das. Wenn es wirklich so einfach wäre, sollte man viel mehr Kulturfunktionäre Rad fahren lassen …
Der zaunlattendünne, aber sehr bewegliche Brunnert hat weder einen Dukaten spuckenden Großbetrieb noch sonstige sprudelnde Quellen hinter sich. Von den zwanzig Leuten, die in der Märkischen Getränkefabrik Selterswasser zum Gluckern bringen, oder von den dreißig Frauen, die in einer abgelegenen Baracke für den VEB Damenmoden Kleider und Röcke zuschneiden, ist kaum finanzielle Unterstützung zu erwarten; eine LPG gibt es nicht, ringsum ist Landschaftsschutzgebiet. So hängt das geistig-kulturelle Leben eigentlich nur von der Ausdauer und der Tatkraft weniger Menschen ab.
Brunnerts treueste Verbündete ist Frau Sirch, die Buchhändlerin aus Passion, eine freundlich-bescheidene Frau unbestimmbaren Alters, die sich als Volkskammerabgeordnete nebenbei auch um alte Schlösser, Kaufhallen, Pflegeheime und die Wohnungssorgen kinderreicher Familien kümmert. Mittags lädt mich die Sirchin ins Strandcafé ein. Das Nussparfait soll dort ganz vorzüglich sein. Auf der Terrasse bleiben wir unwillkürlich stehen, um den Ausblick auf den tiefer liegenden See und das fröhliche Gewimmel am Badestrand zu genießen.
Die Eisbar gibt sich zauberhaft-exotisch. An den Wänden hat Bofinger mit heiter-skurrilem Pinsel die Erdkugel gemalt mit allerlei zugehörigem Getier: den Wisent in Polen, die Anakonda am Amazonas, den Hammerhai im Mittelmeer, die Kaiserpinguine am Südpol. Nicht mal Professor Dathes Truppe nahm daran Anstoß, dass das indische Panzernashorn tintenblau ist und der sibirische Tiger mit Bofingerschen Glupschaugen pliert.
Staunend bewundere ich die Geweihe der Oryx- und Addax-Antilopen, da nähert sich der Hausherr, braun gebrannt, sportlich, mit dichtem dunklem Haar und Bart, ein Typ, wie er im Maghreb zu Hause ist. Karl Behrend ist sein Name. Im Sommer komponiert er in seinem „Laden“ nach italienischen Rezepturen die verlockendsten Eisspezialitäten, wuchtet zentnerschwere Fässer in den Keller, schenkt abends Sekt mit Ananas aus.
Doch sobald sich das Laub zu färben beginnt und vom fröhlichen Badegewimmel nur noch ein paar tuckende Haubentaucher übrig bleiben, überfällt ihn das Fernweh. Im Herbst 1965 kreuzte er mit der Segeljacht „Berliner Bär“ auf dem Mittelmeer, ein andermal zog er zur Brunftzeit mit der Kamera durch die Naturschutzgebiete Polens, „wo Elch und Wisent grasen“ und „wo Wölfe und Bären ziehen“. Von Neugier getrieben, durchquerte er mit Helmut Drechsler und auf eigene Faust den schwarzen Kontinent von Libyen bis zum Kilimandscharo und vom Senegal bis Tschad.
Einmal, im Südsudan, versackte der Wagen mit der Fotoausrüstung im Morast. Mithilfe der Eingeborenen holten sie ihn mühsam wieder heraus. Geld wollten sie nicht dafür, nur Fleisch. So blieb Behrend, der das Gewehr immer nur für äußerste Notfälle bei sich trug, nichts anderes übrig, als einen Kaffernbüffel zu schießen. Das prächtige Büffelhaupt kann man neben ägyptischen Wasserpfeifen und dämonischen Tanzmasken aus Dahomey noch heute im Strandcafé bewundern.
Angeregt von der Anziehungskraft afrikanischer Tierreservate, schlug Karl Behrend vor, das viertausend Hektar große Landschaftsschutzgebiet um Buckow in ein Wildreservat zu verwandeln. Dann hätten Großstädter berechtigte Hoffnung, einmal Dachs und Fuchs, Hirschkuh oder Rehbock in freier Wildbahn zu beobachten. Der Mann wäre mit seiner vulkanischen Aktivität imstande, diese Idee zu verwirklichen.
Erna Sirch löffelt zufrieden ihr zweites Nussparfait. Die Überraschung ist ihr geglückt. Nach Eichendorff, Chamisso und Fontane ist Behrend wahrhaftig ein Musensohn besonderer Prägung. Den berühmtesten heben wir uns für den Schluss auf: Bertolt Brecht. 1948 aus der Emigration zurückgekehrt, stürzte er sich mit voller Kraft in die Theaterarbeit. Berlin drohte ihn aufzufressen mit Tausend Terminen und Verpflichtungen, wichtigen und weniger wichtigen, und ihm brannten so viele Stoffe auf den Nägeln. Darum zog er in das Haus am See und schrieb an seine Tür: „In Erwägung, dass mir nur wenig Wochen bleiben, in denen ich für mich arbeiten kann…“
Die Buckower haben ihn noch so im Gedächtnis, wie ihn Elizabeth Shaw auf dem Schutzumschlag des Brechtschen Kinderbuches zeichnete: in einem abenteuerlichen Vehikel, Hupe seitlich draußen, Scheinwerfer wie Schlangenköpfe nach vorn gebogen. So kurvte er, mit dem Auspuff um die Wette räuchernd, durchs Gelände. Dann wieder blieb er tagelang unsichtbar, arbeitete an der „Kriegsfibel“, am „Kaukasischen Kreidekreis“, stritt sich mit Strittmatter über den „Katzgraben“, feilte mit Eisler und Dessau an Song-Texten, spielte mit seinen Schülern Besson, Palitzsch, Beilag und Wekwerth die unterschiedlichsten Varianten einer Szene durch …
Brechts Art, Auto zu fahren, musste man als tollkühn bezeichnen. Weniger Courage zeigte er allerdings, wenn seine Frau Pilze auf den Tisch brachte. Helene Weigel war eine vorzügliche Köchin, alle Freunde des Hauses priesen ihre Kunst, aus nichts was zu machen. Ihre pikanten Pilzsalate genossen legendären Ruf. Nur Brecht aß nie davon. Vom ersten bis zum letzten Tag ihres Zusammenlebens hatte er ihr in allen Dingen vertraut, in diesem einen Punkte nicht. Als die Weigel später die Leitung des Berliner Ensembles ganz in ihre Hände nahm, blieb ihr nur wenig Zeit für das Haus in Buckow. Wenn sie aber draußen war, versammelte sich das halbe Ensemble, zumindest die Familie mit Kind und Kindeskind, um den großen Tisch mit den hohen, altväterischen Stühlen.
Sie, die gelernt hatte, um den Pfennig zu feilschen, schenkte der kleinen Stadt tausend Reclambändchen mit Brechts Gedichten. Und im frostklirrenden Februar 1970 las sie im großen überfüllten Saal des FDGB-Heimes „Einheit“ aus den „Buckower Elegien“, ohne Honorar, nur aus Dankbarkeit, wie sie es nannte. Das vergessen die Buckower nicht.
Wir stehen vor ihrem Haus, der Eisernen Villa. Ein besorgter Fabrikant hatte es lange vor ihrer Zeit mit schmiedeeisernen Gittern umgeben lassen, sie hat immer darüber gespottet. Drinnen ist alles noch so, als wäre sie nur für eine Weile fortgegangen, und so soll es bleiben, eine stille Stätte des Gedenkens an die „große, wandelbare, wissende, Brot backende, Suppe kochende Kennerin der Wirklichkeit“, wie Brecht sie genannt hatte.
Der Gärtner harkt am See das gelbe Weidenlaub zusammen. Wir rufen vergebens. Er ist fast taub. Die Kiefern werfen schon lange Schatten, Wind kommt auf und flüstert in der Silberpappel.
Am See, tief zwischen Tann und Silberpappel
Beschirmt von Mauer und Gesträuch, ein Garten
So weise angelegt mit monatlichen Blumen
Dass er vom März bis zum Oktober blüht.
Hier, in der Früh, nicht allzu häufig, sitz ich
Und wünsche mir, auch ich mög allezeit
In den verschiedenen Wettern, guten, schlechten
Dies oder jenes Angenehme zeigen.
Bernau
Ein liebenswürdiges und romantisches Städtchen, denkt der Wanderer, wenn er über die Wallanlagen in den Ort hineinkommt. Linker Hand die Kirche Zum heiligen Georg – sie hat mindestens fünf Jahrhunderte auf dem Buckel –, dann der Friedhof, umschlossen von mannshoher Mauer, die noch überragt wird von der Stadtbefestigung: Feldsteine, hoch aufgetürmt bis zu acht Metern, Wiekhäuser, Pulverturm und Hungerturm, starke Tore, die ein Bild davon geben, wie Bernau im Mittelalter ausgesehen haben mag. Angelehnt an die Stadtmauer das Henkerhaus, schmalbrüstig und altersschwach, in das nach dem Henker der Toilettenmann einzog. Der Lehm ist rissig geworden. Die geborstenen Balken werden wohl bald unter der Spitzhacke ihren letzten Seufzer tun. In unmittelbarer Nachbarschaft ein steinerner Sockel, darin eingraviert die Namen der Bernauer Schuster, Weber und Rademacher, die während der Kriege Preußens über halb Europa verstreut und in fremder Erde begraben wurden, und obenauf Viktoria, die Siegesgöttin. Sie scheint es eilig zu haben, fortzukommen: der flüchtende Fuß, der hochgereckte Arm, der den Lorbeerkranz hält … Oder will sie nur hinüber auf die andere Seite der Straße, wo das Ehrenmal für die in der Schlacht um Berlin gefallenen Sowjetsoldaten steht, um dort den Kranz niederzulegen? So betrachtet, hat sie in diesem Städtchen den einzig sinnvollen Standort.
Ein Stückchen weiter stehen wir vor dem Backsteinturm von Sankt Marien, einer spätgotischen Hallenkirche, innen reich ausgeschmückt mit Schnitzwerk, Malereien und einem Hochaltar aus der Schule des Lucas Cranach. Bei näherer Betrachtung erkennen wir am Westturm, der aus dem neunzehnten Jahrhundert stammt, die Buchstaben JFN. Der Besucher zerbricht sich vergebens den Kopf, was diese geheimnisvollen Zeichen bedeuten könnten, wenn er nicht Herrn Bügel vom Stadtmuseum zur Seite hat. Es sind dies, so erklärt der Heimatforscher, die Initialen des Maurermeisters Johann Friedrich Noack, der seinen Handwerkerstolz dort verewigte und wohl auch seinen Zorn über das zu schmal geratene Honorar. Erst als die Gerüste gefallen waren, hatte der Auftraggeber die unerhörte Respektlosigkeit bemerkt, doch da war es zu spät. Wir stehen am Fuße des rostroten Westturms. Je länger man hinaufschaut, desto beängstigender wird das Gefühl, der Turm könne just in diesem Augenblick auf einen stürzen.
Ein dickes Kabel zieht sich bis zum obersten Sims, der Blitzableiter. Daran waren in der Nacht zum 1. Mai 1933 zwei Jungkommunisten hochgeklettert: Paul und Walter. In etwa acht Meter Höhe drehte es Paul fast den Magen um. Walter war es auch nicht wohl. Zum Glück wog er nicht viel, ein verhungertes Bürschchen, aber wer weiß, wie viel so ein Blitzableiter aushält … Sie schwebten in doppelter Lebensgefahr, denn abstürzen oder von den Braunen entdeckt werden, das wäre wohl auf dasselbe herausgekommen. „Gib die Fahne her, ich steige allein weiter“, sagte er zu Paul und brachte das halsbrecherische Kunststück fertig, allein bis nach oben zu klettern. Am 1. Mai wehte weithin sichtbar die rote Fahne am Kirchturm von Sankt Marien. Es fand sich so bald keine Feuerwehrleiter, die lang genug gewesen wäre, das rote Tuch herunterzuholen.
Ich spaziere mit Rudi Bügel, diesem lebenden Geschichtsbuch, durch die Altstadt. Überall nur Einbahnstraßen. Der Marktplatz ist von parkenden Autos überfüllt. In der Rossstraße sind zwei windschiefe Häuser abgerissen worden. Das dritte stürzte gleich mit ein. Jetzt lässt man die handtuchschmalen Häuschen lieber in der Zeile stehen, aus Angst, es könnten beim Abbruch gleich zwei, drei angrenzende ins Wanken geraten. Hier das Referat Wohnungswesen zu leiten, muss eine Strafe sein, wenigstens bis zu dem absehbaren Zeitpunkt, da sich der mittelalterliche Stadtkern nach den Vorstellungen der Bauakademie und der Denkmalspflege grundlegend erneuert haben wird. Wir schlendern an der Stadtmauer entlang, wo die Jungen Historiker aus der zehnten Klasse unter Bügels Anleitung Efeu und kleine Sträucher rupfen, deren Wurzeln sich zwischen den Steinen festkrallen und den Zerfall der Mauer beschleunigen.
Irgendwo hinter Sankt Marien wohnte vor dreihundert Jahren der Prediger, Rektor und didaktische Dichter Georg Rollenhagen, der Froschmeuseler genannt nach seinem Buch „Der Frösch und Meuse wunderbare Hofhaltung“. Die Quintessenz seines lehrreichen Wirkens lautete, auf Schmarotzer aller Art bezogen: „Es nützt nichts, wir müssen sie vertreiben, denn wie die Zeiten sind, so können sie nicht bleiben.“
Bernau soll zu des Froschmeuselers Zeiten berühmter gewesen sein als Berlin, wegen seines Bieres und der Bierproben. Da wurden Schemel im Kreis aufgestellt und mit Bier begossen. Der Bürgermeister, die Rats- und Brauherren setzten sich in bocksledernen Hosen darauf und sprachen wacker dem kräftigen Gerstensafte zu. Erhoben sich die Herren nach zwei oder drei Stunden, so mussten die Schemel an dero höchst erlauchten Hintern kleben bleiben wie angepicht, sonst hatte das Bier die Probe nicht bestanden. Heutzutage trinkt man sein Berliner Pils in der Museumsklause oder im Café am Steintor. Es ist nicht ganz so berühmt und würde vielleicht auch nicht die Probe bestehen, aber es schmeckt doppelt gut, wenn man das Museum im Steintor mit seinen Hellebarden und Schandmasken gerade hinter sich gelassen hat. In diesem Turm fühlt man sich ins finsterste Mittelalter zurückgeworfen: Spieße und Stangen, Harnische, Armbruste und Morgensterne. An einer weiß getünchten Wand fallen besonders die Armzeuge auf; nur linke Armzeuge, warum keine rechten? Rudi Bügel erklärt: „Dies sind Verteidigungswaffen Bernauer Bürger. Den linken gepanzerten Arm legten sie auf die Mauerbrüstung, mit dem rechten bedienten sie die Armbrust, darum musste er frei bleiben. Um aber auch den Panzerarm etwas beweglich zu haben, konstruierten sie ein bewegliches Handgelenk, das später wegen seiner Originalität als ,Bernauer Schlitzgeschübe‘ in die Handbücher der mittelalterlichen Waffenkunde einging. Wie oft diese Rüstungen im Ernstfalle benutzt worden sind, ist nicht bekannt. Nachrichten aus dieser Zeit sind spärlich. Dafür haben sich Legenden gebildet, von denen eine sogar, literarisch durch August Trinius ausgeschmückt, in den Schullesebüchern der Großväter und Väter stand: „Die Hussiten vor Bernau“. Etwa in dieser Lesart: In der Karwoche des Jahres 1432 rückten die Hussiten plündernd und sengend unter Koskas Führung gegen Bernau … Die braven Bürger wehrten sich nach Leibeskräften, unterstützt von ihren wackeren Ehehälften, die heißgemachten Brei auf die Schädel der anstürmenden böhmischen Horden gossen. Und nicht genug damit. Ein Bauer ließ mit harmlosen Gebärden einen großen Transport des weit gerühmten Bieres aus dem Tore hinaus; allerdings hatte er dem edlen Gerstensafte einige freundliche Substanzen wie Stechapfel und Bilsenkraut beigemischt … Die Hussiten fielen begierig darüber her, und nachdem sie wacker gesoffen, taumelten sie berauscht ins Lager und wurden nun von den Bernauer Bürgern und dem Heer Friedrichs I., das von Spandau her anrückte, überrannt, und was sich nicht durch die Flucht zu retten vermochte, das wurde getötet …
Wenn auch nicht bewiesen ist, dass die Hussiten jemals vor Bernau gewesen, so hat sich Bernau auf diesen sagenhaften Sieg in der Vergangenheit viel zugutegehalten. Es gab Hussiten-Spiele, Hussiten-Bier, das Hussiten-Museum und die Hussiten-Drogerie, ja, die Stadt selber nannte sich „Hussiten-Stadt Bernau“. Sie kam damit vielleicht auf andere Art der Wahrheit näher als geahnt, denn vage Nachrichten aus dem aufständischen Heer der Hussiten berichten von märkischen Bauern, auch Bernauer Handwerksgesellen, die mitgefochten haben. In den Kirchenchroniken ist schon früher von der Unbotmäßigkeit Bernauer Bürger zu lesen gewesen, etwa als Probst Cyriacus 1325 beim Eintreiben des Peterpfennigs von einer aufgebrachten Menge verbrannt wurde.
Rudi Bügel, früher Lehrer für Staatsbürgerkunde, hatte es nicht leicht, die Hussiten-Legende vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und was brachten ihm seine Bemühungen ein? Den Spitznamen Hussiten-Bügel.
Eh wir das Steintor verlassen, zeigt er mir noch die Armesünderzelle mit der schmalen Holzpritsche, dem Gebetsschemel und dem ziegelsteinbreiten Loch, durch das die Sonne scheint. Adieu, Mittelalter!
Im achtzehnten Jahrhundert fiel Bernau im Wettrennen mit der brandenburgischen Residenzstadt Berlin hoffnungslos zurück. Der Archidiakonus Tobias Seiler fand auch heraus, warum. „Gott hat seine gnädige Hand von der Stadt abgezogen, weil darinnen zuviel gesündigt wurde!“, wetterte er. Vor allem hatte der Archidiakonus die Windmüller auf dem Kieker, die selbst an Sonn- und Feiertagen ihre Mühlen klappern ließen und seine Predigt störten. Er beschwerte sich beim königlichen Kammer- und Domänengericht und erhielt die lakonische Antwort: „Wenn dero Pfarrer denen Windmüllern in der Woche genügend Wind zum Mahlen garantiert, dann sollen sie des Sonntags in die Kirche gehen.“ Zwei Jahre lang prozessierte er, dann gab er auf und donnerte von der Kanzel: „Das bonum publicum weiß nun, warum Segen und Nahrung aus unserer Stadt fast ganz verschwunden und ohnlängst gar Häuser abgebrannt sind! Das Beginnen der Windmüller ist schuld, ihr heilloses Vorgehen ist lauter Wind, Wind, Wind! Hier Wind und dort ewiges Feuer!“
Mit den zugewanderten Samt- und Seidenwebern aus Frankreich kamen dann neue Gedanken von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nach Bernau und liefen um in den Familien der Weber und Spinner. Als 1848 die Berliner hinter den Barrikaden standen, eilten sie ihnen zu Hilfe und „brachten neben etlichen Blessuren auch Neuigkeiten und Druckschriften mit, die die besitzende Klasse sehr in Sorge versetzten“, wie der Stadtchronist mit zitternder Hand schrieb. Er fügte hinzu: „Das Drängen der Weber, Tagesarbeiter und kleinen Handwerker wird von Tag zu Tag drohender. 500 Familienväter sind bereits brotlos. Man lässt sie Wege ausbessern, Stubben roden, die Straße nach Weißensee bauen; doch sie lassen sich von aufrührerischen Kräften verführen und weigern sich, für 10 Silbergroschen am Tag zu arbeiten.“ (Das Existenzminimum lag bei 20 Silbergroschen!) „Morgen sollen endlich 2 Comp, des 2. Kgl. Infanterie-Regiments in Bernau einrücken, damit wird wohl fürs Erste wieder Ruhe und Ordnung hergestellt sein.“
Die Ruhe war nicht von langer Dauer. Im November 1848, als Friedrich Wilhelm IV. daran ging, die Nationalversammlung aufzulösen, schickte General Wrangel fünfzig Mann Infanteristen zur Verstärkung nach Bernau, um die in einem Sonderzug eintreffenden sechshundert Stettiner Demokraten am Aussteigen zu hindern. Der völlig konsternierte Stadtchronist berichtet:
„Das Detachement des 2. Kgl. Infanterie-Regiments hatte scharf geladen, als der Zug einlief. Aus stiegen 600, zum großen Teil angesehene und fein gekleidete Bürger, die von den Bernauer Bürgern stürmisch begrüßt wurden. Sie wollten die Weiterfahrt erwirken und zogen generalmarschtrommelnd zum Rathaus, was im Nu den Bürgermeister und die Ratmannen auf den Plan rief. Sofort wurden der Bernauer Tambour Schwendt und der Stettiner Maurermeister Piper verhaftet. Doch das Alarmschlagen hatte die Einwohner erregt. Sie eilten zum Bahnhof, verbrüderten sich mit den fremden Demokraten und zogen zusammen zum Rathaus, wo ein sehr fein gekleideter Stettiner als Wortführer vom Bürgermeister die Freilassung der Verhafteten forderte. Es entstand ein fürchterliches Gedränge. Die Menge wälzte sich ins Polizei-Büro, zerschlug Tische und Stühle und bewarf den Bürgermeister mit Akten und Tintenfässern seines eigenen Schreibtisches! Nur mit Müh und Not retteten sich die Misshandelten durch den Kellerausgang.“
Wo war übrigens die Bürgerwehr geblieben, die „zur Verhinderung solcher Exzesse“ gebildet worden war? Der „bessere Teil derselben“ sah hinter der Gardine zu, wie die andern mit im Demokratenhaufen marschierten. Daraufhin wurde die Bürgerwehr „wegen Unbrauchbarkeit“ aufgelöst, und stattdessen rief man die Pasewalker Kürassiere herbei. Auf die war noch Verlass. Einmal wachgerüttelt, waren die Bernauer Leinen-, Samt- und Seidenweber, Lehrer und kleinen Handwerker nicht wieder einzuschläfern. Im Demokratischen Sozialverein wurden immer eindringlichere Fragen gestellt. Die Fragenliste liegt heute im Museum aus, und wir lesen, was damals die Leute bewegte: „Hat die Krone das Recht, die Nationalversammlung zu verlegen oder nicht?“ – „Was ist Socialismus? Es wäre gut, recht gründlich zu erklären, was das Wort bedeutet, es kennen viele Mitglieder des Socialvereins nicht die Spur der Bedeutung.“
Von nun an konnten weder Verbote noch Verhaftungen und Reglementierungen den Lauf der Dinge aufhalten.
Zum Höhepunkt der kaisertreuen Partei zählte 1882 zweifellos der Besuch des Kronprinzen zur Vierhundertfünfzigjahrfeier der nicht nachweisbaren Schlacht gegen die Hussiten. Acht Ehrenjungfrauen überreichten Seiner Königlichen Hoheit ein tief empfundenes Lobgedicht, das in dem Versprechen gipfelte:
Wie wir vereint die Drachenbrut geschlagen,
So steht, wo finstrer Mächte Ansturm droht,
Zu seinem Kaiser jetzt in Not und Tod
Das deutsche Bürgertum in allen Tagen!
Der Demokratische Sozialverein und die Sozialdemokratische Partei konnten allerdings keine Abordnung zur Begrüßung des hohen Gastes schicken, denn sie waren bereits von Bismarck verboten.
Fünf Jahre später kam ein anderer und hielt eine glänzende Rede, von der noch Generationen erzählen sollten. Er wurde nicht von Stadtrat und Ehrenjungfrauen empfangen, sondern von Tschakos und von einer wissbegierigen Menge, die sich schützend vor ihn stellte. Dieser andere war August Bebel. Er sprach an einem lauen Sommerabend des Jahres 1897 im Elysium. Der Saal war gerappelt voll, und im Garten standen noch Hunderte, die auch etwas hören wollten. Der Stadtbüttel musste aufpassen wie ein Schießhund, dass nichts Gesetzwidriges gesprochen wurde, und ließ die Fenster verriegeln, damit nichts nach draußen dringen konnte. Doch hinter seinem Rücken wurden die Fenster immer wieder geöffnet.
Später fanden die Arbeiterversammlungen im Bellevue statt. Karl Liebknecht sprach dort und die „Niederbarnimer Opposition“, jene mutige kleine Gruppe, die im nationalen Taumel des Sommers 1914 ihre warnende Stimme gegen den Krieg erhob. Im Bellevue wurde auch am 9. November 1918 die Ortsgruppe des Spartakusbundes gegründet, und 1952 kam es an eben jenem Ort, der mit gutem Recht heute „Haus der Einheit“ heißt, zur Einheitsfront aller klassenbewussten Arbeiter.
Dies alles war für die zeitgenössischen Verfasser der Heimatkalender natürlich zu unwesentlich. Sie erzählten von einem geschäftstüchtigen Bernauer Barbier, der dem Kronprinzen einen Finger amputierte und diesen für drei Taler an den Patienten als Souvenir verkaufte. Sie begrüßten in langen Reimen ein Storchenpaar, das hier nach Jahren wieder Quartier nahm, zur hoffnungsvollen Freude der kinderlosen jungen Frauen. Berichtet wurde auch von dreiundsechzig mittellosen Familien, die von der Stadt zwei bis zehn Mark Unterhalt bezogen, im Monat! Unerklärlich und beklagenswert schien es den Kalendermachern, dass Bernau in den zwanziger Jahren die höchste Selbstmordziffer in Deutschland aufwies. Hauptsächlich waren es Seidenweber, Handwerksgesellen, Dienstmädchen und Witwen, die diesen Verzweiflungsschritt taten. Doch – ernst ist das Leben, heiter die Kunst. Freddy Sieg half über alle trüben Tatsachen hinweg und erheiterte jegliches Gemüt mit seinem Couplet über Zickenschulze, jenen Bernauer Ritter Blaubart, dessen kräftig-deftige Hochzeitsgelage stets in einem Schlachtgetümmel endeten, in dem Onkel, Tanten und Verwandte mit Inbrunst und Vajniejen die Fehden längst verblichener Generationen wieder aufleben ließen.
Es kam in Bernau zu dieser Zeit aber auch zu Auseinandersetzungen, die aufhorchen ließen. Zum Beispiel als die KP-Abgeordnete Klara Ulm 1931 im Stadtparlament vorschlug, den zweitausendfünfhundert arbeitslosen Bernauer Bürgern Brennholz und die Volksküchensuppe umsonst zu geben. „Die zehntausend Mark Pension für den ehemaligen Bürgermeister und die sechzigtausend Mark Zuwendungen für die Höhere Schule würden ausreichen, um das gröbste Loch zu stopfen und die Arbeitslosen über den Winter zu bringen.“ Damit kam sie bei den bürgerlichen Abgeordneten schlecht an: Die Pension war heilig und die Höhere Schule nicht minder. Dafür wurde der Etat bei den Volksschulen herabgesetzt, acht Lehrer entlassen und die staatlichen Zuschüsse pro Kind und Tag auf einen Pfennig reduziert … Schade, dass von diesen Stadtverordnetensitzungen um das Jahr 1930 keine Protokolle vorhanden sind. Sie wären unerhört lehrreich für diejenigen, die heute die Geschicke der Stadt lenken und natürlich glauben, ihre Probleme seien die schwierigsten aller Zeiten.
Es sind ganz andere Sorgen. Die Stadt platzt aus allen Nähten. Seit ein paar Jahren ist das Schichtpressstoffwerk mit tausend Beschäftigten hinzugekommen, ein wichtiger Zulieferbetrieb für die elektronische und elektrotechnische Industrie. Kein Fernsehapparat, keine Kofferheule, kein Wahlprogramm für die Waschmaschine, kein Robotron 300 ohne Isolierstoffe aus Bernau. Durchschnittsalter der jungen Betriebsangehörigen: achtundzwanzig. Das heißt, hier werden nicht nur Pläne erfüllt, nicht nur Fanfaren, Trompeten und Posaunen geblasen, hier lebt und liebt man, bekommt Kinder und ruft nach Wohnungen. Es steckt noch Pioniergeist in diesem Werk. Die hier gelernt haben, gehen nicht so schnell wieder fort. Der Soldat, der Fachschulstudent, alle kehren nach Ablauf ihrer Zeit zurück, obwohl das nahe Berlin mit höheren Tarifen lockt. Und so mancher kehrt mit einer Frau zurück, auch für sie gibt es Arbeit und viele Möglichkeiten, klüger zu werden. Sprachkurse sind sehr gefragt, vor allem in Deutsch und Polnisch, denn polnische Elektronikfacharbeiter sind gekommen, mit denen man nicht nur in der Werkhalle zusammen ist. Der eine oder andere gehört auch bald zu einer Familie, was zuweilen nicht ohne Folgen bleibt. Die Eheschließungen sprechen eine beredte Sprache, und im Standesamtsregister gesellen sich zu Heike, Sven und Dieter nun Dunja und Waleria.
Wir fahren ein Stück aus Bernau hinaus in Richtung Wandlitz. Da ist die breit ausladende Brücke über die Autobahn, der Kiefernwald, hochstämmige Bäume, schnurgerade ausgerichtet wie Turner in Riegen, wenig Unterholz und Sand, Sand, Sand. Märkische Heide. Hier trafen sich seit der Jahrhundertwende jedes Jahr die Arbeiterfamilien zum Maiausflug. Dieser Platz war die symbolträchtige Stätte, auf der die Architekten des Bauhauses Dessau die Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes errichteten. Es wurden viele schöne Worte zur Einweihung gesprochen. „Möge von dieser Schule und ihrem Wirken der deutschen Arbeiterschaft reicher Segen werden!“ Mai 1930.
Es war nicht mehr viel Zeit für ein segensreiches Wirken. An die Spitze der Bundesschule wurde ein Dr. Seelbach berufen, der meinte: „Die Lehre von Marx ist höchstens für die jüdische Intelligenz fassbar, nicht aber für den Arbeiter.“ Im Februar dreiunddreißig marschierte Seelbach mit fliegenden Fahnen ins Lager derer, die von jeder Tonne Stahl der deutschen Konzerne ihre Tantiemen erhielten, und wer nicht mitmarschierte, der sah sich wenig später in „Schutzhaft“ genommen und hatte genügend Zeit, darüber nachzudenken, ob nicht der Kommunist Walter Ulbricht vor einem Jahr bei der Maifeier im Bellevue wohl doch recht gehabt hatte …
Die „Lieblinge des Führers“ zogen jetzt in das verlassene Haus, das sich nun NS-Junker-Schule nannte. Und die Bernauer schlugen bald einen weiten Bogen um diesen Ort. Hier wurde auch der Stoßtrupp ausgebildet, der im August 1939 in polnischen Uniformen den Sender Gleiwitz überfiel und damit den Vorwand für den Überfall auf Polen lieferte.
Als der Krieg zu Ende ging, standen die Panzer der 1. Belorussischen Front unter Marschall Shukow vor den Toren Bernaus, und ein neunzehnjähriger Propaganda-Offizier wurde vom Panzer weg als Stadtkommandant eingesetzt. Der junge Mann in der Offiziersuniform der Roten Armee war Deutscher. Er hieß Konrad Wolf und war der Sohn des Dramatikers Friedrich Wolf. Alles Weitere erzählt der Film „Ich war neunzehn“, den Konrad Wolf zwanzig Jahre nach jenem denkwürdigen Tage drehte.
An der neu gegründeten Gewerkschaftsschule führten zunächst Leute wie Kaiser und Lemmer vom rechten Flügel der christlichen Gewerkschaftsbewegung das Wort.
Walter Ulbricht, Albert Norden und Heinrich Rau wurden nur zu Gastvorlesungen geladen. Die Verwirrung in den Köpfen der Studenten – der jüngste knapp achtzehn, der älteste über sechzig – ist für die Jüngeren heute kaum begreifbar.
1949 wurde Hermann Duncker zum Leiter der Schule berufen. Er stand damals schon im achten Lebensjahrzehnt, seine Persönlichkeit strahlte ein Feuer aus, sie begeisterte seine Schüler so nachhaltig, dass sie heute noch ins Schwärmen geraten, sobald sein Name genannt wird. Frau Dr. Bischof, die sich vor allem mit der Weltgewerkschaftsbewegung beschäftigt und in drei Kontinenten zu Hause ist, gehörte – damals noch blutjung – zur ersten Garde seiner Studenten. Er verstand es, jeden an die Hand zu nehmen, in jedem die besten Fähigkeiten zu entwickeln, jedem Mut zu machen. Drei Sätze kehrten bei ihm immer wieder: „Jeder kann alles lernen! Jeder kann sich in alles hineinarbeiten! Jeder ist für den materiellen und kulturellen Fortschritt mitverantwortlich und unerlässlich!“
Für viele, die in dieser Zeit große Verantwortung übernehmen mussten und davon schier erdrückt zu werden drohten, waren diese Sätze das Morgen- und das Abendgebet.
Als der Student Friedrich Wilke einmal bei Hermann Duncker den Parteibeitrag kassieren kam, fasste ihn Duncker, noch ehe dieser etwas sagen konnte, an der Schulter, lud ihn zum Sitzen ein und fragte rundheraus: „Sag mal, Genosse, was hast du eigentlich zuletzt gelesen und was ist dir daran besonders aufgefallen?“ Er hatte eine Art zu fragen und den Dingen auf den Grund zu gehen, dass man sich unmöglich darüber hinwegmogeln konnte. Duncker wollte den verlegen Stotternden keineswegs in eine Zwickmühle bringen, so ganz nebenbei nannte er dieses und jenes Buch, und als Friedrich Wilke mit roten Ohren das Zimmer des Professors verließ, trug er eine lange Liste unbedingt zu lesender Literatur bei sich. Das nächste Mal bereitete er sich gründlich auf den Besuch vor. Heute ist der Student selbst Professor an der Hochschule, am Institut für Weltgewerkschaftsbewegung. In vier Sprachen wird dort unterrichtet, in deutscher, englischer, französischer und arabischer. Immer, wenn Friedrich Wilke vor einer heiklen Aufgabe steht, etwa einen Vortrag in französischer Sprache vor Bauarbeitern von Kongo-Brazzaville zu halten, dann erinnert er sich seines alten Lehrers. Und merkwürdigerweise – dann geht’s.
Äußerlich ist alles noch so wie zu Dunckers Lebzeiten. Betritt man das Gelände der Hochschule, so stößt man gleich rechter Hand auf ein niedriges Haus mit dem Namensschild „H. Duncker“. In seinem Arbeitszimmer Bücher mit zahllosen Zetteln und Randnotizen, die graubraune Schirmmütze, von der er sich ungern trennte, die Schirmbrille, ohne die er in der letzten Zeit so gut wie nichts mehr sah. Im Wohnzimmer steht noch das Klavier, hier spielte er abends seinen Studenten Tschaikowski und Beethoven vor. Hermann Duncker wollte ursprünglich Musiker werden, studierte dann aber Nationalökonomie, Geschichte und Philosophie, heiratete Käthe Döll, eine Schülerin Clara Zetkins, lernte bei Rosa Luxemburg und Franz Mehring das Abc eines Journalisten, gründete in Leipzig ein Arbeitersekretariat, wo sich Arbeiter in allen Fragen des Lebens Rat und Hilfe holen konnten, gewann hier entscheidende Einsichten, die fortan sein Leben bestimmen sollten.
„Wer seine Lage erkannt hat, wie sollte der aufzuhalten sein“, lässt Brecht seine Pelageja Wlassowa sagen. Brecht hatte zu den lernbegierigsten Schülern Dunckers auf der MASCH gehört.
Wie von ungefähr, scheinbar gerade erst aus der Hand gelegt, sind Bücher auf Dunckers Arbeitstisch verstreut, Bücher mit ähnlich lautenden Widmungen: „Wenn Sie nicht gewesen wären, hätte ich dieses Buch nicht geschrieben …“ Wir erkennen die Handschrift Brechts in den „Tagen der Commune“, die Namenszüge Auguste Lazars und Andersen Nexös, der 1936 mit dem Flüchtling sein kärgliches Brot teilte. An der Wand des ehemaligen Wohnzimmers Fotos, wenige, gemessen an dem Leben, das so reich war an historisch entscheidenden Augenblicken. Was wäre das für ein herrliches Bild gewesen: November 1918, Duncker im Habitus eines Gelehrten an der Spitze einer Gruppe Roter Matrosen in der Chefredaktion des „Berliner Lokalanzeigers“: „Meine Herren, das Blatt der Geschichte hat sich gewendet, jetzt wird es Zeit, dass auch Ihr Blatt sich wendet!“ Und ihm gegenüber die erstarrten Herren in feierlich tristem Schwarz. Es war jedoch kein Bildreporter dabei. Nur das erste Exemplar der „Roten Fahne“ liegt vor, das an jenem denkwürdigen Abend statt des reaktionären „Lokalanzeigers“ erschien.
Die Stationen von Hermann Dunckers Odyssee durch Tausend Jahre Finsternis sind fotografisch nur spärlich angedeutet: die Gefängniszelle in der Nacht nach dem Reichstagsbrand, die Flucht 1936 über Dänemark, London nach Paris. Als Hitler in Paris einmarschierte, wieder Flucht, zu Fuß, Duncker nun schon sechsundsechzigjährig, von Paris nach Agen und weiter nach Marseille. Dem KZ in Deutschland entgangen, geriet er in ein französisches, gelangte endlich nach Amerika, wo seine Frau auf ihn wartete, lernte Paul Robeson kennen und den berüchtigten McCarthy-Ausschuss, kehrte 1947 in die Heimat zurück, dreiundsiebzigjährig, aber noch immer voll Elan. Rostock: Duncker als Dekan der soeben gegründeten Fakultät für Gesellschaftswissenschaften. 1949: Dunckers erste Vorlesung in Bernau. Wo die Professoren heute auch hinkommen auf ihren Vortragsreisen, überall treffen sie auf ehemalige Schüler, wie unlängst Professor Wilke in der kongolesischen Hafenstadt Point Noir. Selbst unser damaliger Außenminister Otto Winzer wurde zwischen New Delhi und Damaskus öfter gefragt: „Wie geht’s, wie steht’s in Bernau?“, sodass er, heimgekehrt, sich bei Professor Wilke erkundigte, wie groß denn dieses Bernau eigentlich sei. „Oh“, erwiderte dieser, „gar nicht so groß; aber mit Bernau ist es eben wie mit der DDR, nicht wahr, die Größe ist nicht das Entscheidende …“
Eden
Niemand weiß, wo es liegt, dieses sagenhafte Eden, in dem Adam und Eva sorglos lebten, bis sie vom Baum der Erkenntnis aßen. Auch die Bibel gibt über die geografische Lage höchst ungenaue Auskunft. Darum beschlossen Ende des neunzehnten Jahrhunderts einige idealistische Weltverbesserer, in der Nähe Berlins einen neuen Garten Eden zu schaffen, in dem alle Menschen gut und freundlich miteinander leben sollten. Selbst den Tieren wollten sie kein Leid zufügen, keines sollte sein Leben lassen, nur weil ein Mensch Appetit auf Kalbsteak au four verspürte.
Leider gab es nirgends auf der Welt ein Modell für dieses Unternehmen, und so standen denn im Frühjahr des Jahres 1893 die Apostel einer natürlichen Lebensweise ziemlich ratlos in der spärlichen Heidelandschaft vor den Toren Oranienburgs, wo sie soeben vierhundertfünfzig Morgen märkischen Sand erworben hatten, um darauf eine gemeinnützige, antialkoholische und vegetarische Obstbaugemeinschaft zu gründen.
Aus den steinernen Kästen der großen Städte kamen sie, aus den mit Samtportieren verhangenen Zimmern der Vorderhäuser, aber auch aus den muffigen Stuben der Hinterhöfe, die weder Luft noch Sonne kannten. Sie trafen sich in der Verachtung einer Welt, die alles, nicht nur die Taillen der Damen, in atemberaubende Korsagen zwang. Sie wollten frei sein von allem Zwang, in ihrem Eden sollte jeder nach seiner Fasson selig werden.
Das Experiment lockte sonderbare Leute an, die hier einen günstigen Nährboden für ihre Weltbeglückungstheorien vermuteten: Ein hochbegabter, amüsanter und bedenkenloser Professor wollte seine Freigeldideale verwirklichen; ein anderer verfocht die konsequente Freiheit, vor allem in der Liebe: „Kein Zaun soll uns trennen, nur Hecken sollen symbolisch das individuelle Territorium andeuten, dahinter lasst uns leben und lieben und der schnöden Welt entraten!“ Als die Hecken hoch genug waren, krähte kein Hahn mehr nach dem Liebesapostel. Ein dritter tauchte barfuß und im Frack in Eden auf, hielt, vor Begeisterung schwitzend und sich den wilden Bart raufend, Feuer speiende Reden: „Ich bin der helle Blitz am Mittag! Ich bin das A und O des Lebens!“ Er brüllte einzelne Silben heraus, andere verschluckte er, ein Dadaist des Wortes, ein expressiver Spinner, der jedoch so manchen Zuhörer eine Zeit lang faszinierte.
Es fehlte natürlich nicht an Miesmachern und Spöttern. Doch es gab auch fleißige, ernst zu nehmende Leute unter den Edenern. Auf zweitausendachthundert Quadratmetern märkischer Heide – denn so groß waren die einzelnen Parzellen – pflanzten sie Birn- und Apfel-, Kirsch- und Pflaumenbäume, Erdbeeren und Himbeerhecken, bauten sie sich einen kleinen Betrieb, in dem chemiefreies Obst und Gemüse verarbeitet wurden. Dank der Neuform-Bewegung und der gerade gegründeten Reformhäuser fanden sich Edener Fruchtsäfte und Konfitüren bald auf allen vegetarischen Frühstückstischen in- und außerhalb Europas. Der Versandhandel schickte Edener Honig, Nussmus und Naturreis sowie Dr. Landmanns Reformmargarine in alle Welt. Mit geringen Kräften versuchten sie, das zu erreichen, was heute von allen Ärzten gefordert wird: gesunde, bekömmliche Ernährung für jedermann und mehr pflanzliche statt tierische Fette. In Eden sind daher die Dicken selten; dafür gibt es körperlich und geistig unerhört rüstige Achtziger. Man braucht ja nicht unbedingt jedem Schnitzel abzuschwören, aber ein bisschen von der Edener Ernährungsweise könnte uns nicht schaden.
Es gab einmal in Eden ein vegetarisches Gasthaus, man spielte sogar mit der Idee, einen Obst-Kurbetrieb einzurichten, doch dafür fehlten den Edenern Gelder, Räume und medizinische Erfahrungen und vielleicht auch die Gäste, die mit Hasenkost vorliebnehmen wollten.
Die Edener achteten anfangs sehr streng auf ihre Grundsätze. In den Dreißigerjahren waren noch Schnüffler unterwegs, um zu kontrollieren, ob nicht doch einer hinter seiner hohen Hecke rauchte oder trank, heute ist ein Pfeifchen nicht mehr verpönt. In den Versammlungen der Edener Genossenschaft ist allerdings nachahmenswerterweise das Rauchen noch immer nicht gestattet. Als der Konsum vor Jahren einen Zigarettenautomaten in der Siedlung anbringen wollte, da liefen die alten Edener so lange Sturm, bis der prinzipienwidrige Gegenstand entfernt wurde. Man fragt sich jedoch, wie ein Zigarettenautomat in einer Siedlung von Nichtrauchern sich überhaupt hätte rentieren können. Der Konsum wird schon gewusst haben, warum …
Es soll noch vier oder fünf Familien geben, die ganz und gar vegetarisch, rauchlos und alkoholfrei leben. Bei den meisten gluckert’s im Sommer eben doch neben dem Küchentisch im Gärballon, wo der Obstwein seine stürmische Jugend verbringt; und es soll einem Gerücht zufolge so eiserne Vegetarier geben, die extra nach Berlin fahren, um unbemerkt ein Stück Rehkeule oder Roastbeaf zu kaufen.
Als Arnold Seifert, Finanzminister der Edener Genossenschaft, seine kaufmännische Lehre begann, kostete ein Korb Gravensteiner Milliarden, und die Gute Luise war nicht für Billionen zu haben. Die Inflation ging eben auch nicht am Garten Eden vorbei. Nur verspürte man hier die Not nicht so stark wie in den Städten. Der Obstverwertungsbetrieb brachte so viel ein, wie die Edener brauchten, um sich über Wasser zu halten. Große Gewinne erzielten sie nie.
Das galt bis zum Herbst 1972, da wurde der kleine überalterte Betrieb volkseigen. Der Staat zahlte den Edenern eine, wie sie zugeben, erstaunlich hohe Kaufsumme und gab großzügige Kredite, damit sie endlich den Anschluss fänden an die großen Brüder vom Havelland. Sie produzieren jetzt so viel wie nie zuvor, sind aber doch auch ihrem Grundsatz treu geblieben: Reinheit geht vor Rentabilität.
Ich darf mich davon überzeugen. Berge von Äpfeln liegen da, aber zuerst wird Holunder gepresst, er muss taufrisch verarbeitet werden. Da gibt es Handgriffe, die keine Maschine dem Menschen abnehmen kann, die Frauen müssen zufassen, ungeachtet der Tatsache, dass Holunderblau von den Fingern nur mit Mühe und aus Stoffen überhaupt nicht zu entfernen ist. Es findet sich heute kaum noch ein Betrieb bereit, Holunder zu pressen, obwohl an der gesundheitsfördernden Wirkung des Saftes kein Zweifel besteht. Eden scheut sich nicht. Es hat seine Prinzipien.
Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen … Mit Kummer sollst du dich auf deinem Acker nähren dein Leben lang! soll Gott dem ungehorsamen Adam nachgerufen haben, als er ihn aus dem Paradies verjagte, und so wurde es früher in der Siedlung Eden oft zitiert. Doch wenn sich die Edener bald nur noch äußerst mühsam von ihren Erträgen ernähren konnten, hatten sie das nicht einem himmlischen Wesen zuzuschreiben. Einer, der sich selbstherrlich irdische Allmacht anmaßte, saß seit 1933 im Luftfahrtministerium und hatte befohlen, in der Nachbarschaft Edens die Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke zu errichten. Das Werk brauchte viel Wasser. Seen und Kanäle wurden nach Gutdünken reguliert, und der Grundwasserspiegel sank um hundert Zentimeter. Die Obstbäume streckten bald ihre verdorrenden Zweige anklagend gen Himmel, von dem keine Rettung kam. Die Edener gruben sich wie die Maulwürfe tiefer und tiefer ins Erdreich, um weitere Wasseradern zu finden, ersannen neue, kraft- und zeitraubende Arten der Düngung, schleppten das kostbare Nass hundertliterweise in Gießkannen zu den Plantagen.
Trotz all dieser Plackerei hielten die Edener ihre Theatergruppe aufrecht, die sich neben Sprech-, Atem- und Bewegungstechnik auch mit Literatur- und Kulturgeschichte beschäftigte, eine Gruppe, in der linksgerichtete Intellektuelle Begegnungen mit den Arbeitern gesucht hatten. Die künstlerische Seele des Ganzen war Anna Rubner mit ihren drei begabten Töchtern. Ihr zur Seite standen Heinrich Zartmann, der das Oranienburger Waisenhaus leitete, Abdon und Luise Poepke, Käthe Müller-Lisowski, Hans Neuhauser, der später den Parnass im Wiener Burgtheater erklomm, und das Ehepaar Wolf.
Bis 1933 waren sie in Solidaritätsveranstaltungen aufgetreten, groschenweise hatten sie Geld in Hüten gesammelt und es der Roten Hilfe gegeben. Sie inszenierten Szenen aus Gogols „Mantel“ und Stücke von Tschechow; sie hämmerten, schmiedeten, nähten, komponierten, dramatisierten und spielten. Sie versuchten ihren Idealen treu zu bleiben, auch als es lebensgefährlich für sie wurde.
Die Edener saßen in einer verfluchten Zwickmühle: zwischen den Heinkel-Werken, die den Nachtjäger und die berüchtigte He 111 bauten, mit der Coventry dem Erdboden gleichgemacht wurde, und dem Todeslager Sachsenhausen. Nur wenige begriffen, in welche Lage sie geraten waren. Die es wussten und nach ihrem Gewissen handelten, landeten bald hinter Zuchthausmauern, wie die Edener Genossen der Widerstandsgruppe „Nordbahn“.
Die Theatergruppe um Anna Rubner vollbrachte keine Husarenstücke im Widerstandskampf, aber sie half den Familien der Unbeugsamen, die in Gefängnissen und Lagern einem ungewissen Schicksal entgegensahen. Manches Kind aus Berliner Hinterhöfen verlebte dank solcher unauffälligen Hilfsaktionen unbeschwerte Ferienwochen in Eden, und manche Mutter gebar in der Obhut von Frau Altmann ihr Kind.
1936 studierte die Rubnertruppe den „Sommernachtstraum“ ein. An diesem zauberhaften Gaukelspiel, so meinten sie, könne doch niemand etwas politisch Anstößiges finden. Aber sie bedachten nicht – oder wollten es nicht bedenken –, dass ja Mendelssohn Bartholdy die Musik dazu komponiert hatte. Sie sonnten sich noch im freundlichen Glanze der gelungenen Aufführung, als das Unwetter über sie hereinbrach. Die Reichskulturkammer hatte Anstoß an der „jüdischen Musik“ genommen, aber auch daran, dass ausgerechnet Erich Teichert sie spielte, mit seinen Musikanten, die schon seit Langem auf der schwarzen Liste standen, denen man jedoch nichts nachweisen konnte. Mehrmals sagten ihm die Nazis auf den Kopf zu, dass „die ganze Klimperei“ nur dazu diene, illegale Zusammenkünfte zu kaschieren, aber Erich Teichert wies jedes Mal auf einen SA-Mann hin, der im Orchester mitspielte. Mit ihm als Aushängeschild kamen sie glimpflich über die Runden. Dieser SA-Mann schwebte oft in tausend Ängsten, wenn er nach den Übungsstunden nach Hause geschickt wurde, wohl wissend, dass man sich danach noch über Dinge unterhielt, die in keinem Notenblatt standen.
Im Sommer neununddreißig hatte die Rubnertruppe ihre letzte Aufführung: „Figaros Hochzeit“ von Beaumarchais. Der junge Willi Schwabe spielte den Cherubin. Bald darauf wurde die Gruppe auseinandergerissen. Die Männer mussten feldgraue Kostüme anziehen und in der großen Tragödie des zweiten Weltkrieges ungewollte Statistenrollen übernehmen. Käthe Müller-Lisowski, Kennerin alter keltischer Sprachen, konnte rechtzeitig nach Irland emigrieren, das Ehepaar Wolf wurde ins Warschauer Getto verschleppt.
Die bescheidenen, alkoholfreien Feste, in denen die Edener Siedler Frühlingsankunft, Mittsommernacht, Erntekrone und Wintersonnenwende feierten, fielen immer dürftiger aus, und gegen Ende des Krieges stand keinem mehr der Sinn nach fröhlicher Festlichkeit. Die Gemeinschaft der Obstesser war so sehr gerüttelt, geschüttelt und in Mitleidenschaft gezogen worden, dass die alte Theaterfreudigkeit auch nach der Befreiung nicht mehr auflebte. Das hatte allerdings noch andere Gründe: Die jungen Leute erlernten meist Berufe außerhalb Edens, studierten und zogen in industriereiche Gegenden. Nur wenige blieben, gründeten Familien, aber auch sie fahren heute nach Oranienburg und Hennigsdorf zur Arbeit und betrachten ihre Heidesandparzelle nicht mehr als den Nabel der Welt, sondern als ein besonders schönes Wohngebiet von Oranienburg, dem sie inzwischen eingemeindet sind.
Familie Tennius ist ein typisches Beispiel: Sohn Dieter ist Lehrer. Als man in Oranienburg einen stellvertretenden Bürgermeister suchte, überzeugte man ihn, dass es für den abgelegenen Wohnbezirk nur von Nutzen sein könne, im Rat der Stadt einen Fürsprecher zu haben. Wenn er mal nicht zur Sitzung muss und Frau Ingrid keine Hausaufgaben fürs Fernstudium in Finanzökonomie zu machen hat, widmen sie sich den Kindern Dirk, Jens, Sven, Ilka und dem Riesengarten. Aber das Unkraut siegt so manches Mal über den Ordnungssinn der Familie, und das kann gar nicht anders sein, wenn der Horizont etwas weiter reicht als bis zum Gartenzaun.
Dieter Tennius möchte gern das Gelände am Bootshafen zu einem Naherholungsgebiet gestalten. Es gibt verschiedene Konzeptionen, die einen verlangen mehr Geld, die anderen mehr Eigenleistungen. Doch die Edener reißen sich nicht darum, mit ihren Schweißtropfen den Badestrand zu netzen, an dem sich auch die Oranienburger aalen werden. Ja, wenn man noch wie früher unter sich wäre …
Vergleiche mit früheren Zeiten bringen nichts ein. Als die Edener noch barfuß mit dem Handwagen durch den Sand zockelten, um das Obst zur Mosterei zu bringen, genügte ein Mann für die ganze Siedlung, der mit einem Wägelchen voll Schlacke unterwegs war, um die Wegelöcher zuzuschütten. Wie soll der arme Mann heute mit seinem Schlackewägelchen nachkommen, wenn statt der Barfüßler schwere Laster die Wege benutzen? Lastwagen bringen und holen jährlich Millionen Flaschen mit Obst- und Gemüsesäften aus dem Edener Betrieb. Aus der alten Mosterei wurde ein Versorgungsdepot für Landmaschinen. Lastwagen sind ständig unterwegs, um Ersatzteile zu bringen oder abzuholen. Nicht umsonst verglich sich der Schlackemann mit Sisyphus, bis ihm das Kombinat für Landtechnik zu Hilfe kam. Es half nicht nur mit Schlacke, es half auch bei der Rekonstruktion alter Edener Häuser und des Bootshafens. Wer die Technik hat, der ist fein raus. Wer pfiffige Technologen und Neuerer als Nachbarn hat, der ist es doppelt. Nicht wenige Leute vom Kombinat wohnen in der Siedlung, Parteisekretär Paul Paschold zum Beispiel. Er bekam das älteste Haus zugewiesen, Baujahr 1893. Manch Alteingesessener lugte da neugierig über die Hecke: „Mal sehen, was der aus diesem Bröckelkasten macht!“
Paschold blieb gar nichts anderes übrig, er musste Haus und Garten in ein Schmuckkästchen verwandeln. Anerkennung geht manchmal seltsame Wege, wenn’s sein muss, übers Blumenbeet.
Auf der Suche nach einem waschechten Edener geraten wir an Gerhard Matthä. Ohne einen Lotsen durch das verzweigte System der Wald- und Feldwege hätte ich das Häuschen schwerlich gefunden. Schon im Flur duftet es nach Äpfeln, und wir bekommen auch gleich ein paar saftstrotzende Delicious angeboten. Unser Gastgeber ist achtundsechzig, ein Edener Original. Er schildert Eden aus seiner Sicht.
„Ich stamme aus einer Beamtenfamilie, war aber als Kind schon ein schwarzes Schaf, weil ich den Kindergottesdienst schwänzte und lieber spazieren ging. Ich trank nicht, rauchte nicht, und als 1921 die Reformhäuser gegründet wurden, befasste ich mich zum ersten Mal wissenschaftlich mit gesunder Ernährung. Nur es nützte mir nicht viel, weil ich arbeitslos wurde. Da musste man froh sein, wenn man überhaupt was zu knabbern hatte. Ich hörte von Eden und dachte, das müsste so eine ideale Vereinigung edler Geister sein. Aber die wollten mich gar nicht. Arbeitslose hätten sie schon genug, schrieben sie mir. Na, ich bin doch hin und hab beim Gärtner Meerschank für Kost und Logis gearbeitet. Mit der Zeit stellte ich fest, dass auch hier nur mit Wasser gekocht wurde. Die Leute waren keine Engel. Einer liebte Singvögel so sehr, dass er alle Katzen umbrachte. Manche verabscheuten nicht nur Fleisch, sondern auch Milch und Eier. Als ich ihnen vorhielt, das könne zu Leberstörungen führen, entgegneten sie, die Kuh fräße auch nur Grünes und gäbe doch fette Milch. Ich dachte, der ist zwar ein Rindvieh, aber zwei Mägen hat er nicht. Er vertrug das Grünzeug eine Weile, dann ging er ein.
1933 haben die Nazis in der alten Brauerei in Oranienburg das erste KZ in Deutschland eingerichtet. Die Kommunisten aus der Siedlung wurden verhaftet, alles anständige Leute wie der ‚unverbesserliche Aufrührer' Kurt Hintze. In den Augen der Nazis mag er wirklich unverbesserlich gewesen sein. 1923 hatte er den Vorsitz im Arbeitslosenrat, er gab die Wochenzeitschrift ,Das Rote Echo' heraus, holte sogar den Roten Geiger Soermus her, und als seine Partei verboten wurde, sammelte er Groschen und Pfennige für die Frauen und Kinder der verhafteten Genossen, bis sie ihn selber abholten … In zehn Zuchthausjahren versuchten sie vergebens, ihm seine rote Seele aus dem Leibe zu prügeln, aber nur sein Trommelfell ging dabei kaputt. Das war Kurt Hintze.
Ich hab mich ja nicht so um Politik gekümmert und mich da rausgehalten, so gut es ging. Nur am Schluss musste ich noch zum Volkssturm. Wir sollten die Nachhut der SS bilden, ihr den Rückzug freihalten. Wir latschten ihnen hinterher, nicht zu schnell, bis sie uns aus den Augen verloren, da machten wir kehrt, und ab nach Hause. Über unsere Siedlung war die Front schon weggegangen. Auf unserem Grundstück hatten sie ein 8,8-cm-Geschütz eingebuddelt und ’ne 2-cm-Flak, da können Sie sich vorstellen, wie der Garten aussah. Meine Frau heulte, ich hab gesagt, sind wir darüber hinweggekommen, dass uns Heinkel das Wasser abgegraben hat, werden wir wohl auch hiermit fertig werden. Na, und heute sehn Sie nichts mehr von der Mondlandschaft. Aber es ist schon ’ne Viecherei mit dem Gießen und Düngen. Das zahlt sich eigentlich nicht mehr aus …“
„Und warum geben Sie nicht auf?“
„Nee, aufgeben is nich. Nur anders muss man vieles machen, man sieht doch, dass es geht, seit der Betrieb volkseigen geworden ist. Ich bin kein Prophet, aber seit Rehbrücke sozusagen auf höchster Ebene für gesunde Ernährung plädiert, ist Eden wieder im Kommen. Ach, eh ich’s vergess, soll ich Ihnen mal was ganz Feines anbieten, Rote- Rüben-Saft auf Milchsäurebasis? Ist sehr gesund und wirkt tumorhemmend!“
Mein Begleiter blinzelt mich vielsagend an. Das hat man davon, wenn man bei Vegetariern zu Gast ist. Das Angebot abzuschlagen wäre unhöflich. So nippen wir denn an einer Flüssigkeit, die Drachenblut ähnlich sieht, und in der Tat, sie schmeckt wirklich sehr – gesund. Als Herr Matthä jedoch die Vorzüge von Rettich- und Huflattichsaft zu preisen beginnt, verlassen wir geschwinde das gastliche Haus.
Zwischen Eden und Oranienburg liegt der Luisenhof, ein Begriff für jeden Agronomen. Vor hundert Jahren stützte sich die Schule in ihren Vorlesungen auf die fortschrittlichen Lehren des Landwirts und Wissenschaftlers Daniel Albrecht Thaer, doch dieses Wissens teilhaftig werden konnte nur, wer für Unterricht, Kost und Logis jährlich dreihundertfünfzig Taler auf den Tisch des Hauses legte. Im Kuratorium saßen adlige und bürgerliche Rittergutsbesitzer, die hier ihre Verwalter und Inspektoren ausbilden ließen. Von 1925 an nahm die Anstalt auch Mädchen auf; sie wohnten separat und wurden separat unterrichtet, im Kochen, Backen, Waschen, Plätten, Einkochen und Servieren, in Gartenbau, Viehzucht und häuslicher Buchführung, eben in allen Disziplinen, für die sie von der Natur aus geschaffen sein sollten.
Der Luisenhof hatte seine Schüler von jeher so ausgebildet, wie sie der jeweilige Staat brauchte: als Verwalter von Rittergütern, als Wehrbauern für den „deutschen Osten“, Kriegsversehrte als Aufseher über ausländische Feldsklaven auf deutschen Höfen, alles mit dem Anspruch, eine „unpolitische Anstalt“ zu sein. Für die Luisenhofer von heute ist das graue Vorzeit, denn ihr Staat braucht keine Aufseher, sondern gebildete Beherrscher der Landwirtschaft.
Die gutnachbarlichen Beziehungen zur Agrar-Ingenieur-Schule und zum Kombinat für Landtechnik bewirkten eine Art Frischzellenkur für die Siedlung Eden; alte, überlebte Traditionen sterben aus, die guten Edener Sitten aber, wie die Bewegung „Leb gesund und beweg dich“, werden wie eh und je gepflegt. Auch die Volksfeste feiern fröhliche Auferstehung. Im Bierzelt war beim letzten Sommerfest kaum noch ein Stehplatz zu haben, das brutzelnde Wildschwein am Spieß verführte mit seinem Duft manchen Huflattichesser zu sündiger Völlerei. So streng sind die Edener Bräuche nicht mehr, denn schon der alte Wilhelm Busch bemerkte:
Ach, es kann der Heiligste nicht widerstehn,
wenn die Versuchung nur hübsch kräftig kommt …
Schorfheidestadt Joachimsthal
September. Auch wenn die Sonne manchmal noch brennt wie im August, man spürt es allenthalben: Der Sommer hat einen Knacks bekommen, er rutscht langsam, aber unaufhaltsam den Bornberg hinunter. Zwar bewahren die Buchen noch standhaft ihr Grün, der Ahorn dagegen hüllt sich schon in leuchtendes Orange, und die Birke streut spielerisch lichtes Gelb dazwischen. Die Herbstsaison beginnt. Schwalben bilden auf ihrem Flug nach Süden rätselhafte Zeichen am Himmel. Biber nagen sich neue Stützbalken für ihre Wasserburgen zurecht, und in der Dämmerung hallt der Brunftschrei der Hirsche. Das ist die richtige Zeit, um in die Schorfheide zu fahren.