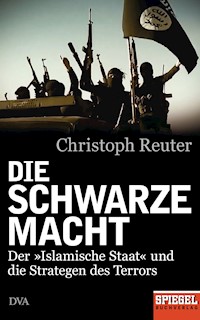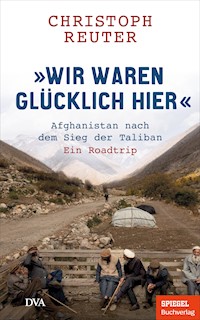13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Zwischen Haushalt und Terror: Als deutsche Dschihadistin beim IS
Maryam A. ist Mitte zwanzig, als sie 2014 mit ihrem Mann nach Syrien reist, um sich dem »Islamischen Staat« anzuschließen. Doch das Leben im »Kalifat« ist nicht geprägt von Glauben und Gemeinschaft, wie sie sich erhoffte. Stattdessen erlebt sie Terror, Gängelung und ständige Bombardierungen sowie den zermürbenden Kleinkrieg der Dschihadisten untereinander. Unter Lebensgefahr gelingt es ihr zu fliehen, aber bis heute muss sie versteckt in Nordsyrien leben – während die Hoffnung auf eine Rückkehr nach Deutschland schwindet.
Bestsellerautor Christoph Reuter hat Maryams Bericht über ihre Zeit beim »Islamischen Staat« aufgeschrieben. Ihre Erinnerungen erlauben bislang unbekannte Einblicke in das Innenleben des IS und sind zugleich eine schonungslose Abrechnung – mit der eigenen Verblendung sowie mit der Grausamkeit und Scheinheiligkeit jener ausländischen Dschihadisten, die in den letzten Jahren ins »Kalifat« gereist sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Ähnliche
Zum Buch
Warum entschließt sich eine junge Frau aus Deutschland, nach Syrien zum »Islamischen Staat« zu reisen? Weil zuhause alles schiefgegangen ist? Aus Glaube, aus Liebe oder aus Naivität? Im Sommer 2014 reist Maryam A. mit ihrem Mann nach Syrien, zwei Jahre wird sie im »Kalifat« leben. Der IS ist in dieser Zeit auf dem Höhepunkt seiner Macht, doch für die junge Deutsche beginnt eine Odyssee zwischen Luftangriffen und IS-Hinrichtungen von »Verrätern«, zwischen Angst und eigener Unmenschlichkeit, zwischen banalen Sorgen und absurden Fragen des Alltags im Terrorstaat. Immer wieder das Quartier wechselnd, trifft sie Fanatikerinnen und Verstörte, eine amerikanische Agentin und verzweifelte Witwen. Nach monatelangen Vorbereitungen gelingt es ihr 2016, in einer mondlosen Nacht zu fliehen. Sie ist dem IS entkommen, doch in Sicherheit ist sie nicht.
Zum Autor
Christoph Reuter, geboren 1968, berichtet seit Jahrzehnten aus den Krisenregionen der islamischen Welt, zunächst für »Die Zeit« und den »Stern«, seit 2011 für den SPIEGEL. Neben preisgekrönten Reportagen veröffentlichte er mehrere Bücher, darunter »Mein Leben ist eine Waffe« (2002) über Selbstmordattentäter. Für seine Recherchen über den »Islamischen Staat« wurde er u.a. als »Reporter des Jahres« ausgezeichnet, für seinen Bestseller »Die schwarze Macht« gewann er den NDR Kultur Sachbuchpreis des Jahres 2015.
Christoph Reuter
Maryam A. Mein Leben im Kalifat
Eine deutsche IS-Aussteigerin
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München, und SPIEGEL-Verlag, Hamburg, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotiv: © Peter Macdiarmid / Getty Images
Typografie und Satz: DVA/Andrea Mogwitz
Satz und E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-20735-9V004
www.dva.de
Inhalt
Zur Entstehung dieses Buches Ein Vorwort von Christoph Reuter
Prolog Wo anfangen?
Kapitel 1 Eigentlich wollte ich nie dorthin
Kapitel 2 Willkommen im Kalifat
Kapitel 3 Wegen jeder Bombe anrufen?
Kapitel 4 Das Leben in Ra’ei
Kapitel 5 Tod und Umkehr
Kapitel 6 Wie komme ich hier weg?
Kapitel 7 Gewissensbisse
Kapitel 8 Auf dem Dorf und unter Beschuss
Kapitel 9 Die Flucht
Kapitel 10 Im Niemandsland
Epilog Ein paar Worte an die Anhänger des IS
Die Fakten Ein Nachwort von Christoph Reuter
Glossar
Dank
Zur Entstehung dieses BuchesEin Vorwort von Christoph Reuter
Am Anfang stand die Frage: Geht das überhaupt? Kann man einer Person, die immerhin zwei Jahre lang beim »Islamischen Staat« in Syrien war, einfach den Raum geben, ihre Geschichte zu erzählen? Würde jemand, der freiwillig zu dieser ebenso furchtbaren wie intelligenten Terrororganisation gegangen ist, nicht entweder sich selbst von aller Schuld freischreiben oder den IS in ein milderes Licht rücken wollen?
Wer viel zum IS schreibt, schreibt über ihn. Wenn dessen Mitglieder zu Wort kommen, dann für gewöhnlich eingehegt ins Fragenkorsett eines Interviews. Wer in den vergangenen Jahren in deutschen Gerichtssälen die Einlassungen deutscher IS – Ausreiser verfolgte, wird Misstrauen für angebracht halten: Unisono reden die nach ihrer Rückkehr festgenommenen Männer ihre Rolle klein. Sie hätten die ganze Zeit nur die Gartenbeete gewässert, den Gefangenen Tee gekocht und so weiter.
Aber nun kam von langjährigen Quellen in Syrien die Anfrage: Bei ihnen wohne eine Deutsche, der sie über mehrere Monate bei ihrer Flucht aus dem IS – Gebiet geholfen hätten. Die sei, wie sie sagten, fertig mit dem Kalifat, sei da 2014 zwar freiwillig hingegangen – aber habe jetzt nur noch weggewollt. Im Sommer 2016 entkam sie schließlich mit ihrer Hilfe und sei nun bereit zu erzählen.
Es folgten lange Gespräche mit ihr über ihre Motive, das Erlebte und vor allem die Gründe, überhaupt zum IS zu gehen. Sie saß, sitzt Ende 2017 immer noch im Gebiet der Rebellen fest, die sowohl gegen den syrischen Diktator Baschar al-Assad wie gegen den IS kämpfen. Rasch war klar, dass die Geschichte einer konvertierten Deutschen beim IS nur verständlich werden könnte als Geschichte ihres ganzen Lebens.
Vieles würde sich überprüfen lassen, aber nicht alles. Was es erleichterte, war der Umstand, dass es um eine Frau ging: Männer, die in den Militärapparat des IS eingebunden waren, haben im Zweifelsfall gemordet, geschossen, gefoltert. Aber die zugereisten Ausländerinnen beim IS waren Teil einer viel weiter reichenden Planung, als al-Qaida und andere Radikalengruppen je erwogen: den eroberten »Islamischen Staat« mit Fanatikern aus aller Welt zu bevölkern, die eine neue Generation bedingungslos loyaler Untertanen hervorbringen sollten.
In seinen Propagandavideos nahm die Werbung für das Familiendasein inklusive (von anderen geraubten) Häusern, Schulen und Heiratsbeihilfen mehr Raum ein als Hinrichtungsvideos. Nur wurde selten darüber berichtet.
So kamen nicht nur Männer, sondern auch Paare, sogar Familien und alleinreisende Frauen zum IS. Einige der Frauen wurden als Mitglieder der Frauenpatrouillen Teil des Unterdrückungsapparats. Aber die meisten waren: Hausfrauen im Kalifat, sollten Kinder kriegen und ihrem Gatten ein wohliges Heim bieten. Wie auch Maryam A., so ihr Pseudonym, die mit ihrem deutsch-türkischen Mann im Sommer 2014 nach Syrien reiste.
Mittendrin, aber doch nicht ganz dabei: Dies war eine Perspektive, die gangbar erschien für das Wagnis. In monatelangen Gesprächen über die brüchigen Internetverbindungen Nordsyriens, aus Fragmenten, die Maryam A. selbst schrieb, und rekonstruierten Chatprotokollen entstand dieses Buch, so offen und akribisch, wie noch keine deutsche Konvertitin über ihren Weg zum IS gesprochen hat. Es bleibt die Lücke, dass Maryam A. ihre Identität (und die ihrer Familie) nicht veröffentlichen will. Es bleiben verstörende Momente bei der Lektüre, etwa mit welcher Menschenverachtung deutsche IS – Frauen in ihren Chats über versklavte Jesidinnen plaudern. Es bleiben die Widersprüche von Maryams Slalom-Biografie, erst aus eigentlich unspektakulären Gründen und einer empfundenen Ausweglosigkeit zum IS zu gehen – ihm aber zwei Jahre später unter Lebensgefahr wieder zu entkommen. Und dann die Flucht in allerletzter Minute beinahe daran scheitern zu lassen, dass sie nicht ohne ihre zwei Katzen fliehen will.
Aber das ist eben Wirklichkeit. Der schlingernde Parcours zwischen Tod und Toffifee, Witwen-WGs und Zickenkriegen ermöglicht einen dichteren Blick auf das wirkliche Dasein. Darauf, dass die Wünsche und Vorstellungen vieler deutscher Ausgereister eben nicht durchdrungen waren von terroristischem Eifer und ausgefeiltem Wahnsinn. Sondern von einem Spießer-Idyll im Terrorstaat.
PrologWo anfangen?
Seit geschlagenen zwei Stunden laufe ich über steinige Äcker.
Vor mir der Schmuggler und zwei weitere Männer.
Neben mir zwei Frauen.
Ich male mir aus, was passiert, wenn plötzlich eine Gruppe IS – Kämpfer auf uns aufmerksam wird.
Das wäre das Todesurteil für unseren Schmuggler, bei dessen Familie ich die letzten fünf Tage versteckt leben musste.
In Gedanken versunken sehe ich, wie Abdullah, unser Schmuggler, die Hand hebt, um uns zu sagen, dass wir stehen bleiben sollen. Sofort gehen alle in die Hocke.
Nachdem sich mein Atem beruhigt hat, höre ich, wieso wir nun auf dem Feld hocken. Das Knacken und Rauschen eines Funkgerätes. Dazu mehrere Männerstimmen.
Ein Wachposten des IS. Ganz in unserer Nähe.
Kurz darauf nähert sich auf der Landstraße hinter uns ein Auto. Neben mir legt sich eine der Frauen ganz flach auf den Boden.
Es ist eine warme Augustnacht. Man hört immer mal wieder das Bellen der vielen Straßenhunde.
Vor uns sieht man die türkische Grenze. Hell beleuchtet.
Ich denke an die Tage in der Türkei, bevor ich nach Syrien kam.
Auf der türkischen Autobahn, 100 Kilometer vor Gaziantep, stand »Aleppo« auf den Schildern. Das war endgültig der Moment, in dem ich mir das erste Mal in meinem Leben gewünscht habe, dass mich die Polizei anhält, einbuchtet und zurück nach Deutschland abschiebt.
Doch das ist nicht passiert.
Und nun ist dieser Wunsch mehr als zwei Jahre her.
Das leise Flüstern der Männer macht mich müde.
Wir laufen etwa hundert Meter neben einer Landstraße.
Plötzlich ein lauter Knall. Blitzschnell wieder auf den Boden.
Ein zischendes Geräusch. Wir wissen, dass in weniger als zwei Sekunden etwas einschlagen wird.
Wo es genau landet, ob es uns direkt trifft oder wir nur Splitter abbekommen, ist ungewiss.
Fakt ist allerdings: Wir wurden entdeckt.
Sie haben etwas Großkalibriges auf uns abgefeuert.
Diese Zeilen aus meiner Zeit beim »Islamischen Staat« waren die allerersten, die ich vor einigen Monaten geschrieben habe. Der Anfang von dem, was nun ein Buch geworden ist. Dabei handeln sie von meinen letzten Momenten beim IS, genauer: von meiner Flucht aus dem Kalifat. Sie erzählen davon, wie ich es nach monatelangen Vorbereitungen endlich schaffte zu entkommen.
Warum ich beim Schreiben mit meiner Flucht anfing? Vielleicht, weil es mir am leichtesten fiel. Denn die Frage, warum jemand vor dem IS flieht, beantwortet sich jedem wie von selbst. Klar, nichts wie weg!
Die viel größere Frage aber lautet natürlich: Warum geht jemand überhaupt dahin? Wieso bin ich zum IS gegangen? Als Frau, als Deutsche, nicht verschleppt mit vorgehaltener Waffe, sondern letzten Endes: freiwillig. Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Vor allem ist sie: unangenehmer.
Wo anfangen? Dass es ein Fehler war? Ja, war es, klar. Aber das sagt sich ebenso rasch, wie sich die Flucht erzählen lässt. Und erklärt doch nichts.
Wo also anfangen? Dass ich als Kind sauer war auf meine zerbrochene Familie, keinen Bock hatte auf die Schule, irgendwann einfach nicht mehr hingegangen bin? Dass ich auf niemanden gehört habe und fand, dass mir niemand zuhört? Dass ich gekifft und in den Tag hineingelebt habe, aber dann einen Menschen traf, der mich verstand, einfach im richtigen Moment da war und Großzügigkeit zeigte? Dass dieser Mensch Muslim war und mich neugierig machte auf den Glauben?
So ist mein Leben verlaufen, bis ich 19 war und zum Islam konvertierte. Eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, als Lebensinhalt, nicht um irgendwohin zu gehen und Bomben zu werfen.
Wo soll ich weitermachen? Dass ich aus Dummheit einen Mann geheiratet habe, vor dessen Verwandtschaft ich am Ende ins Frauenhaus floh? Dass ich mich dann verliebte in einen anderen Mann, dessen türkische Mutter mich hasste, weil ich eine Deutsche und keine Türkin war? Dass wir als Paar keine Jobs hatten, kein Geld, keine Wohnung? Dass wir beide, er und ich, empört waren über die Gleichgültigkeit in Deutschland gegenüber dem Grauen in Syrien? Und dass er dann an die falschen Leute geriet, die ihm versprachen, uns den richtigen Weg zu weisen? Dass ich schließlich mitging aus Angst, ihn sonst zu verlieren?
Ich kann die Frage »Warum bist du zum IS gegangen?« nicht einfach beantworten. Denn es gibt die eine, klare Antwort nicht. Es gab eine ganze Reihe von Schritten, Entscheidungen in meinem Leben, durch die ich erst in die Lage gekommen bin, diesen letzten Schritt zu tun. So wie es viele kleine Dinge in jedem Leben gibt, die einen dazu bringen können, saudumme Entscheidungen zu treffen. Die meisten dieser Entscheidungen kann man rückgängig machen, oder zumindest kann man ihre Folgen wieder in Ordnung bringen. Andere ruinieren dein Leben.
Das entschuldigt nichts. Aber vielleicht erklärt es ein wenig, warum diese letzte Entscheidung für die Reise nach Syrien damals nicht Ergebnis eines kometenhaften Sinneswandels war, keine plötzliche Eingebung, ab heute alle Ungläubigen abknallen zu wollen, nein. Sondern, warum es sich damals anfühlte wie bloß ein weiterer Schritt in die falsche Richtung, als alles sowieso beschissen war. Als es keine richtigen Schritte gab, weil wir beide, mein Mann und ich, das Gefühl hatten, überall vor Mauern zu rennen.
Wären nur ein paar Dinge in unserem Leben anders gelaufen, wäre unser Weg ein anderer geworden. Wenn man zurückschaut, erscheint alles so klar: Hier bist du falsch abgebogen, dort hast du einen Fehler gemacht. Aber wenn man mittendrin ist, kann man es nicht so klar sehen.
Wieder: keine Entschuldigung. Aber im Nachhinein wünsche ich mir, dass jeder Mensch im Leben eine Person hat, die ihm sagt: »Hör mal, das, was du tust oder tun willst, ist falsch! Du schadest dir oder anderen damit!« Einen Menschen, der einfach da ist für einen in schweren Zeiten und, ja, der weiter denkt, als man es selbst tut in solchen Momenten.
Dass ich 2014 letztlich mit meinem Mann nach Syrien gegangen bin, um ihn nicht zu verlieren, aber dann 2016 ohne ihn geflohen bin, ist das Furchtbarste. Es ist meine ganz persönliche Hölle der Schuld: dass ich mir seit meiner Entscheidung zur Flucht immer wieder denke, ohne mich wäre er gar nicht erst zum IS gegangen. Obwohl er angekündigt hatte, auch alleine zu gehen, wenn ich nicht mitkäme.
Damals war ich zu schwach, habe, anstatt Nein zu sagen, bei jeder Passkontrolle, auf jeder Autobahn zwischen Frankfurt und Gaziantep gehofft, dass sie uns rauswinken, anhalten, durchsuchen, festnehmen und zurückschicken. Aber niemand hat uns aufgehalten auf unserem Weg zum IS.
Als ich endlich stark genug war zu gehen, konnte ich meinen Mann nicht retten. Ich konnte es ihm nicht einmal ins Gesicht sagen, dass ich ihn im Stich lassen werde, obwohl ich ihn liebe. Er wollte nicht fort, das wusste ich. Und ich hatte zu viel Angst, dass er auch mich nicht fortlassen würde. Mich habe ich gerettet. Ihn nicht.
Ich hoffe, dass dieses Buch hilft zu verstehen: mich, aber auch andere, die einen ähnlichen Weg gegangen sind, die ihre Fehler eingesehen und oft teuer für sie bezahlt haben. Vielleicht hilft es, uns nicht alle als wahnsinnige Terroristen abzustempeln. Und hoffentlich hilft es anderen, nie, nie einen solchen Weg einzuschlagen.
Kapitel 1Eigentlich wollte ich nie dorthin
Ich bin von meiner Mama weg, als ich zehn war. Da hatte ich schon seit sieben Jahren keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Außerdem verstand ich mich mit dem neuen Mann meiner Mutter nicht. Ich war genervt, frustriert von meiner Familiensituation. Zusammen mit meiner kleinen Schwester zog ich dann zu meiner Patentante, die in einer anderen Stadt lebt. Aber wir kamen nicht gut miteinander aus, ich war einfach durch den Wind, habe mich komplett zurückgezogen, war wie ein Buch mit hundert Siegeln. Keiner konnte mir nahekommen, in der Schule habe ich auch nur gemacht, worauf ich Bock hatte: Sprachen. In Deutsch hätte ich eine Eins, meinte der Lehrer, wenn ich je meine Hausaufgaben machen würde. Physik, Bio, Chemie, das habe ich alles vergeigt. Ich hatte keine Lust, habe es nicht verstanden, und es war mir egal.
Meine Patentante hat sich dann ans Jugendamt gewandt, denen gesagt, wir haben hier nur Streit, ich kann ihr nicht helfen. Die hatte ja auch noch eigene Kinder. Wir haben uns zusammengesetzt, und die Lösung war, dass ich mit 14 wieder zurück nach Frankfurt zog, wo ich ja herkam, allerdings in ein Projekt für betreutes Wohnen. Das war ein ganz normales Wohnhaus, zwölf Zimmer, Büro, Küche. Mit zwölf, 13 konnte man da schon einziehen. Es war immer jemand da, an den ich mich wenden konnte, ganz familiär. Ich bin dann auf die Gesamtschule gegangen. Naja, ab der neunten Klasse nicht mehr, da bin ich eher mit Freundinnen ins Café gegangen.
Die Schulleitung hat mich vor die Wahl gestellt: Entweder ich bekomme einfach ein Abgangszeugnis, oder ich wiederhole das ganze Jahr. Ich wählte das Abgangszeugnis. Das war dumm von mir. Heute sagt sich das so leicht. Damals war ich sorglos, wütend, und es gab niemanden, der mir einen Weg zeigte. Weil niemand da war? Oder weil ich mir von niemandem etwas sagen lassen wollte? Beides. Ich hatte keinen Respekt vor den Betreuern, habe lieber den ganzen Morgen irgendwo im Café gesessen mit Freunden. Ja, ein bisschen war das so wie im Klischee von den haltlosen Jugendlichen, die später im Dschihad landen.
Ich habe dann ein paar Praktika gemacht, im Kindergarten, in einer Drogerie, aber hatte immer wieder Stress dort, habe gekifft, bis die Betreuer vom Jugendamt mir eine eigene Wohnung in Frankfurt vermittelt haben.
Das war mein Untergang.
Man kann eine Jugendliche aus kaputten Verhältnissen nicht einfach in eine eigene Wohnung ziehen lassen. Ich hätte jemanden gebraucht, der mich an die Hand nimmt, aber dieses »Mach, was du willst« war für mich eine Katastrophe. Im Nachhinein hat mich das furchtbar geärgert, weil ich eigentlich kein blöder Mensch bin.
Ich habe gejobbt, in einem Internetcafé, als Kellnerin, da war ich schon 18. Nach kurzer Zeit zog eine Gleichaltrige aus Hamburg bei mir ein, wurde meine beste Freundin. Wir haben uns gegenseitig runtergezogen. Als sie anderthalb Jahre später wieder zurück nach Hamburg zu ihrer Oma zog, habe ich sie dort wochenlang besucht. Wir haben gemeinsam gekifft und unsere Chill-Sessions eben nach Hamburg verlagert. Damals war es witzig. Aber so ein Leben wünscht man doch keinem, einfach so in den Tag hineinzuleben. Mal habe ich gekellnert, mal ging ich zum Jobcenter, mal habe ich ein bisschen Gras, aber auch nur Gras, verkauft, irgendwie war immer ein bisschen Geld da. Genug zum Leben.
Einmal waren wir beide die ganze Nacht feiern, völlig zugedröhnt. Ich lag dann am Samstag bei mir zu Hause und hatte solches Herzrasen, dass ich mich überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Mir war gleichzeitig heiß und kalt. Da habe ich mir gesagt: Es reicht! So geht es nicht mehr weiter.
Zu dieser Zeit habe ich einen marokkanischen Freund kennengelernt, ganz harmlos, auch später waren wir nie zusammen. Saryuh, so möchte ich ihn hier nennen, hat mir gesagt: »Was machst du da eigentlich? So kann man doch nicht leben! Willst du so weitermachen, bis du mit 30, 40 irgendwann auf der Straße landest? Du bist doch nicht dumm! Sonst könnte ich das verstehen, aber so? Du gehst morgen zum Amt, meldest dich und nimmst an einer Maßnahme teil!«
Das war mir eine Horrorvorstellung, morgens um sieben aufzustehen und um acht auf den Plastikbänken beim Amt zu hocken. Aber ich habe es gemacht. Also, zumindest die Maßnahme. Für eine Weile, bis ich wieder abgestürzt bin, mich von einem Gelegenheitsjob zum nächsten gehangelt habe. So richtig fest irgendwo angestellt habe ich nie gearbeitet, bevor ich nach Syrien gegangen bin.
Saryuh war als Wirtschaftsflüchtling nach Deutschland gekommen. Anfangs hat er auf Parkbänken geschlafen, erzählte er mir. Aber er hat sich durchgebissen, das hat mir imponiert. Es gibt Menschen, die sind einem auf Anhieb sympathisch. Ich war nicht unbedingt verliebt, aber er hat mich fasziniert, er war klug, hilfsbereit. Einmal kam mein Geld vom Amt später als erwartet. Da hat er mir seine letzten zehn Euro gegeben. Ich habe ihm gesagt: Du spinnst doch. Aber er meinte: »Nee, ist okay. Die Monatskarte ist bezahlt, ich komme schon durch.«
Ich wollte wissen, woher kommt diese Großzügigkeit? Diese Hilfsbereitschaft? Warum ist der so?
Saryuh war der Mensch, den ich zehn Jahre früher gebraucht hätte. Er hat mir ein bisschen über den Islam erzählt, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Gerade genug, um mein Interesse zu wecken. Von diesem ganzen radikalen Kram hatte ich da noch nichts gelesen, hatte keinen Schimmer vom Dschihad. Im Islam, wie Saryuh ihn mir erklärte, ging es um Hilfe, um Gastfreundschaft, ums Füreinander-Einstehen, solche Sachen. Ein marokkanischer Freund von ihm, der immer ins Internetcafé kam, in dem ich manchmal jobbte, hat mir dann eine CD gegeben, auf der jemand über den Sinn des Lebens aus islamischer Sicht erzählte. Und ein Buch über den Propheten, naja, eher ein Heft. Da ging es zwar auch um Kriege, aber nur am Rande, nicht so wie später in Syrien, wo ich die Ermordeten gesehen habe, die tagelang am Wegrand neben unserem Haus aufgestapelt liegen blieben. Es ging in der CD und dem Buch mehr um die Charaktereigenschaften des Propheten, solche Sachen.
Das klang gut, vor allem, weil ich sehen konnte, wie Saryuh seinen Glauben lebte. So ein Mensch wäre ich auch gerne, dachte ich mir damals. Er war einfach toll, so etwas wie meine beste Freundin, nur halt als Mann. Sonst war ich mit Männern zu dem Zeitpunkt gerade durch, die waren nur Katastrophen in Serie. Ich hatte gerade eine dreijährige Beziehung hinter mir, die endete, als mein Freund, der Idiot, in die Türkei abgeschoben wurde und ich ihm sogar noch hinterhergeflogen bin, dort mein Visum überzogen und dann Stress bei der Ausreise bekommen habe. Während ich um ihn kämpfte, hat er sich in der Türkei irgendwelche Touristinnen klargemacht. Hinterher war es mir ein Rätsel, was ich an dem mal gefunden habe. Dann verschimmel halt, dachte ich mir. Danach hatte ich erst mal genug von den Männern.
Als ich klein war, hatte ich an Gott geglaubt, konnte aber mit dem Christentum nichts anfangen. Als Kind verstehst du das alles ja sowieso noch nicht ganz. Die einen glauben an die Trinität, die anderen nicht, aber was hat das mit mir zu tun? Ich wusste nicht, was ich mit Religion in meinem Leben anfangen sollte. Aber dann kam diese CD. Die traf mich einfach zur richtigen Zeit.
Der Autor erklärte darauf den Sinn des Lebens, wieso so viele Leute in Europa mit Depressionen herumlaufen, nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, warum sie Alkohol trinken, Drogenprobleme haben. Oder warum andere den ganzen Tag arbeiten, um sich die Miete für eine Wohnung leisten zu können, in die sie nur zum Schlafen kommen, weil sie ja sonst die ganze Zeit arbeiten. Das hat mich einerseits genervt, andererseits dachte ich: Das ist doch meine Situation! Er hatte recht, also, zumindest mit der Bestandsaufnahme. Zugleich versprach der Autor, dass jeder Muslim sein kann, dass jeder willkommen ist. Das hat mich angesprochen damals, darin fühlte ich mich wohl.
Saryuh und ich sind immer noch gute Freunde. Aber im Gegensatz zu mir hat er es geschafft, lebt jetzt ein richtiges Leben, mit Familie, Kind, gutem Einkommen und so. Ich hingegen bin damals nach und nach in die salafistische Szene reingerutscht.
Mein Chef in dem Internetcafé, in dem ich jobbte, war Pakistaner, der meinte: »Wenn du konvertieren möchtest, kannst du das bei uns machen. Wir haben eine Moschee, die hat auch einen Frauenraum.« Mit 19 bin ich dann konvertiert. Und landete in einer Gemeinschaft, die mir näher war als meine Familie. Kurze Zeit nach meinem Übertritt standen dann im Internetcafé auf einmal zwei verschleierte Frauen vor mir. Ich dachte: »Scheiße, was wollen die denn von dir?« Da meinte die eine: »Wir wollten dir Bücher geben und dich einladen. Eine Freundin hat ein Kind bekommen, wir feiern am Sonntag, magst du auch kommen?« Die waren auch Konvertierte, eine Deutsche und eine Polin. Ich bin dann in deren Kreis geraten, wir waren meistens vier oder fünf, die in der einen oder anderen Wohnung zusammengehockt haben. Da waren Deutsche, Amerikaner, Polen, Afrikaner, wir haben zusammen gegessen, zusammen eingekauft, viel Zeit miteinander verbracht. Das erste Mal seit Langem hatte ich wieder einen einigermaßen geregelten Tagesablauf. Ich war zwar immer noch arbeitslos, bin aber morgens aufgestanden, habe die eine oder andere Freundin besucht, war mit ihr und den Kindern auf dem Spielplatz, wir haben zusammen gekocht, Kuchen gebacken. Kleine, alltägliche Dinge, aber die haben mir gutgetan.
In die Moschee bin ich damals nicht so oft gegangen, was vor allem daran lag, dass die einzige in der Nähe keinen Frauenraum hatte. Aber die Gebete habe ich befolgt, auch das Frühgebet. Im Winter war das okay, da wird es ja nicht so früh hell. Im Sommer war es schon hart, den Wecker auf vier Uhr morgens zu stellen. Aber danach konnte ich ja weiterschlafen. Ganz am Anfang habe ich nur ein Kopftuch getragen, nach einer Weile dann auch den Khimar: einen Überwurf, der nur das Gesicht frei lässt und den ganzen Oberkörper bedeckt. Den habe ich aber in verschiedenen Farben gehabt, nicht nur in Schwarz. Einen Niqab, also den dreilagigen Schleier, der wirklich nur die Augen frei lässt (oder sogar die, je nach Modell, noch bedeckt), habe ich erst nach einem halben Jahr angezogen. Und auch dann nur, wenn ich mit anderen verschleierten Frauen unterwegs war. Wenn wir zusammen Einkaufen gingen, war das okay, aber alleine war es schon hart, wegen der Reaktionen der Passanten, mit denen man als verschleierte Frau leider rechnen muss.
Einmal war ich in der S-Bahn in Frankfurt unterwegs, schon mit Niqab, da saß neben mir ein Typ mit Aktenkoffer, und gegenüber wollte sich eine Frau mit ihrer Tochter hinsetzen. Dann guckte die aber und sagte: »Nee, lass uns mal weiter vorne einen Platz suchen, bevor die uns hier noch alle in die Luft jagt.« Ich habe eine ziemlich große Klappe, und so einen Spruch wollte ich nicht auf mir sitzen lassen: »Gute Frau, ich weiß nicht, bei wem Sie Physik hatten. Aber wenn ich mich hier sprenge, gehen Sie auch hoch. Egal, wo Sie sitzen.« Da lachte der Typ mit dem Aktenkoffer los, und sie war baff. Ein anderes Mal im Bus quatschte mich eine Frau blöd an: Das sei doch verboten, so herumzulaufen. Da habe ich sie gefragt, warum ich denn dann im Bus säße und nicht im Knast. Ein paar Leute um mich herum fanden das jedes Mal lustig, weil einfach niemand damit rechnete, dass eine Frau unterm Niqab so gut Deutsch kann – und dann auch noch so austeilt.
Grundsätzlich, bei allem Stress, hatte der Niqab in Frankfurt einen unschlagbaren Vorteil: Niemand hat mich mehr blöde angequatscht, ob ich ihm meine Handynummer gebe. Naja, bis auf einen algerischen Taxifahrer am Hauptbahnhof, der aber auch gleich fragte, ob ich ihn heiraten wolle. Doch im Vergleich zu vorher: endlich mal Ruhe.
Ich bin ja nun keine Augenweide mit Modelmaßen, aber vor meinem Übertritt zum Islam reichte es manchmal schon, in Schlabberklamotten Zigaretten holen zu gehen, um dumm angelabert zu werden. So wie an einem Abend, als eine Freundin bei mir zu Besuch war und wir kiffen wollten, aber keine Zigaretten mehr hatten. Da haben wir Schnickschnackschnuck gespielt, wer zum Kiosk läuft und welche holt. Ich verlor, also bin ich los in Jogginghose, Oberteil und Schlappen nachts um halb zwei. Der Kiosk war nur drei Minuten entfernt. Kaum hatte ich eine Schachtel geholt, hörte ich hinter mir Schritte. Ich dachte, der will bestimmt schnorren, und hatte schon die Packung in der Hand. Da rief der: »Entschuldigung? !«
Ich: »Ja, was denn?«
Er: »Entschuldigung, hast du vielleicht Bock auf Sex?«
Ich: »Bist du noch ganz dicht?«
Er: »Ich frage doch ganz ehrlich und offen.«
Ich: »Ja, und jetzt verpiss dich, sonst trete ich dir die Nase ein, ganz ehrlich und offen.«
Da war er auch noch beleidigt. Zumindest solche Begegnungen blieben mir erspart, nachdem ich nur noch verhüllt unterwegs war.
Auf die Dauer wurde mir dieses enge Zusammensein mit den neuen Glaubensschwestern aber zu anstrengend, da ständig irgendjemand an mir herumnörgelte. Ich war neu konvertiert und konnte die Dinge, die ich vorher getan hatte, nicht auf Knopfdruck abstellen, also Musik hören, mit meinen alten Freundinnen abhängen, ohne Niqab ausgehen. Eine der anderen Konvertierten sagte dann garantiert immer: Das geht doch alles gar nicht! Außerdem hat mir eine von denen hinterherspioniert, wenn ich am Laptop war, den alle in der Wohnung benutzten, wo wir uns trafen. Da hat sie hinterher den Suchverlauf durchforstet, und zwar nur bei mir. Das war eklig, hat mich total abgeschreckt.
Und dann waren da ja auch noch meine alten Freunde und Freundinnen: Von denen waren auch viele Muslime, aber die haben gesoffen, gekifft, Drogen verkauft, da hat niemand gesagt: »Hey, werd Muslim, das ist gut!« Irgendwann dachte ich mir: Bleibe ich doch lieber mit denen zusammen. Muslima kann ich ja weiterhin sein! Und bin wieder in meine alten Gewohnheiten verfallen.
Dann kam ein alter Bekannter, bei dem ich in meiner frühen Kifferzeit immer mein Gras gekauft hatte, auf mich zu und hat lange geworben, dass ich doch seinen Cousin heiraten möge. Ich mochte den auch, aber vor allem tat er mir leid. Zwei seiner Brüder waren von den Taliban erschossen worden, die Mutter krank, der Vater tot. Dass die Familie ziemlich tief in zwielichtige Geschäfte verwickelt war, ahnte ich mehr, als dass ich es wusste. Aber das störte mich damals nicht groß, ich war ja Kunde. Und der kleine Cousin war auf den ersten Blick echt süß, auch wenn wir sonst kaum Gemeinsamkeiten hatten. Er war noch nicht lange in Deutschland. Wenn wir heiraten würden, müsste er zumindest keine Angst haben, abgeschoben zu werden. Also habe ich den geheiratet.
In der Rückschau war diese ganze Zeit eine Achterbahnfahrt: Mal hing ich mit meinen alten Kifferfreunden rum, mal bin ich zu einem mehrtägigen Salafistentreffen im Ruhrgebiet gefahren, habe da Abu Usama al-Gharib gehört, mit echtem Namen Mohammed Mahmoud: diesen ultraradikalen Österreicher, der schon früher mal im Irak gewesen war. Aus dessen Clique kam der Vorschlag, ob ich nicht Deso Dogg heiraten wolle, den Rapper, der damals immer bekannter wurde und später auch zum IS ging. Wollte ich aber nicht. Dabei hatte ich zwischendurch meinen afghanischen Mann schon verlassen, wohnte bei Freunden und Bekannten in Bonn und Solingen, für kurze Zeit sogar mal in einer Wohnung von Deso Dogg und einem seiner Freunde, die aber zu der Zeit woanders waren. Nach zwei Monaten bin ich dann doch wieder zurück zu meinem Mann. Deso Dogg habe ich erst in Syrien wiedergesehen, aber er hat mich nicht erkannt – wie auch, ich war ja vollverschleiert.
Warum ich mich überhaupt darauf eingelassen habe, den Afghanen zu heiraten? Das habe ich mich später selbst gefragt. Auch wenn ich konvertiert war und den gleichen Glaube hatte wie er, kamen wir doch aus komplett verschiedenen Kulturen. Zwar haben wir zusammengewohnt und gelebt wie ein richtiges Ehepaar, zumindest am Anfang. Aber wir waren einfach nicht auf einer Wellenlänge. Okay, er sprach Englisch und lernte ziemlich rasch Deutsch, aber er konnte nicht über meine Witze lachen, und ich nicht über seine. Das klingt vielleicht banal, aber wenn ich mich wegwerfe vor Lachen über etwas, und er sitzt nur daneben und guckt wie ein Auto, wird einem der Mensch fremd. Der Arme kam aus dem Niemandsland bei Kandahar und hatte keine Ahnung von gar nichts. Vielleicht hätte ich diese Ehe trotz allem weiterlaufen lassen, hätte ihm irgendwann einfach gesagt, dass wir nach getrennten Wohnungen schauen sollten, auch wenn wir offiziell verheiratet sind.
Ein halbes Jahr lang hatte ich zu der Frauengang der Verschleierten gar keinen Kontakt mehr gehabt, bis sich diejenige, die ich am meisten gemocht hatte, wieder bei mir meldete: Sie habe neu geheiratet und mit den anderen auch nichts mehr zu tun, ob ich sie nicht besuchen wolle?
Ohne dass es so geplant gewesen wäre, wurden diese Freunde für mich zu so einer Art Familie, die ich nie hatte. Sie war Deutsche, ihr Mann war Marokkaner. Da war kein »Du musst, du musst, du musst«. Ich habe mich einfach wohlgefühlt, viel mit deren Kindern unternommen. Ich hatte da meinen Platz.
Für eine kurze Zeit habe ich dann auch versucht, meinen Schulabschluss nachzuholen. Aber meine Klassenkameraden waren ein solcher Haufen von Spinnern, die da alle nur hingingen, um vom Jobcenter weiter ihre Kohle zu bekommen, dass ich es bald auch wieder geschmissen habe.
Meine Ersatzfamilie ist dann leider nach Ägypten umgezogen. Als ich wieder auf mich allein gestellt war, habe ich wieder angefangen zu kiffen, war mit alten Freundinnen unterwegs, mal zu Hause in der Wohnung, die ich übers Sozialamt bekommen hatte, mal am Main. Es war so trostlos.
Aber dann habe ich Ende 2012 meinen Mann kennengelernt, also den, in den ich mich wirklich verliebt habe. Das hat alles verändert. So ein Gefühl hatte ich seit Ewigkeiten nicht gespürt: dass da einer ist, mit dem es sich richtig und gut anfühlt.
Er war ein fröhlicher Mensch, 1991 geboren, Deutsch-Türke. Genauer: Er war in Hessen groß geworden, aber hat sich erst einbürgern lassen, als wir schon zusammen waren. Ich konnte mit ihm über ganz verschiedene Dinge reden, er war sehr gebildet für sein Alter. Und ein sehr hübscher Mensch war er außerdem noch. Aber was ich vor allem toll fand: Er war wirklich interessiert an mir! Er hat Fragen gestellt, sich für mich, auch für meine Familie interessiert. Zwischen uns hat einfach alles gepasst.
Als wir uns kennengelernt haben, hat er nicht mal gebetet. Wir sind Schischa rauchen gegangen, er war feiern, ich war halt kiffen, so ging das die ersten Monate. Seiner Familie war schnell klar, dass sich in seinem Leben etwas verändert hat: Er kam manchmal spät nach Hause, hat seinen Vater nicht bei der Arbeit abgeholt. Das hatte er sonst immer getan als guter Sohn, zumal die ganze Familie sich ein Auto teilte. Damit brachte er seinen Vater morgens zur Arbeit, fuhr dann zur Schule, oder jemand anderer übernahm den Wagen. Und um Viertel nach drei musste das Auto vor der Firma stehen, oder er musste seinen Vater eben abholen.
Natürlich war er von meinen Lebensverhältnissen überhaupt nicht begeistert: Dass ich noch mit dem Afghanen verheiratet sei, das ginge wirklich nicht, wenn wir zusammenbleiben wollten. Ich bin dann zur Familie des Afghanen gegangen und habe versucht, ihnen meine Lage zu erklären. Ein Cousin meines Noch-Ehemannes hatte mir damals Geld geliehen und gesagt, er wolle das gar nicht wiederhaben. Aber als ich nun die Scheidung einreichen wollte, ist er komplett ausgerastet: »Ich will mein Geld zurück!« Mein afghanischer Ehemann guckte still und traurig dem Streit zu wie ein Hund, dem man gerade einen Tritt verpasst hatte. Es hat mir sehr leidgetan. Aber es ging einfach nicht mehr.
Es wurde dann sehr hässlich. Sein Cousin drohte mir: Wenn mein Mann abgeschoben werde, gehe das nicht gut für mich aus. Früher war ich kein einziges Mal in der Nachbarschaft einkaufen, ohne dass ich einen von der Familie traf, kurz plauderte, »Hey, was geht ab?«, das war toll. Aber wenn man die auf einmal alle gegen sich hat, ist es natürlich nicht mehr lustig, auf Schritt und Tritt Angst haben zu müssen, einem Familienmitglied zu begegnen. Die suchten mich. Und ich hatte panische Angst vor ihnen, so wütend, wie ich den Cousin von meinem Ex erlebt hatte, als ihm klar wurde, dass der wegen mir seine Aufenthaltsgenehmigung verlieren würde. Ich bin schließlich in ein Frauenhaus in der Nähe von Offenbach abgehauen, aber das Irre ist: Offiziell sind wir immer noch verheiratet, da ich viel zu viel Angst hatte, die Scheidung durchzuziehen.
Da wohnte ich nun also im Frauenhaus, ohne Job, in einer fremden Stadt, und versuchte, mit dem Mann zusammenzukommen, den ich wirklich wollte. Was vor allem hieß: Ich versuchte, mit seiner Familie klarzukommen. Ich bin zwei Jahre älter als mein Mann und keine Türkin. Was nach Meinung meiner Schwiegermutter bedeutet: eine Schlampe. Er schlug vor, dass wir uns mal zu dritt treffen sollten, mit seiner Mutter. Da hat sie uns ausgefragt und wurde zunehmend angesäuert, als ich ihr erzählte, dass ich nicht mehr zu Hause bei meinen Eltern wohne. Vom Frauenhaus und der ganzen Vorgeschichte haben wir ihr erst gar nichts gesagt. Wenige Tage später hat sie trotzdem auf ihn eingeredet: »Ihr passt doch nicht zusammen! Ich suche dir eine Türkin, die auch jünger ist als du, eine, die besser passt.«
Er: »Nein, das will ich nicht!«
Daraufhin gingen die Probleme mit seiner Familie richtig los. Seine Mutter hat immer wieder versucht zu intrigieren, hat Sachen erfunden, die nicht stimmen konnten. Etwa: Sie kenne eine Freundin von mir, die habe ihr schlimme Dinge über mich erzählt. Ich wäre so eine Art Schlampe, die Männer überredet, für mich in den Krieg nach Afghanistan zu gehen. Die Nachbarn würden schon Unterschriften gegen mich sammeln. Dabei wohnte ich doch im Frauenhaus. Das ging so lange, bis sie ihn vor die Wahl stellte: wir oder sie.
Er hat das kurze Zeit mitgespielt, gesagt, okay, ich trenne mich von ihr. Aber er hat das nicht gut gespielt. Wir haben uns natürlich weiter getroffen, und seine Mutter hat in seinem Handy herumgeschnüffelt und es gemerkt. Daraufhin durfte er nicht mehr das Auto benutzen und ähnliche Schikanen mehr. Auch mich wollte sie unter Druck setzen: »Lass das, das passt nicht! Ich kann dich mit anderen Männern in Kontakt bringen, die kannst du heiraten!« Ich habe widersprochen, aber bin noch ruhig geblieben. Dann hat sein kleiner Bruder ihr das Handy weggenommen und losgebrüllt: »Hör mal, du kannst vielleicht meine Mutter verarschen, aber nicht mich!«
Da bin ich dann ausgerastet, habe in etwa geantwortet: »Hör mal zu, du kleiner Pisser! Erstens bist du etwa sechs Jahre jünger als ich, also mäßige dich! Außerdem haben wir uns noch nie getroffen, also lass das!« Das Telefonat endete damit, dass wir uns gegenseitig Prügel angedroht haben. Tja. Nun war Polen offen. Jetzt ging es richtig rund.
Als er nach Nürnberg zu seiner Einbürgerung musste, bestand seine Mutter darauf, ihn zu fahren, damit nur ja ich nicht mitkomme. Wir hatten keine Wohnung, kein Auto, kaum Geld, keine Perspektive. Es war alles zu viel.
Im Nachhinein sieht das komisch aus: Erst lässt sich mein Mann einbürgern in Deutschland, ein paar Monate später geht er zum IS. Aber diese paar Monate haben uns fertiggemacht. Zum Zeitpunkt der Einbürgerung, die vor allem seine Mutter wollte, drehten sich unsere Gedanken noch ausschließlich um die Wohnungssuche, darum, nicht mehr auf die Eltern und deren Auto angewiesen zu sein. Die Ausreise stand da noch überhaupt nicht zur Debatte. Aber dann begann unser Strudel in Richtung Abgrund.
An manchen Tagen, wenn mein Mann mich beim Frauenhaus abholte, war er einfach fertig mit der Welt. Dann kam es mir so vor, als hätte es auch nicht schlimmer sein können, wenn er seiner Mutter gesagt hätte: »Mama, ich bin schwul und will einen Mann heiraten!« Seine Familie war so absolut gegen uns. Immer wieder habe ich versucht, den Riss zu kitten, habe versucht zu beschwichtigen, wenn seine Mutter mich angerufen und beleidigt hat. Aber irgendwann ging es nicht mehr.
Ich war müde, habe ihm, wenn die Lage komplett aussichtslos schien, auch mal gesagt: Vielleicht sollten wir das lassen. Aber er hat dann immer »Nein!« gesagt und zu mir gehalten. 2013 haben wir dann recht diskret islamisch geheiratet. Auf dem Standesamt konnten wir schon deswegen nicht heiraten, weil ich von meinem afghanischen Mann ja nicht geschieden war. Allein davor, dass dessen Anwalt wüsste, wer mein Scheidungsanwalt ist, hatte ich Angst. Ich dachte, die kennen Wege herauszufinden, wo ich wohne. Nun jagte mich also die Familie meines nicht geschiedenen Ex-Mannes, während die Mutter des Mannes, den ich liebte, mich lieber tot sähe als an seiner Seite. Sie ist es einfach gewohnt, ihren Willen in der Familie durchzusetzen. Wo sie rübermäht, wächst erst mal kein Gras mehr.
Aber auch wir waren hartnäckig und wollten zusammenbleiben. Und mein Mann wusste, wie man seine Mutter zur Weißglut treibt. Aus Protest gegen sie, gegen den Krieg in Syrien, gegen alles letztlich, hat er sich einen Bart wachsen lassen, hat sich Misk bestellt, dieses Parfümöl, was sie natürlich wieder ärgerte. »Wieso riechst du wie ein dreckiger Araber?«, fauchte sie ihn an. Er hat sich einen Palästinenserschal bestellt, sie hat ihn weggeschmissen. Dass er sich mit dem Islam beschäftigte, Videos anschaute, Predigten las, hat sie geärgert. Aber was sollte sie gegen den Islam sagen? Er hat sie toben lassen, nicht noch weiter Benzin ins Feuer gegossen. Aber das hat sie nur noch fuchsiger gemacht. Wenn sie streiten will, und ihr Gegenüber will das nicht, rastet sie erst recht aus.
Nachdem wir geheiratet hatten, suchten wir nach einer gemeinsamen Wohnung. Um uns die Angebote in Frankfurt anzuschauen, konnten wir meistens nicht das Auto seiner Familie nehmen, sondern mussten mit der Bahn fahren. Aber das kostete von Offenbach hin und zurück 22 Euro, das konnten wir uns nicht oft leisten. Für ein paar Wochen sind wir schließlich nach Frankfurt gezogen zu einer Bekannten von mir. Aber sie war auch verheiratet und hatte zwei Kinder, das ging nicht lange gut. Sein halber Clan hat mich dann über WhatsApp, Telefon und Mails bombardiert: Wir sollten doch bitte zurückkommen, sie würden das mit uns beiden akzeptieren.
Versuchen wir’s, dachte ich, und für ein paar Tage ging es auch gut: Ich im Frauenhaus, er bei seinen Eltern, aber zwischendurch durften wir uns wenigstens treffen. Bis der ganze Stress wieder von vorne losging. Am Anfang unserer Beziehung war ich noch in dieser Zwischenphase meines Glaubens gewesen, als mir der Zwang und die Nörgeleien der anderen Musliminnen auf die Nerven gingen und ich nicht einmal mehr Kopftuch trug. Aber dann habe ich wieder angefangen, mich zu verschleiern: erst Kopftuch, ein halbes Jahr später Khimar, und kurz bevor wir ausgereist sind, habe ich auch wieder Niqab getragen. Mein Mann wollte das auch gerne so, aber er zwang mich nicht dazu. Er meinte, er sei halt sehr eifersüchtig, deswegen sähe er es lieber, wenn ich mich verhülle. Das konnte ich verstehen, ich bin es ja auch.
In den Monaten vor unserer Ausreise nach Syrien hat sich mein Mann in das Thema Syrien hineingesteigert, schaute sich Videos von der FSA an, wie sie gegen Assads Armee kämpfte, sah diese Videos von halb Verhungerten, die Gelehrte fragten, ob man auch Katzen essen dürfe, sah die Bilder der Giftgasattacken. YouTube war voll davon, während diese Grausamkeiten im deutschen Fernsehen kaum Beachtung fanden. Wir dachten alle: Der Westen macht nichts. In Syrien werden die Leute systematisch abgeschlachtet. Und wir schauen zu.
Mein Mann war damals nächtelang im Netz, hat sich Vorträge angehört, Videos geschaut, viel von Anwar al-Awlaki, dem jemenitischen al-Qaida-Führer, den die Amerikaner mit einer Drohne getötet hatten. Dadurch, dass er ja keine Arbeit mehr hatte, hatte er noch mehr Zeit, sich diese Filme anzugucken. Ich habe mir das selten angeschaut, auch nicht die Videos von denen, die schon nach Syrien gegangen waren. Die waren mir zu aggressiv: Der eine fackelte da seinen Ausweis ab, ein anderer fuchtelte die ganze Zeit mit dem Messer herum. Es gab da nur noch »uns« und »die anderen«. Die Leute in den Videos schienen es tatsächlich zu glauben, wenn sie sagten: »Die wollen uns alle ausrotten! Wir müssen die bekämpfen.«
Irgendwann meinte mein Mann, wir müssten auch nach Syrien fahren und helfen. Diese Idee, nach Syrien zu reisen, hatte nichts von »Boah, ich will jetzt die Abtrünnigen abschlachten«, darum ging es überhaupt nicht. Aber er wollte da unbedingt hin. Gut und schön, sagte ich, aber was willst du da denn machen? Helfen, meinte er. Der Rest würde sich schon ergeben.
Ich habe damals auch übers Internet herumgesucht, vor allem nach einer Wohnung, habe viele aus der Salafistenszene gefragt, die wiederum auch meinen Mann kannten. So hat mein Mann jemanden kennengelernt, der ihn dann zur Tauhid-Moschee in Offenbach mitgenommen hat. Da war eine ganze Gruppe von extrem Radikalen, von denen insgesamt vier oder fünf später nach Syrien gegangen sind: Waliullah, der Afghane, Hassan und Abdullah, zwei Pakistaner, und Abdelrauf, ein Kurde. Diese Gruppe war schon bekannt, weil sie mal ein Fernsehteam verprügelt hatte, das vor der Moschee drehen wollte.
Die Männer erzählten meinem Mann die ganze Zeit, wie toll es in Syrien sei: »Du kriegst da deine eigene Wohnung, dein eigenes Haus, hast auch Zeit für deine Familie!« Wie Rattenfänger waren die. Ich trug zwar auch wieder Khimar und Niqab, aber wäre von mir aus im Traum nicht darauf gekommen, in den Dschihad zu ziehen. Dieser Krieg in Syrien hat mich zwar mitgenommen. Diese Grausamkeiten und unsere Ignoranz haben mich bedrückt. Aber selber dahin gehen? Was sollte ich in Syrien ausrichten können?
Mein Mann ist in dieser Offenbacher Gruppe, so blöd das klingt, schlicht und einfach zur falschen Zeit an die falschen Leute geraten. In Deutschland schien er keine Zukunft zu haben. Eine Weile lang hatte er zwar über eine Zeitarbeitsfirma Arbeit in einer Firma für Autobremsen gefunden, aber das war auch begrenzt. Aber mehr noch als die Geldprobleme und die Arbeitslosigkeit hat ihn die ganze Streiterei wegen mir mit seiner Familie belastet. Er konnte nachts nicht schlafen, war tagsüber total kaputt, einfach fertig. Hinzu kommt, dass er ein wenig naiv und sehr leicht manipulierbar ist. Ich habe ihm immer gesagt: »Du bist wie ein Hundebaby, das jedem hinterherläuft, der dir einen Zipfel Wurst hinhält.« Er ist einfach ein bisschen zu gutgläubig.
Im Nachhinein klingt das wie ein schlechter Witz, aber für uns waren damals vor allem diese Erzählungen der Offenbacher Gruppe extrem verlockend: dass man in Syrien einfach so ein eigenes Haus, wenigstens eine eigene Wohnung bekommen könne. Über den ganzen Rest haben wir uns weniger Gedanken gemacht als darüber: endlich in Ruhe irgendwo zusammen wohnen zu können! Wobei mein Mann von dieser Aussicht noch faszinierter war als ich. Es führte einfach eins zum anderen. Unsere Misere und seine Wut haben sich gegenseitig hochgeschaukelt. Er konnte ja noch nicht einmal Hartz IV beantragen, weil er nie in einer Jugendhilfemaßnahme gewesen war wie ich. Sonst geht das erst, wenn man mindestens 25 ist.
Dabei war er für eine Weile auf dem Gymnasium gewesen, wollte nachträglich sein Fachabitur machen. Aber die ganze Streiterei wegen mir mit seiner Familie hat ihn fertiggemacht. Er konnte nachts nicht schlafen, war tagsüber total kaputt, einfach fertig. So hat das alles seinen Lauf genommen.
Die Männer von der Gruppe in Offenbach haben sich gegenseitig gepusht, dauernd kamen Sprüche wie: »Voll geil, komm auf jeden Fall her!« Von den vier oder fünf, die schließlich nach Syrien gegangen sind, ist einer sogar mit Fußfessel abgehauen. Die hat ihn nicht vom Dschihad abgehalten. Mindestens zwei von ihnen sind später umgekommen. Ob die anderen noch leben? Heute ist die Lage im ehemaligen IS – Gebiet so unübersichtlich, dass sich schwer sagen lässt, wer noch lebt oder schon tot ist.
Letztlich hat mein Mann einfach entschieden, dass wir nach Syrien gehen – ob zum IS oder zur Nusra-Front, das war ihm gar nicht so wichtig. Oder es war ihm nicht einmal klar. Zumindest hat er darüber weniger geredet, Hauptsache: Wir hauen hier jetzt ab und gehen dahin, wo schon die anderen Offenbacher sind. Wenn wir diese ganzen Schwierigkeiten mit seiner Mutter und meinem Ex-Mann nicht lösen können, lassen wir sie einfach hinter uns. Ich habe ihn gefragt, ob er noch alle beisammenhabe: Warum soll ich da mitkommen und warten, bis du irgendwann tot bist? Er als Deutscher werde doch mit dem ganzen Lebensstil dort unten nicht zurechtkommen. Ich auch nicht, das war mir klar. Aber von ihm kamen die immer gleichen Floskeln: Es sei unsere islamische Pflicht, nach Syrien zu reisen.