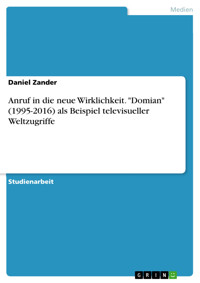Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Um 1800 war Afrika in den Augen der Europäer ein dunkler, unbekannter Erdteil, wo tödliche Krankheiten lauerten und unzivilisierte Völkerschaften hausten; ein Paradies für Sklavenhändler und wilde Tiere. Dennoch stiessen europäische Wegbereiter im Verlauf der nächsten Jahrzehnte tief in den Kontinent vor und durchdrangen ihn mit Sextant, Bibel und Handelsware. Von Anfang an kamen die weissen Eindringlinge jedoch auch als Eroberer, die den Afrikanern ihre eigenen Ordnungs- und Herrschaftsvorstellungen mit Gewehr und Kanone aufzwangen. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs besetzten und eroberten sie beinahe die gesamte afrikanische Landmasse. Von Napoleons Einmarsch in Ägypten 1798 bis zu den Kolonialkriegen in Nordafrika 1914 spannte sich ein Bogen kriegerischer Gewalt, an dessen Ende das Maschinengewehr über den Assegai, den traditionellen afrikanischen Wurfspeer, triumphiert und ein ganzer Kontinent seine Unabhängigkeit verloren hatte. Dieses Buch erzählt die dramatische und blutige Geschichte der Eroberung und Unterwerfung der afrikanischen Völker, berichtet, wie sechs europäische Staaten und ein König als Privatmann fast das gesamte Land zwischen Tanger und Kapstadt unter ihre Herrschaft brachten, schildert die Truppen und Akteure beider Seiten und zeichnet die einzelnen militärischen und politischen Etappen dieser einzigartigen und brutalen Landnahme in epischer Breite nach. Zum ersten Mal wird eine Gesamtdarstellung des europäischen Angriffs auf Afrika vorgelegt, die das ganze "lange 19. Jahrhundert "(Eric Hobsbawm) umspannt, den gewalttätigen Aspekt der Aufteilung und damit die Kolonialkriege in den Vordergrund rückt und alle daran beteiligten europäischen Mächte gleichermassen mit einbezieht. Mit einem umfangreichen Anhang, der eine Aufstellung aller Kolonialkriege sowie Berechnungen zu den Menschenverlusten dieser Konflikte enthält. Achtzehn Landkarten runden das Werk ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1397
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinen lieben Eltern Irmgard und Karl-Heinz
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Teil I: Der verbotene Kontinent (1798–1829)
1. Kapitel 1798-1815 Im Schatten des Korsen
Napoleons ägyptisches Abenteuer
Mehmet Ah und die Briten
Barbaresken, Europäer und Amerikaner
Afrika um 1800
Napoleonische Kriege an den Küsten Afrikas
Südafrika: Holländer, Buren, Bantu und die Briten
Abolition!
Jahrhundert- und Zeitenwende
2. Kapitel 1815-1829 Neue und alte Kräfte
Grossbritannien, die Bekämpfung des Sklavenhandels und die Gründung Liberias
Krieg und Frieden an der Goldküste: Die Ashanti und die Briten
Südafrika: In der Kapkolonie
Südafrika: Die Mfecane
Mosambik und die Nguni-Invasion
Die Barbaresken unter Druck
Teil II: Erste Einbrüche (1830-1876)
3. Kapitel 1830-1847 Frankreich erobert Algerien
Die Invasion in Algier 1830
Der Aufbau der Armée d'Afrique
Abd el-Kader und Constantine
Bugeaud und der letzte Krieg gegen Abd el-Kader
Arabischer Imperialismus: Oman und Sansibar
Mehmet Alis grenzenlose Ambitionen
4. Kapitel 1834-1840 Der grosse Treck
Südafrika: Ein neuer Grenzkrieg 1834-1835
Der grosse Treck der Buren
5. Kapitel 1835-1865 Handel, Wandel und Krieg in Westafrika
Die Kriege des Informal Empire
Dänen, Niederländer, Amerikaner, Belgier und Preussen in Afrika
Frankreichs erste Schritte
Jihadin Westafrika
Faidherbe und der Senegal
6. Kapitel 1840-1865 Missionare, Pioniere, alte Kolonialreiche
Kreuz und Kompass: Missionare und Entdecker
Portugal und seine Kolonien
Das blutige Ende der Eroberung Algeriens
Spaniens Krieg gegen Marokko
Südafrika: Grenzkriege, Viehtötungen, Burenrepubliken
7. Kapitel 1866-1878 Die Zeit vor der Aufteilung
Portugals Demütigungen
Napiers Abessinienfeldzug
Die Eröffnung des Suez-Kanals
Algeriens Katastrophen: Hunger, Krieg und gnadenlose Sieger
Die Niederlandekämpfen in Ghana ... und verkaufen ihre Kolonie
Wolseleys Ashantikrieg
Eine neue britische Armee
Henry Morton Stanley und der Kongo
Afrika und Europa vor der Aufteilung: Eine Bilanz
Teil III: Die Balgerei um Afrika (1877-1889)
8. Kapitel 1877-1881 Südafrika
Einheitsträume: Diamanten- und Konföderationskriege am Kap
Der Zulu-Krieg
Blutiger Imperialismus am Kap
9. Kapitel 1877-1885 Am Kongo
Die Reisen und Verträge des Savorgnan de Brazza
Ein König und seine Gier nach einer Privatkolonie
10. Kapitel 1878-1887 Vom Senegal zum Niger
Eine Eisenbahn und ein Militärkommando
Samori
Senegal: Lat Dior
11. Kapitel 1880-1885 Nordafrika und der Sudan
Sahara: Der Tod des Oberstleutnants Flatters
Algerien: Der letzte Aufstand
Frankreich pflückt sich die tunesische Birne
Ägypten: Ismails Imperialismus
Ägypten den Ägyptern!
Der Mahdi im Sudan
Schlachtfeld Suakin: Der Ost-Sudan
Gordon in Khartum
Die Rettung? Wolseleys Entsatzfeldzug
Zu spät!
12. Kapitel 1883-1885 Der erste Höhepunkt des »Wettlaufs«
Warum sie sich um einen Kontinent balgten
Britisch-Französischer Wettlauf in Westafrika
Deutschlands »Platz an der Sonne«
Die Berliner Kongo-Konferenz
Das Treaty Making
13. Kapitel 1883-1890 Zwischen Kap und Rotem Meer
Frankreich und die rote Insel: Madagaskar
Südafrika: Cecil Rhodes und das Bechuanaland
Italien in Ostafrika: Hohes Lehrgeld
Teil IV: Die Zerschlagung der grossen Reiche (1890-1900)
14. Kapitel 1885-1900 Die Instrumente der Eroberung
Europas technologischer Vorsprung
Die langsame Verminderung des Gesundheitsproblems
Nationale Armeen und ihre Ableger in Übersee
Die Kolonialtruppen
Weisse Offiziere ...
... und schwarze Soldaten
Leitfaden für einen Kolonialkrieg
Totaler Krieg mit beschränkten Mitteln
Kollaborieren oder kämpfen? Die afrikanische Reaktion
15. Kapitel 1885-1900 Die Feldzüge der Eroberung
Geladene Pause und totale Invasion
Portugals rosarote Landkarte
West-Sudan: Das Imperium der Soldaten
Der Fall des Reiches Dahomey
Deutsch-Ostafrika: 16 Jahre Krieg
Namibia: Die Sandbüchse des Kaisers
Kamerun und Togo
Britanniens afrikanisches Herz
Leopolds Kongo: Im Herzen der Finsternis
Spanisch-Marokko: Margallos Krieg
Das Land des Cecil Rhodes
Der Gaza-Krieg und Portugals »Generation von 95«
Frankreichs Madagaskar-Kriege
Italienisch-Ostafrika: Die Katastrophe von Adua
Südliches Afrika: Die Rinderpestaufstände
Britisch-Westafrika: Chamberlains Imperialismus
Französisch-Westafrika: Volta, Sikasso und Samori
Die Rückeroberung des Reiches des Mahdi
Fashoda
Rabeh und das blutige Rennen zum Tschadsee
Südafrika: Das Gold der Buren
Teil V: Unterwerfung (1901-1914)
16. Kapitel 1900-1908 In der Sahara und südlich davon
Das Jahr 1900: Eine Zeitenwende?
Neue Kolonialtruppen für ein neues Jahrhundert
Krieg in der Wüste: Frankreich erobert die Sahara
Der letzte Krieg in Ashantiland
Nigeria: Lugard und die Emire
Kenia: Die Eisenbahn und die Nandi
Britisch-Somalia: Der Heilige Krieg des Mad Mullah
Italienisch-Somalia: Die Bimai
Portugal in Mosambik und Angola
17. Kapitel 1900-1908 Massenmord - Völkermord
Leopolds Kongogräuel kommen ans Licht
Namibia: Der Völkermord des Kaisers
Der Maji-Maji-Krieg
18. Kapitel 1902-1914 »Befriedung« südlich der Sahara
Im anglo-ägyptischen Sudan
Südafrika: Der letzte Aufstand der Zulu
Frankreich: Die kurzlebige Schimäre von der »friedlichen Durchdringung«
Französische Kolonnen im Tschad
Mauren und Franzosen
Im Dschungel (Französisch-West- und Äquatorialafrika und Deutsch-Kamerun)
1914: Portugals Afrika
19. Kapitel 1907-1914 Rückkehr nach Nordafrika
Entente cordiale:Freie Bahn in Marokko
Casablanca
Spanien in Melilla
Spaniens Bürde Nord-Marokko
Frankreich erobert Marokko
Der Italienisch-Osmanische Krieg
Die (vermeintliche) Eroberung Libyens
Ausblick
Teil VI: Der Versuch einer Bilanz
Das Problem der Einordnung
Krieg und Frieden
Europäische Eroberer in Afrika
Der afrikanische Gegner
Gründe für den europäischen Sieg
Die Kosten der Kolonialkriege
Die Folgen: Eine vergiftete Erblast
Appendix:
Allgemeine Anmerkungen
Liste A: Chronologische Liste der militärischen Operationen
Liste B: Anzahl der militärischen Operationen pro afrikanischem Staat und Grossregion
Liste C: Anzahl der militärischen Operationen pro Kolonialmacht
Liste D: Anzahl der militärischen Operationen pro Zeitabschnitt/Kolonialmacht
Liste E: Menschenverluste in den Kolonialkriegen
Karten
Endnoten
Literaturverzeichnis
Vorwort
Einst herrschten die Europäer über Afrika. Für viele Kreise ist das Grund genug, die Verantwortung für die heutigen Fehlentwicklungen auf dem afrikanischen Kontinent den weissen Herren von damals anzulasten. Doch an den aktuellen Schwierigkeiten Afrikas trägt Europa nur geringe Schuld. Man kann ihm Überbevölkerung, Korruption, Stammesdenken und islamistischen Terror nicht zur Last legen. Die heutzutage verbreitete Neigung, den Afrikanern mit einer Art Outsourcing der Ursache für ihre Nöte unter die Arme zu greifen – indem man die Verantwortung dafür zu uns Europäern umlagert – darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die meisten Probleme Afrikas sehr alt und hausgemacht sind.
Aber nicht alle. Staatsgrenzen, die sich schnurgerade durch die Landschaft ziehen und auf ethnische Siedlungsgebiete keinerlei Rücksicht nehmen, oder nationale Armeen, die sich, den Kolonialtruppen früherer Tage entwachsen, in ihren eigenen Staaten wie Besatzungskräfte und Marodeure aufführen –; das sind nur zwei der toxischen Vermächtnisse des europäischen Kolonialismus in Afrika.
Diese koloniale Fremdbestimmung hat auf dem ganzen Kontinent physische und seelische Spuren hinterlassen, tiefe Gräben aufgeworfen und schlecht verheilende Wunden gerissen.
Begonnen hatte sie mit den Marschkolonnen weisser Eroberer.
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts setzte Europa zum Sprung nach Afrika an, um den Erdteil zu erforschen, zu durchdringen, ihn sich anzueignen und ihn sich schliesslich zu unterjochen. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges teilten sechs europäische Mächte und ein König als Privatmann fast die gesamte riesige Landmasse Afrikas erst unter sich auf, bevor sie den Kontinent militärisch besetzten und eroberten. Sie zwangen den hier lebenden Völkern ihren Willen auf und schlugen fast alle Versuche, sich bewaffnet dagegen zur Wehr zu setzen, mit harter Hand nieder. Im Jahre 1914 war das kriegerische Werk im Wesentlichen vollbracht; nahezu überall hatte sich der afrikanische Widerstand den fremden Mächten beugen müssen. Das Maschinengewehr harte den Assegai zerbrochen, die moderne Tötungsmaschine Europas hatte den Sieg über die traditionelle Waffe Afrikas davongetragen, den anderthalb Meter langen Wurfspeer mit breiter Klinge.
Dieses Buch erzählt die Geschichte dieser Invasion. Es setzt an der Wende zum 19. Jahrhundert ein, einer Zeit, ab der Afrika im Zuge der Abschaffung und Bekämpfung des Sklavenhandels, der Ausweitung des legalen Handels, der christlichen Missionierung und der Entdeckung unerforschter geografischer Regionen sukzessive immer stärker ins Blickfeld Europas rückte. An seinen Rändern – in Ägypten, Algerien, im Senegal, in Südafrika und in den alten portugiesischen Besitzungen – drangen die Europäer erstmals gewaltsam tiefer in das Land vor; Kaufmann und Offizier tauschten die Rollen, das Kontor wich dem Fort. Noch handelte es sich nur um einzelne Brocken, an denen sich die Grossmächte jener Tage festbissen, doch das änderte sich ab etwa 1880. Da hub der »Wettlauf um Afrika«, der Angriff auf den Kontinent mit voller Wucht und auf breiter Front an, ein Sturmwind blutiger Eroberung und Unterdrückung, der erst mit dem Hereinbrechen der »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts« – dem Ersten Weltkrieg - abflaute.
Die Kolonisatoren beschränkten sich nicht darauf, zu besetzen und zu vernichten; sie zwangen die Menschen in eine gänzlich neue Ordnung, bezogen sie ins Weltwirtschaftssystem ein, bauten Schulen, Märkte, Kliniken und Strassen. »Warum reden die Zeitungen nicht eher davon, als noch aus dem geringsten Scharmützel ein grosses Hallo zu machen?«, empörte sich seinerzeit der Kolonialoffizier Hubert Lyautey über die seiner Meinung nach einseitige Berichterstattung der Presse.
Seine Frage könnte genauso gut an mich gerichtet sein, denn in diesem Bericht soll es weder um Aufbauleistungen noch Unterlassungssünden, weder um die Strukturen von Kolonialherrschaft noch um die diplomatische Aufteilung Afrikas gehen.
Vielmehr wendet er sich der gewaltsamen Inbesitznahme des »dunklen Erdteils« durch die Europäer zu und damit den Myriaden von kolonialen Eroberungskriegen, Aufständen, Feldzügen, Strafexpeditionen, Bombardements und bewaffneten Demonstrationen, mit denen die Angriffstruppen Europas von dem Tage an, an dem Napoleon 1798 seinen Fuss auf Ägypten setzte, bis zur letzten Juliwoche des Jahres 1914 die afrikanischen Völker und Reiche unter ihre Autorität zwangen und ihre Machtansprüche durchsetzten.
Die Operationen, Truppen, Befehlshaber, die Art dieser Konflikte und ihrer Austragung sowie die Reaktionen der afrikanischen Gegenseite stehen im Mittelpunkt dieser Darstellung. Um sie nicht von ihren Hintergründen und Kontexten zu isolieren, werden diese einzelnen Ereignisse in einen grösseren Rahmen eingebettet, wobei die historische Einordnung nicht soweit gehen soll, eine vollständige Geschichte Afrikas im 19. Jahrhundert vor dem Leser auszubreiten oder ihn mit den umfassenden Theorien einiger historischer Denker zum Entstehen des europäischen Imperialismus vertraut zu machen.
Anders als es der erhebliche Buchumfang vermuten lässt, ist es unmöglich, eine vollständige Übersicht aller militärischen Unternehmungen der Europäer in Afrika zu liefern, wenngleich der Appendix mit seinem umfassenden Überblick über das Ausmass kriegerischer Gewalt hier Abhilfe schaffen soll. Im Text wird allerdings ein weiter Bogen geschlagen, der alle Kolonialmächte, Regionen und Epochen der Landnahme mit einbezieht. Durch dieses Vorgehen entfällt auf den Einzelfall weniger Platz – dem deutschen Leser etwa mag der Raum spärlich vorkommen, der dem wilhelminischen Kolonialtraum(a) zugemessen wird – dafür erlaubt es, sonst nie geschilderten Kolonialaktivitäten, zum Beispiel der Portugiesen, nachzuspüren.
Notwendigetweise kommt dieses Werk weitgehend eurozentrisch daher, freilich ohne den veralteten Wortsinn des Begriffes wiederbeleben oder die Afrikaner abwerten zu wollen. Aber aufgrund der Quellenlage, der europäischen Dominanz des Geschehens, der chronologischen Struktur dieses Werkes, der Unmöglichkeit, Tausende von afrikanischen Gemeinwesen berücksichtigen zu können und nicht zuletzt wegen meines eigenen europäischen Hintergrundes, erschien mit die gewählte Perspektive als der einzig gangbare Weg.
Mittlerweile existiert eine wachsende Bibliothek mit wissenschaftlichen wie populärwissenschaftlichen Schriften zu den europäischen Kolonial- und Imperialkriegen, doch fehlt bisher eine detaillierte, breit angelegte und trotzdem eine gewisse Tiefe anstrebende Allgemeindarstellung.
Dieses Buch soll also eine Lücke schliessen und sich in dem Bemühen an ein breites Publikum wenden, einem Thema zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen, dem bislang ein stiefmütterliches Dasein innerhalb des Zirkels einiger Fachleute beschieden war.
Krieg und Unterwerfung, Tod und Zerstörung. Es kann niemanden verwundern, dass ein solcher Gegenstand angesichts der ausnehmend hässlichen Begleitumstände der kolonialen Eroberung in unserer heutigen, sich als kultursensibel inszenierenden Gesellschaft emotional hoch aufgeladen ist. Damals mit einer Argumentations-Mixtur aus sozialdarwinistischen Lehren von der »Selektion des Stärksten« und vom »Kampf ums Dasein«, nationalistischen Grossmachtsfantasien und häufig ungefiltert rassistischen Auffassungen von der Überlegenheit des weissen Mannes legitimiert und ins Werk gesetzt, liegen die Kolonialkriege, wie die gesamte Zeit des Kolonialismus, heute Afrikanern wie Europäern gleichermassen schwerverdaulich im Magen.
Dabei verliert man leicht aus den Augen, dass eine simple Täter-Opfer Dichotomie so nicht funktioniert. Es gab kein Exklusivabonnement der Weissen auf Imperialismus, Kolonialismus und Rassismus. Wer diesem Mythos anhängt, hat sich noch nie gefragt, wie Sinkiang zu China oder die Oromo zu Äthiopien gekommen sind und auch noch nie etwas vom türkischem Hautfarbenrassismus gegenüber schwarzen Afrikanern gehört. Der Wille, zu expandieren und damit auf Kosten anderer Völker zu erobern, ist ein uraltes Phänomen der gesamten Menschheit und eine Konstante der Weltgeschichte, die nicht an Hautpigmentierungen gebunden ist. Die enorme Wirkmächtigkeit und mit grosser Brutalität einhergehende Durchschlagskraft des »weissen« Imperialismus speiste sich aus dem Kraftwerk des wissenschaftlich-technologischen Fortschritts Europas, nicht aus einer rassischen Besonderheit.
Umgekehrt passen auch die Afrikaner nicht so recht in die Schablone der duldsamen Opfer hinein. In Tausende von Ethnien und Gemeinschaften unterteilt, bildeten sie niemals eine homogene Einheit und auch keine passive Opfergruppe. Sie waren keine unbeteiligte Manövriermasse ihrer eigenen Geschichte, sondern aktive Akteure, selbstständig handelnde Agenten, Lenker ihres Tuns, die den immensen Herausforderungen der kolonialen Dampfwalze, die auf sie zurolle, mit unterschiedlichen Lösungsansätzen begegneten. Königreiche, Gruppen oder Individuen kämpften gegen oder eben auch für die weissen Invasoren, je nachdem, welche Interesssenlage ihr Handeln diktierte. Aus diesem Grund finden sich viele Beispiele dafür, dass dieselben Personengruppen, die das Gewand der Kollaboration überstreiften, zu anderen Zeiten mitunter den Waffenrock des Widerstandes anzogen.
Es mag pathetisch klingen, aber in unserer Zeit überbordender Empörungskultur und oftmals hysterischer Selbstanklage soll diesem Buch ein Leitstern der Objektivität und Sachlichkeit vorangehen. Um der drohenden Regentschaft postfaktischer Bilderstürmer vorzubeugen, die »Haltung« einfordern, statt Sachkenntnis zu fördern, und den Kulturrelativisten wie Revisionisten ihren Befindlichkeits-Schlagstock zu entwinden, ist es so neutral wie möglich gehalten. Es will Informationen vermitteln und keine Schuldgeschichte sein. Folgerichtig wäre es absurd, so lange zurückliegende Ereignisse einer Wertung zu unterziehen, die heutige Massstäbe anlegt.
Als praktische Anmerkung sei darauf verwiesen, dass ich mich keiner politisch gereinigten Sprachregelung befleissigen werde. Wo heutige Kulturkämpfer Begriffe aus der Vergangenheit als »kolonialistische Terminologie« schmähen und ihnen den Kampf ansagen, werde ich mir dort, wo es nötig scheint, erlauben, weiterhin von »Stämmen« oder »Hütten« zu sprechen, nicht um dem Lauf der Moderne markigen Trotz entgegenzusetzen oder um afrikanische Lebenswelten herabzuwürdigen, sondern einfach weil es dieselben Ankläger bisher vermieden haben, adäquate, griffige und passende Ersatzbezeichnungen zu schaffen. Es kann unmöglich ernst gemeint sein, wenn beispielsweise geraten wird, das Wort »Häuptling« durch »Bürgermeister« zu ersetzen.
Stereotypisierungen sind gleichermassen nicht beabsichtigt, ein diffiziles Unterfangen, weil viele (übrigens keineswegs nur) afrikanische Kriegsbräuche jener Tage auf heutige Gemüter schockierend und abstossend wirken. Soweit ich mich auch bemüht habe, sie nur selten zu skizzieren, habe ich sie dennoch nicht »entschärft«, nur weil sie in einigen Köpfen negative Assoziationen wachrufen könnten.
Ein gut geöltes Räderwerk an institutioneller Förderung stand mit als »Einzelkämpfer« bei dieser Arbeit nicht zur Verfügung. Umso aufrichtiger geht mein allumfassender, inniger Dank an meine Frau Monika, ohne deren solidarische Treue und selbstlose Unterstützung dieses Buch niemals zustande gekommen wäre.
Gränlichen, im November 2017
Daniel Zander
TEIL I: DER VERBOTENE KONTINENT (1798-1829)
1. Kapitel 1798-1815 Im Schatten des Korsen
Napoleons ägyptisches Abenteuer
»Nirgends ein Baum, nirgends ein Haus. Die Natur schien nicht nur traurig, sie schien zerstört. Allgemeines Schweigen herrschte.« Niedrige, sandgelbe, öde Landstriche boten sich den Männern dar, als sie an Land spähten. »Der Munterkeit unserer Soldaten schadete das aber nichts; einer von ihnen zeigte seinen Kameraden die Wüste mit den Worten: ,Du, sieh da, da sind die sechs Acker Landes, die man uns versprochen hat.'« Alle lachten.
So erinnerte sich Dominique-Vivant Denon, Maler, Kunstsammler und Diplomat, an diesen 1. Juli 1798, als er und die Männer zum ersten Mal die ägyptische Küste erblickten, das Ziel der Reise. Er gehörte der Kommission der Wissenschaften und Künste an, die, gemeinsam mit Napoleons Armée de l’Orient, auf der grossen Mittelmeer-Flotte mit über 260 Schiffen die Küste des Nillandes bei Abukir angesteuert hatte.
In der stockfinsteren Nacht des 2. Juli und in den folgenden Tagen ging die Armee an Land, eine kraftstrotzende Streitmacht von 24 000 Infanteristen, 2800 Kavalleristen, 3150 Artilleristen mit 171 Geschützen, 1200 Sapeuren, 900 Apothekern und Krankenpflegern, einer Kundschafterkompanie und nicht zuletzt über 150 Gelehrten, Schriftstellern und Künstlern, darunter auch Denon.
Diese Armee schickte sich an, Ägypten zu erobern.
Frankreich besetzt das Land am Nil. Die Idee war nicht neu. Selbst in russischen Köpfen war sie schon herumgespukt, damals, als die Zarin in St. Petersburg dem König in Paris den Vorschlag unterbreitet hatte, Frankreich für die Teilnahme an einem Krieg gegen das Osmanische Reich mit »einem Stück des Kuchens« abzufinden, eben jenem Ägypten, das zum Reich des Sultans gehörte.
Mittlerweile war der König tot – von der Guillotine der Revolution gefällt -, nicht aber das Projekt. In einer grossen Rede führte Charles Maurice de Talleyrand, der künftige Aussenminister des Direktoriums, im Sommer 1797 aus, dass Frankreich Kolonien benötige, wenn es sich neue Einnahmequellen erschliessen wolle. »Ägypten war eine Provinz des römischen Reiches,« dozierte er, »jetzt muss es eine der Französischen Republik werden. ... Die mamelukischen Militärs werden uns nicht lange widerstehen, und die Ägypter werden uns als Befreier empfangen.« Und erlaube es eine solche Eroberung nicht, die Verbreitung der französischen Revolutionsideale durch die Gründung einer Tochterrepublik Ägypten voranzutreiben?
In Oberitalien liess sich der gerade 28-jährige korsische général en chef der Italien-Armee von diesen Gedankenspielen begeistern. Nach seinen berauschenden Siegen über die Österreicher benötigte Napoleon Bonaparte neue Ruhmestaten, glaubte er doch zu wissen: »Wenn ich zu lange nichts tue, bin ich verloren«. Von Kindesbeinen an vom Orient fasziniert, hatte er als junger Offizier davon geschwärmt, die Taten Alexanders des Grossen zu imitieren. Nun geriet er in Verzückung: »Ich hatte grosse Träume ... Ich sah mich eine Religion gründen, in Asien einmarschieren, reitend auf einem Elefanten und mit einem Turban auf dem Kopf, in der Hand den neuen, von mit entworfenen und meinen Bedürfnissen angepassten Koran.«
Ägypten verhiess ihm alles; die Möglichkeit, die Briten – mit denen man seit 1793 im Krieg lag – in Indien zu bedrohen, die Chance, den Levante-Handel an sich zu reissen, und das Potenzial, als Ersatz für die verlorene Zuckerinsel Saint-Domingue zu fungieren. Schwierigkeiten sah er kaum voraus: »Nach Ägypten gehen, sich dort einzurichten und eine französische Kolonie zu gründen, wird nur einige Monate beanspruchen. ... Die Türkei wird die Vertreibung der Mameluken begrüssen.«
Welch eine aberwitzige Vermutung. Gewiss bekundete der türkische Sultan grosse Probleme mit dem Freiheitsdrang der ägyptischen Herrscherschicht, der Mameluken, und ihrer Beys (Statthalter) Ibrahim und Murad. Daraus jedoch eine Einladung zu einer Invasion abzuleiten, grenzte an eine politische Fata Morgana.
Ohne sich des Trugbilds gewahr zu werden, erteilte das Direktorium General Bonaparte am 5. März 1798 carte blanche in der Ägyptenfrage, froh, den schrankenlosen Ehrgeiz des militärischen Emporkömmlings ins Ausland umleiten zu können.
Vier Monate später ging die französische Flotte, der starken britischen Verfolgerflotte des Admirals Horatio Nelson glücklich entwischt, bei Alexandria vor Anker.
Vor ihr breitete sich ein Land aus, das, vom Nil gespeist, knapp vier Millionen Menschen eine Heimat bot, ägyptischen Bauern, Fellachen, die ihre Pachtscholle beackerten, oder Beduinen, die durch die Wüste streiften. Ihren Gehorsam schuldeten diese Menschen den Mameluken, einer Kaste von Militärsklaven aus dem Kaukasus, die seit Jahrhunderten die Elite des Landes stellte. Sie bildeten nur eine kleine Schicht von 60 000 Menschen und stammten allesamt von georgischen oder tscherkessischen Sklaven ab, die als Kinder nach Kairo verkauft und dort einem scharfen Drill als Soldatensklaven überantwortet worden waren. Zum Islam bekehrt, ihres sozialen Umfelds entrissen und gut bezahlt, fügten sich diese einstigen Knechte in die Klasse der brutalen Herren ein. Die Mameluken blieben in Ägypten die tonangebende, von der übrigen Bevölkerung fast losgelöste Kraft, auch jetzt noch, 300 Jahre nachdem sie von den Osmanen unterworfen worden waren. Ihre harte Hand lag drückend über dem Land und ihre hemmungslosen Machtkämpfe auferlegten den Menschen stets neue schwere Prüfungen.
Ein halbes Jahrhundert der Kriege, des Hungers und der Not hatten Ägypten in den Abgrund gerissen. Diese Plagen schienen endlich vorbei – da landeten die Franzosen bei Abukir.
Noch am Morgen des 2. Juli 1798 rückte die Vorhut ihrer Armee gegen das nahe Alexandria vor, dessen Gouverneur zu Napoleons Verblüffung keine Anstalten traf, sich zu ergeben. »Es erstaunt mich, dass Ihr feindselige Massnahmen gegen mich ergreift. ... Wenn ich in zehn Minuten nicht eine weisse Fahne erblicke, werdet Ihr vor Gott Rechenschaft ablegen müssen für das Blut, das sinnlos vergossen wird«. Darauf ging keine Antwort ein und Napoleon machte seine Drohung wahr. Seine Truppen stürmten die alte Stadt Alexanders. »Niemand floh und alles musste in der Bresche getötet werden«, wusste Denon zu berichten.
Alle diejenigen unter Napoleons Männern, die auf einen blumenbekränzten Empfang als republikanische Befreier gehofft hatten, erwartete ein Schock: Ein paar Syrer, Griechen und koptische Christen hiessen sie freundlich willkommen, der Rest der Einwohner wartete in dumpfer Feindseligkeit ab.
Daran änderte auch Napoleons pompöse Proklamation nichts, mit welcher der Eroberer sich allzu durchsichtig beim Volk einschmeicheln wollte:
»Zu lange schon haben die Beis der Mameluken, die über Ägypten herrschen, die französische Nation beleidigt und ihre Kaufleute schikaniert. Die Stunde ihrer Züchtigung ist gekommen. Zu lange schon haben diese Sklavenhorden, die aus dem Kaukasus und aus Georgien stammen, das schönste Land der Welt tyrannisiert. Aber Gott, von dem alles ausgeht, hat beschlossen, dass ihre Herrschaft nunmehr ein Ende findet. Ägypter! Man wird Euch sagen, ich sei gekommen, um Eure Religion zu zerstören. Glaubt das nicht. Anwortet, dass ich komme, um Eure Rechte wiederherzustellen und die Usurpatoren zu bestrafen, und dass ich Gott, seinen Propheten und den Koran mehr ehre als die Mameluken.«
Den grossen Worten sollten Taten folgen. Napoleons Kriegsplan sah vor, dem Nil entlang geradewegs auf die Hauptstadt Kairo zu marschieren und unterwegs die mamelukischen Aufgebote aus dem Feld zu räumen.
Wer diese Route von Alexandria aus einschlug, musste jedoch zunächst eine fast trinkwasserlose Küstenlandschaft durchqueren, ehe er bei Rosetta an den westlichen Nilarm stiess. Unvorbereitet – ohne Feldflaschen! – marschierte Bonapartes Armee bei flirrender Hitze von 45 Grad in die knochentrockene Einöde hinein. Ihr Zug verwandelte sich in einen Leidensmarsch. Soldaten verdursteten, andere erblindeten, einige überkam der Wahnsinn. Bei einem der wenigen Brunnen drängten die Dürstenden so nach vorne, dass sie 30 ihrer Kameraden erdrückten.
In Rosetta löschten sie ihren Durst. Aber ihre Qualen gingen weiter. Hitze, Ruhr und Hunger blieben beim weiteren Vormarsch ihre ständigen Begleiter, der Durst geisselte sie und die schweren weissen und blauen Uniformteile hingen ihnen wie Blei am Körper. Entsetzt mussten sie feststellen, dass Fluss-Krokodile Männer rissen, die gerade badeten, und Beduinen um sie herumschwärmten, um Nachzügler umzubringen. Immer wieder wurden sie von Dorfbewohnern beschossen. Frustriert und gepeinigt, rächten sich die Soldaten für ihre Unbill häufig an den Einwohnern: Plünderungen, Vergewaltigungen und Exekutionen säumten ihren Weg. Ihr Martyrium linderte das freilich nicht. Bis Damanhur mussten sie bereits 1500 Gräber schaufeln, darunter viele für Männer, die sich selbst entleibt hatten. Desillusionierung griff um sich, auch bei Offizieren wie Oberst Morand: »Ägypten, seine Landschaften, Ruinen, Bauwerke - all das ist mit ein Gräuel. Ein Schleier des Grauens hat mich erfasst. Meine Fantasie, die so lange in romantischen Träumen und angenehmen Hoffnungen befangen war, besteht nur noch aus grässlichen Bildern.«
Ihre Laune besserte sich erst, als sie am 13. Juli bei Shubrakit endlich an den Feind kamen. »Es schienen etwa 12 000 oder 13 000 Mann zu sein,« erinnerte sich Hauptmann Deponthon, »aber nur 3000 waren zu Pferd. Die übrigen waren ihre Sklaven, die ihre Ausrüstung trugen, oder Bauern, einige davon waren mit Musketen bewaffnet, die meisten aber mit Knüppeln.«
In Schwärmen ritten die prächtig anzusehenden Mameluken heran. Man konnte ihre verzierten seidenen Umhänge erkennen, die weiten bauschigen Hosen, die zu grossen Schuhe aus Ziegenleder. »Ihre Turbane müssen Unmengen gekostet haben, so fein sind sie gearbeitet«, beobachtete Hauptmann Moiret. »Sie rasieren ihre Köpfe kahl, bis auf eine kleine Stelle oben auf dem Kopf. Daran, so sagen sie, wird Mohammed sie packen und ins Paradies ziehen, wenn ihr Ende gekommen ist.« In ihren Gürteln steckten mehrere juwelenbesetzte Pistolen und Schwerter; manche Kämpfer trugen Panzerketten und Helme mit Gesichtsschutz. Virtuos liessen sie ihre für den Kampf gezüchteten Pferde punktgenaue Bewegungen ausführen.
All diese Finesse und Prachtentfaltung nützten der »besten Kavallerie der Welt« nichts. Vier Stunden liessen ihre Beys Ibrahim und Murad sie gegen die französischen Quadratformationen und Kartätschenkanonenladungen anrennen, solange, bis sie rund 1000 Männer und die Schlacht verloren hatten.
Eigentlich hätten die Beys die Lehre daraus ziehen müssen, dass einem solchen Feind mit kühnen Reitermanövern allein nicht beizukommen war. Stattdessen versuchten sie es hochmütig in der gleichen Weise, als die beiden Armeen am 21. Juli 1798 nahe Imbaba wieder aufeinander stiessen. Sie führten 6000 Mameluken, 21 000 Osmanen und Beduinen sowie 20 000 Mann Miliz aus Kairo und 40 Kanonen in das Treffen mit Napoleon, der seinerseits 20 000 Mann mit 42 Kanonen aufbot; elende, nach einem Gewaltmarsch ausgebrannte und vor Hunger fast zum Meutern bereite Soldaten – die gleichwohl ihr Handwerk verstanden.
Diszipliniert folgten sie ihrem Heerführer, der sich zu ihnen umdrehte und ihnen zurief: »Soldaten, seid euch bewusst, dass von diesen Pyramiden vierzig Jahrhunderte auf euch herabblicken.«
Sie gliederten sich in die grossen Divisions-Karrees ein, die Napoleon formieren liess. Wie keine andere Aufstellung war das Karree geeignet, einem berittenen Feind beizukommen, denn als mehr oder minder quadratische und im Inneren hohle Formation, in diesem Fall sechs Reihen Soldaten stark, konnte sie nach allen Seiten hin austeilen. In Europa hatte sie als Verteidigungsgliederung gegen feindliche Kavallerieangriffe nur noch eine begrenzte Lebensdauer; in Afrika gewann sie später als Standardaufstellung der Kolonialtruppen grosse Bedeutung.
Hier und jetzt wälzten sich fünf dieser blauweissen, waffen- und bajonettstarrenden Vierecke, jedes an die 100 Meter im Durchmesser, langsam über den Wüstensand. In ihrem Hohlraum sammelte sich die Kavallerie und zwischen den Karrees fuhren die Feldgeschütze auf.
Es war unverständlich, dass die Mameluken ihre Kräfte in zwei Teile gespalten hatten; Murad Bey lag, mit dem Rücken zum Nil, auf der »französischen Seite« bei Imbaba, Ibrahim Bey auf der anderen Seite des Stroms, nördlich von Kairo.
Das einzige, was Murad aus dem ersten Gefecht gelernt zu haben schien, war, noch härter, noch rascher, noch durchschlagender anzugreifen. »Schnell wie der Blitz« galoppierten seine Reiter heran, direkt auf General Reyniers Division zu, und einen Moment sah es so aus, als könnten sie die blauen Reihen überrumpeln. Dann brach der Ansturm im Kanonen- und Musketenfeuer zusammen. Während einer Stunde ging dieses vergebliche Anrennen gegen den Wall aus Bajonetten weiter, das Napoleon trocken zusammenfasste: »Wir liessen sie auf fünfzig Fuss herankommen und begrüssten sie dann mit einem Kugelhagel aus unseren Artilleriegeschossen, der viele von ihnen zu Tode brachte. Als sie sich in die Lücke zwischen den beiden Divisionen warfen, waren sie doppeltem Feuer ausgesetzt, und ihre Niederlage war besiegelt.« Als Bonaparte zum Gegenangriff rief und seine Soldaten Imbaba erstürmten, »hörte es auf, eine Schlacht zu sein, es wurde eine Metzelei«, erinnerte sich Denon. Die Osmano-Ägypter wurden in den Nil getrieben, wo Hunderte ertranken. Er würde ihre Armee wie einen Kürbis zerhauen, hatte Murad Bey den Franzosen grossspurig geweissagt; jetzt erlitten seine Kämpfer dieses Schicksal. Auf der anderen Flussseite rührte Ibrahim Bey keinen Finger für Murads Korps.
Das war der berühmte Sieg bei den Pyramiden (die von hier aus kaum zu sehen waren), ein Sieg, der den Franzosen 40 Kanonen und die Herrschaft über Ägypten eintrug. Dreissig Toten und 360 Verwundeten der Gewinner standen bis zu 1600 Tote und 1000 Gefangene bei den Verlierern gegenüber.
Im Gesicht verwundet, floh Murad Bey durch die Wüste nach Oberägypten, derweil Ibrahim Bey nach Osten entwich und die Sieger am 24. Juli verstaubt und bärtig in die 270 000 Einwohner zählende Stadt Kairo einzogen.
Sieg auf der ganzen Linie. In Europa kündigten der Gewinn der Entscheidungsschlacht und die Einnahme der feindlichen Hauptstadt im Regelfall den Erfolg aller Kriegsbemühungen an.
Aber man war hier nicht in Europa. Von Beginn weg erhoben sich Fellachen und Beduinen in unzähligen lokalen Aufständen gegen die Eroberer. Und mit Ausnahme der Kopten und syrischen Christen, die sich von Napoleon eine Verbesserung ihres Loses erhofften, stellten sich nicht selten auch die Stadtbewohner gegen die Franzosen. In Alexandria hatten Einwohner schon in den ersten Tagen unvorsichtige Soldaten in dunkle Gassen gelockt und ihnen dort die Kehlen durchgeschnitten; in Kairo deckten Napoleons Agenten alsbald eine Verschwörung auf.
Im Nildelta herrschte im Rücken der Besatzer bald offene Rebellion. Ein erbarmungsloser Kleinkrieg wütete, beantwortet durch eine lange Abfolge von Scheusslichkeiten und Massakern, die im Gewand von Aufstandsbekämpfungsoperationen bis zum Schluss der französischen Besatzung weitergehen sollten.
Auf der einen Seite verbrannte die Bevölkerung eines Dorfes einmal zwei Soldaten bei lebendigem Leib, auf der anderen Seite schlug die Orientarmee mit Blutbädern wie demjenigen vom 19. Juli in Shum zurück. Ein Feldwebel berichtete darüber:
»Wir stiegen über die Mauern und drangen in das Dorf ein, dabei schossen wir die ganze Zeit in die Menge. Wir töteten etwa 900 Menschen, die Frauen und Kinder nicht mitgezählt, die in ihren Häusern geblieben waren, welche wir mit unseren Musketen und Geschützen in Brand setzten. Als das Dorf eingenommen war, sammelten wir alles, was wir finden konnten – Kamele, Esel, Pferde, Eier, Kühe, Schafe ... Bevor wir dieses Dorf verliessen, verbrannten wir auch die restlichen Häuser oder, besser gesagt, Hütten, um diesen halbwilden und barbarischen Menschen eine furchtbare Lektion zu erteilen.«
Wie passte das Abschlachten von Menschen jeden Alters und Geschlechts zu den wortreichen Salbadereien über die Befreiung vom mamelukischen Joch und die Etablierung einer »Tochterrepublik« von Frankreich? Napoleon musste einsehen, dass es darauf keine befriedigende Antwort gab. Rasch verabschiedete er sich denn auch von diesen Idealen, als er daranging, in seinem Nilreich die Verwaltung aufzubauen.
Er, der sich jetzt Sultan al-Kabir nennen liess, hoffte, den muslimischen Klerus für seine Ziele einspannen zu können, und berief zu diesem Zweck einen siebenköpfigen Diwan aus islamischen Rechtsgelehrten in die Regierung. Als zweite Mitarbeiterklasse fanden Türken, Griechen und Kopten Einlass in die Reihen der Beamtenschaft der neuen Institutionen. Innovationsfreudig hob Bonaparte einheimische Truppenneuschöpfungen aus der Taufe – eine koptische Legion und ein Dromedar-Bataillon – und schielte darauf, sich durch die Ausrichtung aufwendiger traditioneller Feste wie der Nilfeier die Volksfrömmigkeit zunutze zu machen. Zu guter Letzt liess er durchblicken, möglicherweise zur Bekehrung zum Islam bereit zu sein. Als die Geistlichkeit ihn darauf verpflichten wollte, musste er zurückkrebsen: Weder liessen sich seine Männer beschneiden, noch würden sie je auf ihren Wein verzichten, an den sie »seit ihrer Kindheit« gewohnt seien, meinte er kleinlaut.
All diese Normalität vortäuschenden Massnahmen, ja selbst die Revolten im Delta rückten bald in den Hintergrund. In der Nacht vom 1. auf den 2. August 1798 stellte Admiral Nelsons britisches Mittelmeergeschwader die französische Flotte bei Abukir und vernichtete sie. Nur vier Schiffe konnten sich retten. Mit einem Schlag war das französische Ägyptenabenteuer aller Erfolgsaussichten beraubt. Ein Abend und eine Nacht reichten aus, um Napoleons Armee vollkommen zu isolieren, ihre Verbindung zur Heimat zu kappen und ihre Zukunft in ein düsteres Licht zu tauchen.
Am 12. September stürzte das nächste Kartenhaus zusammen. Unwillig, auf eine der strahlendsten Perlen seines Imperiums zu verzichten und den Verlust seiner Kornkammer und seines Kaffeehandelszentrums hinzunehmen, erklärte der osmanische Sultan Selim III. in Konstantinopel Frankreich den Krieg.
Obendrein kämpften die Mameluken weiter, Ibrahim Bey gegen die Grenze zu Syrien hin, Murad Bey in Oberägypten. Der général en chef musste persönlich intervenieren, um die Mameluken des Ibrahim und deren Beduinen-Verbündete, laut Napoleon »die grössten Diebe und die grössten Schurken auf der Erde«, in ihre Schranken zu weisen und über die syrische Grenze abzudrängen.
Im Süden heftete sich General Louis Desaix, begleitet von nie mehr als 4000 Mann und einem blutjungen äthiopischen Mädchen als Geliebter, an die Fersen von Murad Bey. Der 50jährige, weissbärtige Mamelukenführer, ein in vielen Intrigen und Kämpfen gestählter Überlebenskünstler aus dem Kaukasus, zog sich nach Oberägypten zurück. Von dieser Basis aus hoffte er, seine Kräfte sammeln und seine Macht zurückgewinnen zu können.
Sein 20 Jahre jüngerer Verfolger liess indes niemals locker, egal in welche glühend heissen, wasserarmen Ödnisse ihn Murad auch hineinzog. In Sediman beging der Bey am 7. Oktober wieder den Fehler, seine 4000 Militärsklaven und 8000 Beduinen »mit einer Tapferkeit ... die an Wut grenzte« auf Desaix‘ drei französische Karrees loszulassen. Diesmal fegten sie mit verheerender Gewalt durch ein kleines Vorhutskarree, um am Ende abermals zu unterliegen. Ein bitteres Nachspiel verlieh dem Kampf gleichwohl den Anschein einer französischen Demütigung: Der Gegner setzte sich trotz Ausfällen von 400 Mann in guter Ordnung ab, wohingegen das französische Kommando sich zu einer brutalen Entscheidung gezwungen glaubte: Es liess die eigenen Verwundeten in der Wüste zurück. »Desaix blieb, tief gerührt, einige Augenblicke lang unschlüssig«, erläuterte Denon. »Aber die allgemeine Not befahl. Die Stimme der Notwendigkeit übertönte das Geschrei der unglücklichen Verwundeten, und man marschierte«.
Nach der Schlacht von Sediman verlegte sich Murad auf den Guerillakampf. Er wich den Franzosen aus und überliess ihnen nur verbrannte Erde. In zerfetzten Uniformen, völlig zerrissenem Schuhwerk, geplagt von der Ruhr und einer schweren Augenkrankheit, die Hunderte erblinden liess, stocherten die Franzosen hinter einem Feind her, der sich nicht mehr fassen liess. Geriet einer der ihren in die Hände der Beduinen, war ihm ein qualvoller Tod gewiss.
Von Mameluken ausgeplündert und von Franzosen für diese »Kollaboration mit dem Feind« auch noch schwer bestraft, litten die Einwohner bittere Not. So wie der Ort Gemerissiem, wo die Franzosen die Nacht verbrachten. Denon erzählte:
»Das Geschrei der Weiber gab uns bald zu erkennen, dass sich unsere Soldaten der Dunkelheit der Nacht bedient und trotz ihrer Müdigkeit unnützerweise Kraft verschwendet und unter dem Vorwande, Lebensmittel zu suchen, etwas an sich gerissen hatten, dessen sie nicht bedurften. Durch Raub und Entehrung aufs Höchste getrieben, fielen die Einwohner über unsere Patrouillen, die zu ihrer Verteidigung ausgesandt waren, her. Oh Krieg! Du bist glänzend in der Geschichte, aber näher betrachtet, wenn sie nicht die Schrecken deiner einzelnen Züge verbirgt, bist du voller Runzeln.«
Monatelang zog sich dieses hartnäckige, mit Gefechten und einseitigen Abschlachten von militärisch unbedarften Dörflern durchsetzte Ringen hin. Bei Beni Adi zum Beispiel säbelte die französische Kavallerie am 1. Mai 1799 2000 Fellachen nieder. Überall trugen sich schlimmste Gräuel zu, wie Vivant Denon zugab: »Die Schwierigkeiten, unsere Feinde an Gestalt, Farbe und Kleidung sogleich zu erkennen, machten, dass wir täglich unschuldige Fellachen umbrachten. ... Das Los der Einwohner, zu deren Glück wir gekommen, war nicht sonderlich beneidenswert.«
Ein ganzes Land stöhnte unter den Schrecknissen, aber Murad bedurfte noch weiterer Schläge, um das Handtuch zu werfen. Nach einem Jahr der Inaktivität verständigte er sich im April 1800 mit General Kléber und starb im Folgejahr an der Pest.
Das ganze dröhnende Pathos von Freiheit und Republikanismus versackte mittlerweile längst im Sumpf der faktisch kolonialen Massnahmen Napoleons. Er drängte die Moslems ins Abseits, indem er immer mehr Christen mit Verwaltungsaufgaben betraute. Das löste Furcht vor einer christlichen Kolonisation aus, eine Angst, die der türkische Sultan, für viele immer noch der legale Herrscher Ägyptens, für sich nutzte, indem er zum Jihad, zum heiligen Krieg gegen die Besatzer aufrief. Dabei bedurfte es solcher Proklamationen gar nicht; die Franzosen taten auch so genug, um sich unbeliebt zu machen. Ihre lockere Moral löste Abscheu aus, das Verhalten als Besatzungsmacht noch mehr, aber am schlimmsten waren die ständig steigenden, immer drückenderen und auf schlichtes Raubrittertum hinauslaufenden Abgaben, Bussgelder, Strafkontributionen, Steuern und Requisitionen, die sie den angeblich befreiten Menschen abpressten. Fern der Heimat auf sich allein gestellt, überlebte die Orientarmee, indem sie das Land kahlfrass.
Die Menschen wehrten sich verzweifelt. Im Delta erhoben sie sich ab September 1798 in immer grösserer Zahl. Sogar Kairo versuchte am 21. Oktober, seine Besatzer abzuschütteln. Eine von den Türmen der vielen Minarette aus aufgepeitschte, lynchbereite Masse schnitt jedem Franzosen den Hals durch, den sie finden konnte – bis zu 300 –, plünderte das griechische Viertel und stürmte ein Krankenhaus, wo kaum jemand am Leben blieb. Den Aufständischen, die sich um die Al-Azhar-Moschee herum sammelten, erging es nicht besser, als Bonaparte am nächsten Tag mit Kanonen und Grenadieren gegen sie vorging. »Alle Strassen wurden zum Schauplatz eines blutigen Gemetzels«, bezeugte ein Quartiermeister. Rund 3000 Menschen starben in diesen Kämpfen und noch mehr, als Bonaparte General Berthier am 23. Oktober befahl: »Bürger General, gebt an den zuständigen Befehlshaber die Anweisung, alle Gefangenen, die mit Waffen in der Hand festgenommen wurden, zu enthaupten. ... Ihre kopflosen Leichen werden in den Fluss geworfen.«
Zum Jahresende hin wütete auch noch die Pest im Delta. Längst frass sich die Niedergeschlagenheit, die seine Soldaten demoralisierte, auch in das Gemüt des Oberbefehlshabers. Vorbei die orientalischen Träume. Den Ägyptern grollte er: »Ihre Häuser sind erbärmlich. Es ist schwierig, ein fruchtbareres Land zu finden und ein Volk, das ärmer, unwissender und verrohter ist. Sie ziehen den Uniformknopf eines unserer Soldaten einer Sechs-Francs-Münze vor.«
Seine Stimmung hellte sich vorübergehend auf, als er wieder marschierte. Im Februar 1799 zog er mit 13 000 Mann nach Syrien, um sich aus seinem strategischen Halseisen zu befreien und den Osmanen offensiv entgegenzutreten. Er nahm El Arish und Jaffa, biss sich dann aber an der alten Kreuzritterburg Akkon die Zähne aus, die er zwei Monate lang vergeblich belagerte. Im Mai 1799 musste er sich sieglos nach Ägypten absetzen. Noch einmal gelang ihm dort ein grosser Erfolg, als er eine osmanische Invasionsabteilung am 25. Juli bei Abukir zurück ins Meer trieb.
Einen Monat später hielt General Jean-Baptiste Kléber einen Brief Napoleons in seinen Händen. Er konnte erst nicht glauben, was er da las:
»Sie finden dem beigeschlossen, Bürger General, einen Befehl, das Kommando über die Ägyptenarmee zu übernehmen ... Wenn, durch unvorhergesehene Ereignisse, alle Versuche [zur Versorgung der Armee, DZ] scheitern sollten und wenn Sie bis Mai weder Hilfe noch Nachrichten aus Frankreich erhalten haben, und wenn ferner in diesem Jahr, trotz aller Vorkehrungen, die Pest wieder in Ägypten wütet ... sind Sie für diesen Fall bevollmächtigt, mit der Osmanischen Pforte Frieden zu schließen, selbst unter der Voraussetzung, dass die vollständige Evakuierung Ägyptens die Hauptbedingung dafür wäre.«
Klammheimlich, ohne Kléber oder die Armee zu informieren, war Napoleon an Bord einer Fregatte in Richtung Heimat davongesegelt. Der Oberbefehlshaber hatte seine Armee im Stich gelassen! Und das Glück lachte ihm dabei: Er entging den britischen Geschwadern, erreichte Südfrankreich und putschte sich im November 1799 an die Macht im Land.
In Ägypten zurück blieben der Elsässer Kléber und der überlebende Rest der Orientarmee: 27 000 getäuschte, verratene Soldaten, die dem Untergang geweiht waren, nicht zuletzt deshalb, weil Napoleon jedes Interesse an ihnen verloren hatte. In den Schatztruhen des Heeres herrschte gähnende Leere, viele Männer litten an Krankheiten, und nur die Hälfte der Armee war noch einsatzbereit.
Unter diesen Vorzeichen mutete es geradezu brillant an, wie der hünenhafte, bei seinen Männern äusserst beliebte ehemalige Architekt Kléber den Hals der Armee immer wieder aus der Schlinge zog. Vom neuen Machthaber als faul und unentschlossen verleumdet – Napoleon fürchtete, dass die Wahrheit seiner Desertation ans Licht kommen könnte –, wehrte ein tatkräftiger Kléber am 1. November die Landung eines osmanischen Korps ab. In der Konvention von El-Arish handelte er mit dem osmanischen Grosswesir am 24. Januar 1800 den freien Abzug seiner Armee in die Heimat aus. Das wäre ihre Rettung gewesen – wenn Grossbritannien das Frieden bringende Abkomen nicht torpediert hätte. Der Krieg ging weiter.
»Soldaten, man antwortet auf solche Unverschämtheiten nur mit Siegen: Bereiter euch auf den Kampf vor«, lautete Kléber stolze Antwort auf das englische Veto. Und er siegte: bei Heliopolis in den Vororten Kairos am 20. März 1800 mit 10 000 Mann gegen 60 000 Osmanen. Dann in der Stadt selbst, die sich neuerlich erhob und den Franzosen einen vierwöchigen Häuserkampf abnötigte, der noch einmal 3000 Menschenleben forderte. Die Überlebenden unterwarf Kléber einem von ihm als »Auspressen der Zitrone« bezeichneten Verfahren: Sie mussten 12 Millionen Francs an Kriegskontributionen leisten.
Die Summe sicherte das Weiterbestehen der Armee für ein paar Monate. Ihrem Oberbefehlshaber war nicht einmal mehr so viel Zeit vergönnt. Am 14. Juni 1800 setzten die Dolchstösse eines fanatisierten Moslems aus Jerusalem seinem Leben ein jähes Ende. Ihres Idols beraubt, verlangten die Soldaten nach Rache – und erhielten sie: Der französische Henker pfählte den Mörder vier Stunden lang.
Diese Barbarei war noch nicht der letzte Akt des Dramas. Unter dem zum Islam konvertierten, von seinen Männern verabscheuten, brutalen und unfähigen General Jacques-François »Abdullah« Menou krallte sich die mürrische, heimwehkranke französische Armee noch über ein Jahr lang in der ägyptischen Erde fest.
Erst die langerwartete britische Landung bei Alexandria im März 1801 läutete das Ende ein. Die Briten siegten bei Mandora und Canopus und schlossen Menou und seine Armee in Alexandria ein. Mit ihrer Kapitulation ging der Traum von einer nordafrikanischen Kolonie am 2. September 1801 als Fiasko zu Ende.
Er hatte 17 000 Franzosen und wenigstens 30 000 Mameluken, Osmanen und Ägyptern den Tod gebracht.
Es konnte nicht ausbleiben, dass der grösste Reinfall in Napoleons Karriere die unterschiedlichsten Interpretationen nach sich zog.
Der Korse selbst kaschierte seinen Misserfolg mit bombastischer Propaganda-Prosa. Andere hoben die Leistungen der mitgereisten Wissenschaftler bei der Erforschung und Beschreibung des Nillandes hervor und verwiesen auf deren monumentale, 20-bändige Description de l’Égypte als Vermächtnis französischer Geisteskraft. Sie legten dar, dass die Epoche des Ancien Régime in Ägypten geendet habe und das Land durch den Aufbau fortschrittlicher staatlicher Strukturen in die moderne Zeit katapultiert worden sei. Auch ein Nationalist wie Nasser hat davon gesprochen, dass Napoleon »die Ketten der Vergangenheit zerbrochen« habe.
Aber diesen Erwägungen müssen andere gegenübergestellt werden.
Namentlich jene, dass statt republikanischer Entwicklungshilfen Fremdherrschaftsbestrebungen und Unterdrückung aus den Läufen der französischen Kanonen kamen. Die französische Invasion diente zudem geradezu als Blaupause für spätere europäische Angriffe in Nordafrika, weil sie die Schwäche der dortigen Staatswesen aufdeckte. Es ist kein Zufall, dass sich 30 Jahre später eine exakt gleichgrosse Truppenmacht auf den Weg machte, Algerien zu erobern, und dabei Plänen folgte, die in napoleonischer Zeit ausgearbeitet worden waren.
International schreckte das Ägyptenabenteuer die Briten auf und veranlasste sie zu epochalen strategischen Entscheidungen. Wo sie in Indien verstärkt dazu übergingen, ihre Kolonialherrschaft aufzurichten, erhoben sie gleichzeitig das Mittelmeer zu einem Operationsgebiet ersten Ranges.
Damit schufen sie die Grundlage für die späteren Querelen mit Frankreich, das aus Napoleons ägyptischer Expedition und einer Reihe weiterer historischer Schnittpunkte mit dem Nilstromland – von den Kreuzzügen über die Beihilfe für Mehmet Ali bis zum französisch geleiteten Bau des Suezkanals – eine emotionale Vereinnahmung Ägyptens ableiten zu können glaubte. Paris betrachtete es als eigene Einflusssphäre und wähnte sich mit einer Art moralischem Vorrecht darauf ausgestattet. Genau das führte 80 Jahre später anlässlich der britischen Besetzung des Landes zu jenem schweren Zerwürfnis, das zu einem der Triebkräfte des »Wettlaufs um Afrika« heranwachsen sollte.
Mehmet Ali und die Briten
Um Napoleons Armee zu bekämpfen, kam Mehmet Ali nach Ägypten. Gemeinsam mit 300 Mann albanischer Miliz bestieg er im Januar 1801 im mazedonischen Kavala ein Schiff, das ihn und seine Männer nach Nordafrika trug, um dort das osmanische Heer zu verstärken.
Diese Reise stand am Beginn der Metamorphose, die aus einem analphabetischen und provinziellen 30-jährigen albanischen Tabakhändler und Milizhauptmann in osmanischen Diensten den »letzten Pharao« des Nillandes und den »Löwen der Levante« machen sollte, den Begründer des modernen Ägypten.
Später von Mehmet Ali angefertigte Porträtgemälde zeigen eine stämmige, pausbäckige und rauschebärtige orientalische Nikolausfigur, vermissen es aber, die harten Seiten seines Wesens einzufangen. Rücksichtslosigkeit und Brutalität mischten sich mit List, Klugheit und Führungsstärke zu einer Rezeptur, die Herrschaft verhiess.
Kaum in Alexandria gelandet, witterte Mehmet, dass das Machtvakuum in dem ausgebluteten, kriegsversehrten Land ungeahnte Möglichkeiten für denjenigen bereithielt, der geschickt agierte und energisch zupackte. Die Franzosen waren ebenso abgezogen wie die siegreichen Briten. Von Oberägypten aus versuchten die stark geschwächten Mameluken mit britischer Hilfe wieder Oberwasser zu bekommen. Dem standen die Osmanen entgegen, die gleichfalls keinen starken Rückhalt im Land hatten und auf Hilfstruppen wie die Albaner des Mehmet Ali angewiesen waren. Raffiniert setzte Mehmet seine Truppe als Machtbasis ein, um als eigenständiges Zünglein an der Waage aufzutreten und am Ende eines chaotischen und Leid verursachenden Wechselspiels aus Bürgerkriegen, Morden, Intrigen und Hungersnöten als Sieger dazustehen: Im Juni 1805 ernannte die Hohe Pforte – die osmanische Regierung – ihn zum Pascha und neuen Vizekönig in Kairo.
Im Namen der osmanischen Regierung ging Mehmet brutal gegen die Mameluken vor, deren mit Stroh ausgestopfte Köpfe er als Siegeszeichen nach Istanbul weiterleitete. Mit reichen Tributzahlungen sicherte er sich die Gunst des Sultans und zielstrebig ging er daran, seinen osmanischen Gouverneurssitz in Kairo zur glänzenden Residenz eines selbstbewussten Herrschers auszubauen.
Hochfliegende Machtvisionen beflügelten seinen Ehrgeiz. Doch noch ehe seine Pläne ausgereift waren, drohten die Briten, sie zu durchkreuzen.
Sie hatten die französische Orientarmee 1801 nicht aus Ägypten hinausgeworfen, um nun ungerührt zuzusehen, wie eine franzosenfreundliche Partei dort ans Ruder gelangte. Mehmet Ali verehrte Napoleon als sein Idol, agierte als Statthalter der – gegenwärtig englandfeindlichen – Osmanen und bekämpfte mit den Mameluken die Kraft, die Grossbritannien wieder in den Sattel zu heben beabsichtigte. Das zeitliche Aufeinandertreffen dieser Umstände löste in London eine politisch-militärische Kurzschlusshandlung aus.
Am 17. März 1807 gingen die ersten Teile eines viel zu gering dimensionierten Expeditionskorps aus 5914 britischen Linieninfanteristen, schweizerischen Söldnern, französischen Exilanten und sizilianischen Freiwilligen bei Alexandria an Land.
Ihrem Kommandeur, Generalmajor Alexander M. Fraser, »ein freimütiger, aufrichtiger und ehrenwerter Gentleman von sehr gutem, klarem Verstand, aber ohne das geringste Wissen um die höheren Fachgebiete politischer oder militärischer Wissenschaft«, war es nicht allein anzulasten, dass die ganze Unternehmung unter einem schlechten Stern stand. Aber er hatte erheblichen Anteil daran. Auf die Zusicherung des britischen Konsuls hin, dass 60 Kilometer entfernte Rosetta warte freudig auf seine Befreier, liess er eine kleine Marschkolonne von 1600 Mann dorthin abrücken und unterstellte sie obendrein einem Trottel: General Patrick Wauchope erschien es nicht eigenartig, am 31. März eine Stadt vor sich liegen zu sehen, die tot und verlassen wirkte. Da sich nichts rührte, führte er seine Männer, ohne die geringste Aufklärung zu treiben, geradewegs in das Gewirr würfelförmiger, braungelber Häuser – mitten in einen Hinterhalt hinein, in dem der General und 184 Mann den Tod fanden und 282 weitere Soldaten verwundet wurden.
Fraser musste Rosetta selbst belagern und tat sich mit den hartnäckigen albano-ägyptischen Stadtverteidigern schwer. Weitaus grösseres Ungemach drohte indes seinen rückwärtigen Verbindungen, denn mittlerweile näherten sich Mehmet Ah und seine Armee in Eilmärschen dem Kriegsgebiet. Als britische Sicherung lagen Teile des Schweizer Von-Roll-Regiments sechs Kilometer hinter Rosetta bei El Hamed auf einem Deich nahe des Nils. Hier setzten Mehmets Kämpfer an: Am 20. April zerhackte ihre Kavallerie eine Schweizer Kompanie auf der sandigen Ebene und liess nur drei Mann am Leben. Tags darauf ging der eigentliche Hammer am gleichen, durch mehrere Kompanien hastig verstärkten Ort nieder. Eine Flut von Ägyptern, Osmanen und Albanern ergoss sich aus Dutzenden von Nilbooten auf Colonel Macleods 815 Offiziere und Soldaten, die sich mit drei Kanonen auf einem Sandhügel zusammendrängten und verzweifelt zur Wehr setzten. Vergeblich. Nach Stunden erbitterten Ringens lagen 292 Europäer tot auf dem Feld. Macleods Vertreter, Major Karl Vogelsang, musste sein weisses Taschentuch schwenken; er ging mit allen Überlebenden in Gefangenschaft.
Zu diesem Zeitpunkt setzten sich Fraser und die Belagerer Rosettas bereits nach Alexandria ab, wo ihnen die Einschliessung und letztlich die Kapitulation drohte. Sie konnte abgewendet werden, weil die Vernunft nach London zurückkehrte und die Regierung zur Korrektur ihres kolossalen Fehlentscheids bewog. Im September 1807 holte sie die Truppen heim, ohne das Geringste erreicht und Mehmet Alis Macht erschüttert zu haben.
Barbaresken, Europäer und Amerikaner
Fast lautlos glitten sie heran, die zwölf Schiffe, die in der Nacht vom 2. auf den 3. September 1798 die Insel San Pietro vor der Südküste Sardiniens anliefen. Später hiess es, ein zum Islam bekehrter Insulaner selbst, ein gehörnter Ehemann, habe die Freibeuter gegen den Ort Carloforte geführt. Dessen Bewohner schlummerten nichtsahnend, als die Hölle losbrach. Ein Chronist berichtete:
»Im Nu hatten sich die Barbaresken überall auf dem kleinen Eiland verteilt, die Türen gesprengt und das Innere der stillen Behausungen mit ihren Fackeln in grelles Licht getaucht. Die Leute, zu Tode erschrocken und gänzlich kopflos, wurden ohne Gegenwehr gepackt und in Ketten gelegt. ... Den Frauen drohten Schande und Gewalt, den Unglücklichsten unter ihnen, welche sich verzweifelt gegen die Besudelung durch ihre Umarmung gewehrt hatten, stiessen die Barbaren auf eigenem Bette den Dolch in die Brust.«
Nahezu die ganze Einwohnerschaft, rund 750 Menschen, verschwand in den Schiffsbäuchen, um auf dem Sklavenmarkt von Tunis wieder ausgespien zu werden.
Die Episode war Teil des piemontesisch-tunesischen Krieges, einem von vielen Konflikten zwischen den europäischen Mächten und den Barbaresken-Staaten, Staaten, die alle in der »Barbarei« lagen, im Westen (Maghreb) der islamischen Welt: Marokko, Algier, Tunis und Tripolis (Libyen). Mit Ausnahme Marokkos unterstanden sie nominell alle der Hoheit des osmanischen Sultans in Istanbul. In Wahrheit regierten Deys, Beys und Paschas sie als quasi unabhängige Regenten.
Jahrhundertelang lebten diese islamischen Küstenreiche gut von der Piraterie im Mittelmeer, oder genauer, der Freibeuterei, denn um »legal« Schiffe aufbringen, Küstenorte überfallen und Menschen versklaven zu können, mussten sich die Staaten nach geltender Rechtsordnung im Kriegszustand befinden. Fast die ganze Zeit über herrschte daher Krieg zwischen den Barbaresken, den italienischen und den iberischen Staaten.
So inszenierten und organisierten die muslimischen Korsaren ihre Kaperfahrten und Sklavenraubzüge als legitime Kriegsakte. Sie erbeuteten Schiffe und deren Fracht, vor allem aber die Menschen. Zurück in ihren Heimathäfen verkauften sie die toten und lebenden Prisen auf dem Basar und verhalfen damit dem Staat, der ein Gutteil des Verkaufserlöses einbehielt, zu seinen Einnahmen.
Ihre Schläge trafen meist südeuropäische Fischer oder Handelsmatrosen, die, mit wenigen Ausnahmen, einem harten Los entgegengingen. Als Kettensklaven schufteten sie in Steinbrüchen, an Festungsmauern und Hafenmolen, auf Schiffswerften, Landgütern oder den harten Ruderbänken der Galeeren. Die Frauen verschwanden hinter den Mauern von Harems und Bordellen.
Der amerikanische Seemann John Foss berichtete, wie er, 1793 gefangen in den Laderaum eines Schiffes geworfen, von »Ungeziefer, wie Läuse, Käfer, und Flöhen« regelrecht gefressen wurde. Am Bestimmungsort Algier marschierten er und die anderen Gefangenen durch ein Spalier »von Tausenden von boshaften Barbaren« zum Palast des Deys, der ihnen ankündigte: »Jetzt habe ich euch, ihr christlichen Hunde, ihr werdet Steine fressen.« Gemeinsam mit Hunderten anderer Sklaven hauste er auf dem Steinboden einer alten Festung, wo sie täglich 100 Gramm saures Schwarzbrot und, bei schwerer Kettenarbeit, Stockschläge verabreicht bekamen. Was die Lage der 3000 weissen Sklaven in der Regentschaft Algier von derjenigen der schwarzen Sklaven in den USA unterschied war die grausige Raffinesse der Strafen, die auf sie warteten: Schon fürs Zuspätkommen erhielt man 100-200 Stockschläge auf die Fusssohlen, auf beinahe alles andere stand der Tod durch Pfählen, Rösten oder Verbrennen, das Aufhängen an Eisenhaken oder durch Kreuzigen.
John Foss litt nicht allein: Binnen dreier Jahrhunderte mussten zwischen 800 000 und 1,25 Millionen Europäer dieses bittere Schicksal auf sich nehmen.
Viele sind nicht zurückgekehrt. Andere schon. Die fünf Prozent der Gefangenen, die das Glück hatten, wohlhabende Gönner oder reiche Angehörige zu haben, sahen sich freigekauft. Auch die Menschen aus Carloforte erlangten gegen ein Lösegeld von 95 000 Piastern nach ein paar Jahren ihre Freiheit zurück.
Längst hatte sich dieses System des Freikaufs verfestigt und auf ganze Länder ausgedehnt: Um ihren dauerklammen Staatskassen weitere Einkünfte zu erschliessen, erlaubten die Barbaresken den Feindnationen, sich durch Tributzahlungen von ihren Kaperfahrten zu befreien. Demütigend wie sie war, kostete eine solche Beschwichtigungspolitik die betroffenen Königtümer doch weitaus weniger Geld als militärische Gegenmassnahmen. Die meisten zahlten denn auch. Der Pascha von Tripolis zum Beispiel erhielt um 1800 von Spanien 20 000 USDollar und ein Schiff, von Frankreich $ 10 000 und zwei kleine Schiffe, von Venedig $ 6000, von Schweden und Dänemark je $ 5000 und so weiter.
Die Tribut-Verweigerer bekamen es mit nordafrikanischen Staaten zu tun, deren Schrekkenspotenzial damals bereits abgenommen hatte. Nicht mehr als zwei Dutzend kleine wendige Piratenschiffe vermochte zum Beispiel der Pascha von Tripolis 1801 auszuschicken. Aber das reichte immer noch aus, um empfindliche Nadelstiche auszuteilen und die Einwohner italienischer Küstenorte in Angst zu halten.
Das Königreich beider Sizilien bezahlte nicht und lag demzufolge mit Yusuf Karamanli, dem Pascha von Tripolitanien, im Krieg. Auch die Schweden mussten ihre Flotte aufbieten, als derselbe Herrscher ihnen wegen verschleppter Tributüberweisungen 1798 den Krieg erklärte und 13 Handelsfahrer aufbringen liess.
Erst nach Jahren liess sich ein schwedisches Geschwader aus vier Fregatten vor der tripolitanischen Küste sehen ... um sich dort jeder Aggression zu enthalten und passiv zu bleiben. Am 2. Oktober 1802 schied das skandinavische Land bereits wieder aus dem Krieg aus, nachdem der Pascha die gefangenen Handelskapitäne in »Kremationshemden« gesteckt und gedroht hatte, sie anzuzünden. Die Schweden kamen mit einer leichten Reduktion ihres Tributbetrages davon.
Zäher hielt Sardinien-Piemont dagegen. Jahrzehntelang schlug es sich mit dem Bey von Tunis und seinen Kaperfahrern herum. Zweimal, 1804 und 1811, gelang es seiner winzigen Marine, tunesische Korsarenschiffe aufzubringen. Dennoch gingen unzählige Fischerboote verloren, und es konnten nicht alle Attacken auf die Insel Sardinien verhindert werden, wie der Fall Carloforte bewies. Allerdings warnten die Wehrtürme an der Küste die Bevölkerung häufig erfolgreich: Bei Orosei wehrte die sardische Miliz im Juni 1806 einen Landungsversuch von 700 Nordafrikanern ab und tötete 80 von ihnen. Der Krieg wollte kein Ende nehmen.
»From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli«. Mit diesen Zeilen beginnt die Hymne des US-Marinekorps, deren zweiter Teil sich auf einen obskuren Krieg in Nordafrika bezieht, den ersten überhaupt, den die jungen USA im Ausland ausfochten.
Sobald sie ihre Unabhängigkeit erkämpft hatten, waren auch die Vereinigten Staaten ins Visier der Barbaresken-Piraten geraten. Das erste Schiff ging im Oktober 1784 an die Freibeuter verloren, viele weitere folgten.
»Millionen für die Verteidigung, aber keinen Cent für Tribut!« rief ein Kongressabgeordneter markig aus, doch die Parole verschleierte die Wahrheit; auch die USA zahlten, weil sie erst eine Kriegsmarine bauen mussten, mit der sie den Störenfrieden des Seehandels Paroli bieten konnten. Ab März 1794 legte man sechs Fregatten modernster Bauart in den Werften Neuenglands auf Kiel.
Im Gefühl neugewonnener Stärke verkündete Präsident Thomas Jefferson: »Ich bin ein Feind all dieser Weichheiten, Tribute und Demütigungen«. Den Fehdehandschuh allerdings warf Pascha Karamanli von Tripolis, als seine Männer im Mai 1801 den Flaggenmast im US-Konsulat umhauten. Das war die Kriegserklärung.
Zwei Monate später blockierten die neuen amerikanischen Fregatten Tripolis. Von schlappen Commodores auf der Kommandobrücke bestenfalls halbherzig geführt, richteten sie nicht das Geringste aus. Die ersten beiden Geschwaderchefs vertrödelten ihre Zeit und wetteiferten nur in Sachen Inkompetenz miteinander.
Der dritte Mann, Captain Edward Preble, ein dünner, rothaariger, kampflustiger Menschenschinder mit Magengeschwür, musste erst einmal mit einer Hiobsbotschaft fertigwerden: Die Tripolitanier hatten die Fregatte USS Philadelphia aufgebracht und die gesamte Besatzung gefangengenommen. Ein solch wertvolles Schiff in den Händen des Feindes zu belassen, war für Preble keine Option. Es musste zerstört werden. Vierundsiebzig Freiwillige meldeten sich zu einem gewagten Handstreich, auch Lieutenant Stephen Decatur, ein 25jähriger breitschultriger Veteran, der Prebles Order fasste: »Es ist mein Befehl, dass sie sich nach Tripolis begeben, des Nachts in den Hafen eindringen, die Philadelphia entern, sie verbrennen und sich zurückziehen.« Das las sich leicht. Erstaunlicherweise gelang es. Am 16. Februar 1804 schlichen sie sich als Malteser verkleidet auf einem wurmstichigen, alten Kahn in den Hafen, gingen längsseits der Philadelphia, sprangen hinüber und erledigten die Wachmannschaft mit Säbeln und Entermessern. Von allen Seiten beschossen, zündeten sie das Schiff an und entkamen, ohne einen einzigen Mann zu verlieren.
»Die kühnste und wagemutigste Tat des Zeitalters«, als die Admiral Nelson sie bezeichnete, machte Decatur zum amerikanischen Nationalhelden, nach dem Städte und Schulen benannt wurden. Das Kriegsblatt vermochte sie nicht zu wenden.
Genauso wenig die heftigen Bombardements von Tripolis, die der um Bombardierschiffe aus Sizilien verstärkte Preble im August 1804 unternehmen liess.
Hier nun kamen die eingangs erwähnten Marines ins Spiel. Beziehungsweise ein stürmischer und unkonventioneller Diplomat namens William Eaton, der den Plan ausheckte, den in Tripolis herrschenden Yusuf durch seinen exilierten Bruder Hamid zu ersetzen. Ohne sich sonderlich darum zu scheren, dass Washington sein Vorhaben nicht billigte, zog Eaton mit 160 lokalen Söldnern, einer Kanone und ganzen acht Marines von Alexandria aus in die Wüste. Nichts konnte ihn aufhalten, nicht die Sandstürme, nicht der Wassermangel, nicht einmal eine Meuterei und auch nicht der Feind. Am 27. April 1805 nahm er die Stadt Derna ein und wehrte alle Gegenangriffe aus dem fernen Tripolis ab.
Damit war das Patt durchbrochen. Am 4. Juni 1805 schlossen Tripolis und die USA Frieden. Die 300 amerikanischen Gefangenen kamen in Freiheit – gegen die Zahlung von 60 000 US-Dollar ...
Afrika um 1800
Die Militäraktionen der Amerikaner rissen den Barbaresken-Staaten die Maske der Unbesiegbarkeit vom Gesicht, die sie seit 300 Jahren trugen. Seit jenen Tagen kämpften die islamischen Nordafrikaner auf den blauen Fluten der Mittelmeergrenze gegen die christlichen Europäer und versetzten die Schifffahrtswege und Küsten in Angst und Schrecken. Noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatten sie den Spaniern vor Algier eine herbe Niederlage beigebracht und ihnen Oran, ihre letzte Niederlassung an der Küste entrissen.
Doch im Zeitalter von Aufklärung und Revolution begann der Wind zu drehen. Eine auf dem Weg in die Moderne voranschreitende westliche Welt ging, nicht mehr gewillt, ihre Untertanen auf orientalischen Sklavenbasaren verschachert zu sehen, immer offensiver in den alten Konflikt. Ihre wachsende Stärke reduzierte die Barbaresken mit ihren Miniaturflotten aus kleinen Korsarenschiffen auf den Status einer Plage. Überall gerieten die nordafrikanischen Staaten unter Druck; ihre osmanische Hoheitsmacht konnte ihnen, selbst schwächelnd, keine Hilfe leisten.
Entschlossen gingen die Amerikaner voran und enthüllten, wie brüchig die Fassaden der Macht in Tripolis, Tunis und Algier mittlerweile geworden waren. In nicht allzu ferner Zukunft würden die Grossmächte die Moslem-Piraten in ihre Schranken weisen, soviel war absehbar. Den Korsarenstaaten bliebe nur noch eine allerletzte Verschnaufpause bis zum Ende der napoleonischen Kriege.
Jenseits dieses dünnen Mittelmeersaumes gibt es ein anderes, grösseres Afrika.
Die grösste Wüste der Welt, die Sahara, legt sich auf über 5000 Kilometern Breite quer über den ganzen Kontinent, zwischen den mediterranen Norden und den tropischen Süden. Fast ein Drittel dieses gewaltigen Kontinents von 30 Millionen Quadratkilometern, des zweitgrössten der Erde, füllt sie aus.
Im Süden geht sie allmählich in die Savannenlandschaft über, schafft jene landschaftlichen Bühnen mit hohen, verdorrten Gräsern, rostrot leuchtenden Termitenbauten und bizarr verkrüppelten Affenbrotbäumen, die uns aus den Broschüren der Touristikunternehmungen entgegenprangen. Dieses tropische Steppenland breitet sich in der ganzen Zone zwischen der Wüste und dem Regenwald aus, als Feuchtsavanne im Süden, Trockensavanne in der Mitte und Dornenstrauch-Savanne nahe der Wüstenränder. Halbkreisförmig zieht es sich um den ganzen Kontinent, vom Senegal im Westen bis Somalia im Osten, von wo aus es eine breite Schneise durch das ostafrikanische Küsten- und Hinterland bis zum südafrikanischen Veld schlägt.
Im Nordosten durchfurcht der grosse afrikanische Grabenbruch die Länder von Äthiopien bis Mosambik. Entlang seiner Ränder türmen sich die höchsten Berge Afrikas auf, auch der Kilimandscharo mit seinen 5895 Metern, hier senken sich die tiefsten und grössten Seen in die Erde, der Turkana-, der Malawi-, der Tanganjika- und der grösste, der Victoriasee.
Westlich dieses Rift Valley liegt das feuchtdampfende Herz des Kontinents. Da, wo das Satellitenbild am dunkelgrünsten leuchtet, erhebt sich noch heute der Regenwald des Kongobeckens, das urtümliche Zentrum eines Tropenwaldgebietes, welches sich vor 200 Jahren über mehr als ein Zehntel Afrikas erstreckte und – unterbrochen nur vom Dahomey Gap - quer durch die Küstenzone Westafrikas bis nach Guinea hinein spross und wucherte.
Als schärfsten Kontrast dazu formen wasserarme Trockenzonen die Landschaft in weiten Teilen des Horns von Afrika – die drei Danakil-Somalia-Wüsten – und im südwestlichen Afrika, wo sich die dornenstrauchbewachsene Kalahari fast nahtlos an die unwirtlich leere und sandige Namib an der Küste anschliesst.
Von unzähligen Tierarten belebt und (heute) einer Milliarde Menschen bewohnt, teilen sich die Wüsten, Dschungel und Savannen in 54 selbstständige Staaten und drei international nicht anerkannte Staatswesen (Puntland in Somalia, Nordsomalia und die Westsahara) auf.
Vor 200 Jahren hätte es jeden Kartografen überfordert, eine politische oder ethnische Landkarte Afrikas zu zeichnen, selbst wenn ihm die Verhältnisse bekannt gewesen wären. Höchstens 110 Millionen Menschen bevölkerten damals den Erdteil, und noch 1920 würden es bloss 142 Millionen sein. So gering die Menschen an Zahl waren, so vielfältig waren die Gruppen, in die sie sich aufteilten. Man hat die Zahl der Entitäten – Völker, Stämme, Staatswesen – auf über 10 000 geschätzt, diejenigen der Ethnien auf rund 4000 und die der Sprachen auf über 2000.
Die Vielzahl an Sprachen lässt sich in vier grosse Familien einordnen: die nilosaharanische, afroasiatische, nigerkongolesische und khoisanische. Südlich einer Linie von Kamerun bis Kenia werden beispielsweise in der ganzen Südhälfte Afrikas – mit Ausnahme des Südwestens – Bantusprachen gesprochen, 500 an der Zahl, die ihrerseits dem Volta-Kongo-Zweig der Niger-Kongo-Sprachen zugeordnet werden.
Vielfältigste kulturelle, soziale, religiöse und politische Formen haben sich auf dem Boden des Kontinents entwickelt, ein faszinierend bunter Kosmos menschlicher Lebenswelten. Die Sahara als grosse Übergangs- und Scheidezone trennte die Welt des Nordens – hellhäutige Berber, Araber und Maghrebiner, die historisch mit dem Mittelmeerraum vernetzt waren – von dem scheinbar isolierten, eigenständigen Kosmos der Subsahara mit ihren primär dunkelbis schwarzhäutigen Bewohnern. Südwärts der Wüste lebten die einen als Nomaden, die anderen als Bauern und wieder andere als Städter. Sie kleideten sich in üppig weite Gewänder oder fast gar nicht, und wenn sie sich gruppierten – zu hierarchisiert-kastenartigen oder egalitären Gesellschaften –, suchten sie das personenbezogene Gemeinschaftsmodell.
In den nährstoffarmen Urwäldern steckten die Naturvölker, Jäger und Sammler, die auch Obst und Gemüse anbauten, politisch in den Formen von Urgemeinschaften fest, die keine übergeordnete Autorität anstrebten.