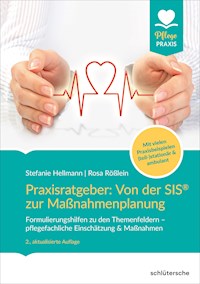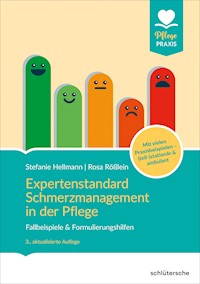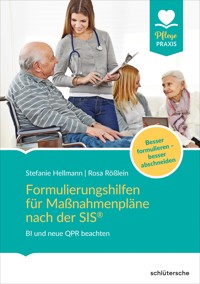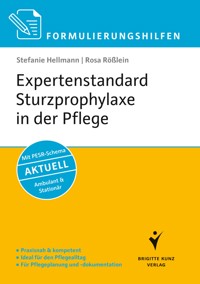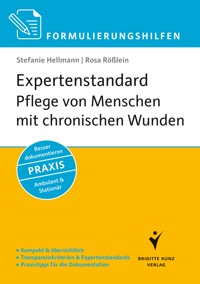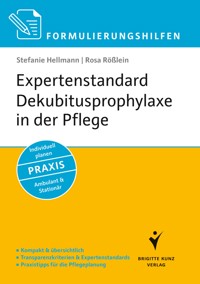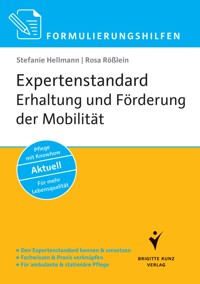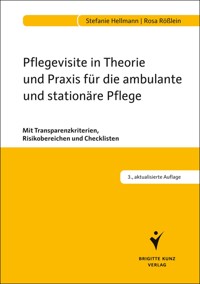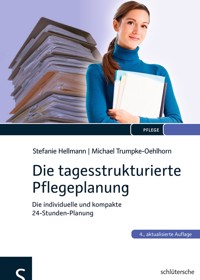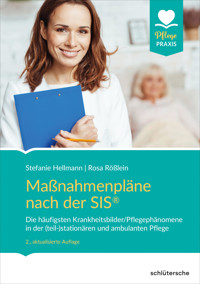
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Pflege Praxis
- Sprache: Deutsch
Wie kann ein individueller Maßnahmenplan aussehen? Wie lässt sich die Komplexität einzelner Krankheitsbilder kompakt und aussagekräftig abbilden? Das sind nur zwei von vielen Fragen, die sich Pflegekräfte stellen müssen, wenn es darum geht, aus der Strukturierten Informationssammlung (SIS®) einen individuellen Maßnahmenplan zu formulieren. Dieses Buch bietet eine kompakte Übersicht: Die häufigsten Krankheitsbilder älterer Menschen und Vorschläge für einen daraus resultierenden Maßnahmenplan: erweiterbar, individualisierbar und auf dem neuesten Stand. Konkrete Fallbeispiele aus der Praxis erläutern den Weg, der von der SIS® zum individuellen Maßnahmenplan führt. Die ideale Arbeitshilfe für alle Pflegekräfte, die mit der Maßnahmenplanung nach der SIS® betraut sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefanie Hellmann ist Diplom-Pflegewirtin (FH), Dozentin, Heimleiterin und examinierte Altenpflegerin.Rosa Rößlein ist Gerontologin (M.Sc.), Diplom-Pflegewirtin (FH), Mitarbeiterin beim Medizinischen Dienst sowie examinierte Altenpflege-und Gesundheits- und Krankenpflegekraf.
» Der Wechsel von der alten Pflegeplanung zum aktuellen Maßnahmenplan ist leichter als Sie denken!«
STEFANIE HELLMANN
Bibliografische Informaton der Deutschen Natonalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
ISBN 978-3-8426-0911-2 (Print)
ISBN 978-3-8426-9214-5 (PDF)
ISBN 978-3-8426-9215-2 (EPUB)
2., aktualisierte Auflage
© 2024 Schlütersche Fachmedien GmbH, Hans-Böckler-Allee 7, 30173 Hannover, www.schluetersche.de
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in diesem Buch gelegentlich die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich Personenbezeichnungen gleichermaßen auf Angehörige des männlichen und weiblichen Geschlechts sowie auf Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen.
Autorin und Verlag haben dieses Buch sorgfältig erstellt und geprüft. Für eventuelle Fehler kann dennoch keine Gewähr übernommen werden. Weder Autorin noch Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus in diesem Buch vorgestellten Erfahrungen, Meinungen, Studien, Therapien, Medikamenten, Methoden und praktischen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen. Insgesamt bieten alle vorgestellten Inhalte und Anregungen keinen Ersatz für eine medizinische Beratung, Betreuung und Behandlung.
Etwaige geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Daraus kann nicht geschlossen werden, dass es sich um freie Warennamen handelt. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der gesetzlich geregelten Fälle muss vom Verlag schriftlich genehmigt werden.
Lektorat: Claudia Flöer, Text & Konzept Flöer
Covermotiv: Viacheslav Iakobchuk – stock.adobe.com
Inhalt
Vorwort
1Themenfelder der SIS® und ihre Bedeutung für den Maßnahmenplan
1.1Die sechs Themenfelder der SIS®
1.2Der Maßnahmenplan in der Tagesstruktur
2Grundlage eines Maßnahmenplans – die SIS®
2.1Das Erstgespräch
2.2Die pflegefachliche Einschätzung
2.3Der Handlungsbedarf aus der Risikomatrix
3Maßnahmenpläne für die häufigsten Krankheitsbilder/Pflegephänomene im Alter
3.1Apoplex
3.1.1Maßnahmenplan stationär
3.1.2Maßnahmenplan ambulant
3.1.3Maßnahmenplan teilstationär
3.2Arthrose
3.2.1Maßnahmenplan stationär
3.2.2Maßnahmenplan ambulant
3.2.3Maßnahmenplan teilstationär
3.3COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung)
3.3.1Maßnahmenplan stationär
3.3.2Maßnahmenplan ambulant
3.3.3Maßnahmenplan teilstationär
3.4Dekubitus
3.4.1Maßnahmenplan stationär
3.4.2Maßnahmenplan ambulant
3.4.3Maßnahmenplan teilstationär
3.5Demenz
3.5.1Maßnahmenplan stationär
3.5.2Maßnahmenplan ambulant
3.5.3Maßnahmenplan teilstationär
3.6Depression
3.6.1Maßnahmenplan stationär
3.6.2Maßnahmenplan ambulant
3.6.3Maßnahmenplan teilstationär
3.7Herzinsuffizienz
3.7.1Maßnahmenplan stationär
3.7.2Maßnahmenplan ambulant
3.7.3Maßnahmenplan teilstationär
3.8Morbus Parkinson
3.8.1Maßnahmenplan stationär
3.8.2Maßnahmenplan ambulant
3.8.3Maßnahmenplan teilstationär
3.9Multiple Sklerose
3.9.1Maßnahmenplan stationär
3.9.2Maßnahmenplan ambulant
3.9.3Maßnahmenplan teilstationär
3.10Osteoporose
3.10.1Maßnahmenplan stationär
3.10.2Maßnahmenplan ambulant
3.10.3Maßnahmenplan teilstationär
3.11Rheuma
3.11.1Maßnahmenplan stationär
3.11.2Maßnahmenplan ambulant
3.11.3Maßnahmenplan teilstationär
3.12Chronischer Schmerz
3.12.1Maßnahmenplan stationär
3.12.2Maßnahmenplan ambulant
3.12.3Maßnahmenplan teilstationär
Literatur
Register
Vorwort
Sie arbeiten in Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege und Begriffe wie SIS® bzw. Maßnahmenplan sind für Sie längst keine Fremdwörter mehr. Doch wie wir aus der Praxis hören, fällt der Umstieg von der »alten« Pflegeplanung zum neuen Maßnahmenplan immer noch vielen Pflegekräften schwer.
Das ist wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, wie lange wir alle mit der Pflegeplanung gearbeitet haben – und wie oft wir uns über die überbordende Dokumentationsarbeit beschwert haben.
Tatsächlich hat die Entbürokratisierung der Pflegedokumentation vieles gebracht: ein klareres Bild vom Pflegeprozess, eine transparentere Struktur der Arbeit und sogar eine Zeitersparnis! Die allerdings nur dann, wenn man sich wirklich mit dem Strukturmodell und seinen Elementen auskennt. Eines dieser Elemente ist die Strukturierte Informationssammlung (SIS®) als Basis der Maßnahmenplanung.
Wir möchten, dass Sie schnell zu klaren Maßnahmen kommen und dass Sie diese auch transparent kommunizieren können. Für dieses Buch haben wir uns daher die häufigsten Krankheitsbilder und zwei relevante Pflegephänomene in der Altenpflege als Gliederungsmaßstab genommen. Anhand ausgewählter Fallbeispiele zeigen wir Ihnen, was Sie bei bestimmten Krankheitsbildern beachten müssen, was Sie schreiben können und wie Sie es einfach und verständlich formulieren.
Wichtig ist, dass dabei immer die Individualität, die Wünsche und Bedürfnisse jedes einzelnen Menschen beachtet werden. Mit unseren Beispielen möchten wir alle Mitarbeiter ermutigen, Veränderungen vorzunehmen und mit den Betroffenen zusammenzuarbeiten.
Wichtig Aktuelles Wissen – konkret aufbereitet
So ist das Buch aufgebaut:
1. Kurzvorstellung des Krankheitsbildes bzw. des relevanten Pflegephänomens
2. Maßnahmenplan in der Tagesstruktur
1 Themenfelder der SIS® und ihre Bedeutung für den Maßnahmenplan
Wir sind bereits in unserem Buch »Praxisratgeber: Von der SIS® zur Maß-nahmenplanung«1 sehr ausführlich auf den Zusammenhang zwischen SIS® und Maßnahmenplan eingegangen.
Daher möchten wir an dieser Stelle nur einige wenige Aspekte ansprechen: Ein Maßnahmenplan basiert immer auf der SIS®. »Die SIS® stellt den Einstieg in den Pflegeprozess dar und ist somit Kernstück des Strukturmodells. Sie wird … im Rahmen des Erstgesprächs oder bei gravierenden gesundheitlichen akuten oder schleichenden Veränderungen im Laufe der Versorgung eingesetzt. Sie … stellt im Wesentlichen die Sichtweise der pflegebedürftigen Person zu ihrer Lebens- und Pflegesituation und ihren Wünschen und Bedarfen an Hilfe und Unterstützung dar.
Der personenzentrierte Ansatz liegt dem Strukturmodell zugrunde. Ihre Aufgabe als Pflegefachkraft ist es, die Selbstbestimmung, die individuellen Wünsche des Pflegebedürftigen konsequent in die Gestaltung der Pflege und Betreuung einzubeziehen. Die Wünsche und Bedürfnisse des Pflegebedürftigen rücken somit in den Fokus der Versorgung. Praktisch geht es um den Beziehungsaufbau mit dem Pflegebedürftigen, dessen Beteiligung bezogen auf die Pflege- und Betreuungsplanung. Das heißt auch, miteinander in einen Verständigungs- und Aushandlungsprozess über die Pflege- und Versorgungsplanung zu gehen.
Abb. 1: Der personzentrierte Ansatz im Strukturmodell.
Des Weiteren wird … das Ergebnis des Verständigungsprozesses dokumentiert, welcher zwischen der pflegebedürftigen Person und der Pflegefachkraft erfolgt ist. Dieser bewusste Prozess des »sich Annäherns«, sorgt dafür, dass Pflegefachkräfte die Situation der pflegebedürftigen Person in ihrer Gesamtheit wahrnehmen, einordnen können und in Kooperation mit der pflegebedürftigen Person und den Angehörigen/Betreuern, die gewünschten Lösungen im Hinblick auf die Pflege und Betreuung gemeinsam festlegen.«2
Info
»Der Begriff der ‚Maßnahmenplanung‘ im Strukturmodell wurde anstelle des Begriffs ‚Pflegeplanung‘ gewählt, weil die Leistungen der Pflegeversicherung aus einem Mix von Grundpflege, psychosozialer Betreuung und hauswirtschaftlicher Versorgung besteht und im stationären Versorgungssektor auch die Leistungen der Behandlungspflege einbezieht.«*
* Die Pflegebeauftragte 2017: 21.
Tab. 1: Die Felder der SIS®
Feld A:
Allgemeine Daten wie Name und Geburtsdatum des Pflegebedürftigen, Datum des Gesprächs, Handzeichen der Pflegekraft
Feld B:
Stellen sie möglichst offene Fragen, hören sie gut zu, lassen sie den Pflegebedürftigen/ggf. Angehörigen/Betreuer erzählen.
Originalton des Pflegebedürftigen zur Eigenwahrnehmung der Situation, zu seinen Vorstellungen zum Hilfebedarf, ggf. Ängsten, Befindlichkeiten und Wünschen, Vorstellungen zum Unterstützungsbedarf und wie man seine Selbständigkeit fördern/erhalten kann – also die »Perspektiven des Pflegebedürftigen«. »Im Feld B soll die Erzählung der pflegebedürftigen Person auf keinen Fall mit Fachvokabular versehen oder (übersetzt) in der Fachsprachedokumentiert werden.«
Einstiegsfragen:
• Was bewegt Sie im Augenblick?
• Was brauchen Sie?
• Was können wir für Sie tun?
Zusatzfrage für die Tagespflege und Kurzzeitpflege:
• Was bringt Sie zu uns? (Fokus: eventuelle Vorstellungen, Wünsche des Pflegebedürftigen zu seiner weiteren Versorgung).
Feld C1
*
:
Abbildung der fachlichen Einschätzung der Pflegefachkraft zur Situation des Pflegebedürftigen. Darzustellen bzw. zu dokumentieren sind:
• pflegerische Hilfe- und Betreuungsbedarfe,
• bestehende Ressourcen,
• biografische Angaben inklusive Gewohnheiten, diese sind bezüglich ihrer Bedeutung für die individuelle Pflege und Betreuung den Themenfeldern zu zuordnen,
• mögliche Risiken in einzelnen Themenfeldern, deren Besprechung mit dem Pflegebedürftigen ggf. Angehörigen/Betreuer und Vorschläge zu entsprechenden Maßnahmen und Dokumentation des Ergebnisses der Besprechung,
• unterschiedliche Einschätzungen zur Situation zwischen den Pflegebedürftigen/Angehörigen und der Pflegefachkraft sowie die Ergebnisse des Aushandlungsprozesses zwischen den beteiligten Personen (vgl. der Bevollmächtigte der Bundesregierung, 2017:33f).
Dies erfolgt in einer Gliederung mit sechs pflegebezogenen Themenfeldern in Anlehnung an das BI. Deshalb kann die Risikomatrix erst dann ausgefüllt werden, wenn alle Themenfelder bearbeitet sind. (vgl. der Bevollmächtigte der Bundesregierung, 2017:33f).
Feld C2:
Initialassessment/Ersteinschätzung – Matrix zur Risikoeinschätzung – Basis sind die Erkenntnisse aus den Feldern B und C1
* C1 gesamt zitert von: Der Bevollmächtge der Bundesregierung für Pflege (2017): Informatons- und Schulungsunterlagen zur Einführung des Strukturmodells in der ambulanten, stationären und teilstationären Langzeitpflege. Berlin
1.1Die sechs Themenfelder der SIS®
»Die ersten fünf Themenfelder der SIS® sind wissenschaftsbasiert und für alle Versorgungsbereiche identisch. Die jeweils vier unterschiedlichen sechsten The-menfelder beruhen auf Konsensentscheidungen der Expertengruppen und den Ergebnissen aus den entsprechenden Praxistests.«3
Die fachliche Perspektive der sechs SIS®-Themenfelder entspricht der Struktur des Begutachtungsinstruments (BI) (Tab. 1). Auf dieser Grundlage werden zu den einzelnen Krankheitsbildern und Beeinträchtigungen individuelle Maßnahmen abgebildet.
Tab. 2: Themenfelder der SIS® und die Inhalte der BI im Überblick
Themenfeld
Inhalte (stationär, ambulant, teilstationär)
1 – Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
• Personen aus dem näheren Umfeld erkennen
• zeitliche und örtliche Orientierung
• Gedächtnis
• mehrschrittige Alltagshandlungen ausführen
• Entscheidungen im Alltagsleben treffen
• Sachverhalte und Informationen verstehen
• Risiken und Gefahren erkennen
• Mitteilung elementarer Bedürfnisse
• Aufforderungen verstehen
• Beteiligung am Gespräch
• Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
Leitfragen:
Inwieweit kann die pflegebedürftige Person sich zeitlich, persönlich und örtlich orientieren? Kann sie interagieren, Risiken und Gefahren erkennen? Beschrieben werden hier auch auftretende herausfordernde Verhaltensweisen.
2 – Mobilität und Beweglichkeit
• Positionswechsel im Bett
• stabile Sitzposition halten
• Aufstehen aus der sitzenden Position/Umsetzen
• Fortbewegung innerhalb des Wohnbereichs
• Treppensteigen
• außerhäusliche Aktivitäten
Leitfrage:
Inwieweit kann sich die pflegebedürftige Person frei und selbstständig innerhalb und außerhalb der Wohnung bzw. des Wohnbereichs bewegen? Beschrieben werden hier auch herausfordernde Verhaltensweisen.
3 – Krankheits-bezogene Anforderungen und Belastungen
• selbstständige Krankheitsbewältigung
• Medikation, Injektion, Einreibungen, Messung und Deutung von Körperzuständen
• Umgang mit Hilfsmitteln
• Verbandswechsel, Wundversorgung
• zeit- und technikintensive Maßnahmen in häuslicher Umgebung
• Arztbesuche
• Selbstständigkeit bei der Erhaltung einer Diät oder anderer Verhaltensweisen
• Unterstützungsbedarfe bei der Bewältigung von Phänomenen wie z. B. Schmerz, Inkontinenz oder deren Kompensation
Leitfrage:
Inwieweit liegen beim Pflegebedürftigen krankheits- und therapiebedingte sowie für die Pflege und Betreuung relevante Einschränkungen vor?
4 – Selbstversorgung
• Körperpflege
• An- und Auskleiden
• Ernährung
• Ausscheidung
Leitfrage:
Inwieweit kann die pflegebedürftige Person z. B. die Körperpflege, das An- und Auskleiden, das Essen und Trinken, die Toilettengänge etc. selbstständig/mit Unterstützung durchführen?
5 – Leben in sozialen Beziehungen
• Tagesablauf gestalten und an Veränderungen anpassen
• Ruhen und Schlafen
• sich beschäftigen
• in die Zukunft gerichtete Planung vornehmen
• Interaktion mit Personen im direkten Kontakt
• Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfeldes und Teilnahme an kulturellen, religiösen, sportlichen Veranstaltungen
• spirituelle und religiöse Aspekte
Leitfrage:
Inwieweit kann die pflegebedürftige Person Aktivitäten im näheren Umfeld und im außerhäuslichen Bereich selbstständig/ mit Unterstützung durchführen?
6 –Wohnen/ Häuslichkeit und Haushaltsführung
• eigene Möbel
• Haushaltsführung
Leitfragen:
Haushaltsführung (ambulant):
Inwieweit kann die pflegebedürftige Person ihren eigenen Haushalt noch selbstständig oder mit Unterstützung bewältigen?
Wohnen/Häuslichkeit (teilstationär/stationär):
Inwieweit kann die pflegebedürftige Person ihre Bedürfnisse und Bedarfe im Hinblick auf Wohnen und Häuslichkeit umsetzen?
»Risikomatrix stationäre, ambulante Pflege bzw. Tagespflege
Die SIS® soll eine umfassende Darstellung und Orientierung der Gesamtsituation des Pflegebedürftigen ermöglichen. Mit einer Risikomatrix (stationär, ambulant, Tagespflege) erfolgt nun eine Risikoeinschätzung. »Bei der Risikomatrix kommt abweichend vom sonstigen Vorgehen in den Feldern der SIS®, ein systematisches Ankreuzverfahren zum Tragen. Die Spalte ,Sonstiges’ am Ende der Risikomatrix symbolisiert, dass es sich bei dieser Risikomatrix nicht um eine abschließende Aufzählung handelt, sondern die Risikomatrix bei Bedarf um ein weiteres festgestelltes Risiko ergänzt werden kann.«4 Die praktische Anwendung der Risikomatrix in der stationären Pflege zeigt Abbildung 1.
Die Risikomatrix der SIS® für die ambulante Versorgung beinhaltet bei den Risiken und Phänomenen eine weitere Spalte »Beratung«. Erfolgt eine Beratung zu einem der Risiken und Phänomenen, wird der Inhalt kurz im Themenfeld dokumentiert und in der Risikomatrix angekreuzt. In der Praxis wird in der ambulanten Pflege oft ein Zusatzbogen zur Dokumentation der Beratungsleistung geführt (vgl. Der Bevollmächtige der Bundesregierung für Pflege, S. 49).5
Abb. 2: Praktische Anwendung der Risikomatrix in der stationären Pflege am Beispiel »Arthrose«.
1.2Der Maßnahmenplan in der Tagesstruktur
Der Maßnahmenplan in der Tagesstruktur ist Handlungsgrundlage für alle an der Pflege und Betreuung beteiligten Personen. Alle Maßnahmen zur Pflege, Betreuung, ggf. Hauswirtschaft sind zu dokumentieren. Auf Basis der Informationen aus der SIS® und anderer Quellen sind konkrete aktuelle und individuelle Maßnahmen zu beschreiben, ohne gesondert die Probleme, Ressourcen und Ziele zu dokumentieren. Die Maßnahmen sollten immer die Erwartungen, Vorstellungen der Betroffenen widerspiegeln und Bestandteil einer personenzentrierten Pflege sein.6
Info
Der Maßnahmenplan bzw. die Tagesstruktur sind fortlaufend anzupassen.
• Das gilt individuell wie z. B. bei Veränderungen des Krankheitszustandes, nach Krankenhausaufenthalten oder bei Veränderungen vereinbarter Leistungen.
• In der ambulanten Versorgung ist die Arbeitsteilung zwischen den Angehörigen und dem Pflegedienst zu dokumentieren.
Grundsätzliche Bestandteile eines Maßnahmenplans in der Tagesstruktur:
• Darstellung der Individualität des Betroffenen (Wünsche, Vorlieben, Rituale etc.)
• Festlegung von wiederkehrenden Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen (z. B. Körperpflege, Betreuung, hauswirtschaftliche Leistungen)
• Ableitung von Maßnahmen aus dem Risikomanagement und/oder deren Beobachtung
• Hinweise zu zusätzlichen Betreuungsleistungen sowie Maßnahmen zur Behandlungspflege
_____________________
1 Hellmann S, Rößlein R (2017): Praxisratgeber: Von der SIS® zur Maßnahmenplanung. Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover.
2 Der Bevollmächtigte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten sowie Bevollmächtige für Pflege (2017): Informations- und Schulungsunterlagen zur Einführung des Strukturmodells in der ambulanten, stationären und teilstationären Langzeitpflege. Version 2.0, Berlin: S 19
3 Ebd., S. 34.
4 Ebd., S. 49
5 Der Bevollmächtige der Bundesregierung für Pflege (2017): Informations- und Schulungsunterlagen zur Einführung des Strukturmodells in der ambulanten, stationären und teilstationären Langzeitpflege. Berlin
6 Vgl. Beikirch E, Nolting HD, Wipp M (2017): Dokumentieren mit dem Strukturmodell. Grundlagen – Einführung – Management. 2. Aufl. Vincentz Network, Hannover: 139f.
2 Grundlage eines Maßnahmenplans – die SIS®
Es gibt eine Reihe von Krankheitsbildern/relevanten Pflegephänomenen, die Ihnen in Ihrer Arbeit immer wieder begegnen:
• Apoplex
• Arthrose
• COPD
• Dekubitus
• Demenz
• Depression
• Herzinsuffizienz
• Morbus Parkinson
• Multiple Sklerose
• Osteoporose
• Rheuma
• Chronischer Schmerz
Wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie die besonderen Anforderungen, die diese Krankheitsbilder stellen, in tagesstrukturierenden Maßnahmenplänen berücksichtigen können. Denn diese Krankheitsbilder und relevanten Pflegephänomene haben Auswirkungen auf die Selbstständigkeit und Fähigkeiten der Betroffenen im Alltag und ihren Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe.
Natürlich wissen auch wir, dass ein Mensch nicht nur über seine Krankheit definiert wird. Darum geht es uns in diesem Buch auch nicht. Vielmehr möchten wir Ihnen – wie in einer Art Checkliste – zeigen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie tagesstrukturierende Maßnahmenpläne auf Basis der SIS® schreiben. Doch zunächst ein paar Sätze zu den Grundlagen.
2.1Das Erstgespräch
Das erste Gespräch mit einem Pflegebedürftigen und/oder seinen Angehörigen war schon immer wichtig. Im Rahmen der SIS® ist es nicht etwa unwichtiger geworden, sondern die Perspektive hat sich etwas verschoben: vom rein fachlichen Blick auf die Einschätzung des Pflegebedürftigen/ seiner Angehörigen. Aspekte wie der Erhalt der Selbstständigkeit, die Förderung der Selbstkompetenz des Pflegebedürftigen, aber auch die Pflegekompetenz der Angehörigen und die Stabilisierung der (häuslichen) Pflegesituation rücken in den Vordergrund. Das heißt, dem Pflegebedürftigen wird Raum für die Schilderung seiner Perspektive gegeben. Seine subjektive Sicht, Wünsche, Vorstellungen zum selbstbestimmten Leben, seine Wahrnehmung der aktuellen Lebens- und Pflegesituationen rücken dabei in den Vordergrund:
• Welche konkreten Erwartungen, Vorstellungen hat der Pflegebedürftige an die Pflege und Betreuung?
• Welcher Unterstützungs- und Hilfebedarf resultiert daraus?
Sie haben die Gelegenheit den Pflegebedürftigen kennenzulernen. Für Sie als Pflegefachkraft heißt das zugleich, dass Sie sich etwas zurücknehmen müssen. Sie fragen – aber die Antworten hat Ihr Gesprächspartner! Ihre Aufgabe ist es, diese Antworten möglichst genau (wörtlich) zu protokollieren und anschließend in eine Struktur zu stellen, aus der heraus sich Einschätzungen und schließlich Maßnahmen ergeben. Es wird aber immer wieder Situationen geben, in denen der Pflegebedürftige aufgrund von unterschiedlichsten Beeinträchtigungen Probleme hat, sich selbst zu äußern. Hier kann das stellvertretende Gespräch mit z. B. den Angehörigen/Betreuern hilfreich sein. Denken Sie aber immer auch daran, dass Sie über die Beobachtung des Betroffenen, seine Reaktionen im Zusammenhang mit pflegerischen Verrichtungen, in Betreuungssituationen und alltäglichen Begegnungen ebenso Informationen darüber erhalten, was dem Betroffenen z. B. angenehm oder unangenehm ist, was bei ihm Wohlbefinden auslöst.
Wichtig Gestalten Sie ein wirkliches Gespräch
Ob Sie gute, verwertbare Informationen für die Maßnahmenplanung erhalten, hängt nicht nur davon ab, ob der Pflegebedürftige Ihre Fragen versteht und darauf antworten kann. Es hängt auch davon ab, ob Sie es zu einem richtigen Gespräch kommen lassen:
• Schaffen Sie eine angenehme und vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre. Nehmen Sie sich Zeit. Wählen Sie einen Ort, an dem Sie ungestört miteinander sprechen können. Begegnen Sie den Pflegebedürftigen/Angehörigen mit Wertschätzung und Respekt.
• Hören Sie aktiv zu.
• Sagen Sie Ihrem Gegenüber, was Sie von ihm möchten.
• Stellen Sie immer nur eine Frage.
• Fragen Sie – aber warten Sie auch die Antworten ab.
• Beziehen Sie Informationen aus der Umgebung mit ein (Einrichtung, Bilder etc.).
• Machen Sie sich Notizen.
Wichtig Ihre Darstellung zählt*
Dokumentieren, informieren, verständigen, legen Sie fest:
• Dokumentation des Hilfe- und Pflegebedarfs, der Ressourcen sowie der Einschätzung zu Risiken und Phänomenen des Pflegebedürftigen
• Informieren Sie mit Empathie den Pflegebedürftigen, ggf. Angehörigen/Betreuer über die Ergebnisse ihrer Ersteinschätzung
• Verständigen Sie sich gemeinsam über die individuelle Versorgung
• Festlegen der ermittelten Pflege- und Betreuungsleistungen und Dokumentation abweichender Auffassungen zur pflegerischen Situation und empfohlenen Maßnahmen zur Risikoreduktion.
* vgl. Der Bevollmächtige der Bundesregierung für Pflege, S. 20f.
2.2Die pflegefachliche Einschätzung
Wir können Sie nur ausdrücklich ermuntern: Trauen Sie Ihrer pflegefachlichen Kompetenz! Als Pflegefachkraft sind Sie geschult in der Beobachtung von älteren und pflegebedürftigen Menschen. Wenn Sie ein Risiko beobachten, dann brauchen Sie kein Assessment, sondern einfach den Mut, das Kreuz an der richtigen Stelle der Risikomatrix einzutragen.
Wichtig Ihre Entscheidungen zählen
Beobachten, erfragen und bewerten Sie:
• Gibt es ein Risiko?
• Ist es notwendig, dieses Risiko noch weiter (= intensiver) einzuschätzen?
• Im ambulanten Setting: Brauchen der Betroffene/seine Angehörigen, Betreuer eine weitergehende Beratung?
2.3Der Handlungsbedarf aus der Risikomatrix
Bitte achten Sie darauf, dass jedes relevante Risiko, dass Sie in der Risikomatrix angekreuzt haben, zuvor auch von Ihnen im zutreffenden Themenfeld beschrieben wurde. Ein Risiko gilt nur dann als kompensiert, wenn Sie im Themenfeld nachvollziehbar dargestellt haben, wodurch das Risiko ausgeglichen wird.
Mit der SIS® wird eine umfassende Darstellung und Orientierung der Gesamtsituation des Pflegebedürftigen erreicht. Mit der Risikomatrix (stationär, ambulant, Tagespflege) erfolgt nun die Risikoeinschätzung (Abb. 2, Abb. 3).
Abb. 3: Pflegefachliche Einschätzung anhand der Risikomatrix – Überblick.
Die Risikomatrix ist ihre fachliche Befunderhebung. Sie betrachten pflegerelevante Risken (wie z. B. Dekubitus, Sturz, Ernährung) und Phänomene im Zusammenhang mit dem dokumentierten Befund in den Themenfeldern der SIS. Sie haben dabei die Gesamtsituation des Pflegebedürftigen im Blick. Grundlage der Risikoeinschätzung ist ihr evidenzorientiertes (= berufliche Erfahrung) und evidenzbasiertes (= wissenschaftliche begründetes) Fachwissen. Sie nutzen zur Unterstützung ihrer fachlichen Einschätzung pflegewissenschaftlich systematisiertes Wissen wie z. B. die Expertenstandards des DNQP (vgl. Der Bevollmächtige der Bundesregierung für Pflege, S. 49ff).
Abb. 4: Risiken einschätzen und Maßnahmen planen.
Wichtig Ihre Aufgabe als Pflegefachkraft
• In der Risikomatrix müssen Sie für jedes Themenfeld in Kombination aller Risikobereiche die Einschätzungs- und Entscheidungsschritte durchführen.
• Wenn Sie alle in der Matrix genannten Risikobereiche eingeschätzt haben, können Sie in der Spalte »Sonstiges« Ergänzungen vornehmen. Sie gehen bei der Einschätzung wie oben beschrieben vor. Die Spalte kann, muss aber nicht genutzt werden!
• Beachten Sie: Prophylaxen dokumentieren Sie immer im individuellen Maßnahmenplan.*
• Die Krankenbeobachtung ist grundlegender Bestandteil des pflegefachlichen Handelns.
* Vgl. Die Beauftragte 2017: 51.
Bitte denken Sie daran: Auf der Ebene der Risikomatrix erfolgt ausschließlich eine (Erst-)Einschätzung zu bestehenden Risiken. Wenn Veränderungen (akut oder schleichend) auftreten – bezogen auf die Situationseinschätzung des Pflegebedürftigen –, sind diese als Abweichungen im Berichteblatt zu dokumentieren und werden somit für das Pflege- und Betreuungsteam, Ihre »Teamkollegen«, sichtbar. Sie müssen dann die Situation des Pflegebedürftigen mittels Evaluation neu einzuschätzen. Je nach Ergebnis folgt dann die Anpassung des Maßnahmenplanes und ggf. der SIS®.
3 Maßnahmenpläne für die häufigsten Krankheitsbilder/ Pflegephänomene im Alter
Im Alltag ist es mitunter nicht so einfach, schnell eindeutige Formulierungen für Maßnahmen zu beschreiben. In den folgenden Kapiteln haben wir deshalb eine spezifische Auswahl von Krankheitsbildern und relevanten Pflegephänomenen sozusagen »durchdekliniert«. Es handelt sich dabei um die häufigsten (chronischen) Krankheiten im Alter. Der Ablauf ist stets der gleiche:
1. Definition des Krankheitsbildes
2. Zusammenfassung der Erkenntnisse aus der SIS®
3. Maßnahmenpläne (stationär, ambulant und teilstationär) in Form einer Tagestruktur
Vergessen Sie bitte nie die Individualität des einzelnen Menschen!
Wie gesagt: Wir wollen Ihnen einfach Hinweise darauf geben, was Sie bei den häufigsten Krankheitsbildern und relevanten Pflegephänomenen keinesfalls vergessen sollten bzw. worauf Sie achten sollten.
»Prinzipien des Maßnahmenplans
Routinemäßige und wiederkehrende Abläufe in der grundpflegerischen Versorgung sowie der psychosozialen Betreuung werden übersichtlich einmal nachvollziehbar abgebildet.
Es kann mit fixen Zeiten oder variablen Zeitkorridoren gearbeitet werden. Ausschlaggebend ist, ob aus fachlicher Sicht oder auf Wunsch des Bewohners bestimmte Leistungen zu einem fixen Zeitpunkt erbracht werden sollen oder müssen (z. B. Medikamente). Einzelheiten der Behandlungspflege werden wie bisher separat dokumentiert.
Unterstützende oder pflegerische Maßnahmen, die mehrmals am Tag in derselben Form erbracht werden (z. B. das Bereitstellen von Mahlzeiten in einer bestimmten Form), werden nur einmal individualisiert beschrieben und im Weiteren dann mit einem Kürzel in die Tagesstruktur integriert.
Auf der Ebene der Formulierung der Maßnahmen spielt die eindeutige Beschreibung der Maßnahme eine bedeutende Rolle. Die Maßnahmen werden handlungsleitend beschrieben. Das heißt, durch die Art der Beschreibung der Maßnahme wird z. B. nachvollziehbar ?Wer, Was, Wie, Wo und Wann? zu tun hat.
Abb. 5: Maßnahmen eindeutig beschreiben
Ziele sind immanenter Bestandteil der geplanten Maßnahmen. Maßgeblich kommt dies im Sinne der individuellen Zielsetzung durch die Aussagen und Wünsche der pflegebedürftigen Person zu ihrer Situation zum Ausdruck (personzentrierter Ansatz). In den konkreten Maßnahmen spiegeln sich die Ergebnisse dieses Prozesses wider, ohne dass die übrigen Zwischenschritte verschriftet wer-den.«7
3.1Apoplex
Definition Apoplex
Bei einem Apoplex kommt es zu einem plötzlichen Ausfall von Gehirnfunktionen aufgrund einer Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstofff. Folglich kommt es zu Schädigungen von Nervenzellen in der betroffenen Gehirnregion. Die Betroffenen leiden oft unter plötzlicher Schwäche, Lähmungen und Empfindungsstörungen einer Körperseite, starken Kopfschmerzen, Sprach- und Sehstörungen sowie Schwindel.
Generell kann zwischen zwei Arten von Schlaganfällen differenziert werden: Schlaganfälle als Folge von Durchblutungsstörungen und Schlaganfälle als Folge von Hirnblutungen.*
* Vgl. Kompetenznetz Schlaganfall (2017): Schlaganfall. Vorbeugung ist möglich. Im Internet: http://www.kompetenznetz-schlaganfall.de/292.0.html, Zugriff am 10.1.2019
3.1.1Maßnahmenplan stationär
Situation: Frau K. ist 86 Jahre alt. Nach einem Schlaganfall musste sie vor Kurzem in ein Pflegeheim umziehen. Ihre beiden Kinder (Sohn und Tochter) kommen regelmäßig zu Besuch.
Grundbotschaft: »Ich akzeptiere Hilfe. Aber wenn es um die Körperpflege geht, möchte ich ausschließlich von Frauen betreut werden.«
Themenfeld 1 – Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
»Das Plaudern fällt mir schwer und strengt mich an. Ich bin mir nicht immer sicher, welcher Tag heute ist. Früher habe ich am Morgen die Zeitung gelesen.«
Pflegefachliche Einschätzung:
• spricht von sich aus nur sehr wenig und wenn, dann verwaschen, braucht immer wieder Orientierungshilfen (Zeit, Datum, Tag)
• kann Wünsche und Bedürfnisse äußern
Verständigung:
• dazu anregen, langsam und deutlich zu sprechen, sich Zeit nehmen
Themenfeld 2 – Mobilität und Beweglichkeit
»Meine rechte Seite ist gelähmt. Ich kann nicht mehr das tun, was ich möchte. Den Rollstuhl kann ich nur wenig fortbewegen. Auf den Friedhof komme ich nur noch selten, um das Grab meines Mannes aufzusuchen. Früher war ich jeden zweiten Tag dort.«
Pflegefachliche Einschätzung:
• Hemiparese auf der rechten Seite, auf Lagerung des rechten Armes achten
• kann mit Hilfe stehen, benötigt Hilfe bei allen Transfers
• Positionswechsel im Liegen und Sitzen gelingen selbstständig
• versucht kleinere Wegstrecken selbstständig mit dem Rollstuhl zu bewältigen
• Bewegungsübungen bei Transfer und Körperpflege
• auf Dekubituskissen im Rollstuhl achten (Prophylaxe)
Themenfeld 3 – Krankheitsbezogene Anforderungen und Belastungen
»Der rechte, gelähmte Arm tut mir öfter weh. Wenn der Arm nach unten fällt, schaffe ich es nicht, ihn auf das Kissen zu legen. Mein Hausarzt hat mir eine Schmerzsalbe verschrieben, die hilft mir gut.«
Pflegefachliche Einschätzung:
• kann Schmerzen äußern
• auf Wunsch mit Schmerzsalbe einreiben
• Medikamente nach ärztlicher Verordnung
• Bewegungsübung der Hand im warmen Wasser
• Lagerung des rechten Armes
Verständigung:
• Bei Schmerzen meldet sie sich. Auf die korrekte Lagerung des rechten Armes wird geachtet.
Themenfeld 4 – Selbstversorgung
»Ich konnte mich früher selbst versorgen. Es ist nicht leicht, von anderen versorgt zu werden. Mir ist es unangenehm, von einem Mann gepflegt zu werden. Die Frisur muss bei mir gut sitzen und ein bisschen Schmuck muss sein.«
Pflegefachliche Einschätzung:
• legt Wert auf gepflegtes Äußeres (trägt Schmuck)
• ist überwiegend unselbstständig bei der Körperpflege, dem An- und Auskleiden
• meldet sich zum Toilettengang. Ist unselbstständig bei der Intimpflege und beim Einlagenwechsel
• Essen mundgerecht servieren
• hat Schluckbeschwerden, Nahrungsreste sammeln sich immer wieder in den Wangentaschen an, kaut wenig
• Getränke in Tasse mit Henkel einschenken
Verständigung:
• wenn möglich weibliche Pflegekräfte zur Pflege einteilen, Schmuck zusammen aussuchen und anlegen, auf die Frisur achten
Abb. 6: Risikomatrix (stationär) bei Apoplex.
Themenfeld 5 – Leben in sozialen Beziehungen
»An sich bin ich ein geselliger Mensch. Ich war vor meinen Schlaganfall jede Woche mit meinen Seniorenkreis in der Stadt unterwegs. Das geht jetzt nicht mehr und darüber bin ich traurig. Zu meinen Kindern habe ich einen guten Kontakt.«
Pflegefachliche Einschätzung:
• Kontakt zu Seniorenkreis fehlt ihr – war immer sehr gesellig
Verständigung:
• Angebot zur Unterstützung, Kontakt zu Seniorenkreis herstellen – Besuche anregen
• zu Aktivitäten im Haus bringen (Gymnastik, Gedächtnistraining usw.)
• Kinder kommen mehrfach die Woche zu Besuch, telefonieren mit ihr
Themenfeld 6 – Wohnen/Häuslichkeit
»Ich hatte eine schöne Wohnung, bin immer noch traurig, dass ich diese auflösen musste. Lege sehr viel Wert auf Sauberkeit und Gemütlichkeit.«
Pflegefachliche Einschätzung:
• hat Möbel und Bilder mitgebracht
• legt sehr viel Wert auf Sauberkeit
Verständigung:
• Reinigungsdame achtet verstärkt darauf, dass das Zimmer sauber und aufgeräumt ist
Tab. 3: Tagesstrukturierender Maßnahmenplan (stationär)
Tagesstrukturierender Maßnahmenplan (stationär)
Name: Frau K. geb. 25.9.1932 Blatt Nr. 1
Erstellt am:
Evaluation am:
Von:
HZ:
Evaluation am:
Von:
HZ:
Evaluation am:
Von:
HZ:
Individuelle Wünsche, Besonderheiten und Notwendigkeiten:
•