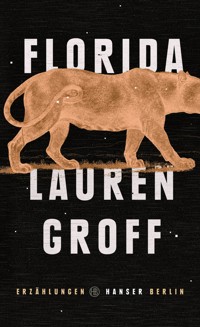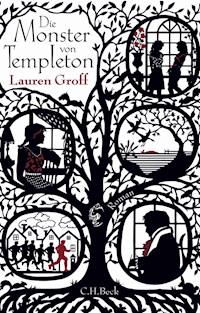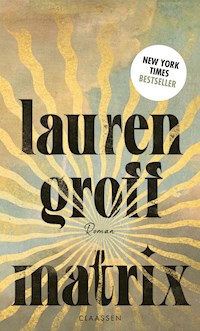
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte von weiblicher Gemeinschaft und Macht. Ein Fest der Erzählfreude, der Erfindungskraft und des Intellekts. Das neue Meisterwerk von Lauren Groff. Marie ist siebzehn Jahre alt, groß und ungelenk und nach allgemeiner Ansicht ungeeignet für die Ehe und das höfische Leben. Sie verehrt ihre Königin, Eleonore von Aquitanien, doch die verstößt sie mit einem Lächeln: Marie soll Priorin eines abgelegenen Klosters werden, irgendwo im Schlamme Englands, fern von den zärtlichen Zuwendungen ihrer Dienerin. Lebendig begraben in der Gemeinschaft verarmter, frierender, hungernder Nonnen – ausgerechnet sie, die aus einer Familie von Kriegerinnen stammt und alles andere als fromm ist. Doch in der Abgeschlossenheit des Klosters findet Marie für sich und ihre Schwestern ungeahnte Möglichkeiten von weltlichem Einfluss, Wohlstand und neuer Gemeinschaft. Matrix erzählt die Geschichte einer fehlbaren Heldin: einer Frau – kriegerisch, imposant, machtbewusst, hingebungsvoll –, deren Visionen verlorengehen, wie so viele Stimmen starker Frauen im Lauf der Geschichte. Der neue, flirrend aufregende Roman von Lauren Groff erweckt sie zum Leben und beschwört die utopische Kraft weiblicher Kreativität in einer korrumpierten Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Matrix
Die Autorin
LAUREN GROFF, geboren 1978, lebt in Gainesville, Florida. Ihr Roman LichtundZorn ist einer der größten Erfolge der amerikanischen Literatur der vergangenen Jahre. Er stand ebenso wie Matrix und ihre Erzählungen auf der Shortlist des National Book Award.STEFANIE JACOBS, geboren 1981, lebt und arbeitet als freie Übersetzerin in Wuppertal.Für ihre Übersetzungen von Jonathan Safran Foer, Edna O‘Brien, Mirandy July und vielen anderen Autor:innen wurde sie mehrfach ausgezeichnet.
Das Buch
Marie ist siebzehn Jahre alt, groß und ungelenk und nach allgemeiner Ansicht ungeeignet für die Ehe und das höfische Leben. Sie verehrt ihre Königin, Eleonore von Aquitanien, doch die verstößt sie mit einem Lächeln: Marie soll Priorin eines abgelegenen Klosters werden, irgendwo im Schlamme Englands, fern von den zärtlichen Zuwendungen ihrer Dienerin. Lebendig begraben in der Gemeinschaft verarmter, frierender, hungernder Nonnen – ausgerechnet sie, die aus einer Familie von Kriegerinnen stammt und alles andere als fromm ist. Doch in der Abgeschlossenheit des Klosters findet Marie für sich und ihre Schwestern ungeahnte Möglichkeiten von weltlichem Einfluss, Wohlstand und neuer Gemeinschaft.
Lauren Groff
Matrix
Roman
Aus dem Amerikanischen von Stefanie Jacobs
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Matrix im Verlag Riverhead Books, einem Imprint von Penguin Random House, LLC, New York.
claassen ist ein Verlagder Ullstein Buchverlage GmbH
© Lauren Groff, 2021© der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehalten.Umschlaggestaltung: zero-media.net, München nach einer Vorlage von © Grace HanUmschlagmotive: © Billnoll / Getty Images und © Bridgeman ImagesAutorenabbildung: © Eli SinkusE-Book powered by pepyrus
ISBN 978-3-8437-2827-0
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Erster Teil
1
2
3
Zweiter Teil
1
Dritter Teil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Anhang
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Erster Teil
Für all meine Schwestern
Erster Teil
1
Sie kommt allein aus dem Wald geritten. Siebzehn Jahre alt, im kalten, feinen Märzregen, Marie aus Frankreich.
Es ist 1158, und die Welt geht erschöpft dem Ende der Fastenzeit entgegen. Bald ist Ostern, früh in diesem Jahr. Die Saat auf den Feldern streckt im dunklen, kühlen Boden die ersten Keimblätter aus, bereit für den Ausbruch ins Freie. Zum ersten Mal sieht Marie das Kloster, bleich und unnahbar auf einer Anhöhe in diesem klammen Tal, in dem sich die vom Meer aufziehenden Wolken beständig an den Bergen abregnen. Die meiste Zeit des Jahres ist die feuchte Landschaft smaragdgrün und saphirblau und birst förmlich vor Leben, wimmelt es hier von Wassermolchen, Buchfinken und Schafen, während Pilze die zarten Köpfe aus dem fruchtbaren Boden drücken, doch jetzt zum Ende des Winters ist alles düster und grau.
Ihr altes Schlachtross schleppt sich mutlos dahin, und in einem Weidenkäfig auf der Truhe hinter ihr sitzt zitternd ein Merlin.
Der Wind verstummt. Die Bäume regen sich nicht mehr.
Marie spürt, wie die Augen der Landschaft auf sie gerichtet sind.
Sie ist groß, mehr Riesin als Mädchen, ungelenk und mit hervorstehenden Ellbogen und Knien; der feine Regen sammelt sich, bis er in Bächlein ihren Seehundmantel hinunterrinnt und ihr Kopftuch durchweicht, das eigentlich grün ist, aber jetzt schwarz. In ihrem reizlosen angevinischen Gesicht liegt keinerlei Schönheit, nur Klugheit und noch ungezügelte Leidenschaft. Es ist nass, aber vom Regen, nicht von Tränen. Dass man sie vor die Hunde geworfen hat, muss sie erst noch beweinen.
Zwei Tage zuvor hatte Königin Eleonore unvermittelt in der Tür von Maries Kammer gestanden, ganz Busen und goldblondes Wallen, mit Zobelpelz im Inneren des blauen Gewands, einem Juwelenregen, der sich von Ohren und Handgelenken ergoss, einem glänzenden Rosenkranz und so starkem Parfüm, dass es einen fast niederstreckte. Entwaffnen durch Überwältigen, das war schon immer ihre Strategie gewesen. Ihre Hofdamen hinter ihr verkniffen sich das Grinsen. Unter diesen Verräterinnen war auch Maries Halbschwester, genau wie Marie eine uneheliche Schwester der Krone, die Frucht auf Abwege geratener väterlicher Lust, doch das affektierte Ding hatte den Nutzen von Beliebtheit bei Hofe erkannt und war kreidebleich davongerannt, als Marie sich mit ihr anzufreunden versucht hatte. Sie würde eines Tages eine walisische Prinzessin werden.
Marie knickste linkisch, und Eleonore schwebte mit zuckenden Nasenflügeln ins Zimmer.
Die Königin sagte, es gebe Neuigkeiten, nein, was für erfreuliche Neuigkeiten, welch eine Erleichterung, just in diesem Moment habe sie den päpstlichen Dispens erhalten, dem armen Pferd sei beinahe das Herz zersprungen, so schnell sei es galoppiert, um ihn noch heute Morgen zu überbringen. Die Mühen, die sie, die Königin höchstpersönlich, im Laufe der letzten Monate auf sich genommen habe, hätten sich ausgezahlt, und die bedauernswerte uneheliche Marie aus Nirgendwo in Le Maine sei nun endlich zur Priorin eines königlichen Klosters ernannt worden. Was für eine wundervolle Nachricht. Endlich wusste man etwas mit dieser merkwürdigen Halbschwester der Königin anzufangen. Endlich war Marie für etwas zu gebrauchen.
Die dunkel umrandeten Augen der Königin ruhten für einen Moment auf Marie, bevor ihr Blick zu dem hohen Fenster schweifte, das auf die Gärten hinausging und dessen Läden offen standen, sodass Marie, wenn sie sich auf Zehenspitzen stellte, die Flanierenden draußen beobachten konnte.
Als Maries Lippen ihre Starre überwunden hatten, sagte sie heiser, sie danke der Königin für die außerordentliche Ehre ihrer Aufmerksamkeit, doch nein, oh nein, sie könne unmöglich Nonne werden, sie sei unwürdig und zudem mangele es ihr gänzlich an göttlicher Berufung.
Und es stimmte; die Religion, in der man sie erzogen hatte, war ihr trotz des Reichtums an Mysterien und Zeremonien immer leicht töricht vorgekommen, denn wie konnte es sein, dass Babys in Sünde geboren wurden, warum sollte sie zu unsichtbaren Mächten beten und Gott eine Dreifaltigkeit sein, und warum sollte sie, die spürte, wie ihre Größe in ihrem Blut pulsierte, weniger wert sein, weil die erste Frau aus einer Rippe geformt worden war, eine Frucht gegessen und daraufhin den müßigen Garten Eden verloren hatte? Das ergab doch keinen Sinn. Ihr Glaube hatte schon früh in ihrer Kindheit eine andere Richtung eingeschlagen und würde immer weiter in seine eigene Geometrie hineinwachsen, kantig und majestätisch.
Doch mit siebzehn, in dieser schlichten Kammer am Hof zu Westminster, konnte sie der eleganten, geschichtenverliebten Königin nicht das Wasser reichen, die, wenn auch klein und zierlich, sämtliches Licht, sämtliche Gedanken in Maries Kopf und sämtliche Luft aus ihren Lungen aufsog.
Eleonore sah Marie einfach nur an, und Marie fühlte sich so klein wie zuletzt in Le Maine, als ihre Mutter, nachdem ihre sechs Amazonentanten schon das Zeitliche gesegnet, geheiratet oder den Schleier genommen hatten, ihre Hand ergriffen, sie auf das wachsende Ei zwischen ihren Brüsten gedrückt und mit einem strahlenden Lächeln und Tränen in den Augen gesagt hatte, oh Liebling, verzeih mir, ich sterbe; dieser große, kräftige Körper so plötzlich nur noch Haut und Knochen, beißender Atem und dann gar kein Atem mehr, und Marie, die alles Leben, das sie in sich trug, all ihre Gebete in die Rippen ihrer Mutter gepresst hatte, doch das Herz stand still. Die bitterlichen Qualen der Zwölfjährigen auf dem Friedhof auf einer windigen Anhöhe, gefolgt von zwei Jahren Einsamkeit, weil die Mutter darauf bestanden hatte, dass ihr Tod geheim bleiben musste, weil die Wölfe der Familie Marie ihr gesamtes Erbe entreißen würden, sobald sie davon erführen, denn sie als uneheliches Kind, Frucht einer Vergewaltigung und noch dazu ein Mädchen, hatte kein Anrecht auf irgendetwas; zwei einsame Jahre, in denen Marie dem Land abrang, was sie nur konnte. Dann das Hufgetrappel von fern auf der Brücke und die Flucht hinauf nach Rouen, anschließend über den Ärmelkanal zum königlichen Hof ihrer gesetzmäßigen Halbschwester in Westminster, wo jedermann entsetzt war über die ausgehungerte, keinerlei Manieren besitzende Marie und ihren ungelenken, grobknochigen Körper, und wo man ihr die meisten Privilegien, die mit ihrem königlichen Blut einhergingen, wegen persönlicher Makel wieder entzog.
Eleonore lachte darüber, dass Marie ihren Gefallen ablehnte, und mokierte sich über sie. Aber aber aber. Glaubte Marie im Ernst, man würde sie eines Tages verheiraten? Einen linkischen Galgenvogel wie sie? Drei Köpfe zu groß, mit polterigem Gang, dieser schrecklich tiefen Stimme, ihren riesigen Pranken, ihrer Streitlust und ihrem Schwert? Welcher Mann würde Marie als Gattin akzeptieren, ein Wesen bar jeder Schönheit, das nicht im Ansatz irgendeine der femininen Künste beherrschte? Nein, nein, es sei besser so und schon seit Langem beschlossen, bereits im Herbst, und ihre ganze Familie habe zugestimmt. Marie wisse, wie man ein großes Anwesen führte, könne in vier Sprachen schreiben und beherrsche die Buchhaltung; sie habe all das nach dem Tod ihrer Mutter schon im zarten Kindesalter so bewundernswert praktiziert, so gut sogar, dass sie der ganzen Welt zwei Jahre lang vorgegaukelt habe, sie wäre ihre eigene verstorbene Mutter. Womit sie natürlich sagen wolle, dass das Kloster, dessen Priorin Marie werden würde, so arm sei, dass man dort Hungers sterbe, leider leider. Man habe vor einigen Jahren Eleonores Unmut erregt und lebe seitdem in bitterer Armut. Außerdem wüte dort seit einiger Zeit eine Krankheit. Sie, Eleonore, könne unmöglich zulassen, dass die Nonnen eines königlichen Klosters verhungerten und noch dazu an einem grässlichen Husten zugrunde gingen! Was würde das für ein Licht auf sie werfen?
Der Blick ihrer kühlen, schwarzumrandeten Augen durchbohrte Marie förmlich, und sie traute sich nicht, ihn zu erwidern. Sie solle nur Geduld haben, sagte die Königin zu Marie, im Laufe der Zeit werde eine gute Nonne aus ihr werden. Jeder, der Augen im Kopf habe, könne sehen, dass sie von jeher für die heilige Jungfräulichkeit bestimmt sei.
Die Hofdamen brachen in schallendes Gelächter aus. Marie hätte ihnen am liebsten die Lästerschnäbel zugehalten. Eleonore streckte die reich mit Ringen geschmückte Hand aus. Marie müsse ihr neues Leben lieben lernen, sagte sie sanft, müsse lernen, das Beste daraus zu machen, denn das sei der Wunsch Gottes wie auch der Königin. Gleich morgen werde sie abreisen, mit königlichem Geleit und Eleonores persönlichem Segen.
Weil sie nicht wusste, was sie sonst tun sollte, ergriff Marie mit ihren rauen Fingern die kleine weiße Hand und küsste sie. Sie verspürte ein inneres Ringen. Am liebsten hätte sie das weiche, weiße Fleisch in den Mund genommen und hineingebissen, bis Blut kam; am liebsten hätte sie ihr die Hand mit dem Dolch abgeschlagen und als Andenken auf ewig in ihrem Mieder getragen.
Die Königin schwebte wieder hinaus. Marie legte sich benommen ins Bett, zu ihrer Dienerin Cecily, die ihr den Kopf, die Lippen und den Hals küsste. Cecily war simpel gestrickt und treu wie ein Hund. Sie schäumte und murmelte etwas von Verunglimpfung, und überhaupt sei die Königin eine liederliche und zügellose Weibsperson aus dem Süden, die beim ersten Mal nur wegen einer rasenden Sau aus Frankreich Königin geworden sei und beim zweiten Mal wegen eines Lackaffen von einem englischen Grafen, denn für ein lumpiges Lied bekomme sie ein jeder ins Bett, ja, man brauche ihr doch bloß irgendeine Rührseligkeit vorzusingen, schon hebe sie die Röcke, und es sei ja nicht ohne Grund so, dass keins ihrer Kinder dem anderen ähnele, der Teufel selbst habe die Bosheit in diesen königlichen Kopf gesetzt, oh, Cecily habe entsetzliche Geschichten gehört, schlimm, wirklich schlimm.
Als Marie sich von ihrem Schock erholt hatte, sagte sie der Dienerin, sie solle still sein, denn das Parfüm der Königin hing noch im Raum wie ein wachsamer Geist.
Dann brach Cecily in Tränen aus, weinte sich das zarte Gesicht rot und schnoddrig und versetzte Marie den zweiten Schlag. Sie eröffnete ihr, sie könne nicht mit ihr ins Kloster kommen. Zwar liebe sie ihre Herrin, doch sie sei zu jung und habe noch viel zu viel Leben vor sich, um sich inmitten einer Handvoll trübsinniger Nonnen auf ewig lebendig begraben zu lassen. Cecily sei für die Ehe gemacht, allein ihre Hüften, wie geschaffen, um zehn stramme Kinder zu gebären, und außerdem habe sie schlechte Knie und könne sich nicht von früh bis spät auf den Boden werfen und beten. Den ganzen Tag rauf und runter, rauf und runter, wie die Murmeltiere. Nein, am nächsten Morgen würden sich Cecilys und Maries Wege trennen.
Und Marie – die in diese Freundschaft mit Cecily, der Tochter der Köchin auf dem Familiengut in Le Maine, hineingeboren worden war, dieser rauen Person, die für sie bis zu diesem Moment alles gewesen war, Herrin und Schwester und Dienerin und Wonne und einzige liebende Seele in ganz Angleterre – begriff schließlich, dass sie ihrem lebendigen Tod allein entgegengehen würde.
Ach, meine liebe Marie, sagte die Dienerin schluchzend immer wieder, ach, es breche ihr das Herz.
Worauf Marie sich aus ihrer Umarmung wand und erwiderte, es müsse sich wohl um die treuloseste Form eines brüchigen Herzens handeln.
Dann stand sie auf und sah durch das offene Fenster hinaus auf den in Nebel gehüllten Garten, während in ihr die Sonne sank. Sie steckte sich die Kerne der Aprikosen in den Mund, die sie der Königin im Sommer von ihren privaten Bäumen gestohlen hatte, weil sie im Herbst und Winter gern das Bittere heraussog. Über ihre innere Landschaft strich der kühle Wind der Abenddämmerung, und alles, was im Schatten lag, wirkte fremd und verzerrt.
Und Marie spürte die überwältigende Liebe abebben, von der ihre beiden Jahre an Eleonores Hof in Angleterre erfüllt gewesen waren und deren zartes, schimmerndes Licht selbst ihre innere Einsamkeit und alles Schwierige gestreift hatte. Ihr erster Tag am Hof in Westminster; sie hatte noch das Salz der Überfahrt auf den Lippen, als sie sich, vollkommen überwältigt, zum Abendessen setzte und Lauten und Oboen aufspielten, und schließlich stand Eleonore in der Tür, hochschwanger und kugelrund, nur Bauch und Brüste und die rechte Wange geschwollen, weil sie an diesem Tag einen Zahn gezogen bekommen hatte; sie machte so winzige Schritte, dass sie schwanengleich zu gleiten schien, und ihr Gesicht war exakt dasselbe, das Marie von klein auf in ihren Träumen gesehen und verehrt hatte. Alles Licht im Raum verengte sich zu einem Nadelstich und fiel auf Eleonore. In diesem Augenblick war es um Marie geschehen. Als sie sich am Abend ins Bett legte, schnarchte Cecily bereits, und sie rüttelte an der Hand des Mädchens, um es zu wecken. Marie hätte sich auf die Jagd nach einem Gral gemacht, wäre als Mann verkleidet in den Krieg geritten und hätte, ohne mit der Wimper zu zucken, getötet; sie hätte gesenkten Hauptes Grausamkeiten ertragen und geduldig ihr Dasein inmitten Aussätziger gefristet – zu alldem wäre sie bereit gewesen, hätte Eleonore es von ihr verlangt. Die Königin war für sie die Quelle alles Guten: Lachen und Liebe und Minnegesang; ihre Schönheit brachte Schönheit hervor, und Schönheit, das wusste jeder, war ein Zeichen von Gottes Gunst.
Selbst jetzt, überlegt Marie beschämt, während sie auf das düstere, feuchte Kloster zureitet, selbst jetzt, nachdem sie weggeworfen wurde wie Unrat, hat sich daran nichts geändert.
Denn es ist bestürzend, wie arm diese fahle, auf den Hügel gezwängte Klosteranlage im kalten Sprühregen wirkt. England ist zwar insgesamt ärmer als Frankreich, die Städte sind kleiner, düsterer und schmutziger und die Menschen mager und von Frostbeulen übersät, doch das hier ist selbst für englische Verhältnisse ein trauriger Anblick – die baufälligen Nebengebäude, die morschen Zäune, der Garten mit den schwelenden Laubhaufen vom letzten Jahr. Ihr Pferd trottet dahin. Der Merlin rupft sich verzagt piepsend den Flaum unter den Flügeln aus. Marie nähert sich langsam dem Friedhof. Bisher wusste sie über das Kloster nur, dass es von einer vor Jahrhunderten heiliggesprochenen Schwester des Königs gegründet wurde, deren Fingerknochen nun im Tod Furunkel heilen können, dass es zu Zeiten der dänischen Invasionen erobert und geplündert worden war und die Nonnen vergewaltigt wurden, und dass in der Moorlandschaft ringsherum manchmal noch immer Skelette gefunden werden, deren Schädel das Filigranmuster tiefer Tätowierungen tragen. Und als Marie in der Herberge, in der sie über Nacht abstieg, gegenüber der Wirtstochter, die ihr das Abendessen brachte, den Namen des Klosters erwähnte, wurde das Mädchen kreidebleich und murmelte irgendetwas Unverständliches auf Englisch, doch seine Stimme ließ keinen Zweifel daran, dass das Kloster für die Menschen in der Gegend etwas Erbärmliches und Unheimliches war, ein Ort des Grauens. Also schickte Marie ihre Begleitung noch in der Stadt zurück, um ihrem lebendigen Begräbnis allein entgegenzureiten.
Jetzt zählt sie unter der Eibe vierzehn frische schwarze Gräber, glänzend im Sprühregen. Später wird sie erfahren, dass hier ein Dutzend Nonnen und zwei Oblatinnen, kindliche Laienschwestern, begraben liegen, erst wenige Wochen zuvor von einer seltsamen Krankheit dahingerafft, die die Betroffene blau anlaufen lässt, als wäre sie an ihrer eigenen Lunge ertrunken, und dass einige der Nonnen noch immer krank sind, keuchen und nachts von rasselndem Husten gequält werden.
Auf den frischen Gräbern liegen Stechpalmenzweige, und die roten Beeren sind das Einzige, was im Nieselgrau, ja eigentlich auf der ganzen, aller Farben beraubten Welt noch matt leuchtet.
Alles wird grau sein, denkt sie, der Rest ihres Lebens grau. Graue Seele, grauer Himmel, graue Märzerde, grauweiß das Kloster. Arme graue Marie. In den hohen Türen des Klosters stehen jetzt zwei zierliche Nonnen in wollenem Habit.
Im Näherkommen sieht Marie, dass eine der Nonnen ein großes, altersloses Gesicht hat, aufgedunsen und weich, und dass ihre Augen weiß und wolkenverhangen sind. Viel hat man Marie nicht über das Kloster erzählt, aber immerhin so viel, dass die Frau die Äbtissin Emme ist, der zum Trost für ihre Blindheit die Gabe einer inneren Musik zuteilwurde. Sie hat gehört, die Äbtissin sei beängstigend verrückt, doch auf eine freundliche Weise.
Die andere Nonne hat ein gelbliches, verkniffenes Gesicht, das an Mispeln erinnert, von den Menschen hier in dieser merkwürdigen, feuchten Gegend Hundsärsch genannt, wegen des Anus, den Gott hineinzudrücken beliebte. Es ist die Subpriorin Goda. Nachdem die vorherige Priorin und Subpriorin an der Erstickungskrankheit gestorben waren, hatte man sie hastig zu diesem Amt bestimmt, weil sie die letzte Nonne war, die in leserlicher Handschrift Latein schreiben konnte. Die von der Königin für Marie angebotene Mitgift genüge, um die Nonnen eine Weile am Leben zu halten, hatte Goda zähneknirschend an Eleonore geschrieben, sie könnten diesen Bastard aufnehmen, warum auch nicht. Godas Brief war mit Fehlern gespickt.
Marie bringt ihr Pferd am Eingang zum Stehen und steigt unter Schmerzen ab. Sie versucht, die Beine zu bewegen, doch nachdem sie an zwei Tagen dreißig Stunden lang im Sattel saß, sacken sie ihr in ihrer Furcht und ihrem Schrecken einfach unter dem Körper weg. Sie rutscht in dem Gemisch aus Schlamm und Pferdeäpfeln aus und fällt aufs Gesicht, der Äbtissin direkt vor die Füße. Emme sieht aus ihren weißen Augen zu ihr hinab und erkennt auf dem Boden vage den Umriss der neuen Priorin.
Mehr gesungen als gesprochen bemerkt sie, ihre Demut mache der neuen Priorin alle Ehre. Dank sei der Heiligen Jungfrau Maria, Stern des Meeres, dass sie ein so bescheidenes und zurückgenommenes königliches Wesen geschickt habe, um das Kloster nach all den schrecklichen Sorgen, dem todbringenden Husten und dem Hunger zu führen und zu heilen. Die Äbtissin lächelt anmutig ins Nichts.
Goda hilft Marie schließlich auf die Beine und schimpft dabei vor sich hin – was für ein grobschlächtiger Tölpel, dieses Mädchen, eine Riesin, und wie merkwürdig sie aussieht, auch wenn die Kleider wirklich edel sind oder vielmehr waren, jetzt, wo sie sie versaut hat, aber vielleicht bekommt Ælfhild sie wieder hin, denn natürlich muss man sie verkaufen, allein die Ärmel werden Mehl für eine ganze Woche einbringen. Murmelnd schiebt sie das Mädchen nach drinnen in den Flur, und die Äbtissin folgt ihnen. Goda hat den gekränkten Gesichtsausdruck eines Menschen, der in der Ecke darauf lauert, andere schlecht über sich reden zu hören, um seinen Groll zu nähren.
Fensterscheiben gibt es hier nicht, nur hölzerne und mit gewachstem Stoff überzogene Läden, die schmale Lichtstreifen hereinlassen, und aus irgendeinem Grund scheint es, als würde der große, lange Raum, in dessen Kamin ein winziges Feuer aus dünnen Holzscheiten brennt, die Kälte von draußen noch verstärken. Der Boden ist kahl und glänzt, kühler, sauberer Stein ohne Binsenteppiche. Aus sämtlichen Türen werden Köpfe herausgestreckt, dann verschwinden sie wieder.
Motten, denkt Marie. Vielleicht fantasiert sie.
Goda kratzt mit den Fingernägeln den Schlamm von ihr ab und befreit sie von ihrem besudelten Schleier, wobei sie sie absichtlich mit den Nadeln pikt. Eine Dienerin bringt eine Schüssel dampfendes Wasser. Die Äbtissin kniet nieder, streift ihr die nutzlosen schlammigen Schuhe und Strümpfe von den eiskalten Füßen und wäscht sie.
Kribbelnd und mit einem scharfen Brennen erwachen Maries Füße wieder zum Leben. Erst jetzt, unter den sanften Händen der blinden Äbtissin, lässt der Schock allmählich nach. Dieser farblose Ort mag das Leben nach dem Tod sein, doch Marie spürt, wie sie unter Emmes Händen wieder ein Mensch wird.
Leise dankt sie der Äbtissin dafür, dass sie ihr die Füße wäscht; so viel Freundlichkeit habe sie nicht verdient.
Doch Goda zischt, sie solle bloß nicht glauben, dass sie etwas Besonderes sei, alle Besucher bekämen hier die Füße gewaschen, ob sie denn gar nichts wisse, das stehe so in der Regel.
Die Äbtissin schickt Goda weg und heißt sie, in der Küche auszurichten, das Abendessen möge ihr in ihre Wohnung hinaufgebracht werden. Murrend zieht die Subpriorin von dannen.
Die Äbtissin sagt zu Marie, sie solle nicht auf die Subpriorin hören, denn Goda habe ihre Ambitionen gehabt, die Maries Ankunft schlagartig zerstört habe. Goda stamme von den edelsten Familien Englands ab, ein wenig Berkeley, ein wenig Swinton und etwas Meldred, und sie sehe nicht ein, warum sie sich ausgerechnet von einer unehelichen Schwester aus einer Sippe normannischer Emporkömmlinge und Throndiebe von ihrem Platz in der Hierarchie verdrängen lassen sollte. Aber nun habe Eleonore die Position für Marie beansprucht, sagt Emme, was solle sie schon machen, wenn das der Wille der Königin sei? Und Goda wäre als Priorin sowieso schrecklich ungeeignet. Sie könne besser die Tiere führen, die sie versorge, als ihre Schwestern, mit denen sie nur zanke und die sie mit ihren Standpauken traktiere. Die Äbtissin tupft Maries Füße mit einem weichen Tuch trocken, das einst weiß war.
Sie führt Marie barfuß über den kalten Stein die dunkle Treppe hinauf. Die Wohnung der Äbtissin ist winzig, ein Durcheinander aus Pergament- und Bücherstapeln, doch sie hat teure Fenster mit Scheiben aus transparentem Horn, durch die ein wachsartiges Licht in den Raum fällt und ihn zum Leuchten bringt. Der Merlin sitzt bereits auf seiner Stange nahe dem kleinen Birkenholzfeuer und wärmt sich; eine hübsche blaue Flamme züngelt an der hellen Rinde. Auf dem Tisch steht etwas zu essen, trockenes hartes Roggenbrot mit einer hauchdünnen Schicht Butter, Wein, zum Glück unverwässert und in besseren Zeiten aus Burgund mitgebracht, und zwei Schüsseln Suppe mit je vier Steckrübenscheiben darin. Die Äbtissin erzählt Marie von der großen Not, die gerade herrsche, ach, die Nonnen litten Hunger, aber Leiden läutere die Seele und mache diese frommen, demütigen Frauen in den Augen Gottes noch frommer. Und wenigstens heute Abend werde Marie essen.
Sie betrachtet Marie, fixiert mit ihren trüben Augen einen Punkt hinter ihrem Kopf und fragt sie, was sie über das Leben einer Nonne in einem Kloster wisse. Gar nichts, gesteht Marie. Das Essen hat keinerlei Geschmack, oder vielleicht hat sie auch zu schnell gegessen, um etwas zu schmecken. Sie hat immer noch Hunger, ihr Magen knurrt. Als die Äbtissin es hört, lächelt sie und schiebt Marie ihr Brot und ihre Butter hinüber.
Nun, sagt die Äbtissin, Marie werde sicher schnell lernen, der Königin zufolge mangele es dem Kind nicht an Intelligenz. Sie beschreibt ihr den Rhythmus der Tage. Acht Stunden Gebet: tief in der Nacht die Matutin, im Morgengrauen die Laudes, anschließend Prim, Terz, Sext, Kapitel, Non, Vesper, Kollation und Komplet und dann Nachtruhe. Arbeit, Stille und innere Einkehr, sonst nichts. Jede Bewegung ihres Körpers ist Gebet, das tägliche Brevier ebenso wie die harte körperliche Arbeit. Die Stille der Nonnen, die Lesehoren, denen sie lauschen, ihre Demut – das alles ist Gebet. Und Gebet ist natürlich Liebe. Gehorsam, Pflicht und Unterwürfigkeit; alles ist Ausdruck der Liebe, gerichtet an den großen Schöpfer.
Die Äbtissin lächelt heiter, bevor sie in einer hohen, zitternden Stimme zum Singen anhebt.
Nein, denkt Marie trotzig, Liebe ist nicht Demütigung, Liebe ist etwas Erhebendes. Das karge Abendessen hat ihren ärgsten Hunger gestillt, mehr aber auch nicht. Das Leben einer Nonne wirkt genauso schrecklich, wie sie es sich vorgestellt hat.
Die Äbtissin hört plötzlich auf zu singen und sagt, dass Marie ihren kleinen Falken und die Sachen in ihrer Truhe behalten dürfe, bis sie ihr Gelübde abgelegt habe; dann gehe alles, was ihr gehöre, in den Besitz des Klosters über. Marie weiß noch nicht genug, um zu verstehen, dass das ein großes Zugeständnis ist, das man niemandem sonst machen würde.
Draußen, wo die Dunkelheit hereinbricht und es noch immer regnet, läutet eine Glocke. Komplet. Die Äbtissin geht und überlässt Marie zum Ausruhen ihre Wohnung. Marie hört die Nonnen in der Kapelle das Nunc dimittis singen und schläft ein. Als sie aufwacht, steht Emme wieder vor ihr, beglückt und mit geröteten Wangen vom Chorgebet.
Es sei Zeit für Maries Bad, sagt sie sanft.
Marie sagt danke, das sei nicht nötig, sie habe erst im November gebadet, und die Äbtissin lacht und antwortet, die Reinigung des Körpers sei ebenfalls eine Form des Gebets, alle Nonnen hier im Kloster badeten einmal im Monat und die Bediensteten alle zwei Monate, denn Körpergerüche missfielen Gott.
Aus einer dunklen Zimmerecke tritt auf einmal eine noch dunklere Gestalt hervor, eine alte Nonne mit langen weißen Kinnhaaren und einem Gesicht, das aussieht wie aus einem Holzklotz gehackt. Das Bad sei bereit, sagt diese Nonne in weinerlich-wütendem Ton. Ihr Französisch hat einen so starken englischen Akzent, dass es klingt, als würde sie Kieselsteine kauen. Marie zuckt zusammen.
Auch die Äbtissin fährt zusammen und beklagt sich, sie möge es gar nicht, wenn jemand einfach aus dem Nichts komme und sie erschrecke. Das sei die Magistra, sagt sie zu Marie, die Novizenmeisterin. Ihr Name sei Schwester Wevua. Es sei schon merkwürdig; obwohl Marie in der Kathedrale in der Stadt hastig zur Jungfrau geweiht worden und natürlich schon als Priorin ins Kloster gekommen sei, bleibe sie, solange sie nicht die Profess abgelegt und den Schleier genommen habe, eine Novizin. Doch Wevua pflege einen sehr gedeihlichen Umgang mit den Novizinnen. Sie arbeite mit strengen Methoden, aber unter ihrer Führung lernten alle Novizinnen so rasch, dass sie in erstaunlich kurzer Zeit die Profess ablegten.
Die Magistra nickt. Die Ablehnung strömt förmlich aus ihr heraus, ein spiritueller Wind, der Marie wie auch der Äbtissin entgegenschlägt. Sie hat einen hinkenden Gang, der klingt wie ein Herzschlag, ba-damm, ba-damm, weil ihr als junges Mädchen einmal ein Pferd auf den Fuß getreten ist und die Knochen und Nerven darin zermalmt hat.
Ich habe den Fuß gesehen, als sie damals vor vielen Jahrzehnten ins Kloster kam, ich musste ihn waschen, ach, schrecklich, ein verstümmeltes Elend, sagt die Äbtissin, der Stoff, aus dem Albträume sind.
Schmerzt bis heute wie die Flammen der Hölle, sagt Wevua zufrieden.
Und so gehen die drei Frauen hinunter, durch das dunkle Kloster mit dem feuchten, kalten Steinboden unter Maries nackten Füßen und hinaus ins Brunnenhaus, noch immer erfüllt von den Stimmen und dem Schlamm der Nonnen, die zuvor von den Feldern hereingekommen sind und sich fürs Chorgebet gewaschen haben. Aus einem großen Holzzuber ganz hinten in einer Ecke steigt geisterhaft Dampf in die kühle, feuchte Luft auf. Als sie näher kommen, schlägt ihnen ein so intensiver Kräutergeruch entgegen, dass Marie, so erschöpft, wie sie ist, durch den Mund atmen muss, um nicht in Ohnmacht zu fallen. Die Kräuter seien gegen die Läuse und Flöhe, von denen es am Hof ja nur so wimmele, sagt Wevua, und es klingt, als würde sie die Wörter mit den Schneidezähnen abbeißen. Sie werde Maries Sachen in die Latrine hängen, wo die Nonnen ihre Notdurft verrichten; das Ammoniak im Urin werde den Biestern über Nacht den Garaus machen.
Jetzt ziehen die beiden Nonnen Marie gemeinsam die restlichen Sachen aus, das seidene Kleid, eine enger genähte Version des wogenden Kleids ihrer Mutter, und die Unterwäsche. Marie bedeckt sich mit ihren langen, dünnen Armen, innerlich kochend vor Wut. Wevua bückt sich, um dem Mädchen zwischen die Beine zu starren, dann betastet sie Marie mit ihren kalten Fingern. Die neue Priorin sei so hochgewachsen, sagt sie, habe so große Hände, eine so tiefe Stimme und ein so unweibliches Gesicht, dass sie sich mit eigenen Augen habe überzeugen müssen, dass sie wirklich eine Frau ist, aber jetzt sei sie zufrieden – Marie ist, was sie zu sein behauptet –, und sie gibt ihr einen Schubs, damit sie in die Wanne steigt.
Marie lässt die Arme sinken und sieht Wevua direkt ins Gesicht, und die alte Magistra tritt einen Schritt zurück.
Ach, sagt die Äbtissin sanft, was sei die Magistra doch unnötig grob zu dem Mädchen. Sie deutet freundlich auf das Badewasser und sagt, das werde Marie nach dem langen Ritt durch die Kälte sicher eine Wohltat sein. Marie steigt hinein. Das Brennen beginnt an ihren Knöcheln, steigt über ihre Waden, Knie und Schenkel bis zu ihrer Scham, dann den Bauch und die Brust hinauf zu den Achseln und schließlich zum Hals. Der Kräutergestank sticht ihr in die Nase und bohrt sich tief in ihr Gehirn.
Schwester Wevua und die Äbtissin stecken ihre Hände in Sackleinen, reiben Marie mit nasser Seife ein und schrubben graue Würmer von ihrer Haut, stellenweise, bis es blutet. Und dort im heißen Wasser, gewärmt und überwältigt, müde und gequält, verrät ihr Körper sie plötzlich. Sie beginnt zu weinen und schluchzt ins Wasser, dabei hatte sie sich doch geschworen, niemals zu weinen, stark zu sein und all die Verluste stoisch zu ertragen – kein Hof mehr, keine Cecily mehr, keine Zukunft, keine Farbe und auch keine Eleonore mehr, die sie aus der Ferne betrachten konnte, die Sehnsucht wie eine unsichtbare Freundin an ihrer Seite. Sie weint, während ihr langes aschblondes Haar zu einer nassen Peitsche geflochten wird, während sie nach der guten Wärme wieder in der Kälte steht, während ihr großer, hagerer Körper mit einer Bahn Stoff abgetrocknet und sie anschließend angezogen wird. Ein Leinenunterhemd mit einem großen braunen Fleck von der Brust bis hinunter zum Saum; ohne Zweifel hat es einer verstorbenen Nonne gehört. Ein Wollkittel, der nach Lavendel und der Haut von jemand anders riecht und ihr gerade so über die Knie reicht. Viel zu kurz, zischt Wevua ärgerlich in Richtung der Äbtissin. Auch das Skapulier ist viel zu kurz. Und natürlich auch das Hemd darunter, was bedeutet, dass die armen Beine dem garstigen Wetter, dem Schneeregen und dem eisigen Wind jetzt gegen Ende des Winters schutzlos ausgeliefert sind.
Die Äbtissin seufzt. Schwester Ruth werde morgen die schlechtesten der überzähligen Habite zerschneiden und die Reste unten an den Kittel und das Skapulier annähen, sagt sie. Wegen des kalten Wetters werde Marie drei Paar Strümpfe bekommen. Sie werde leiden, doch Leid sei nun einmal das Los des Menschen, und jeder Moment des Leidens bringe den irdischen Körper ein Stück näher an den himmlischen Thron.
Eigenhändig legt die Äbtissin Marie das weiße Novizinnenkopftuch an, Stirnband, Wimpel und Schleier, während Wevua ihr ruppig die Strümpfe überstreift und mit ihrer Kieselsteinstimme lamentiert, dass ihr auch sämtliche Holzschuhe zu klein sein werden.
Die Äbtissin murmelt etwas über das arme Kind, aber dann sagt sie, tja, was solle sie machen? Die Königin habe Maries Mitgift noch nicht geschickt, und sie seien im Moment so knapp bei Kasse, dass kein Geld da sei, um Holzschuhe für Marie anfertigen zu lassen. Worauf Wevua erwidert, Marie könne ja nicht barfuß herumlaufen, nicht einmal die Dienerschaft des Klosters gehe barfuß, da wäre es eine schreckliche Sünde, die neue Priorin ohne Schuhe gehen zu lassen. In der Tat, erwidert die Äbtissin, dann werde Marie eben tragen, worin sie gekommen sei, und Wevua entgegnet, sie sei in Hofschläppchen aus Ziegenleder gekommen, nutzlose Dinger, man stelle sich nur vor, die Priorin stehe damit in den schlammigen Frühjahrsfeldern und überwache die Aussaat, was für kalte, nasse Füße sie darin in kürzester Zeit bekäme, und dann würde die Kälte von unten her hochkriechen und Marie krank werden und sterben, sodass zu allem anderen Ärger auch noch der Leichnam einer zu groß geratenen unehelichen Schwester der Königin hinzukäme. Die Stimme der Äbtissin hatte jetzt nichts Melodisches mehr; scharf entgegnet sie der Magistra, dass Wevua ihrer abendlichen Andacht dann eben ein Gebet für ein Schuhwunder hinzufügen solle, doch bis besagtes Wunder eintrete, werde Marie ihr Schicksal ertragen müssen, das im Moment sicherlich nicht die schlimmste aller Entbehrungen im Kloster darstelle. Zwischen den beiden Frauen herrscht eine uralte Feindschaft, begreift Marie, ein Krieg des Leidens zwischen dem Stummelfuß und den trüben Augen. Über Jahrzehnte gewachsen und sichtbar wie die Ringe eines gefällten Baums.
Die Äbtissin dreht sich um und schreitet sicher durch die Dunkelheit, während die anderen beiden sich vorsichtig an der Wand entlangtasten. Hinaus in die Nacht, durch den Kreuzgang. Die Äbtissin geht wieder ihre Treppe hinauf und ruft zu Marie hinunter, Schlafen Sie gut, neue Priorin, denn am nächsten Morgen werde Marie sich an die Arbeit machen und die Pergamente und Rechnungsbücher sortieren.
Marie folgt Wevua in die Kapelle, in der noch eine dünne Bienenwachskerze brennt. Das Kloster hat in seiner Not sämtlichen Zierrat verkauft, übrig ist nur eine Schnitzerei aus Holz: magere Unterschenkel, Wunden, Dornen, Blut und Rippen, die alte Geschichte, die sie in- und auswendig kennt. Die dunkle Treppe hoch zum Dormitorium, wo zwanzig Nonnen im fahlen Schein einer einzelnen Laterne bereits schlafen, in Reih und Glied und in vollem Habit, denn vielleicht blasen gerade in dieser Nacht die Engel der Wiederauferstehung ihre Trompeten, und dann müssen sie bereit sein, dem Himmel in die Arme zu fliegen. Marie hat das Gefühl, als würde sie beobachtet, doch sämtliche Gesichter um sie herum sind reglos von Schlaf, vorgetäuschtem oder echtem. Weiter hinten hört sie Geflüster, jemand hustet röchelnd. Durch die Ritzen der Fensterläden pfeift der Wind, Schneeflocken schweben durch die Luft des Dormitoriums und schmelzen, bevor sie den Boden berühren. Wevua deutet auf ein Bett, und Marie legt sich darauf. Sie ist zu groß für diese Bettgestelle und kann erst dann einigermaßen darauf liegen, als sie ein Stück hinunterrutscht, die Knie beugt und die Füße auf den Boden stellt, dessen unversöhnliche Kälte durch ihre Sohlen kriecht.
Ach, hätte sie doch nur ihre Mutter hier, diese stattliche, gütige Frau mit dem polternden Lachen, das alles besser machte, und dem Hals, der stets nach Verbene duftete, doch ihre Mutter ist seit fünf Jahren tot. Ach, oder Cecily mit ihrer warmen Haut, ihrer derben Sprache und ihrem gesunden Menschenverstand; sie könnte Maries Hass auf dieses eisige Loch teilen, sodass sie ihn nicht allein ertragen müsste. Wie Cecily es hier wohl finden würde, Cecily, die als Kind einmal im staubigen, stinkenden Hühnerstall, durch dessen Ritzen trübes Licht fiel, ein Ei unter einer Henne hervorgezogen und, mit ihrem Kittelchen als Messgewand, einen Ascheeimer als Weihrauchfass schwenkend, irgendeinen Quatschsingsang angestimmt und das Ei, noch warm vom Inneren seiner Mutter, in Maries Mund aufgeschlagen hatte, Leib und Blut zu einem vermischt, und Marie hatte sich bekreuzigt und den dicken, warmen Glibber mit Mühe hinuntergewürgt. Dann Cecilys Atem auf Maries Gesicht; sie hatte gerade Karotten geschabt und ein paar Schalen gekaut und leckte Marie mit ihrer kleinen harten Zunge etwas Eigelb vom Kinn. Die zweite Ketzerei, Mund auf Mund. Cecilys unverblümter, wissender Körper; unter den Bediensteten, wo sie solche Künste lernte, gab es keine Geheimnisse. Welch eine Entdeckung, dieses stämmige Mädchen mit den Grübchen und dem Stroh im Haar, welch eine Wärme. Sein pulsierender Körper auf dem von Marie.
Marie umklammert ihre eigenen Hände, aber sie sind kalt und knochig, es sind nicht die von Cecily.
Langsam erwärmt sich das Dormitorium durch den Atem und die Körperwärme der Nonnen. Draußen heult einsam der Wind. Marie hört auf zu zittern. Sie wird nie wieder schlafen, denkt sie, dann schläft sie ein.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: