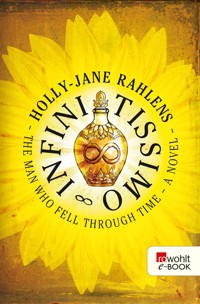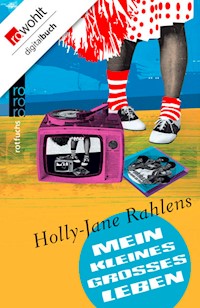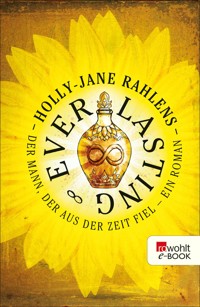6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
November 1989. Zwei Wochen nach der Maueröffnung betritt Molly, Typ Mauerblümchen, die S-Bahn in Richtung Ostberlin zum Geburtshaus ihrer Mutter. Auf der Strecke zwischen S-Charlottenburg und U-Schönhauser Allee begegnet die junge Deutschamerikanerin dem Ostberliner Schauspielstudenten Mick. Und beide müssen feststellen, dass noch viele unsichtbare Mauern fallen müssen – auch in ihnen selbst. «Mauerblümchen» ist die Geschichte einer Liebe auf den ersten Blick und einer Reise in ein unbekanntes Land, auf der zwei junge Menschen sich selbst, die Magie der Liebe und die Rätsel der deutsch-deutschen Verfremdungen entdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Holly-Jane Rahlens
Mauerblümchen
Über dieses Buch
November 1989. Zwei Wochen nach der Maueröffnung betritt Molly, Typ Mauerblümchen, die S-Bahn in Richtung Ostberlin zum Geburtshaus ihrer Mutter. Auf der Strecke zwischen S-Charlottenburg und U-Schönhauser Allee begegnet die junge Deutschamerikanerin dem Ostberliner Schauspielstudenten Mick. Und beide müssen feststellen, dass noch viele unsichtbare Mauern fallen müssen – auch in ihnen selbst. «Mauerblümchen» ist die Geschichte einer Liebe auf den ersten Blick und einer Reise in ein unbekanntes Land, auf der zwei junge Menschen sich selbst, die Magie der Liebe und die Rätsel der deutsch-deutschen Verfremdungen entdecken.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch
Biografie
Jugendliteraturpreisträgerin Holly-Jane Rahlens, «Erzählerin von Teufels Gnaden» (Der Tagesspiegel) und «gelernte Berlinerin aus Brooklyn» (Frankfurter Allgemeine Zeitung), hat eine wundervolle und tiefsinnige Ost-West-Liebesgeschichte geschrieben, die jüngere Leser in einen der aufregendsten Momente deutscher Geschichte entführt und bei allen anderen die unvergesslichen Erinnerungen an die Wendezeit wachruft.
Mehr zur Autorin: www.holly-jane-rahlens.com
Inhalt
[Widmung]
Abbildung
Die Mauer ist [...]
Ich setze mich [...]
Manche der Legos [...]
Das plötzliche Auftauchen [...]
«Und? Wohin geht’s?», [...]
Das Mitropa-Restaurant im [...]
Wir stehen wieder [...]
Ich rieche die [...]
Wir sitzen vor [...]
In der Ost-S-Bahn [...]
Rote Lichter blinken, [...]
«Die waren schon [...]
Der Zug ist [...]
Wir springen mit [...]
Ich habe keine [...]
Meine Mission ruft. [...]
Danksagungen
Für Noah. Ist ja klar.
Die Mauer ist offen. Und ich bin zu. Das war schon immer so. Nicht die Mauer, natürlich, die ist erst seit zwei Wochen offen. Sondern ich. Ich war schon immer zu, habe mich hinter einer Wand versteckt, mich dort eingenistet und werde da auch nicht mehr rauskommen. Sollte man jemals einen Film über mein Leben drehen, wird er «Das Mädchen hinter der Wand» heißen. Es ist wie in dieser alten Fernsehserie Twilight Zone. In einer der Folgen verschwindet ein kleines Mädchen auf mysteriöse Weise durch einen Riss in ihrer Schlafzimmerwand. Ihr Vater will sie zurückholen, verschwindet auch in der Wand und findet sich in einer Art fünften Dimension wieder, an einem seltsam verschwommenen Ort voller Schatten und abstrakter Konturen, einem Ort, wo Raum, Form, Ton, einfach alles verzerrt ist. Genau so fühle ich mich manchmal. Als würde ich ziellos und verloren durch fremde Welten gehen.
Kein Wunder, dass ich mich ständig verlaufe. Ich versuche ja aufzupassen, aber dann verfalle ich ins Grübeln, zum Beispiel darüber, warum es so viele Apotheken in Berlin gibt, und ehe ichs mich versehe, stehe ich plötzlich vor der Bundesversicherungsanstalt am Fehrbelliner Platz und habe keinen blassen Schimmer, wie ich da hingekommen bin, geschweige denn, wie ich wieder nach Hause komme. Es heißt ja immer in den Touristenführern, in Berlin gäbe es an jeder Ecke eine Kneipe. Stimmt nicht. Jedenfalls nicht da, wo wir wohnen. Dafür gibt es in einem Umkreis von fünf Minuten von unserer Wohnung nicht weniger als neun Apotheken, drei Reformhäuser, zwei Bioläden und ein Sanitätshaus. Ist das ein Indiz dafür, wie krank die Menschen in dieser Stadt sind? Oder wie gesund? Schwer zu sagen.
Wir wohnen in Charlottenburg. Wir, das bin ich, Molly Beth Lenzfeld, Schülerin der elften Klasse, und mein Vater, Fritz Lenzfeld, theoretischer Chemiker. Und nein, ich möchte nicht erzählen, was ein theoretischer Chemiker macht. Das ist echt kompliziert. Und es versteht sowieso kein normaler Mensch.
Fazit: Ich bin etwas versponnen, verlaufe mich oft und wohne zurzeit in Berlin-Charlottenburg. Aber nicht mehr lange! Heute Abend feiern wir ganz groß Thanksgiving, und zwar zusammen mit unserem amerikanischen Nachbarn Bo Brody und seiner deutschen Frau Edda, morgen packe ich meine Sachen, und am Samstag fliege ich nach Hause, nach New York. Auf Wiedersehen, Bundesversicherungsanstalt!
Fritz, mein Vater, bleibt noch bis Juli in Berlin. Wir sind im letzten August für ein Jahr aus New York gekommen. Als ich ihm vor ein paar Wochen gesagt habe, dass ich wieder nach Hause möchte, hat er mich gebeten, Berlin noch eine Chance zu geben und wenigstens bis Weihnachten zu bleiben. Thanks, but no thanks. Ich will nach Hause.
Meine Schwester Gwendolyn wird in New York ein Auge auf mich haben. Sie ist einunddreißig und arbeitet als Kellnerin in einem mexikanischen Restaurant nahe Burlington, Vermont. Praktischerweise hat sie sich gerade von ihrem Freund getrennt – dem dreizehnten in diesem Jahr – und freut sich auf einen Tapetenwechsel. Außerdem ist sie der Meinung, dass man die Great American Novel überall schreiben kann, auch in Manhattan. Fritz, der manchmal direkt witzig sein kann, frotzelt, dass der große amerikanische Roman schon längst von einigen Autoren vor ihr geschrieben worden ist, von Melville beispielsweise, von Twain, Salinger und Shakespeare. Aber Gwen hört ihm gar nicht zu, sondern fragt nur, ob er ihr was pumpen kann, bis ihr Roman fertig ist. Ich muss lachen. Gwen guckt mich verdutzt an.
«Shakespeare?», sage ich. «Ein Amerikaner? Und seit wann schreibt er Romane?»
Gwen stöhnt auf und knufft Fritz in die Seite.
Ich hab kein Problem damit, wenn Gwen sich um mich kümmert. Sie ist schon in Ordnung, und vielleicht wird sie ja wirklich eines Tages ihren Roman zu Ende schreiben, aber um ganz ehrlich zu sein: Wir passen nicht zusammen. Wenn sie zum Beispiel in Berlin wäre, würde sie bestimmt nicht herumlaufen und die Apotheken zählen. Dann schon eher die Eckkneipen. Ich bin eigentlich ein Stubenhocker, sie will mich aber immer an Orte schleppen, wo ich nun ganz und gar nicht hinwill, zu verqualmten Vernissagen oder in ein Tattoo-Studio, wo sie sich den Namen ihres fünfzehnten Freundes in diesem Jahr in den Oberarm ritzen lässt. Oder auf die Spitze des World Trade Center, um mit Freund Nummer achtzehn und mir essen zu gehen.
Ich komme mehr nach Fritz, und Gwen kommt nach Leonora. Leonora Sophia Lenzfeld. Ein wundervoller Name, oder? Das ist meine Mutter. Unsere Mutter. Eine atemberaubend schöne Person. Gwen ähnelt ihr sehr, und nicht nur in puncto Schönheit. Genau wie unsere Mutter findet Gwen überall Freunde, rezitiert gern Gedichte und macht leckeres Kartoffelpüree. Und genau wie Leonora Sophia Lenzfeld kann Gwen in sage und schreibe einer Sekunde ihren BH schließen. Nicht vorn, sondern hinten – auf dem Rücken! Wie macht sie das bloß? Natürlich hat sie bei all den Lovers und mit dem ständigen Aus- und wieder Anziehen viel Übung. Ich jedenfalls hake meinen BH vorn ein und ziehe ihn dann um den Bauch nach hinten. Dann erst schlüpfe ich durch die Träger. Na ja. Wenn ich sie darum bitte, bringt Gwen mir sicher bei, wie es richtig geht. Meine Mutter, eine leidenschaftliche Highschool-Lehrerin, hätte das bestimmt getan, wenn sie nicht gestorben wäre. Ich war gerade elf geworden und trug noch keinen BH. Es war sehr traumatisch. Ihr Tod natürlich, nicht dass ich noch keinen BH trug.
Eines Morgens ging meine Mutter mit Bauchschmerzen zum Arzt. Am Abend kam sie mit Krebs zurück. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Vier Wochen später war sie tot. Sie war so damit beschäftigt, sich mit Leuten anzufreunden, Gedichte zu rezitieren und Kartoffeln zu pürieren, dass sie die Warnzeichen übersehen hat – wenn es denn bei Bauchspeicheldrüsenkrebs überhaupt welche gibt.
Man kann sich kaum vorstellen, wie viele Leute zu der Trauerfeier kamen. In der Kapelle war nicht Platz genug für alle, sodass die Trauergäste bis auf den Bürgersteig hinaus standen und sich mit den zwielichtigen Gestalten mischten, die vor dem Wettbüro zwei Häuser weiter herumlungerten.
Alle 35Schüler ihrer zehnten Klasse kamen, der koreanische Gemüsehändler vom Broadway war da, ihre russische Maniküre und sämtliche Freunde meiner Schwester Gwen aus den Jahren 1975 bis 1984.Es waren viele. Alle haben meine Mutter verehrt. Alle. Aber niemand mehr als ich. Außer Fritz vielleicht. Und Gwen. Aber ich war erst elf. Für mich war der Verlust am schlimmsten.
Heute ist ein grauer Tag, wie fast alle Novembertage in Berlin. Es erinnert mich an die Schwarzweißfotos aus den 30er Jahren im alten Fotoalbum meiner Mutter. Düsterer Himmel, nackte Bäume, Kopfsteinpflaster in der Farbe von Bimsstein und Kohle. Alte Damen mit dicken braunen Fellmützen auf dem Kopf und eingepackt in schwere graue Wollmäntel wandern durch die Straßen. Manchmal taucht inmitten all des Graus ein Farbklecks auf: ein hellgelber Mohairstrickmantel an einer stattlichen Afrikanerin, eine himmelblaue Pudelmütze auf dem Kopf eines Kleinkinds im Buggy, eine Explosion von Pink. Das ist das Heidekraut in der Auslage des Blumenladens die Straße hoch. Das Gelb und Blau und Pink wirken fehl am Platz, irgendwie unecht, so als ob man kleine Bereiche der Schwarzweißfotos nachträglich koloriert hätte.
Grau, düster, nackte Bäume. So hatte ich mir Berlin an jenem sonnigen Juninachmittag in New York vorgestellt, als Fritz mir beichtete, er sei für ein Jahr zu einer Gastprofessur an der Freien Universität nach Berlin eingeladen. Wir saßen in unserem Lieblings-Sushi-Restaurant in der Amsterdam Avenue, als er mit der Neuigkeit herausrückte. Ich hatte mich fast an meinen Stäbchen verschluckt! Genauso gut hätte er sagen können, dass wir auf die dunkle Seite des Mondes ziehen, auf den Mars oder noch ein Stückchen weiter.
Fritz ist ein gutmütiger Vater. Er hatte gehofft, ich würde das Jahr in Berlin als Abenteuer betrachten, würde mich in einer neuen Umgebung wieder neu erfinden, würde Berlin wie ein großes Experiment angehen. Er hatte gehofft, Berlin würde mich entflammen wie ein Streichholz den Bunsenbrenner. Irrtum. Mein Vater ist Chemiker, aber wenn es um mich geht, ist er nicht in seinem Element. Es macht ihm Sorgen, dass ich mich seit Leonoras Tod abgekapselt habe. Er kapiert einfach nicht, dass ich nichts dagegen machen kann. Ich war schon immer so. Ich stecke fest. Fest, fest, fest.
Das Experiment Berlin war von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
Ich muss mich beeilen. Ein grauer Brei aus Schnee und Regen fällt vom Himmel, als ich am Imbissstand vorbeihusche und in den S-Bahn-Tunnel eintauche.
Im Tunnel ist es eisig kalt. Ich bin froh, dass ich meine gefütterten Stiefel, warmen Hosen, wollenen Kniestrümpfe und meinen Lammfellmantel angezogen habe. Ich schlage trotzdem die Kapuze zurück, damit meine Haare nicht platt gedrückt werden. Ich habe einen neuen Haarschnitt. Einen lockigen Bob. Sieht nicht schlecht aus.
Mein Atem dampft. Wenn ich ausatme, kann ich ganz schwach den Kaffee riechen, den ich getrunken habe, bevor ich losgegangen bin. Hoffentlich bin ich hier richtig. Ich war noch nie hier. Zu meiner Schule, der deutsch-amerikanischen Schule in Zehlendorf, fahre ich mit dem Bus. Und manchmal nehme ich die U-Bahn, um zu Fritz an die Uni in Dahlem zu fahren. Aber ich habe noch nie die S-Bahn genommen. Fritz hat mir erzählt, dass die Westberliner sie jahrelang boykottierten, weil sie von den Ostdeutschen, den Kommunisten, betrieben wurde, sogar die Strecken im Westteil. Eine kommunistische S-Bahn im Westen? Wie hat so was überhaupt funktionieren können? Und ich dachte immer, die U-Bahn in New York sei kompliziert!
Vom Imbissstand weht der Gestank von abgestandenem, ranzigem Frittenfett hinter mir her, aber der Geruch, den meine frischgewaschenen Sachen verbreiten, ist stärker. Er strömt aus meiner Unterwäsche und meinem karierten Flanellhemd. Schon heute Morgen, als ich das Hemd gebügelt habe, ist er mir aufgefallen: blumig süß und künstlich. Ich bin sehr geruchsempfindlich und musste würgen. Ich habe das Hemd trotzdem angezogen. Ich wollte mich bequem und warm anziehen, denn heute, am Donnerstag, dem 23. November 1989, muss ich eine Mission erfüllen. In Ost-Berlin. Um genau zu sein: im Stadtteil Prenzlauer Berg. Um noch genauer zu sein: in der Greifenhagener Straße. Im Geburtshaus meiner Mutter. Wenn nicht heute, wann dann? Übermorgen bin ich schon in New York.
«Es hat sich nicht viel verändert, seit sie damals wegmusste», hat Fritz mir erzählt.
Er war dort gewesen, kurz nachdem wir in Berlin angekommen waren. Ohne mich. Ich blieb zu Hause und vergrub mich im Bett. Ich war noch nicht so weit, hinzugehen. Jetzt habe ich keine andere Wahl.
«Es ist total runtergekommen, so wie das meiste im Osten», berichtete Fritz mir hinterher. «Von der Fassade bröckelt der Putz, das Mauerwerk liegt bloß. Man hat das Gefühl, die Balkone könnten einem jeden Augenblick auf den Kopf fallen. Sehr seltsam. Es kam mir vor wie direkt nach dem Krieg.»
Fritz ist in einer hessischen Kleinstadt aufgewachsen. Er, seine Mutter, Cousinen und Tanten haben den Krieg nur knapp überlebt. Einige der Männer, darunter mein Großvater, ein Wehrmachtssoldat, sind umgekommen.
Zu der Zeit waren Leonora und ihre Eltern, wie so viele jüdische Familien, schon längst aus Berlin geflüchtet. Wenn sie geblieben wären, hätte man sie wahrscheinlich im Konzentrationslager ermordet. Meine Mutter wusste davon nichts, sie war erst knapp sieben. Als sie es später erfuhr, waren ihre Gefühle für Deutschland extrem zwiespältig. Vielleicht geht es mir deshalb auch so. Aber ich glaube, wenn sie nicht gestorben wäre, wäre sie sicher nach Berlin gekommen, um sich ihre Heimatstadt anzuschauen. Irgendwann einmal. Wäre zurück nach Prenzlauer Berg in die Greifenhagener Straße gegangen. So wie ich heute. Trotz meiner gemischten Gefühle.
Ich schaue nach rechts und versuche mir vorzustellen, Leonora ginge neben mir: schlank, groß (allerdings nicht so groß wie ich), in ihrem silbrigen Haar fängt sich schimmernd das Licht. Sie hatte einen schnellen Gang. Ich kam immer ein wenig außer Atem, wenn ich versuchte, mit ihr Schritt zu halten. Manchmal griff sie mich am Arm und lotste mich in die richtige Richtung. Sie hatte einen ausgezeichneten Orientierungssinn. Und einen festen Griff.
Ich ziehe den BVG-Plan aus meiner Manteltasche. Wie war das nochmal? Welche Linie muss ich nehmen? … Die Bahnlinien im Westteil haben alle unterschiedliche Farben, die im Osten sind alle schwarz … Da ist sie. Die S3, eine türkisfarbene Linie. Ich fahre also mit der S3 bis zur Endstation Friedrichstraße, gehe dort über die Grenze, nehme eine schwarze Linie Richtung Osten und dann eine andere, ebenfalls schwarze Linie Richtung Norden. Durch die Mitte des Plans windet sich ein dicker, grau schraffierter Streifen: die Berliner Mauer.
Die Ereignisse des 9. November habe ich zum größten Teil verschlafen. Ich habe einen festen Schlaf. An dem Abend bin ich relativ früh, so gegen zehn Uhr, ins Bett gegangen. Ich wachte auf, als es bei uns Sturm klingelte. Das waren Edda und Bo Brody, unsere Nachbarn. Dann klopfte Fritz bei mir und sagte, dass die Mauer offen sei und ob ich nicht mit rauskommen wollte, um zu feiern und vielleicht ein bisschen auf der Straße rumzulaufen?
Zuerst begriff ich überhaupt nicht, wovon er sprach. Welche Mauer? In unserem Hinterhof gab es eine, wo die Mülltonnen stehen, aber … Und als ich dann endlich kapierte, dass sie die Mauer meinten, da schien mir das noch lange kein Grund zu sein, mein gemütliches Bett zu verlassen, noch dazu mitten in der Nacht.
Doch als dann alle fort waren, konnte ich nicht gleich wieder einschlafen und ging raus auf den Balkon. Ich sah in Richtung Ku’damm und hörte den Lärm, das Gehupe der Autos, das Gejohle der Menschen. Wow, dachte ich, die Berliner Mauer, das ist doch eine historische Nacht, vielleicht sollte ich ein Teil davon sein. Aber das war ich eben nicht, ich fühlte mich nicht als Teil davon. Also ging ich wieder ins Bett und schlief, bis –
«Hey, Molly Moo!»
Aufgeschreckt drehe ich mich um.
Es ist Carlotta Schmidt, eine aus meiner Klasse. Ich hatte mich schon am Dienstag von allen verabschiedet und nicht gedacht, dass ich sie noch einmal sehen würde. Schon gar nicht in einem S-Bahn-Tunnel.
«Buh! Molly Moo!», sagt sie. Ein Speicheltropfen landet auf meiner Nasenspitze.
Ich kann es nicht ausstehen, wenn Carlotta «Molly Moo» zu mir sagt.
«Was machst du denn hier?», will sie wissen. Als gäbe es ein Gesetz, das mir verbietet, den S-Bahn-Tunnel zu betreten. Egal, was Carlotta sagt, es klingt immer schrill und so, als ob sie sich über mich lustig macht. Obendrein ist sie ein echter Albtraum, eine Kreuzung zwischen Madonna, Olivia Newton-John und der Lottofee aus der ARD, Karin Tietze-Ludwig. Sie hat Madonnas Körper, Olivias blondgefärbte Dauerwelle und Karins glattes Lächeln. Dabei zieht sie sich an wie die Nutten, die nachts auf dem Ku’damm rumstehen. Nutten auf dem Kurfürstendamm! Ist das nicht zum Schreien? Auf der schicksten Einkaufsstraße Berlins! Das ist, als ob Prostituierte auf der Fifth Avenue vor Tiffany’s anschaffen gehen würden!
Heute trägt Carlotta ein hautenges neonpinkes Schlauchkleid, das ihr bis knapp über die Knie geht, hochhackige, hautenge schwarze Lackstiefel, die bis knapp unter die Knie gehen, schwarze Strümpfe und eine schwarze Lederjacke im Pilotenlook mit Schulterpolstern wie ein Footballspieler. Die Jacke reicht gerade mal bis zur Taille. Sie muss sich den Hintern abfrieren. Hoffentlich!
Carlotta lächelt ihr Tietze-Ludwig-Lächeln, und ich sehe roten Lippenstift auf ihren Vorderzähnen. Gut, soll sie doch so rumlaufen. Ich werde sie jedenfalls nicht darauf aufmerksam machen.
«Ich muss noch schnell ein paar letzte Besorgungen machen», sage ich. Der werde ich bestimmt nicht auf die Nase binden, dass ich eine Mission habe und nach Prenzlauer Berg fahre. Sie würde es schaffen, diese Information irgendwie gegen mich zu verwenden. Obwohl, was kümmert mich das überhaupt noch? Schließlich bin ich am Samstag sowieso für immer weg.
«Oh, ich liebe deine Stiefel», sagt sie.
Genau das meine ich! Sie macht sich über mich lustig. Sie verachtet meine Stiefel. Um nichts in der Welt möchte sie in so was erwischt werden. Ich übrigens auch nicht. Sie sehen wie Militärstiefel aus. Um genau zu sein, sind es auch Militärstiefel. Ich habe sie in New York in einem Armeeladen ergattert. Wenn man Schuhgröße 44 hat wie ich, kann man es sich nicht leisten, besonders wählerisch zu sein.
Das ist übrigens noch ein Grund, warum es mit Berlin von Anfang an danebenging. Ich finde einfach keine halbwegs anständigen Schuhe in dieser Stadt. Anscheinend hat hier niemand, wirklich absolut niemand, große Füße, noch nicht mal die Jungs in meiner Klasse. Nicht dass ich sie mir angucken würde, die Jungs meine ich. Und nicht dass sie mich angucken würden. Wie sollten sie auch? Sie reichen mir gerade mal bis zum Kinn.
Ich bin ein großes Mädchen. Nicht dick, wohlgemerkt. Nur lang. Fast zwei Meter. Na ja, 1,86 m – und womöglich wachse ich noch! Gigantische Füße, Riesenhände, üppige Brüste. Ich bin ein Turm, ein Berg, ein Monster von einem Mädchen. Wenn Hollywood jemals ein Remake von «Angriff der 20-Meter-Frau» drehen sollte, würde ich auf der Stelle die Titelrolle bekommen: Horror! Schock! Angst! Molly Lenzfeld, der Schrecken der Pennäler, ist unterwegs!
Und wenn sie jemals einen Film über Carlotta Schmidt machen sollten, hieße der: «Die Schlampe aus dem All»! Zum ersten Mal auf der Leinwand – das Paarungsverhalten der Carlotta Schmidt! Sabbernde Jungs, wummernde Herzen, kochende Hormone!
«Übrigens hab ich ein Schuhgeschäft für extragroße Schuhe gesehen. Für extragroße Frauen», sagt Carlotta. «Waren ganz hübsch. Nur für den Fall, dass du vorhast, Schuhe zu kaufen.»
Ich höre einen sarkastischen Unterton in ihrer Stimme mitschwingen. Und muss sie unbedingt «extragroß» sagen? Und dann gleich zweimal?
«Ach?», sage ich, Interesse heuchelnd.
«Hinterm KaDeWe. In der Nürnberger Straße. Könnte auch die Passauer gewesen sein.»
Ich kenne das Geschäft. Da kaufen vor allem Transvestiten ein. Ich wette, sie weiß, dass das ein Laden für Tunten ist. Sie macht sich schon wieder über mich lustig! Zicke.
Wir kommen zur Treppe, die zum Bahnsteig führt. Auf einem Schild steht «Friedrichstraße».
«Ich muss noch ’ne Karte kaufen», sagt Carlotta. «Ciao, ciao.»
Wie affektiert ist das denn? Ciao, ciao.
«Mensch», sagt sie plötzlich. «Ich seh dich ja heute Abend.»
«Heute Abend?», frage ich. Zugegebenermaßen klingt es nicht sehr freundlich.
«Na, beim Thanksgiving.»
«Wie, da bist du auch?», sage ich – noch unfreundlicher.
Dann fällt’s mir ein. Unser Nachbar Bo Brody kennt ihre Mutter, Audrey Rockwell-Schmidt, eine Amerikanerin, die hiesigen Amerikanern bei der Steuererklärung hilft.
Carlottas Gesicht verdüstert sich. «Entschuldige bitte, dass ich auch Thanksgiving feiern möchte!»
Sie dreht sich um und steuert den Fahrkartenschalter am Ende des Tunnels an.
Ich gehe auf die Treppe zu.
Ciao, ciao. Bäh!
Ich steige die Treppe zur S3 hoch.
Hm. Vielleicht hätte ich ja doch etwas freundlicher sein können. Vielleicht wollte sie mir wirklich nur helfen. Vielleicht hat sie ja tatsächlich ein hübsches Paar Schuhe in dem Laden gesehen und dachte ernsthaft, sie könnten mir gefallen. Vielleicht habe ich sie falsch interpretiert. Rachel Schwartz, eine Therapeutin, bei der ich vor einigen Jahren war, hat mal gesagt, ich würde nonverbale Gesten oft nicht richtig deuten.
Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich hätte ihr wenigstens eine Chance geben müssen.
Ich drehe mich um. «Hey!», rufe ich.
Carlotta geht weiter.
«Carlotta!»
Jetzt lässt sie mich abblitzen.
«Du hast Lippenstift auf den Zähnen!», rufe ich ihr hinterher.
Sie läuft weiter, aber hebt den Arm hoch und zeigt mir den Stinkefinger. Das ist eine nonverbale Geste, die sogar ich verstehe. Ich zucke mit den Schultern und gehe die Treppe zum Bahnsteig hoch.
Na ja, ich hab’s versucht, oder?
Ich setze mich ans Fenster.