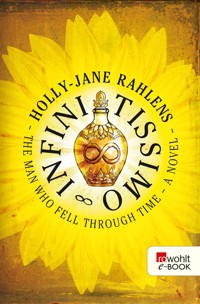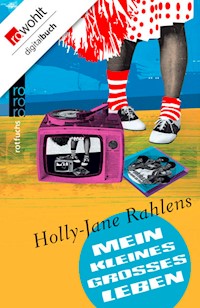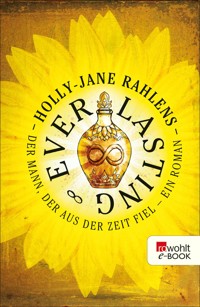4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Über die Liebe zu den Sternen, den Stars und den Irdischen Berlin 1997: Nelly Sue Edelmeister ist zukünftige Weltraumforscherin, brillante Schülerin und – total verliebt. Und zwar in den fünfzehnjährigen Prinz William! Lucy, Nellys amerikanische Mutter, findet das gar nicht komisch. Statt königlicher Websites soll ihre Tochter lieber die Thora studieren: Nellys «Bat-Mizwa» steht bevor. Doch als die Schulmannschaft zu einem Basketballturnier nach England eingeladen wird, hat Nelly, die vorher um jeden Sportplatz einen weiten Bogen gemacht hat, nur noch ein Ziel: Sie will mit. Vielleicht lässt sich ja ein Deal mit diesem Basketball-Crack im Fledermaus-Look, diesem unsäglichen Maximilian Minsky, arrangieren ... Ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Holly-Jane Rahlens
Prinz William, Maximilian Minsky und ich
Über dieses Buch
Über die Liebe zu den Sternen, den Stars und den Irdischen
Berlin 1997: Nelly Sue Edelmeister ist zukünftige Weltraumforscherin, brillante Schülerin und – total verliebt. Und zwar in den fünfzehnjährigen Prinz William! Lucy, Nellys amerikanische Mutter, findet das gar nicht komisch. Statt königlicher Websites soll ihre Tochter lieber die Thora studieren: Nellys «Bat-Mizwa» steht bevor. Doch als die Schulmannschaft zu einem Basketballturnier nach England eingeladen wird, hat Nelly, die vorher um jeden Sportplatz einen weiten Bogen gemacht hat, nur noch ein Ziel: Sie will mit. Vielleicht lässt sich ja ein Deal mit diesem Basketball-Crack im Fledermaus-Look, diesem unsäglichen Maximilian Minsky, arrangieren ...
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch
Biografie
Holly-Jane Rahlens kam nach dem Studium der Literaturwissenschaft und Theater Arts aus ihrer Heimatstadt New York nach Berlin. Mit Funkerzählungen, Hörspielen und Solo-Bühnenshows machte sie sich dort in den achtziger und neunziger Jahren einen Namen. Außerdem arbeitete sie als Journalistin, Radiomoderatorin und Regisseurin.
Holly-Jane Rahlens hat bereits sechs Romane veröffentlicht.
«Prinz William, Maximilian Minsky und ich» wurde 2003 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet und kam 2007 in einer Drehbuchadaption der Autorin ins Kino. Bei rotfuchs sind außerdem die Jugendbücher «Mauerblümchen» und «Mein kleines großes Leben» erschienen.
Die Autorin lebt heute mit Mann und Sohn in Berlin-Charlottenburg.
Mehr zur Autorin: www.holly-jane-rahlens.com
Inhalt
[Widmung]
Nerd Nelly
Universum Schule
Das Teleskop
Staunen
Hin und weg
Das Ziel
Training
Unterricht für Max
Unterricht für Nelly
Das Schwarze Loch
Die große Kälte
Prinzessin Nelly
Dank
as always,
for Noah and Eberhard,
my two and only
Erstes Kapitel
Es war einmal vor langer, langer Zeit, weit fort in einem fernen Land – na ja, es war erst vor ein paar Jahren und genau hier in Berlin –, da entdeckte ich den zukünftigen König von Großbritannien, William Arthur Philip Louis Windsor, auch bekannt unter dem Namen Wills, noch bekannter als Seine Majestät Prinz William, Sohn Seiner Königlichen Hoheit, des Prinzen von Wales, Charles Philip Arthur George Mountbatten Windsor, und seiner von uns gegangenen ehemaligen Gemahlin Prinzessin Di, geborene Lady Diana Frances Spencer. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und es änderte mein Leben vollkommen.
Doch bevor ich jetzt ins Detail gehe, möchte ich ein wenig von mir erzählen. Prinz William kennt schließlich jeder. Aber wer, bitte schön, ist Nelly Sue Edelmeister?
Als Prinz William in mein Leben trat, war ich eine ungeheuer ernsthafte Dreizehnjährige, ein spindeldürres Berliner Schulmädchen mit einem schweren Zopf im Nacken, dicken Brillengläsern auf der Nase und einem Hirn von der Größe der Encyclopædia Britannica. Ich war eine Katastrophe. In Amerika, wo meine Mutter aufgewachsen ist, nennt man Kids wie mich nerds – kein sehr charmanter Ausdruck für Leute mit Superhirn und null Appeal. Und genau so war ich. Ständig hatte ich ein Buch vor der Nase, sogar unterwegs auf der Straße. So was kennt man sonst nur aus Filmen, im wirklichen Leben gibt es das kaum – schließlich muss man ziemlich geschickt sein, um ohne nach rechts und links zu schauen sicher durch die Straßen zu kommen. Besonders in einer Stadt wie Berlin, wo man jeden Moment von einem wütenden Rottweiler angefallen werden kann oder, schlimmer noch, versehentlich in seine Kacke tritt. Ich aber lief und las. Und wenn ich nach Hause kam, trat ich einfach die Schuhe ab – also, wenn ich dran dachte.
«Es ist wie im Mittelalter!», sagte meine Mutter gern, wenn sie sah, wie ich den Dreck aus ihrem guten Perserteppich herausrieb. «Bei so organisationswütigen Leuten wie den Deutschen, in einer derart analfixierten Stadt wie Berlin, wo noch im popeligsten Hinterhof mindestens ein Dutzend verschiedener Tonnen stehen – für Altpapier, Blech, Biomüll, Plastikmüll, grünes Glas, braunes Glas, weißes Glas, bestimmt bald noch magentarotes! –, mein Gott, da sollte man meinen, die Beseitigung von Hundehaufen wäre kein Problem. In New York würde man so eine Schweinerei nicht dulden!»
Meine Mutter Lucy Bloom-Edelmeister verglich Berlin ständig mit ihrer Heimatstadt, und das Ausrufezeichen am Ende ihrer Sätze konnte man immer förmlich hören. «Ich habe New York verlassen», sagte sie gern, «aber New York nicht mich!» Nach einem Berlin-Besuch Anfang der Achtziger fand sie so viel an der Stadt auszusetzen, dass sie beschloss, hier zu bleiben und aus ihrer Nörgelei eine Kunst zu machen.
Meinen Vater traf sie dann ein Jahr und ungefähr zehn Liebhaber später. Papa ist Musiker, ein Klarinettist. Er tritt unter dem Namen Bazooka Benny auf, heißt in Wahrheit aber Bernhard Nikolaus Edelmeister. Meine Mutter und er lernten sich beim Umsteigen im U-Bahnhof Möckernbrücke an der Imbissbude kennen. Sie verliebten sich beim Currywurstessen, zogen zusammen – und fertig war die Laube. Sie wohnten mit ein paar Freunden in Schöneberg, in der Wohnung, in der einst der Rockstar David Bowie lebte – zumindest sagten das alle –, und als meine Mutter mit mir schwanger war, fanden sie die Wohnung hier in Wilmersdorf, wo wir seither wohnen.
Wilmersdorf liegt im westlichen Teil der Stadt. Manche Ecken sind piekfein. Aber größtenteils ist es spießig, stellenweise sogar ziemlich heruntergekommen. Unser Haus ist die reinste Bruchbude. Der Putz an der Fassade bröckelt überall, man kann die Backsteine und den Mörtel darunter sehen. Meine Eltern sind sich einig, dass unser Haus genauso schlimm aussieht wie die übelsten Häuser im Osten. Das ist so ungefähr das Einzige, worüber sie sich einig sind, aber dazu später mehr. Solange ich zurückdenken kann, müffelt es im Keller nach Schimmel und Moder, und jedes Mal, wenn ich unten bin, sehe ich Mäuse, die eilig davonhuschen. Meine Mutter besteht darauf, es seien Ratten, keine Mäuse, aber dann sagt mein Vater zu ihr: «Woher willst du das wissen? Wann warst du denn das letzte Mal da unten? Vor zehn Jahren?»
Unser Vermieter, Herr Pomplun, der mit drei Schäferhunden und einer Urne mit der Asche seiner verstorbenen Ehefrau neben uns wohnt, weigert sich, das Haus renovieren zu lassen. Hin und wieder droht meine Mutter Pomplun damit, sich bei den Behörden über ihn zu beschweren. Und vielleicht tut sie das auch. «Sie ist tough», sagt mein Vater gern. «Made in USA. Hundert Prozent Chuzpe.» Bei dem Haus hat sie aber doch noch nichts gemacht. «Schließlich», sagte sie, «müssen die Leute von der anderen Straßenseite draufgucken – nicht ich.»
Auf der anderen Straßenseite wohnt die ehemals beste Freundin meiner Mutter, Beate. In der Soap Die Universitätsklinik spielt sie die Schwester Bettina. Meine Mutter lernte sie vor Jahren kennen, als sie ein Zeitungsinterview mit ihr machte. Beate hat eine Maisonettewohnung mit mindestens fünfzehn Zimmern, nochmal so vielen Badezimmern und einem Dachgarten. «Genau solche Häuser machen den Charme des Viertels aus», sagte meine Mutter früher. Heute dagegen heißt es: «Genau solche Protzkästen sind schuld, dass die Mieten hier so in die Höhe schießen.»
Jedenfalls, wie gesagt, war ich mit dreizehn ein Nerd, der Bücher geradezu verschlang. Ich las einfach alles. Für Naturwissenschaften aber interessierte ich mich am meisten. Ich bereitete mich auf eine Karriere in Kosmologie vor und sammelte laufend Informationen über Superstrings, Baby-Universen, Schwarze Löcher, Zeitverzerrungen, all solche Sachen.
Meine Leidenschaft für die Astronomie begann in dem Sommer, als ich neun war. Meine Eltern schickten mich nach New York, auf Besuch zum Bruder meiner Mutter, meinem Uncle Bruce, und seiner Frau, Aunt Debbie. Als eines Tages die Klimaanlage ihren Geist aufgab und ich kurz vorm Ersticken war, brachten sie mich bei diesem Astronomie-Projekt für Jugendliche im Hayden-Planetarium unter, das von ihnen aus bequem zu Fuß zu erreichen war. Dort war es herrlich kühl – und ich war sofort Feuer und Flamme! Ich fand es toll, an unerträglich schwül-heißen Nachmittagen der gleißenden Sonne zu entgehen, unter dem klimatisierten Nachthimmel des Planetariums zu sitzen und über das Weltall zu philosophieren. Mein Lebensziel stand hiernach fest: Ich würde die Geheimnisse des Universums ergründen.
In dem Sommer, als ich dreizehn wurde, war ich aber erst mal noch ein Bücherwurm und Sterngucker. Und ein Computerfreak. Tatsächlich lernte ich auch genau dort, am Computer, Prinz William erst so richtig kennen: im Internet, wo ich die Homepage der Queen in mich reinfraß und all die Websites, die der Königsfamilie gewidmet sind. Als meine Mutter diesem Geheimnis auf die Spur kam, sagte sie sofort: «Ach, wie romantisch, Liebe auf den ersten Klick! Hahaha.»
Uah – meine Mutter! Sie hält sich für sooo komisch. Manchmal ist sie das auch. Aber meistens ist sie es nicht. Und als ich dreizehn war, war sie definitiv nicht komisch! Im Gegenteil: Sie war sauer wie ein Fass voller Gurken. Wahrscheinlich, weil sie und mein Vater ständig zankten. Sie stritten sich über alles. Über mich. Über die Hunde von Herrn Pomplun. Über die Mutter meines Vaters, meine Oma Anneliese. Oma und meine Mutter verstehen sich nicht besonders. «Fräulein Anneliese», sagt meine Mutter immer zu meinem Vater, wenn Oma anruft, und reicht ihm den Hörer so angewidert, als wäre er giftig.
Meine Eltern stritten sich sogar über meine Bat-Mizwa. Die Bat- oder bei Jungen Bar-Mizwa ist dieses große Ereignis, das jüdische Kinder begehen, wenn sie etwa dreizehn sind und als erwachsen gelten. Traditionell ist das ein lebensbejahender, freudiger Anlass, richtig? Nicht so bei meiner Mutter. Sie stürzte sich mit einer Vehemenz in die Vorbereitungen, als würde jeden Moment mitten in unserer Küche der dritte Weltkrieg ausbrechen. Also, man muss sich vorstellen, in was für eine wahnsinnige Hektik sie schon verfällt, wenn sie ein einfaches Pessach-Seder für zehn Gäste gibt. Und zu der Bat-Mizwa wollte sie einhundertfünfzig Gäste einladen!
«Hundertfünfzig!», sagte mein Vater, als er das hörte. «Das kann doch nicht dein Ernst sein!»
«Mommy!», sagte ich. «Ich heirate doch nicht!»
«Eben!», sagte meine Mutter. «Heiraten kannst du, sooft du willst – die Bat-Mizwa feierst du nur einmal. Du sagst der Welt, dass du jetzt erwachsen und Teil der jüdischen Gemeinde bist.»
«Ich glaub nicht mal an Gott. Warum sollte ich Teil der jüdischen Gemeinde werden?»
Auf dieses Stichwort hin verdrehte meine Mutter immer die Augen und warf mir einen ihrer vernichtenden Blicke zu. «Weil du Jüdin bist. Deswegen.»
Jüdischem Gesetz gemäß wird die Religionszugehörigkeit eines Kindes durch die Mutter weitergegeben, sodass ich, obwohl mein Vater Nichtjude war, wegen meiner Mutter als Jüdin galt. Sie war nicht religiös oder so, hielt aber viel auf jüdische Tradition und wollte mich so viel wie möglich mit der Kultur in Berührung bringen. Was mir ziemlich egal war, da es um uns herum ohnehin nicht viel jüdische Kultur gab. Ich meine, schließlich lebten wir in Deutschland! Jedenfalls, was die Bat-Mizwa betraf, fand ich, dass meine Mutter es etwas übertrieb. Ich musste Hebräisch lernen, einen Abschnitt aus der Thora aufsagen können, eine Rede schreiben, am Sabbat, also freitagabends oder samstagmorgens, in die Synagoge gehen und und und.
«Keine Bange: Die Bat-Mizwa wird lustig», sagte meine Mutter gern. «Zwei Juden an einem Tisch, und schon lachst du dich kaputt.»
«Warum lachen wir dann jetzt nicht?», konterte ich.
Meine Mutter sah mich an, als wollte sie mir die Familienzugehörigkeit aberkennen oder mich enterben oder am besten beides zusammen. Doch nach ein paar Sekunden heiterte sich ihr Gesicht auf, und sie sagte: «Hey, das war spitze, Nelly. Sehr gut. Siehst du, Juden sind witzig!»
Haha.
Neben der Bat-Mizwa stritten sich meine Eltern am meisten über Geld. Oder vielmehr den Mangel an Geld. Meine Mutter meckerte immer an meinem Vater herum, weil er kein berühmter Musiker war. Als freie Mitarbeiterin einer Reihe gut zahlender Hochglanzmagazine verdiente sie ganz anständig, aber seine Einkünfte durch Musikerjobs waren – abgesehen von ein paar Schülern, denen er regelmäßig Unterricht erteilte – nur sporadisch. Manchmal sogar nicht existent. Jeden Abend, wenn wir uns um den Esstisch setzten, ging dieselbe Leier los.
«Gibt’s was Neues?», fragte meine Mutter und griff nach ihrem Steakmesser. «So in Richtung Engagement?»
«Nein», sagte mein Vater.
«Was ist denn aus der Sache im Wintergarten geworden?», sagte sie, setzte ihr Messer an und zerschnitt das Fleisch.
«Nichts. Die hat jemand anderes bekommen. Jemand Berühmtes.»
«Wer denn?», fragte sie und führte das Fleisch zum Mund.
«Unwichtig. Der Name würde dir sowieso nichts sagen.»
«Wenn er so berühmt ist, warum sollte mir dann der Name nichts sagen?», fragte meine Mutter.
«Sie», sagte mein Vater. «Es ist eine Sie.»
Meine Mutter hätte sich fast an ihrem Fleisch verschluckt, und ein wenig von dem Blut tropfte ihr aus dem Mund. Sie mag ihr Steak am liebsten noch ziemlich roh. Mein Vater seins medium. Ich bevorzuge es gut durch.
«Benny, irgendjemand in Berlin muss doch irgendwo einen Klarinettisten brauchen!», sagte meine Mutter. «Du könntest doch wenigstens Klezmer bei einer Hochzeit spielen. Oder bei einer Bar-Mizwa.»
Mein Vater erbleichte.
Schon mal aufgefallen, wie Leute in Romanen ständig das Wort «erbleichen» benutzen, man so was aber im richtigen Leben fast nie zu sehen kriegt? Ich meine, wann sieht man schon mal Leute richtig weiß werden? Aber bei meinem Vater ist das so. Echt. Vielleicht ist es ein Kreislaufproblem. Oder was Psychisches. Oder wegen einer Allergie. Jedenfalls kann man richtig sehen, wie sein Gesicht an Farbe verliert. Und seine dunkelbraunen Augen wie eine explodierende Supernova blitzen.
«Lucy, bitte!», sagte mein Vater. «Erzähl du mir nicht, wie ich meinen Job zu machen habe.»
«Er ist Künstler», sagte ich. «Ein Komponist. Er gehört auf die Bühne. Oder in ein Aufnahmestudio.»
Meine Mutter knallte ihr Messer so heftig hin, dass ich schon um den Teller fürchtete. «Es ist mir egal, wohin er gehört, solange er dort nur Geld verdient.»
Meiner Ansicht nach sprang meine Mutter mit meinem Vater viel zu grob um. Es fand sich doch immer noch gerade rechtzeitig ein guter Studiogig. «Papa soll nicht ins Hinterzimmer irgendeiner Synagoge, zum Klezmer-Spielen», sagte ich. «Und außerdem, Klezmer hat mit jüdischer Kultur ungefähr so viel zu tun wie Dudelsackmusik mit schottischer Kultur. Und er ist ja noch nicht mal Jude!»
«Prinzessin», sagte mein Vater sanft, «das ist eine Sache zwischen deiner Mutter und mir.»
Meine Mutter sah erst mich und dann meinen Vater an. «Du bist nicht der einzige Künstler in der Familie, Benny», sagte sie. «Ich hab die Zeilenschinderei satt. Ich möchte mein Buch schreiben.»
Ihr Buch. Das war mal wieder typisch meine Mutter. Seit Ewigkeiten redet sie über «Ihr Buch». Ein New-York-Roman, sagte sie, was immer das auch heißen mag. Sie hatte noch nicht einmal damit angefangen, benutzte ihn aber als Waffe, um uns zum Schweigen zu bringen. Und das klappte immer. Wenn sie ihr Buch erwähnte, fühlten wir uns immer sofort schuldig und sagten lieber nichts mehr. Nur wenn Risa, die mit uns zusammenwohnte, dabei war, dauerte dieses Schweigen nie lange. Sie wandte sich dann mir zu, zwickte mich in die Wange und sagte mit ihrem polnischen Akzent: «Bubele, wie wär’s mit einem Lächeln in deinem schönen Gesicht?»
Schönes Gesicht? Bei aller Liebe zu Risa: In der Beziehung hatte sie einen Knick in der Optik! Also protestierte ich und rutschte auf meinem Stuhl herum, aber dadurch ließ sie sich nicht abbringen. «So a schejn mejdele, warum immer diese grimmige Miene?», sagte sie dann.
Risa, die fast siebzig war, würzte ihr Deutsch gern mit jiddischen Einsprengseln. Schejn mejdele zum Beispiel heißt schönes Mädchen und bubele Großmütterchen, ein Kosename für Mädchen. Risa hat nie ihren polnischen Akzent verloren, obwohl sie vor über vierzig Jahren nach Berlin gekommen ist. Sie kam mit ihrem Ehemann Leopold her, den sie nach dem Krieg in Warschau kennen lernte. Beide hatten den Holocaust wie durch ein Wunder überlebt. Na ja: Wenn nicht durch ein Wunder, wie sonst hätte man die Schoah überleben sollen? Seit Leopold gestorben ist – ich war damals gerade in der ersten Klasse –, wohnt Risa bei uns, aber wir kannten sie schon viel länger. Ich kenne sie mein ganzes Leben lang. Und meine Mutter kennt sie auch schon ihr Leben lang. Das kommt daher, weil Risa und meine Großmutter mütterlicherseits, Hanna Bloom, geborene Herschkowitz, zusammen in Polen aufgewachsen sind. Und als meine Mutter nach Berlin kam, nahm Risa, die keine Kinder hatte, sie als Ersatztochter unter ihre Fittiche.
Meine Großmutter Hanna und ihre Familie hatten das Glück, aus Europa nach Amerika fliehen zu können, bevor es zu spät war. Aber Risa und ihre Eltern saßen in Polen fest. Den Krieg überlebten sie in verschiedenen Verstecken, in Kellern und Scheunen, in Kirchen, einmal sogar in einem verborgenen Keller unter dem Gemüsebeet eines Nachbarn. Risa sprach nicht darüber, also weiß ich nicht alles so genau. Wenn man ihr Fragen über den Krieg stellt, erzählt sie immer von der Zeit, als sie Leopold Ginsberg kennen lernte, und das war nach dem Krieg. Er war Deutscher. Nun, eigentlich war er Pole, aber er wuchs in Deutschland auf, also fühlte er sich als Deutscher, doch dann schickten ihn die Deutschen zurück nach Polen, und – Moment mal – wird das langsam ein bisschen zu viel? Kann man noch folgen, warum alle ständig von einem Land zum anderen ziehen, hin und her zwischen Polen und Amerika und Deutschland? Aber was soll ich tun? Die Geschichte unserer Familie ist eben ziemlich verwickelt. Meine Mutter meint, das sei die Schuld der Deutschen. «Wenn die Deutschen nicht versucht hätten, uns loszuwerden», sagt sie, «hätten wir wahrscheinlich völlig unkomplizierte und langweilige Leben geführt. So wie Oma Anneliese und Opa Hans Otto.»
Wenn meine Mutter dies jetzt lesen könnte, würde sie mir raten, genau jetzt Schluss zu machen, mit dieser kontroversen Bemerkung das Kapitel zu beenden. «Genug ist genug», höre ich sie sagen. «Ein zu langer Prolog ist ein zu langer Prolog. Fang endlich mit der Geschichte an. Komm zur Sache!»
Dies eine Mal vielleicht werde ich ihrem Rat folgen. Ich meine, ich wollte ja eigentlich von mir und Prinz William erzählen, nicht wahr?
Zweites Kapitel
Es war ein mieser Septembertag. Von Anfang an. Beim Frühstück musste ich mit anhören, wie meine Mutter am Telefon mit einer Kollegin quasselte, die sie später sowieso noch sehen würde. Im Hintergrund konnte man hören, wie mein Vater Klarinette spielte. Sein Studio ist schallisoliert, damit er beim Spielen niemanden im Haus stört, aber er hatte die Tür offen gelassen – was oft vorkommt.
«Mensch, Benny!», schrie meine Mutter.
Mein Vater spielte weiter. Wahrscheinlich hatte er Kopfhörer auf und lauschte einem Playback.
Meine Mutter legte auf und drehte sich zu mir um. «Ich muss gleich zu einem Krisentreff ins Büro. Aber zum Abendessen bin ich wieder da.»
Meine Mutter arbeitete als freie Redakteurin bei Cinema-Scoop. Wie der Name verrät, handelte es sich dabei um ein Unterhaltungsmagazin, das über Trends aus Film, Fernsehen und der Medienbranche berichtet und alberne Interviews mit Prominenten abdruckt: neunundneunzig Prozent heiße Luft! Was die große Krise wohl war? Hatte Julia Roberts sich den Knöchel verstaucht? Steven Spielberg Konkurs angemeldet?
Meine Mutter griff in ihre Hosentasche. «Hier. Ich habe gestern Abend meine Gästeliste zusammengestellt.»
Ich starrte sie an.
«Und, wie sieht’s mit deiner aus?», fragte sie.
«Mit meiner Gästeliste?»
«Du lädst doch bestimmt ein paar Freunde zu der Bat-Mizwa ein. Nelly, die ist in acht Wochen! Wie wär’s mit Anton?»
«Anton? Anton Weißenberger? Weshalb sollte ich den denn einladen?»
«Weil er der Sohn des Rabbis ist.» Sie schaute mich an. «Und Yvonne? Was ist mit Yvonne?»
Yvonne Priscilla Cohen? Der Superstar der Schule? Geliebt und bewundert von jedermann – jedermann außer mir!
Gebannt beobachtete ich, wie die geschmolzene Butter auf meinem englischen Muffin getoastete Berge hinabrann und Täler überflutete. Die Wahrheit war, dass ich niemanden zum Einladen hatte. Und das wusste nicht nur ich, sondern auch meine Mutter. Meine einzige Freundin, Fiona Lightfoot, ging vor ein paar Monaten nach Kalifornien zurück. Ihr Vater ist bei Microsoft, und wir haben den Kontakt verloren. Sie hat den Kontakt verloren, genauer gesagt. Ich e-mailte ihr, aber sie hat nie geantwortet. Also war ich derzeit ein bisschen eine Außenseiterin. Was mich nicht weiter störte – aber für meine Mutter, die Party-Queen, war es nicht leicht, dass ihre Tochter mit Sternen mehr am Hut hatte als mit Stars.
«Nelly», sagte meine Mutter und trank ein Schlückchen Kaffee, «warum musst du so widerspenstig sein?»
Ich konnte es nicht ausstehen, wenn meine Mutter das sagte. Und sie sagte es ständig. Erinnerte mich ununterbrochen daran, dass ich mir keine Mühe gab, zu tun, was sie wollte, zu sein, wie sie mich gern gehabt hätte. Als zielte alles, was ich tat und ihr nicht gefiel, nur darauf ab, sie zu ärgern.
«Ich wünschte wirklich, du würdest nicht so tun, als hätten die Vorbereitungen zu deiner Bat-Mizwa nichts mit dir zu tun», fuhr sie fort. Sie bedachte mich mit einem ihrer durchdringenden Blicke und widmete sich dann ihrem Frühstück – bis der Klang der Klarinette wieder zu uns drang. «Verdammt nochmal, Benny!», brüllte sie. «Ich kann ja nicht mal meine eigenen Gedanken hören!» Oje. Nun war sie wirklich auf hundertachtzig. Sofort war sie wieder hinter mir her. «Und noch was. Wenn ich wiederkomme, ist dein Zimmer aufgeräumt. Da drinnen sieht’s aus wie in einem Schweinestall.»
Ich sprang vom Stuhl auf. Mein Zimmer war tatsächlich ein klein wenig unordentlich. Na und? «Hör auf, mich rumzukommandieren! Ich räum mein Zimmer dann auf, wenn ich will!», sagte ich. «Und außerdem muss ich nach der Schule ins Hebräisch. Und dann hab ich was mit Risa vor.»
Ich stürmte aus der Küche hinüber ins Studio meines Vaters. Es war genau, wie ich vermutet hatte. Er stand mit dem Rücken zur Tür und hatte seine Kopfhörer auf. Still stand ich da und lauschte. Er spielte etwas Jazziges – klassische Musik spielt er aber genauso gut. Er spürte wohl meine Gegenwart, denn er drehte sich plötzlich um und hob den Kopfhörer auf einer Seite hoch.
«Sie ist auf dem Kriegspfad!», sagte ich.
«Schönen Tag, Prinzessin», antwortete er und warf mir eine Kusshand zu, während ich die Tür für ihn schloss.
Ich schnappte mir meine Jacke, suchte mein Zimmer nach meinem Rucksack ab, fand ihn schließlich auf dem Boden neben dem kaputten Teleskop, warf ihn mir über die Schulter und ging aus dem Haus. O Mann! Wenn meine Mutter schlechte Laune hatte, ließ sie das immer an mir aus. Das machte mich wahnsinnig.
Auf der Straße holte ich ein Buch aus meinem Rucksack und trabte zur Bushaltestelle. Während ich so vor mich hin lief, erhaschte ich aus dem Augenwinkel einen Blick auf die Freaks vor der ehemaligen Tankstelle um die Ecke. Sie waren nicht viel älter als ich und konnten sich nicht entscheiden, ob sie Skinheads oder Punks oder bloß Überbleibsel der letzten Love Parade waren. So wirkte es jedenfalls auf mich. Ein paar von ihnen hatten ihre Köpfe nach Irokesenart rasiert. Ein spindeldürrer Bursche mit schulterlangen, weißblond gebleichten Haaren trug schwere Halsketten und einen Ring durch die linke Augenbraue, und über seine beiden Arme wanden sich tätowierte Schlangen. Einen anderen nannte meine Mutter den Dichter, weil er immer eine hellblaue Jeansjacke trug, die hinten mit schwarzem Filzstift voll geschrieben war. Ich hätte gern gewusst, was da eigentlich draufstand, aber wenn ich mit meiner Mutter unterwegs war, musste ich mich immer ihrem Tempo anpassen. Und wenn ich allein war, kam es mir zu blöd und unhöflich vor, stehen zu bleiben und zu lesen.
Die Freaks waren in diesem Sommer einfach von einem Tag zum anderen aufgetaucht. Offenbar hausten sie in der alten Tankstelle. Meine Mutter rief im Bezirksamt an, um rauszukriegen, wann man die Ruine endlich abreißen und auf dem Grundstück etwas Vernünftiges bauen würde, aber sie wurde nur ständig von einem zum anderen und dann zum Nächsten verbunden, bis sie so entnervt war, dass sie auflegte. «Ich werde darüber schreiben», drohte sie. Aber das tat sie dann natürlich doch nicht.
Es war sonnig und warm – was für ein Glück! Ich kann Regen nicht leiden, nicht bloß, weil er ungemütlich und nass ist. Vor allem kann ich ihn nicht leiden, weil mein Haar sich dann noch mehr kräuselt. Es war so schon kraus genug! Aus dem Grund trug ich es auch immer zu einem Zopf geflochten.
Wenn ich groß bin, werde ich irgendwohin ziehen, wo es das ganze Jahr über schön ist. Vielleicht kommen ja Uncle Bruce und Aunt Debbie bei einem tragischen Autounfall ums Leben, und ich erbe dann ihren Bungalow in den Florida Keys. «Also, Nelly!», empörte sich meine Mutter erst, als ich das einmal laut ausmalte. Doch dann stellte sie für den Fall der Fälle klar, dass ich da überhaupt keine Ansprüche hätte. «Erst mal erbe ich», sagte sie. «Aber wenn du dein Zimmer in Ordnung bringst», räumte sie großzügig ein, «darfst du mich auch mal besuchen.» Ab und zu ist sie tatsächlich ganz witzig.
Der 110er Bus kam. Weil er unten voll war, stieg ich die Treppe zum Oberdeck hoch, wo immer die Kids von meiner Schule sitzen. Ich gehe auf die Mark-Twain-Schule, eine öffentliche zweisprachige Schule, halb deutsch, halb amerikanisch. Unter den Schülern gibt es eine Reihe Promisprösslinge und Kinder von Botschaftsangehörigen, aber die meisten sind ganz normale Deutsche und Amerikaner, die das Glück haben, zweisprachig aufzuwachsen.
Kaum stand ich oben, ruckelte der Bus los, und ich verlor fast das Gleichgewicht. Ich hörte Lachen – bestimmt über mich. Und ich meinte auch, dass jemand «Nerd!» rief. Vielleicht bildete ich mir das auch bloß ein. Wenn man ein Außenseiter wie ich ist, spielt die Phantasie manchmal verrückt. Ich lächelte Philine Lehnert zu, die ich schon seit vor der Grundschule kenne, aber sie tat, als bemerke sie mich nicht. Im Kindergarten waren wir Eistanzpartnerinnen gewesen. Das schien Jahrhunderte her zu sein.
Ich ließ mich auf den ersten freien Platz fallen, schräg gegenüber von zwei älteren Schülern, Bernd Ruppel und Ulla Opitz. Aber hallo, waren die zugange! Und auch noch vor aller Augen. Ullas Blazer war offen. Und bei genauerem Hinsehen konnte ich erkennen, dass auch ihre Bluse aufgeknöpft war. Bernds Hände waren überall. Sie verschwanden hinter ihr. Dann waren sie wieder vorne. Ullas Hände, das sah ich genau, glitten Bernds Rücken hinauf und hinab und zogen ihn dichter an sie. Die beiden wiegten sich auch irgendwie so vor und zurück. Und küssten sich. Mit Zunge. Ich weiß noch, wie ich da saß und mir überlegte, ob es schwer war, all diese Bewegungen zu koordinieren, und wie man das lernte. Oder kam das ganz natürlich? Das war wohl anzunehmen, aber trotzdem sah es ziemlich kompliziert aus. Ich meine, sie machten einfach so viel gleichzeitig.
Die Sache ging mir nicht mehr aus dem Kopf.
Verstohlen sah ich mich im Bus um und landete bei Michael Happe. Wie wäre es, ihn leidenschaftlich zu küssen? Als wir bei Fiona Lightfoots Abschiedsparty im Juni Flaschendrehen spielten, haben wir uns geküsst. Aber es war kein wirklich besonderes Erlebnis, bloß ein flüchtiger Kuss auf die Lippen. Und salzig von dem Popcorn, das wir gegessen hatten. Mit anderen Worten: Es war enttäuschend.
Michael drehte sich zu mir, als hätte er meine Gedanken gelesen. Er lächelte, und seine neue Zahnspange funkelte im Licht. Hmm. Eine Zahnspange war für jemanden wie mich einfach eine Überforderung. Eine unerfahrene Küsserin würde sich mit der Zunge vielleicht in den Metallhaken verheddern oder sonst was. Nö, Michael Happe war nicht der Richtige – wenigstens noch nicht.
Und Uwe Franke, der vor Michael saß? Ich machte die Augen zu und versuchte mir vorzustellen, wie unsere Lippen sich berührten, aber es ging einfach nicht. Wie sollte ich jemanden küssen, der den ganzen Tag Schwerter, Beile, Kampfflugzeuge und abgesprengte Gliedmaßen vor sich hin kritzelte?
Danny Diller aus Los Angeles, dessen Mutter Sängerin an der Deutschen Oper war, machte ein paar Reihen links vor mir rosa Kaugummiblasen. Danny war letztes Jahr in der Schulaufführung von Thornton Wilders Unsere kleine Stadt ein ganz toller George gewesen. Als er niederkniete, um seiner jungen Frau Emily Lebewohl zu sagen, während ihr Sarg in die Erde hinabgelassen wurde, musste ich richtig weinen. So gut war er. Meine Mutter, Hobbypsychologin Dr. Lucy, hatte aber gleich wieder nichts anderes zu sagen, als dass Dannys Vater vor ein paar Jahren an Prostatakrebs gestorben war und dass er vermutlich seine eigenen Verlustgefühle in die Figur des George projizierte. Typisch meine Mutter! Immer musste sie mir alles verderben. Dabei war Danny einfach super auf der Bühne. Und bestimmt auch ein guter Küsser.
Ich fragte mich, wie es wäre, ihn zu küssen, leidenschaftlich zu küssen? Würden seine Lippen weich sein? Feucht? Warm? Alles zugleich? Weder noch? Vielleicht salzig? Oder süß von seinem Kaugummi? Und seine Zunge? Was würde er mit seiner Zunge anstellen? Bestimmt würde er sie mir in den Mund gleiten lassen und darin herumfahren, bis er meine Zunge gefunden hätte. Die Zungen würden miteinander herumspielen. Aber was, wenn er sein Kaugummi im Mund hätte? Was, wenn er eine Blase zwischen unseren Mündern produzierte und sie immer größer werden ließe? Was, wenn ich dann nicht loskam, weil er mich zu fest hielt? Vielleicht bekäme ich keine Luft mehr. Die Blase würde immer größer. So groß wie ein Fußball, und dann … paff!, würde sie direkt vor mir platzen, mitten in meinem Gesicht. Rosa, schleimiger, zuckriger Glibber, der mir im Haar kleben, die Wangen hinablaufen, in die Nasenlöcher dringen würde.
Plötzlich trat der Busfahrer hart auf die Bremse, ich schnappte nach Luft und erwachte aus meinem Tagtraum. Wie erleichternd, dass der ganze rosa Blubber nur ein Produkt meiner viel zu lebhaften Phantasie war. Verstohlen vergewisserte ich mich, ob jemand mein Schnaufen bemerkt hatte. Offenbar nicht. Mein Blick fiel auf Bernd und Ulla, die immer noch im Clinch waren. Bernd bekam mit, wie ich ihn anstarrte. «Verpiss dich!», sagte er.
«Was gibt’s da zu glotzen?», zischte Ulla mir zu.
Als ich den Blick auf mein Buch senkte, hörte ich jemanden sagen: «Hey, Nelly, machst du dir Notizen über Ulla? Für dein nächstes Forschungsprojekt?»
Es war Yvonne Priscilla Cohen. Mit ihren beiden deutschen Komplizinnen, Nicole Kindler und Caroline Ludwig, saß sie zwei Reihen schräg hinter mir auf der linken Busseite. Meine Todfeindinnen. Obwohl sie ein Jahr älter waren als ich, gingen wir alle zusammen in dieselbe Klasse, die achte.
Yvonnes Vater war stellvertretender Kulturattaché an der amerikanischen Botschaft. Bei ihrem Getue aber hätte man glauben können, er wäre Präsident der gesamten Vereinigten Staaten. Meiner Meinung nach hatte sie nicht mehr zu bieten als große Brüste, ein kleines Hirn und eine MCM-Handtasche. Vor Fionas Rückreise nach Amerika gelobten wir feierlich, uns nie im Leben mit einem dieser drei Dinge erwischen zu lassen.
«Na, was liest du denn, Nelly?», fragte Yvonne. Ihrem zuckersüßen Singsang hörte ich an, dass sie mich nur aufziehen wollte. Nicole und Caroline kicherten.
«Eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking. Kennt ihr das?», sagte ich.
Natürlich kannten sie es nicht. Sie starrten mich bloß an. Dann fing Yvonne an zu kichern und schüttelte den Kopf. Ihr Haar schwang hin und her, als würde es von einer leichten Brise liebkost. Sie hatte sehr glattes, glänzendes, volles blondes Haar, das perfekt auf eine einheitliche Länge geschnitten war, ein wunderbarer Schleier, wie bei einer blonden Porzellanpuppe. Nicht ein Härchen lag falsch. Es war Furcht einflößend.
«Hawking ist ein genialer Physiker», erklärte ich. «Er erklärt den Ursprung und das Wesen des Universums auf ganz leicht verständliche Weise. Eine leise Ahnung von der Komplexität unseres Weltalls erhalten so selbst die beschränktesten Leser. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen.» Mit einem Lächeln vertiefte ich mich in das Buch.
Auch ohne hinzusehen, wusste ich, dass Yvonne und ihre Freundinnen unschlüssig waren, ob ich mich über sie lustig machte oder nicht. (Ratet!) Dann sagte Yvonne: «Nelly ist wirklich seltsam. Richtig sonderbar.» Die Worte taten mir irgendwie weh, aber sie waren die letzten, die ich vorerst hörte. Denn wenn ich lese, lese ich. Für alles andere ist dann kein Platz in meinem Gehirn. Ein Glück!
Ein paar Minuten später drang erneut Gelächter in mein Bewusstsein. Es waren Yvonne und ihre Freundinnen. Sie zeigten durch das Fenster auf Pia Pankewitz, die rannte, um den Bus noch zu erreichen. Obwohl ich nicht gelacht habe, muss ich zugeben, dass es komisch aussah. Pia ist ein bisschen pummelig, und wenn sie rennt, fliegen ihre molligen Arme und Beine in alle Richtungen.
Pia kletterte in den Bus und tauchte wenig später auf dem Oberdeck auf. Außer Atem schnaufte sie langsam durch den Gang und blickte suchend durch die Reihen. Bei meinem Anblick hellte sich ihr Gesicht auf. O nein! Warum hatte ich nicht die Nase stur ins Buch gesteckt? Wenn ich eine Null war, war Pia minus zwanzig. Als das Hirn ausgeteilt wurde, steckte man in ihren Kopf statt kleiner grauer Zellen Zuckerwatte. Und was für ein Plappermaul sie war! Den ganzen Tag nur laber, laber, laber.
Ich beschloss, zu lesen und so zu tun, als hätte ich sie nicht gesehen.
Aber natürlich setzte Pia sich neben mich. Nur kein Gespräch anfangen! Ich las einfach weiter, und das schien sie zu akzeptieren.
Ich vergaß Pia völlig.
Aber dann, ein paar Straßen weiter, hörte ich eine Stimme. Ihre.
«Wen findest du süßer?», sagte sie.
«Wie bitte?»
«Wer ist süßer: Anton Weißenberger oder William?»
«Süßer?»
«Ja», sagte Pia. «Das Gegenteil von sauer! Also, wer sieht besser aus: Anton oder William?»
«William? Welcher William?»
«Welcher William?»