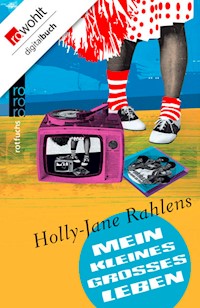
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
NEW YORK CITY ANFANG DER 60ER JAHRE Susie B. Scheinwalds Teenagerleben dreht sich um Pop, Petticoats und Pompons, Bienkorbfrisuren, beste Freundinnen und natürlich um Boys, Boys, Boys! Susie hat ein Ziel im Leben: Trotz ihrer unsäglich peinlichen orthopädischen Schuhe will sie in die Cheerleader-Mannschaft aufgenommen werden und sich so ein Date mit dem begehrtesten Jungen der Schule, dem Basketballkapitän Mark «Lover Boy» Lieberman, sichern. Aber die Realität macht keinen Halt vor Susies kleinem Leben. Der Streit der Eltern, eine mögliche Pfändungsklage und die wirklich großen Weltereignisse der Zeit nehmen einen immer bedrohlicheren Raum ein. Und wieso taucht Fat-Face-Frankie Spolansky plötzlich überall auf? Am Tag von Susies erstem Date mit Mark kommt alles ganz anders ... Ein komischer, tiefsinniger Roman und eine wunderbare Lovestory von Jugendliteraturpreisträgerin Holly-Jane Rahlens. Nur für Teenager unter 88 Jahren!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Holly-Jane Rahlens
Mein kleines großes Leben
This one’s for my sister Maureen
And all our friends from our teens
Anmerkung der Autorin
Früher war ich Journalistin. Aber irgendwann hat mich die Wahrheit nicht mehr so sehr interessiert. Die Wahrheit ist eine ganz brauchbare Sache für Zeitungen und bei Gerichtsverhandlungen oder wenn du den Verdacht hast, dass dein Freund dich gerade betrügt. Doch für mein Leben als Autorin spielt sie eine immer kleinere Rolle. Ich klebe einfach nicht mehr so dran. Vielmehr fasziniert mich das, was hätte passieren können oder hätte passieren sollen. Wie habe ich etwas empfunden? Das ist für mich das Interessanteste, nicht so sehr, was wirklich passiert ist.
Kein Wunder, dass ich mir damit auch eine Menge Ärger einhandele. «So was nennst du Memoiren?», empört sich beispielsweise meine Schwester Wendy. Das ist nicht etwa eine Frage. Es ist eine Kriegserklärung. Jeder Satz danach endet mit einem Ausrufezeichen, fühlt sich an wie ein Basketball auf dem Kopf, ein Tritt vors Schienbein, ein Pfeil in meinem Herzen. «Das stimmt doch gar nicht!», protestiert sie. «Ich war nie schlecht in Mathe! Dad hat nie Lexika verkauft! Und du hast nie orthopädische Schuhe getragen!»
Dann runzle ich nachdenklich die Stirn und sage: «Komisch, so habe ich es aber in Erinnerung.»
Ich erwähne das alles, weil ich erzählen möchte, wie ich es empfunden habe, dreizehn zu sein. Ich tue das für Lily, meine Tochter, die heute genauso alt ist wie ich damals. Vielleicht ist es ja lustig für sie, Vergleiche zwischen ihrer und meiner Jugend zu ziehen. Aber ich schreibe die Geschichte auch für Wendy, meine Schwester, selbst wenn sie es für einen Haufen Unsinn hält. Und für mich selber tue ich es auch – klar. Und natürlich für meine besten Freundinnen von damals, Becky, Judy und Elaine, deren Leben geprägt wurde von dieser magischen Zeit. Ich tue es für uns alle, die diese Jahre erlebt haben, die von ihnen berührt wurden, für uns, die wir immer noch «Be My Baby» von den Ronettes auswendig können und den Song überall laut und falsch herauskrähen, ganz gleich, wer uns dabei zuhört.
Aber Vorsicht: Dieses Buch beginnt mit den Worten «Eines schönen Tages…» Als ich es neulich im Internet nachgeprüft habe, musste ich leider feststellen, dass es an dem Tag, an dem meine Geschichte beginnt, in Wirklichkeit kalt, bewölkt und regnerisch war. Ich bekenne mich also schuldig.
Susie B.Scheinwald
San Francisco
August 2008
Kapitel eins
One Fine Day
The Chiffons
Eines schönen Tages, weit zurück in den Sechzigern und weit weg in New York City, zu einer Zeit, als das Fernsehen noch schwarzweiß war und man Pause machte mit Coca-Cola, gehen ich und meine besten Freundinnen Becky Bernstein, Judy O’Reilly und Elaine Silverman unsere von rotgoldenen Bäumen gesäumte Straße hinunter. Es ist ein leuchtender, frischer Herbstnachmittag. Königsblauer Himmel, weiße Schäfchenwolken, hell gleißendes Sonnenlicht.
Nameoke Street ist in Far Rockaway. Wer einen Stadtplan von New York zur Hand hat, kann sehen, dass Far Rockaway so ziemlich am südöstlichsten Zipfel des Stadtteils Queens liegt und somit direkt an der Atlantikküste und an der wichtigsten Grenze der ganzen Welt: nämlich der, die Queens von Long Island trennt, uns von denen, New York City vom Rest des Universums.
Zum Strand geht man von Nameoke Street nur zwölf Minuten und fünfundvierzig Sekunden, obwohl man bei Gegenwind vielleicht ein, zwei Minuten länger braucht. Wenn man hinter unserem Mietshaus an der nordöstlichen Ecke von Cornaga und Mott Avenue vor dem Sugar-Bowl-Süßwarenladen steht und sich sehr anstrengt, dann kann man fast hören, wie sich Flugsaurier auf der Suche nach ihrem Mittagessen in die Gischt stürzen. Oder man kann das leise Klagen von gestrandeten Polarwalen ausmachen, die draußen vor der Küste herumdümpeln auf ihrem Weg in den Golf von Mexiko oder nach Labrador, oder wo immer sie hinziehen. Was? Man hat noch nie Polarwale vor New York City gesichtet? Wo kommen denn wohl sonst diese Klagelaute her?
Und dann: Wusch! Krach! Bumm! Hilfe! Irgendetwas rollt auf uns zu, vielleicht ein Tsunami, 30Meter hoch – mindestens!–, der die Atlantic Beach Bridge niederreißt und die Straßen mit Wasser und Schaum überflutet. Ich sehe die Verwüstungen schon vor mir, wie die Häuser entlang des Seagirt Boulevard von der Flut hinausgeschwemmt werden. Es sieht aus wie auf den Fotos in dem alten, zerlesenen National-Geographic-Heft, das im Wartezimmer meines Zahnarztes liegt. O nein, mein Zahnarzt! Ich will gar nicht an ihn denken: an Dr. med. dent. Elmer Mermelstein, den Unerbittlichen.
Geht man allerdings 77Schritte in südwestlicher Richtung, steht man vor Sid and Sam’s, dem anderen Süßwarenladen unseres Viertels. Wenn man tief einatmet, ätzt einem die salzige Luft fast die Nase weg – aber zuvor kann man vielleicht noch den Geruch der Strandpromenade aufschnappen, den eine Brise vom Meer heranträgt. Man riecht den Teer und das Pech, mit denen die Holzplanken der Promenade behandelt werden, die fettigen kasha knishes und die süße Zuckerwatte, die an den Ständen verkauft werden, den Seetang, der unter den Holzstegen verfault, und – bäh! – die vergammelten, klebrigen Innereien einer Qualle, die ans Ufer gespült wurde.
Aber Becky, Judy, Elaine und ich sind an diesem strahlenden Samstagnachmittag nicht auf dem Weg zum Meer. Wir haben beschlossen, uns im kleinen Park an der nächsten Straßenecke zu vergnügen. Ich verputze gerade noch die Reste eines gebutterten Mohnbagels, während Judy mit einer Vanille-Eistüte beschäftigt ist. Becky sucht den Sender WMCA auf ihrem kleinen pinkfarbenen Transistorradio, hinter uns übt Elaine mal wieder, auf vier Fingern zu pfeifen – eine Kunst, an deren Perfektionierung sie schon seit längerem arbeitet. Die grantige Mrs.Crumpet, Judys Vermieterin, schlurft in ihren klobigen knöchelhohen Oma-Schnürschuhen vorbei und zieht ihren quietschenden Einkaufswagen hinter sich her. Sie starrt Becky pikiert an. Kein Wunder.
Seit Wochen perfektioniert Becky ihren Bad-Girl-Look. Wer nicht weiß, dass sie eine dreizehnjährige Schülerin der Junior High School im hintersten Winkel von Queens ist, könnte schwören, sie sei die Sängerin Ronnie Spector von den Ronettes.
Becky balanciert eine dunkelbraune Bienenkorbfrisur auf ihrem Kopf, die so steif ist vor lauter Haarspray und so massiv, dass ihr Gesicht nur dazu zu dienen scheint, die Frisur zu stützen. Dabei ist dieses Gesicht schon für sich genommen etwas Besonderes. Es ist mit einer dicken Schicht Grundierung überzogen, die Becky im Schminktisch ihrer Mutter gefunden hat, und darunter wurden ihre Pickel noch mit Clearasil-Klecksen verdeckt. Mit der Kunstfertigkeit eines Rembrandt hat sie Lidschatten unter den Augenbrauen in verschiedenen Braun- und Beigetönen aufgetragen. Dazu Lidstrich (geklaut bei Woolworth) im Kleopatrastil: Ihre Augen sind oben und unten umrandet, wobei sich die beiden Linien an einem Punkt auf halbem Weg zu ihren Ohren treffen. Auf diese Weise wirkt sie großäugig und wachsam. Im Gegensatz dazu geben die Lippen, die mit weißem Lippenstift bemalt sind, ihr ein kränkliches, geisterhaftes Aussehen. An den Füßen trägt sie Turnschuhe im Leopardenlook und über den Schultern eine schwarze Lederjacke, die sie bei Morton’s Army & Navy auf der Central Avenue aufgetrieben hat. Unter ihrem schwarzen Rollkragenpulli trägt sie einen spitzen, wattierten BH, Größe 70C, um ihren Busen Größe 70A ein bisschen aufzuwerten. Sie sieht ganz schön hart aus. Ordinär. Und sehr erwachsen. Einfach atemberaubend.
Becky streckt der grantigen Mrs.Crumpet die Zunge raus, und empört klappert die alte Frau in ihren Omaschuhen keuchend und schnaufend von dannen. Becky kichert. Sie ist die Verwegenste von uns vieren. Manchmal sogar ein bisschen dreist. Und eine echte Quasselstrippe. Meistens aber ist sie umwerfend komisch. Außerdem ist sie meine direkte Nachbarin. Ihre Wohnung, 5D, und meine Wohnung, 5C, teilen sich eine Feuerleiter. Ihr Wohnzimmer und mein Wohnzimmer teilen sich auch eine Wand. Und die ist ziemlich dünn. Ich weiß zum Beispiel, dass Beckys Mutter Gloria, eine Friseuse, und ihr Vater Murray, der eine Reinigung in Valley Stream betreibt, gerade über ihre Scheidung diskutieren. Wobei das Wort «diskutieren» viel zu harmlos ist für das, was ich durch unsere Lilienmustertapete hindurch gehört habe, während ich neulich Abend meine Lieblingssendung, «Dr.Kildare», schaute. Und Becky weiß natürlich, dass meine Mutter, Büroleiterin bei Daisy Dee Dresses, Inc., und mein Vater, ein arbeitsloser Autoverkäufer, der momentan gerade zum Vertreter für die Encyclopaedia Britannica umgeschult wird, die Nächsten sind, die das Thema Scheidung diskutieren werden. Als ich unserem Musiklehrer Mr.Patterson letzte Woche erklärte, dass ich meine Geige nicht zur Orchesterprobe mitbringen konnte, weil sie zur Reparatur sei, wusste Becky natürlich, dass mein Vater sie in Wirklichkeit im Pfandhaus versetzt hatte, um unsere Rechnungen zu bezahlen. Außerdem weiß ich, dass ihr Vater sich in Bars herumtreibt, während sie weiß, dass mein Vater auf der Rennbahn rumhängt. Ich weiß, dass ihre Mutter mit den Nerven am Ende ist, und sie weiß, dass meine Mutter ebenfalls mit den Nerven am Ende ist. Wir reden aber nur selten über diese Dinge. Sie gehören einfach dazu wie das Popcorn im Kino.
Während sie noch immer über die grantige Mrs.Crumpet kichert, fummelt Becky am Knopf ihres Transistorradios herum. Sie nimmt es fast überallhin mit. Ihr Bruder Richie, der diesen Herbst angefangen hat, in Buffalo zu studieren, hat es ihr geschenkt. Er fehlt ihr sehr, glaube ich, aber sie spricht nie darüber.
Becky findet den Sender WMCA auf ihrem Radio. Discjockey Cousin Brucie ist auf Sendung. Er teilt uns mit, dass im Stadtgebiet von New York windige 13Grad herrschen und dass als nächster Song «One Fine Day» von den Chiffons gespielt wird. Unser Lieblingslied! Schnell schlucke ich den Rest meines Mohnbagels herunter.
Den Text zu «One Fine Day» kennen wir auswendig, ohne dass wir ihn je auswendig gelernt hätten. Wir haben ihn einfach eines Nachts per Osmose in uns aufgenommen. Becky singt falsch wie immer, aber Judy zuzuhören ist ein Genuss. Sie ist wild entschlossen, später einmal eine berühmte Opernsängerin zu werden. Und wenn in diesem Herbst eines feststeht, dann dass Judy eines Tages ihren Traum wahr machen wird.
Judy O’Reilly ist ein großgewachsenes Mädchen mit langen, glänzend roten Haaren, grünen Augen, einem Mund voller silberner Zahnspangendrähte und einem Herz aus Gold. Sie wohnt in Mrs.Crumpets altem, heruntergekommenem Holzhaus nur ein paar Häuser von uns entfernt. Die O’Reillys leben in der «Eisenbahn-Wohnung» im Souterrain, bei der sich ein Zimmer an das andere reiht wie die Waggons in einem Zug. Dort unten ist es dunkel und feucht, vollgestopft mit ungemachten Betten und Bergen von Wäsche, Dutzenden von Kruzifixen, die an allen möglichen Wänden hängen, und stapelweise dreckigem Geschirr im Spülbecken. Auslegeware schmückt den Fußboden, und darauf verstreut liegen Flickenteppiche und zerschlissene Orientläufer, die die Kälte von unten abhalten und den Klang unserer Schritte dämpfen. Wir gehen auf Zehenspitzen, weil immer irgendeines von Judys Geschwistern (sie ist die Älteste von sieben) oder ihr Vater, der Feuerwehrmann, schläft oder ein Nickerchen macht, oder es zumindest versucht.
Judy wirkt auf mich wie ein großer, freundlicher Mischlingshund. Sie hat die Farben eines Irish Setters und die Statur und das Gesicht eines Bernhardiners. Und so wie Bernhardiner auf Bildern immer ein Schnapsfässchen um den Hals tragen, ist auch Judy allzeit bereit. In ihren Jackentaschen befindet sich ein Reservevorrat von allem, was eine Dreizehnjährige in einer Notsituation benötigen könnte: Kekse, Sicherheitsnadeln, Pflaster, Schokolade, Stifte, Haarspangen und ein Glücksbringer in Form einer Hasenpfote.
Judy ist die Gläubige unter uns. Sie hat großes Vertrauen in ihren katholischen Gott, Oreo-Kekse und in Donna Axum aus Arkansas, die amtierende Miss America – in aufsteigender Rangordnung. Sie bittet Elaine, ihr Vanilleeis zu übernehmen, während sie «One Fine Day» schmettert. Elaine unterbricht ihre Pfeifübungen und greift nach der Eistüte. Judy sieht die Spucke an Elaines Fingern und verzieht das Gesicht. Elaine deutet auf meine Brust. «Darf ich eins von deinen Kleenextüchern haben?»
Ich seufze entnervt, aber nachdem ich mich nach rechts, links, hinten und vorne davon überzeugt habe, dass die Luft rein ist, öffne ich die obersten beiden Knöpfe meiner Bluse und fische ein zerknülltes Papiertaschentuch aus meinem BH, das mir zusammen mit einigen anderen dazu dient, meine Größe AA etwas aufzupolstern. Elaine wickelt das Papiertuch um die Eiswaffel, und ich ordne diskret die Form meines Busens neu – minus ein Papiertaschentuch.
Judy bewegt sich in ihren weißen Ked-Turnschuhen und grünen Kniestrümpfen zum Rhythmus der Musik. Ihre roten Haare fallen ihr wie ein Cape über die Schultern und bilden einen starken Kontrast zur grünen Wolle ihres Seemannspullis. Grün ist eindeutig Judys Lieblingsfarbe.
Wenn Judy tanzt, laufen die Finger ihrer rechten Hand auf unsichtbaren Tasten auf und ab. Sie spielt Akkordeon in der Schulband und lernt zu Hause all ihre Lieblingsstücke aus dem Radio. Ich sehe zu, wie sich ihre linke Hand beim Auseinanderziehen und Zusammendrücken eines imaginären Blasebalgs hin und her bewegt und sie dabei immer im Kreis herumwirbelt, bis sich ihr grün-gelb karierter Rock bis über die Knie hebt.
One fine day
You’ll look at me
And you will know
Our love was meant to be
One fine day
You’re gonna want me for your girl
Elaine summt mit, während sich ihre Zunge erst links-, dann wieder rechtsherum schlängelt und vorsichtig am Eis leckt. Sie ist die Hübscheste von uns vieren, eine Porzellanpuppe mit einem perfekten blonden Pagenschnitt, riesigen blauen Augen, winzigen, perlengleichen Zähnen und einer makellosen Haut, so seidig schimmernd, man kann sich fast darin spiegeln. Einfach vollkommen. Aber sie ist erstaunlich ernsthaft für ein so hübsches Mädchen, oft ängstlich und übervorsichtig. Wenn sie spricht, flüstert sie, wenn sie geht, dann geht sie auf Zehenspitzen. Sie schreibt, wählt eine Telefonnummer, blättert die Seiten in einem Buch um, als trüge sie weiße Spitzenhandschuhe. Aber von Zeit zu Zeit überrascht sie uns, nimmt all ihren Mut zusammen, holt tief Luft und springt über ihren eigenen Schatten. Das lieben wir ganz besonders an ihr.
Elaine hat früher ebenfalls in der Nameoke Street gewohnt, ist aber vor einem Jahr in ein kleines Haus in der Nähe der Beach 9th Street gezogen. Natürlich sind wir Freundinnen geblieben. Sie braucht uns. Wir bieten ihr eine Leichtigkeit, denke ich, die sie zu Hause nicht findet. Sie ist das einzige Kind von Helena und Harry Silverman, einem stillen, zurückhaltenden Ehepaar, das Goldschmuck in der Diamond Exchange an der West 47th Street in Manhattan verkauft.
Und wir brauchen Elaine natürlich auch. Sie sorgt dafür, dass wir nicht zu übermütig werden. Sie ist ein nützliches Angstbarometer, und an ihr merken wir, wann es an der Zeit ist, vorsichtig zu sein.
Etwas Eis tropft herunter und landet auf Elaines schwarzen Lackleder-Spangenschuhen. Sie blickt zu mir auf. «Kann ich noch eins haben?»
«Muss das sein?», sage ich.
«Von der anderen Seite. Dann siehst du wenigstens nicht schief aus.»
Ich fische noch ein Kleenex aus meinem BH, aber diesmal aus dem anderen Körbchen. Elaine wischt ihren Schuh ab, faltet das Papiertuch zusammen und lässt es ordentlich in ihrer Jackentasche verschwinden.
«Elegant-schmellegant», sage ich wie meine Großmutter Esther aus Russland und mache mich ein bisschen über Elaines Samstagsstaat lustig. Sie war morgens schon in der Synagoge und trägt noch immer ein geblümtes Hemdblusenkleid.
«Ganz im Gegensatz zu dir, in der Tat», sagt Becky mit einem Blick auf meine rot-weiß gestreiften Caprihosen. Okay, auf der Hose sind noch die Flecken von der gestrigen Spaghettisauce zu sehen, meine rote Jacke hat eine ausgerissene Tasche, und unter meinem linken Arm ist eine Naht offen. Meine Nägel sind abgekaut, meine Finger voller Tintenflecken, meine Frisur eine Katastrophe. Und wennschon? Schließlich bin ich ja nicht auf dem Weg zu meiner Hochzeit.
«Ich war den ganzen Tag auf Achse», sage ich. «Ich war in der Tanzschule ganz weit Downtown, auf der Lower East Side. Das ist eine ziemlich lange Fahrt. Da wird man schon mal ein bisschen schmutzig.»
«Ich war auch in der Stadt, ganz weit Uptown, auf der West Side. Zur Stimmbildung», bemerkt Judy.
«Und ich war auch in der Stadt, Midtown, in der Schauspielschule», fügt Becky hinzu. «Aber sehe ich deswegen aus wie ein Ferkel?»
«Nein», erwidere ich. «Du siehst aus wie eine Schlampe.»
Judy, Elaine und ich lachen. Becky lacht auch. Sie fasst es als Kompliment auf. Und vielleicht ist es das ja auch.
«Schreib das auf, Scheinwald», sagt Becky. «Schreib es auf.»
Becky sagt mir immer, ich solle irgendwas aufschreiben. Sie weiß, dass ich Tagebuch führe.
«Kommt schon, singt mit!», sagt Judy, schon wieder ganz bei der Sache.
The arms I long for
Will open wide
And you’ll be proud to have me
By your side
One fine day
You’re gonna want me for your girl
Judy ist unsere Lead-Sängerin, Becky und ich geben die Background-Sängerinnen und Tänzerinnen. Wir beherrschen eine Vielzahl von mehr oder weniger aktuellen Tänzen, vom Twist zum Mash Potato über den Limbo zum Watusi. Außerdem sind wir bekannt für unsere preisverdächtigen Darbietungen von Tänzen aus den 40er und 50er Jahren wie dem Lindy Hop, dem Cha-Cha-Cha, dem Tango und sogar Walzer. Der Legende nach soll Beckys Mutter Gloria in ihrer Jugend mal eine semiprofessionelle Tänzerin gewesen sein und sogar den ersten Preis in einem Jitterbug-Wettbewerb gewonnen haben. Sie hat später Becky alles beigebracht. Und Becky mir.
Wir tanzen also. Vor allem aber singen wir. Meine Spezialität sind die Harmonien, die, wie ich finde, unserer Version von «One Fine Day» erst einen volleren Klang verleihen. Elaine versucht die Blechbläser und das Klavier nachzumachen.
Manchmal, wenn wir alberner Stimmung sind, spielen wir mit dem Gedanken, eine Girl Group wie die Shirelles oder die Chiffons zu werden. Wir würden uns die Knockouts nennen, was die Kurzform ist für Nameoke Knockouts. So haben wir uns genannt, nachdem wir vor zwei Jahren, als wir alle noch in der Sechsten waren, wundersamerweise Fat-Face-Frankie Spolansky und Melvin Minsky in genau zehn Sekunden k.o. geschlagen haben.
Eines Tages während der Pause – so geht die Legende – haben Frankie und sein Kumpel Melvin unser Gummitwistband geklaut und sich geweigert, es zurückzugeben. Wie konnten sie es wagen? Wir hatten es mit solch großer Sorgfalt selbst gemacht, hatten Dutzende von Gummibändern an den Enden zusammengeknotet, bis es lang genug war. «Wir überlegen uns gerade, ob wir es nicht in kleine Stückchen zerhacken sollen», hatte Frankie gedroht, «und dann könnten wir es im Restaurant als Chop-Gummi anbieten. – Hm, lecker! Gehackter Gummi. Das reimt sich mit Chop-Suey. Chop-Gummi.»
Fat-Face-Frankie Spolansky war, wie schon sein Spitzname sagt, ziemlich aufs Essen fixiert. Was Wunder? Seine Eltern betrieben etwa zehn Autominuten von uns entfernt in Cedarhurst auf Long Island ein Restaurant, genauer gesagt einen jüdischen Deli. Aber die Tatsache, dass er eines Tages das Spolansky-Corned-Beef-Imperium samt ein paar Dutzend Fässern koscherer Salzgurken erben würde, gab ihm noch lange nicht das Recht, uns zu ärgern.
«Chop-Gummi», wiederholte er.
«Wetten, dass es besser schmeckt als die Chop-Pampe bei deinen Eltern?», sagte ich.
«Pampe?!», tobte Frankie und stürzte sich auf meinen Rücken, packte das Rückenband meines BHs durch meine Bluse hindurch und ließ es zurückschnellen. Autsch! Melvin machte dasselbe bei Becky. Sie wirbelte herum und schubste ihn. Er rutschte aus und schlug sich beim Fallen die Lippe auf. Frankie war einen Tick schneller und rannte davon. Aber ich war zwei Ticks schneller, holte ihn ein, warf ihn auf den Boden und setzte mich auf ihn. Judy drehte ihm den Arm auf den Rücken.
Es bedarf wohl keiner weiteren Erwähnung, dass wir das Gummitwist zurückbekommen haben.
Bekommen haben wir außerdem eine Woche Nachsitzen.
Das war nicht das erste Mal für mich, wobei ich normalerweise nur wegen Schwatzen im Unterricht nachsitzen musste. Mit schlechtem Benehmen betrat ich also Neuland.
«Nameoke Knockouts?», knurrte mich mein Vater an diesem Abend an und gab mir einen Klaps auf den Hintern. «Deine Schwester Wendy hat gesagt, ihr nennt euch jetzt die Nameoke Knockouts. Wo sind wir hier eigentlich? Ist das hier die ‹West Side Story›? Wer, glaubt ihr, wer ihr seid? Eine Straßenbande? Die Sharks? Die Jets?» Und damit donnerte er den Brief des Schuldirektors mit solcher Wucht auf den Tisch, dass der Löffel in der Teetasse meiner Mutter ein perfektes hohes A auf dem Tassenrand anschlug.
«Die haben angefangen!», brachte ich zu meiner Verteidigung vor. «Und ich habe bloß…!» Ich versuchte, mich aus dem Staub zu machen, aber mein Vater packte mich.
«Nameoke Nieten, das passt besser auf euch! Wehe, du schlägst andere Kinder!», sagte er und zielte nochmal mit der Hand auf meinen Hintern.
Das Wort «Heuchler» existiert nicht in Walter Scheinwalds Wortschatz. In dem meiner Mutter dagegen schon. «Hör auf!», rief Marilyn Scheinwald, geborene Schwichtenberg. «Wie kannst du ihr so was vorwerfen, wenn du selbst so unkontrolliert bist? Wie kannst du nur so ein Heuchler sein?»
«Ich habe niemanden geschlagen!», kreischte ich. «Ich habe mich nur auf ihn drauf gesetzt!»
«Seit wann setzen sich Mädchen denn auf Jungen?», sagte meine Mutter.
Wieder hob mein Vater die Hand. Ich duckte mich und stieß dabei gegen den Tisch. Der Löffel schlug nochmal gegen die Teetasse. Diesmal erklang ein hohes G.
«Unrecht lässt sich nicht mit Unrecht vergelten!», sagte meine Mutter zu meinem Vater und fasste damit die Situation mit einem Sprichwort zusammen. Das tat sie gerne. Sprichwörter und Redewendungen gehören mitunter zu ihren Stärken.
Mein Vater ist nicht dumm. Er ist nur cholerisch. Er sah erst meine Mutter an, dann Wendy, die zwei Jahre jünger ist als ich und uns mit großen Augen durch die Tür anstarrte und dann zurück zu mir. Er bleckte die Zähne.
Unter vier Augen nannten Wendy und ich unseren Vater manchmal Tyrannosaurus Walt. Warum wohl?
«Verschwinde», zischte er und ließ mich los.
Ich rannte in mein Zimmer, in meinen Augen brannten Tränen der Wut. Ich war empört. Kochte vor Zorn. Hatte die Nase voll. «Ich hasse dich!», schrie ich meine dumme Tür an und knallte sie zu. Pamm!
Da sind wir nun also an einem leuchtenden, frischen Herbstnachmittag auf dem Weg zum Park am Ende unseres Blocks. Becky und ich singen Arm in Arm, Kopf an Kopf. Ich kann ihr Haarspray riechen. Es ist überwältigend. Überwältigend ekelig – fast so ekelig wie die Zigarren meines Vaters. Trotzdem versuche ich zu lächeln. Wenn Becky mit zweitem Namen «die Verwegene» heißt, Judy «die Gläubige» und Elaine «die Vorsichtige», dann heiße ich «die Strahlende». Auf alten Fotos aus dieser Zeit habe ich weit aufgerissene Augen, und mein Mund steht vor Staunen offen, als würde ich ständig «Oh!» jubeln. «Oh, ist das Leben nicht wunderbar?!»
Ich wippe im Takt der Musik vor mich hin, ich, die Strahlende, Little Miss Sunshine, die ewig Optimistische. Bei genauerer Nachfrage würde ich allerdings zugeben, dass mein Leben nicht immer «ein Zuckerschlecken» ist, wie meine Mutter es sagen würde. Aber ich glaube fest daran, dass es mir hilft, vertrauensvoll nach vorn zu schauen und der Welt ein glückliches Gesicht zu zeigen – wenn ich dabei nur nicht dieses widerliche Haarspray riechen müsste. Gleich muss ich mich übergeben. Ich drehe mich von Becky weg und lehne mich an Elaine, die gerade die Blechbläser gibt. Ich habe auch schon über eine Bienenkorbfrisur nachgedacht, über die etwas weniger extravagante «Bubble», aber wenn man dazu auch so viel Haarspray braucht, kann ich es gleich vergessen.
Zurzeit trage ich mein krauses dunkles Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, weil ich nicht weiß, was ich sonst damit anstellen soll. Es wird mir schon was einfallen. Hoffe ich jedenfalls. Vielleicht gewöhne ich mich ja dran, mit selbstgebastelten Lockenwicklern aus leeren Orangensaftdosen zu schlafen. Das würde meine Haare vielleicht glätten, auch wenn ich dafür vermutlich meinen Schlaf opfern müsste – wer schön sein will, muss leiden. Ich war mal ein hübsches Kind, aber jetzt spielen meine Haare verrückt, meine Hüften wachsen schneller als mein Busen, auf meiner Stirn sprießen Pickel, und meine Nase wird reichlich knubbelig für meinen Geschmack.
«Das liegt in der Familie», sagt Grandma Esther mit ihrem jiddisch-russischen Akzent. Sie nimmt einen Zug von ihrer Pall Mall. Sie hat Haare auf der Oberlippe, und ihre Finger sind gelb vom Nikotin. «Du hast eine schöne Nase. Prächtig.»
Ich wünschte, ich könnte ihr glauben.
Sie zieht wieder an ihrer Zigarette und nimmt mein Gesicht noch mal genauer in Augenschein. «An dir sieht diese Nase gut aus! Glaub deiner alten bubbe. Und überhaupt, was ist falsch daran, eine Nase zu haben, die man auch richtig sehen kann, frage ich dich?»
Ich verdrehe die Augen.
«Schau, bubele, gefällt dir deine Nase nicht? Soll dein Vater dir eine neue kaufen, wenn du sechzehn wirst? Dann frag den Geizkragen doch.»
Ein großer Fan ihres Schwiegersohns Walter Scheinwald ist Grandma Esther ganz offensichtlich nicht.
Aber im Moment, während ich mit Becky, Judy und Elaine zum Park ziehe, denke ich weder an Nasenoperationen noch an Grandma Esthers haarige Oberlippe. Ich konzentriere mich voll und ganz auf die letzte Strophe von dem Chiffons-Song «One Fine Day».
Wir wippen im Takt der Musik, wirbeln dabei das Herbstlaub auf, Judy mit ihren weißen Ked-Sportschuhen, Becky in ihren leopardengemusterten Sneakers, Elaine in ihren schwarzen Lackleder-Spangenschuhen und ich in meinen – o Gott, was sind das nur für schreckliche Gestelle an meinen Füßen? Ich trage die hässlichsten, schrecklichsten, klobigsten olivgrünen orthopädischen Schuhe, die sich eine modebewusste Dreizehnjährige nur vorstellen kann. Obwohl ich einen schnellen und sicheren Gang habe, ist nämlich nicht zu übersehen, dass ich über den großen Onkel gehe. Über-den-großen-Onkel. Diese Worte lassen mich bis heute schaudern. Na ja, vielleicht übertreibe ich da ein wenig. Wenn man mit den Zehen nach innen gerichtet geht, ist das sicherlich nicht das Schlimmste, was einem Kind widerfahren kann. Schließlich bin ich nicht blind wie Ray Charles oder taub wie Beethoven oder beides wie Helen Keller. Ich hatte den Film über Helens Kindheit gesehen. Zweimal sogar. Einmal im Kino in Brooklyn, wo mein Onkel David abends als Vorführer arbeitet, und einmal mit Elaine, Judy und Becky im Strand-Kino an der Central Avenue. Ich habe jedes Mal geweint, wenn Helen Kellers Lehrerin, Anne Sullivan, Helens Hand unter die Wasserpumpe hält. In dem Moment begreift Helen endlich die Bedeutung von Sprache und versucht das Wort «Wasser» auszusprechen. Wie schwer das für sie ist! Becky, die Schauspielerin unter uns, konnte es tagelang nicht lassen und imitierte immer wieder Helens beschwerliche Versuche, ein Wort zu bilden. «Wa», rief sie urplötzlich aus und verzog den Mund zu den seltsamsten Grimassen. Sie tat, als hielte sie die Hand unter eine imaginäre Pumpe. «Waa. Waaa.» Wenn es draußen regnete: «Wa Waa Waaa.» Wenn sie die Klospülung betätigte: «Wa Waa Waaa Waaaa.» Echt komisch!
Über den großen Onkel zu gehen ist natürlich nichts dagegen. Aber trotzdem. Wer lässt sich schon gerne von einem Fußspezialisten Beinschienen androhen, falls man nicht gerade läuft? Oder von ihm verordnen, täglich fünfzehn Minuten lang einen Tischtennisball mit den Zehen aufzuheben und samstags 120Minuten lang Unterricht in Modern Dance zu nehmen, um das Fußgewölbe zu stärken, während man sich am liebsten aufs Bett legen und die neueste Ausgabe der Young-Love-Comic-Romanze lesen möchte? Oder dass man praktisch jede Minute des Tages olivgrüne orthopädische Schuhe tragen muss, selbst zum bevorstehenden Winterball in unserer Synagoge, wenn alle anderen Mädchen in schicken Pumps und hohen Absätzen antanzen? Es ist mir schnuppe, dass die orthopädischen Schuhe die Knöchel stützen und die Füße nach außen richten. Wer will schon beim Winterball am Tanzwettbewerb teilnehmen und dabei Ziegelsteine an den Füßen tragen?
Aber jetzt pflüge ich durch ein herrliches Meer von rotgoldenen Blättern, und mein Herz ist so leicht wie ein großer Luftballon, der im Rockaway-Wind auf und nieder hüpft. Ich bin verliebt. Zum allerersten Mal. Verliebt in Mark Lieberman, in den großen, schlaksigen, braunäugigen, leichtfüßigen, charmanten Mark «Lover Boy» Lieberman, den Kapitän unserer erstklassigen Schulbasketballmannschaft.
Es gibt nur ein Problem: Leider ist auch Becky in Mark Lieberman verliebt.
Als ich letztes Jahr in die Siebte kam, wurde Mark Teil meines neuen Junior-High-School-Lebens, genau wie all die anderen Dinge: Orchesterprobe, Französisch lernen, Minuspunkte, wenn ich im Unterricht zu viel gequasselt hatte. Eines Tages tauchte er plötzlich in voller Schönheit in den heiligen Hallen der Cardozo Junior High School auf und eroberte mein Herz. Lange habe ich ihn von ferne bewundert, hätte nie geglaubt, dass er sich für jemanden wie mich interessieren könnte… bis zu jenem schicksalhaften Donnerstag vor genau zwei Wochen, einem Tag und zwanzig Stunden. Meine Schwester Wendy und ich waren im Village Clothier auf der Central Avenue. Wir hatten soeben einen Schlips mit Paisleymuster als Geburtstagsgeschenk für unseren Vater ausgesucht und gingen damit zur Kasse. Und da stand er plötzlich, Mark Lieberman, vor einem Regal und legte Pullover zusammen. «Hi», sagte er, «wie geht’s?»
Ich war völlig überrascht. Er wusste, wer ich war! Er erkannte mich!
«Hübscher Schlips», sagte er und betrachtete unser Geschenk.
Ich versuchte etwas zu sagen, aber aus meinem Mund kam kein Ton – so verdattert war ich.
«Für unseren Vater. Zum Geburtstag», sagte Wendy und schüttelte ihre dicken blonden Locken.
«Mein Onkel kassiert», sagte Mark. Er nahm den Schlips, und unsere Finger streiften aneinander. Ich konnte bei der Berührung fast die Funken sprühen sehen. Dann ging er mit uns zur Kasse hinüber und reichte den Schlips an Mr.Spellman weiter. «Geschenkverpackung», sagte er zu seinem Onkel und ging dann wieder zurück zu seinem Regal. «Wir sehen uns in der Schule», rief er mir noch zu.
Ich hatte ihn also vor Becky entdeckt und hatte somit eigentlich ein Vorkaufsrecht auf ihn – auch wenn ich meine Gefühle für mich behielt. Ich weiß nicht, warum ich Becky, Judy und Elaine nie erzählt habe, wie sehr er mir gefiel. Ich vermute, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass irgendjemand einen Trampel mit orthopädischen Schuhen zur Freundin haben wollte. Aber ich erwähnte die Begegnung – allerdings ohne das Herzklopfen–, und prompt ging auch Becky zu Village Clothier, um Mark selbst zu sehen. Als sie zurückkam, war sie ebenfalls in ihn verknallt.
In Beckys pinkfarbenem Transistorradio hat soeben Skeeter Davis aufgehört «End of the World» zu singen.
«Was glaubt ihr? Ist Mark im Park? Ja oder nein?», überlegt Becky laut.
Mark. Schon beim Klang seines Namens möchte ich «One Fine Day» gleich nochmal singen. Der Gedanke, dass er vielleicht nur ein paar Schritte entfernt auf dem Sportplatz ist, gibt mir ein ganz warmes, flatteriges Gefühl im Bauch – wie damals, als ich Grandma Esthers elektrische Heizdecke ausprobiert habe.
Im Radio kündigt DJ Cousin Brucie die singende Nonne mit dem seltsamen neuen Song «Dominique» an.
«Also?», fragt Becky etwas ungeduldig. «Was meint ihr, ist Mark da, ja oder nein?»
Elaine zuckt die Schultern. «Vielleicht arbeitet…», setzt sie an, aber dann erstirbt ihre Stimme. Typisch Elaine. Bis sie einen Gedanken von Anfang bis Ende gedacht hat, könnte die Jurazeit in die Kreidezeit übergehen. «Vielleicht arbeitet er… auch im Laden», fährt sie schließlich fort. «Samstags ist im Laden immer viel los.»
Ich gehe weiter, die Augen fest auf einen Punkt in der Ferne gerichtet, heuchle Desinteresse und hoffe, dass Becky mein Herz nicht hört, das immer lauter klopft wie eine Bombe kurz vor der Explosion.
«Und was meinst du, O’Reilly?», fragt Becky. «Ist Mark da?»
«Keine Ahnung», sagt Judy.
«Aber am Wochenende ist er meistens da!», beharrt Becky.
«Na also, dann wird er auch da sein», bemerkt Judy beschwichtigend.
Elaine gibt Judy die Überreste von ihrem Eis zurück, das inzwischen nur noch eine Mini-Waffeltüte ist, bei der unten durch ein aufgeweichtes Loch Vanilleeis tropft. Das Papiertuch ist feucht und klebrig und taugt nicht mehr als BH-Ausstopfmaterial.
Becky stellt ihr Radio aus. Sie weiß, dass keine von uns die singende Nonne mag. Nicht einmal die gläubige Judy.
«Er war heute Morgen nicht in der Synagoge», bemerkt Elaine.
«Wer? Mark?», fragt Becky.
Elaine nickt.
«Außer dir geht sowieso kein Mensch in die Synagoge», bemerkt Becky.
«Na und?», verteidigt sich Elaine mit einem Anflug von Trotz. «Ich muss eben. Meine Eltern wollen das so.»
Wir schweigen alle und sinnieren über elterliche Zwänge nach. Selbst Becky verschwendet einen Gedanken daran.
«Außerdem sagt Rabbi Breslaw, dass ich gehen muss», fügt Elaine noch hinzu. «Für meine bat mizwa.»
Die arme Elaine. Sie ist die Einzige von uns, die sich auf eine bat mizwa im Dezember vorbereitet. «Findet ihr nicht auch, dass er einfach eine hinreißende Nase hat?», fragt Becky.
Elaine sieht sie verständnislos an. «Rabbi Breslaw?»
«Mark Lieberman!», sagt Becky und verdreht ihre Kleopatraaugen. «Hörst du eigentlich zu?»
«Das würde ich, wenn du unseren Ohren mal eine Sekunde lang eine Pause gönnen würdest», sagt Elaine ganz ohne jeden Sarkasmus. Sie braucht wirklich eine Pause von Beckys Dauerthema Mark. Wie wir alle. Gott sei Dank sind wir jetzt schon fast am Park. Wir können sogar schon Stimmen, Rufe, Lachen hören. Ein Kind weint. Es hört sich an wie Samantha Rosetti, besser bekannt als Sammy die Rotznase, bei der ich manchmal samstagabends babysitte. Ich würde ihr Geheul überall erkennen. Der Eismann hat seinen Wagen am Parkeingang geparkt und bimmelt mit seiner Glocke. Ich höre, wie ein Basketball auf den Boden prallt. Dribbelt Mark? Mein Herz schlägt im Rhythmus mit dem hüpfenden Basketball. Es ist lauter als meine Schritte.
«O Gott, habe ich euch erzählt, dass Mark Lieberman am Freitag in der Cafeteria ‹Hallo› zu mir gesagt hat und dass ich deswegen fast meine Erbsensuppe verschüttet hätte?», fängt Becky wieder an, fischt ihren weißen Lippenstift aus der Hosentasche und trägt ihn auf.
«Das hast du uns schon mindestens hundertmal erzählt!», sagt Judy, mittlerweile auch von Becky genervt. Sie ist ein gutmütiger Mensch, aber Beckys Energie scheint heute selbst ihr zu viel zu sein.
«Oh, ich bitte um Verzeihung», sagt Becky leicht pikiert zu Judy. «Vergib mir, o Herr, ich habe gesündigt.» Sie verdreht die Augen und zieht eine große blau-weiß-rote Packung mit Bazooka-Kaugummi hervor. «Hier, nehmt euch ein Stück», sagt sie zu uns, aber sie reicht die Packung zuerst Judy, um ihr zu zeigen, dass sie ihr nichts krummgenommen hat.
Wir reißen uns alle ein Stück Kaugummi ab.
Judy zieht ihre grünen Kniestrümpfe hoch. Sie sind ihr um die Knöchel gerutscht. Dann streicht sie ihren Rock glatt.
Durch den Gitterzaun kann ich jetzt die schemenhaften Umrisse von Jungen sehen, die über das Basketballfeld rennen. Ich bin so aufgeregt, es ist, als ob mein Herz jeden Augenblick aus meiner Brust herausspringen, davonhüpfen und sich zu den Jungen auf dem Spielfeld gesellen wird.
«Übrigens hast du recht, Becky», sagt Elaine und fährt sich mit den Fingern durch ihre Pagenkopffrisur, «seine Nase ist wirklich toll.»
Becky lächelt sie selbstgefällig an, so als wäre Mark bereits ihr Freund.
Ich fahre mit meiner Zunge über die Zähne, um verräterische Mohnkrümel in den Zwischenräumen aufzuspüren. Dann beiße ich in mein Kaugummi. Der plötzliche Ausbruch von Süße überwältigt mich. Unter meiner offenen Jacke ziehe ich mir die Dr.-Kildare-OP-Bluse über die Hüften. Ich atme tief ein. Dann setze ich ein Lächeln auf. Ein breites, strahlendes Lächeln.
Wir wenden uns nach links. Die Nameoke Knockouts– Becky Bernstein, Judy O’Reilly, Elaine Silverman und Susie B.Scheinwald – schreiten ihrem Teenagerschicksal entgegen und betreten den Park. Unser kleines großes Leben wartet auf uns.
Kapitel zwei
Where the Boys Are
Connie Francis
Mark «Lover Boy» Lieberman ist im Park an jenem leuchtenden Herbstnachmittag und versenkt den Ball wie ein echter Harlem Globetrotter. Er und ein paar seiner Klassenkameraden aus der Neunten, Großmaul Landau und Lenny Domelli, alias Dummelli (ratet mal, warum?), kreisen um den Platz mit den Jungs aus der Achten, Fat-Face-Frankie Spolansky, Melvin Minsky und Jimmy Deutschman. Sie springen hoch in die Luft, prallen zusammen und stürzen hinter dem Ball her wie ein Schwarm spielender Delphine im Coney Island Aquarium.
Mark dribbelt den Platz entlang. Er trägt Jeans, unter seiner grauen Sweatshirtjacke flattert ein blaukariertes Hemd im Wind. Er schwebt geradezu und taucht alles und jeden um sich herum in ein goldenes Licht. Allein sein Anblick lässt mich an Sommer denken, an grelle Hawaii-Hemden und Sonnenmilch, an Nasen, eingecremt mit Zinkoxid. Ich sehe Jungen, die die hohen Wellen reiten, im Schwimmbad mit einem sauberen Köpfer vom Dreimeterbrett ins Wasser springen oder einen Homerun auf dem Baseballfeld laufen.
Mark trifft den Korb und zieht sein Sweatshirt aus – alles in einer einzigen, eleganten Bewegung.
«Welche Koordination», sage ich.
«Welche Eleganz», sagt Judy.
«Welche Anmut», sagt Elaine.
«Welch ein tolles Armband!», sagt Becky.
Marks silbernes Namensarmband glitzert im Sonnenlicht.
«Er sollte es nicht beim Spiel tragen», sagt Elaine. «Er könnte jemanden damit verletzen.»
«Dann soll er’s doch mir geben!», sagt Becky grinsend. «Schließlich geht er mit keiner, sonst würde die ja sein Namensarmband tragen, nicht er.»
Schließlich geht er mit keiner. Mein Magen fühlt sich plötzlich ganz warm an, als ob ich gerade eine Schale mit heißem Grieß hinuntergeschlungen hätte. Offenbar lächle ich, denn Becky kneift ihre dunkelbraunen Kleopatraaugen zusammen: «Hey, Scheinwald. Warum grinst du denn so?»
Ich zucke bloß die Schultern und mache eine Kaugummiblase. Becky dreht die Lautstärke an ihrem Radio auf, wo Connie Francis «Where the Boys Are» kräht. Sie übertönt sogar das Geschrei der kleinen Göre Sammy Rosetti, die in der Sandkiste gerade einen Wutanfall kriegt. Das Radio ist trotzdem nicht laut genug für Becky. Sie gibt noch ein paar Dezibel dazu. Mark dreht sich um, sieht uns, nickt kurz und kehrt dann zu seinem Spiel zurück.
«Omeingott!», quietscht Becky. «Habt ihr das gesehen? Er hat mir zugenickt!»
Judy lacht. «Wenn ihr mich fragt, hat Mark eher deinem Radio zugenickt.»
Aber Becky hört gar nicht hin. Mit verliebten Augen sieht sie zu, wie Mark etwas in Melvins Ohr flüstert. Melvin dreht sich um, betrachtet uns und grinst spöttisch.
«Hat er jetzt mich oder mein Radio angegrinst?», fragt Becky Judy – nicht ohne eine Spur von Sarkasmus.
«Ich glaube, er hat uns angegrinst», sage ich und mache noch eine rosa Kaugummiblase. «Uns alle vier.»
Becky verdreht die Augen.
Melvin ist angezogen, als wolle er auf ein Joan-Baez-Konzert gehen. Er trägt eine braune Cordhose, ein zerknittertes blaues Arbeiterhemd, eine abgewetzte Jeansjacke und braune Lederstiefel mit abgerundeten Kappen wie Bob Dylan auf dem Cover seines Albums «The Freewheelin’ Bob Dylan». Wir sehen, wie Melvin seinem Kumpel Dummelli kräftig auf die Zehen tritt. Der schreit vor Schmerz auf.
«Wie kann er nur in diesen Lederstiefeln Basketball spielen?», bemerke ich.
Dummelli wirft Melvin vom Platz.
«Das war die Antwort auf deine Frage», sagt Becky.
Fat-Face-Frankie dreht sich um und schaut zu uns rüber. Er winkt sogar – der Blödmann. Er ist auch nicht gerade passend angezogen. Mit Ausnahme seiner schwarzweißen All-Star-Basketballschuhe sieht er so aus, als wolle er demnächst für die örtliche Mafia aktiv werden. Es ist ein Wunder, dass er in diesem Aufzug überhaupt Basketball spielen kann. Er trägt ganz enge schwarze Hosen wie Chubby Checker, dazu ein schwarzes Hemd, dessen Zipfel ihm aus der Hose hängen, und eine gewaltige Haartolle. Mit seiner Haartracht könnte er Becky Konkurrenz machen. Während ihr Bienenkorb mittels Haarspray gehalten wird, ist seine Frisur auf einem Fundament aus Pomade aufgebaut. Brylcreem macht’s möglich. Die Schmalzlocke, die ihm wie eine brechende Welle in die Stirn hängt, ist so fettig, dass man darin das perfekte Relief paralleler Kammspuren erkennen kann. Wenn er nicht so ein Knallkopf wäre, könnte er glatt den idealen Freund für Becky abgeben. Er ist viel mehr ihr Typ als Mark.
«Hat Frankie jetzt mir oder meinem Radio zugewinkt?», neckt Becky Judy.
Becky geht mir auch langsam auf die Nerven.
«Er hat Susie zugewinkt», meint Judy. «Ganz eindeutig Susie! Ausrufezeichen.»
Ich bin entsetzt. «Mir? Fat-Face-Frankie hat mir zugewinkt? Hilfe! Ausrufezeichen.»
«Definitiv!», meint Elaine. «Auch mit einem Ausrufezeichen.»
Ich schaue zu Fat-Face-Frankie hinüber. Er ist schon wieder voll ins Spiel verwickelt. Ich hoffe, es bleibt dabei. Mit dem Idioten will ich nichts zu tun haben.
Wir drehen uns um und stolpern dabei fast über einen Posaunenkasten, der hier rumliegt wie ein schlafender Hund. Wir gesellen uns zu ein paar Mädchen aus der Nachbarschaft, die ebenfalls am Basketballfeld herumlungern. Donna Kahn ist da, Cynthia Zucarro und Kathy Churchill. Außerdem sind da noch zwei andere Mädchen aus unserer Schule, die aber nordwestlich von hier in Bayswater wohnen. Es sind eineiige Zwillinge, Carolyn und Doris Meyer. Sie gehören zu einer Clique von Snobs, die sich die Bayswater Babes nennen. Carolyn fragt mich, ob ich auch zum Winterball in der Synagoge gehe. Oder ist es vielleicht Doris? Ich kann die beiden einfach nicht auseinanderhalten. «Ich denke schon», sage ich und hoffe im Stillen, dass ich meine Mutter bis zum Ball davon überzeugen kann, mir hochhackige Schuhe oder wenigstens Pumps zu kaufen. Und ein Kleid brauche ich auch. Meine alte Barbiepuppe ist für einen Ball besser ausgestattet als ich. Ich hätte gerne ein Kleid mit einem weiten Rock, der in der Taille eng ist, und dazu ein auf Figur geschnittenes Oberteil. Vielleicht aus Taft. Oder aus Chiffon. Mit einem gestärkten Unterrock, der beim Tanzen raschelt. Schschsch.
«Hey», sage ich und drehe mich zu Becky. «Willst du beim Tanzwettbewerb auf dem Winterball meine Partnerin sein?»
«Klar», sagt sie, beugt sich dann aber vor und flüstert mir ins Ohr: «Das heißt, falls ich bis dahin nicht mit Mark zusammen bin.» Sie zwinkert mir zu und legt dann einen Finger an die Lippen. «Aber nicht weitersagen.»
Nicht weit von uns reißt Donna Kahn ein Streichholz an. Sie ist bloß ein Jahr älter als wir und raucht in aller Öffentlichkeit! Ganz schön gewagt. Sie reicht die Packung herum. Mit einem Seitenblick sehe ich, dass Mrs.Rosetti uns beobachtet. Ich lehne eine Zigarette ab, und die anderen Nameoke Knockouts folgen meinem Beispiel. Cynthia, Kathy und die Zwillinge zünden sich allerdings eine an.
Donnas Styling













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















