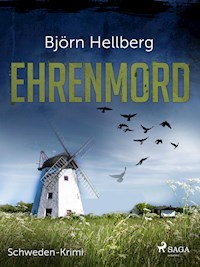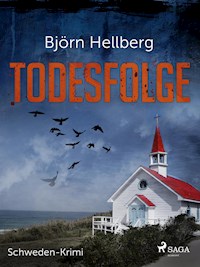Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sten Wall ermittelt
- Sprache: Deutsch
Zwei grausame Leichenfunde erschüttern den Heimatort von Sten Wall: In der Kleinstadt Stad werden zwei unbekannte und brutal zugerichtete nackte Leichen gefunden. Wie kommen die beiden Toten an diesen Ort, und wer kann sie so gehasst haben, sie auf derartige Weise zu ermorden? Als dann auch noch ein anonymer Anrufer die Frauen der Stadt terrorisiert, ist auf einmal von perversen Sexualpraktiken die Rede. Gibt es Zusammenhänge zwischen den Fällen? Kommissar Wall hat keine Zeit zu verlieren. Höchste Spannung und viel Lokalkolorit verspricht die beliebte 23-teilige Krimi-Serie um den sympathischen schwedischen Kriminalkommissar Sten Wall. Die meisten Fälle spielen in der fiktiven Stadt Stad in der südschwedischen Provinz Schonen. Bei SAGA Egmont sind die Bände \"Ehrenmord\", \"Mauerblümchen\", \"Todesfolge\", \"Grabesblüte\" und \"Quotenmord\" erhältlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Björn Hellberg
Mauerblümchen - Schweden-Krimi
Saga
Mauerblümchen - Schweden-Krimi Übersetzt Christel Hildebrandt
Coverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 2004, 2020 Björn Hellberg und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726445060
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
— Erstes Kapitel
Seine Augen schimmerten in diffuser Schwärze direkt über ihr, so nah war er, als er sich fest auf sie presste. Sein Gewicht erschreckte sie. Dann lockerte der Druck sich ein wenig, und sie spürte, wie er sich zwischen ihren Beinen zurechtschob, um eine bequemere Position zu finden.
Im nächsten Augenblick pustete er ihr direkt ins Gesicht. Sein Atem roch nach altem Tabak, roher Leidenschaft und Salzlakritz. Sie erschauderte.
Die Frau spürte, dass sie kurz davor war, das Bewusstsein zu verlieren. Sie zappelte verzweifelt, um sich aus dem immer fester werdenden Griff zu befreien.
Sie bekam kaum noch Luft. Angst bohrte sich in sie.
Ihre Panik wurde vollkommen, als er plötzlich hart ihre Nasenflügel zudrückte und sie über dem zunehmenden Rauschen des Bluts in ihren Ohren seine heisere Stimme hörte:
»Wenn ich jetzt meine Hand auf deinen Mund lege, wird dein Herz in fünf Minuten aufhören zu schlagen, wusstest du das? Aber dann wirst du natürlich schon weit weg sein.«
Als er den Griff um ihre Nase lockerte, schnappte sie gierig nach Luft.
»Schrei nur, hier hört dich sowieso keiner. Schrei doch. Schrei!«
Dann drückte er wieder zu, noch brutaler dieses Mal, und als sie um Gnade flehte, klang das nur wie ein jämmerliches Piepsen.
»Ich sterbe, lass mich los, sonst sterbe ich.«
Er war ihr jetzt so nahe, dass sein Kinn ihres berührte. Die Bartstoppeln kratzten sie. Sie konnte sein höhnisches Grinsen eher ahnen als erkennen.
»Du stirbst? Wie schön.«
Und dann drückte er mit unbändiger Kraft zu.
Ihre geballte linke Hand begann auf den Tisch zu trommeln. Die Bewegung wurde mit der Zeit langsamer, die Finger spreizten sich, bewegten sich wie im Krampf und blieben dann ruhig liegen.
Beim ersten Anruf war sie überzeugt davon, dass es sich nur um ein Missverständnis handeln konnte. Telefonterror war etwas, das andere betraf, wovon sie gehört hatte, was sie aber niemals mit sich selbst in Verbindung bringen würde. Es war ungefähr so, wie ermordet zu werden, ein durchgehendes Pferd mit einem Esel im Sattel zu sehen oder sieben Millionen im Lotto zu gewinnen: Etwas derart Unbegreifliches stieß fremden Leuten zu, namenlosen Menschen, es passierte nie jemandem, den man persönlich kannte.
Und am allerwenigsten einem selbst.
Und dennoch war genau das eingetreten: Von allen Frauen hatte er ausgerechnet sie ausgewählt.
Zuerst hatte sie geglaubt, es handele sich um eine falsche Verbindung. Das unangenehme Gespräch hatte höchstens ein paar Sekunden gedauert.
Keuchender Atem. Sie hatte den Hörer wieder aufgelegt. Falsch verbunden. So etwas kam vor. Schwamm drüber und weiter.
Natürlich war das Gespräch einer anderen armen Person zugedacht gewesen.
Auch beim zweiten Anruf hatte sie anfangs noch gehofft, dass es sich trotz allem um eine irgendwie geartete unglückliche Verwechslung handelte.
Denn wer könnte größeres Interesse an ihr haben, einer allein stehenden Dreiunddreißigjährigen mit ganz alltäglichem Aussehen, etwas zu dicken Waden, zwei gescheiterten, kinderlosen festen Beziehungen und einer mittelmäßigen, unterbezahlten Arbeit in einem Telefonladen in der Stadt?
Aber nach dem Gespräch Nummer zwei musste sie ihren Irrtum einsehen: Genau sie war die Auserwählte.
Das Opfer.
Er hatte sie sogar mit Namen angesprochen:
»Das bist doch du, Dolly, oder? Dolly Nilsson?«
Und sie hatte geschrien, obwohl sie es hätte besser wissen müssen: »Lass mich in Ruhe! Sonst rufe ich die Polizei.«
»Mach das, Schätzchen, mach das nur – sag mal, bist du im Bett genauso wild? Gott, wie schön, eine Frau mit Energie! Es muss wunderbar sein, tief in dich rein ...«
Sie hatte den Hörer auf die Gabel geschmissen.
Eigentlich war das eine gute Methode, ihn loszuwerden.
Aber gleichzeitig verlockte es sie zu hören, was er von ihr wollte. Alles war ein einziger schwieriger Balanceakt.
Eine kurze Weile hatte sie überlegt, ob es Holger sein konnte, der sie auf diese eklige Art erschrecken wollte, als Rache dafür, dass sie vor kurzem mit ihm Schluss gemacht hatte.
Aber den Gedanken schob sie schnell beiseite.
Ihr ehemaliger Mitbewohner lebte inzwischen weit im Norden, in Norrland, und war viel zu geizig, um sich jede Menge Ferngespräche zu leisten. Außerdem könnte er seine Stimme gar nicht so extrem verstellen. Nach vier Jahren Zusammenleben hätte sie ihn wieder erkannt, sosehr er auch versuchen würde, seine Stimme zu tarnen. Aber der Hauptgrund dafür, dass sie ihn als möglichen Täter strich, war, dass ihm ganz einfach die Phantasie für etwas so Raffiniertes fehlte. Er war der langweiligste Kerl, mit dem sie je zu tun hatte – nicht, dass sie besonders viele Vergleichsmöglichkeiten gehabt hätte –, und inzwischen konnte nicht einmal sie selbst sich erklären, wie sie es so lange mit ihm ausgehalten hatte.
Vier Jahre: eine kleine Ewigkeit.
Und es war keine besonders schöne Zeit gewesen, so viel war klar.
Sie verwarf auch den Gedanken, es könnte ihre erste Beziehung sein, die jetzt als Spuk aus der Vergangenheit auftauchte. So war Lars-Göran einfach nicht. Sie hatte sich immer gut mit ihm verstanden, und die Trennung war ruhig und würdevoll verlaufen, ohne ermüdende Szenen.
Dolly hegte den Verdacht, dass Lars-Göran einen leichten Hang zur Homosexualität hatte. Ihr Zusammenleben hatte das eigentlich nicht gestört, aber es hatte gewisse Zeichen dafür gegeben, dass er fremdging. Was ihr jedoch nichts ausmachte.
Zumindest jetzt nicht mehr.
Sie hegte keinen Groll gegen ihn und hatte außerdem seit mehr als sechs Jahren nichts von ihm gehört.
Nein, der Anrufer war mit größter Wahrscheinlichkeit eine für sie vollkommen fremde Person mit krankem Geist. Denn kein normal funktionierendes Individuum würde doch wohl auf so abnorme Ideen kommen, oder?
Die Frage lautete nur: Warum?
Warum ausgerechnet sie, Dolly, diese diskrete, unbedeutende Frau? Warum war sie vollkommen unverschuldet in die Schusslinie geraten, war den seltsamen Scherzen eines verdrehten Individuums ausgesetzt?
Apropos Scherze, wenn nun ...
Sie wagte nicht, den Gedankengang fortzuführen, spürte nur, wie ihr ein eiskalter Schauder den Rücken hinunterlief.
Nach dem vierten oder fünften Anruf überlegte sie, ob er vielleicht noch andere Opfer quälte. Oder sich mit ihr begnügte. Sie dachte, dass es sicher besser sei, wenn er seine Zoten auf mehrere Opfer verteilte und sich nicht auf ein einziges Objekt konzentrierte – ein etwas egoistischer und vielleicht unlogischer Gedanke, aber sie suchte Trost, wo er zu finden war.
Bis jetzt hatte sie sich noch nicht getraut, mit jemandem darüber zu reden, nicht einmal mit ihrer besten Freundin Anna oder einer ihrer Arbeitskolleginnen. Auf eine schwer erklärbare Art war es ihr peinlich, obwohl sie sich in keiner Weise mitschuldig fühlte. Soweit sie wusste, hatte sie sich nie provokativ oder sexuell herausfordernd verhalten, Im Gegenteil, sie sah sich selbst als graue Maus, als ein Teil der anonymen Masse; warum in Herrgotts Namen war sie dann also ausgesucht worden?
Vielleicht war es reiner Zufall, vielleicht hatte der Anrufer nur den Finger durch das Telefonbuch fahren lassen und einen weiblichen Namen auf gut Glück herausgepickt.
Die Vorstellung war tröstlich, auf jeden Fall sehr viel angenehmer als der Gedanke, sie könne aus irgendeinem bestimmten Grund ausgesucht worden sein, nach genauer Begutachtung irgendwo da draußen in der Dunkelheit. Vielleicht hatte er sie nur ausgewählt, weil sie in einem ziemlich großen und abseits gelegenen Holzhaus in einem dünn besiedelten Stadtteil lebte.
Diese Perspektive erschreckte sie mehr als alle anderen.
Das würde ja etwas ganz Schreckliches bedeuten: dass er sie irgendwann aufsuchen konnte, wenn sich die passende Gelegenheit bot und wenn er sich sicher war, das sie wirklich allein war.
Sie vermisste ihre Mutter. Auch wenn ihre Mutter schon alt und gebrechlich war, so hätte sie sich doch sicherer gefühlt, wenn sie noch im Haus wohnte. Sie hatte ihre Mutter nicht überreden können, bei ihr zu bleiben und nicht in dieses Altenwohnheim im Süden zu ziehen.
Dolly hatte die Möglichkeit, sich über ihre Arbeitsstätte ein Gerät zu kaufen, das die Nummer des Anrufers anzeigte, aber sie wusste auch, dass es kein Problem war, sich hinter dem, was so locker als »geschützte Nummer« bezeichnet wurde, zu verstecken. Und ihr war natürlich klar, dass der Anrufer nicht so dumm sein würde, sein eigenes Telefon zu benutzen.
Deshalb war der Kauf einer Anruferkennung im Augenblick nicht aktuell.
Vielleicht später.
Dagegen überlegte sie ernsthaft, ob sie sich eine Geheimnummer zulegen sollte, die sie dann nur ihren nächsten Angehörigen und zuverlässigen Freunden geben würde: Mama, dem Chef, Anna, ein paar ihrer Arbeitskolleginnen, vielleicht noch einigen anderen.
Aber bis jetzt hatte sie sich noch nicht entschieden. Außerdem wusste sie, dass es Wege gab, auch eine Geheimnummer herauszukriegen, wenn man sich nur genügend anstrengte.
Sie hoffte natürlich, dass diese Belästigung ganz von allein aufhören würde, dass der Anrufer ihrer müde wurde oder ein anderes Opfer fand.
Aber wenn sie ehrlich war, wusste sie, dass sie nicht das letzte Mal von ihm gehört hatte. Die Folter würde weitergehen.
Jedes Mal, wenn es klingelte, fürchtete sie das Schlimmste.
Sie hasste ihn inzwischen, hasste ihn wegen dieser kriecherischen Schleimerei, wegen seiner Feigheit, sich hinter der Anonymität zu verstecken, hasste ihn, weil er sie dieser nervenzehrenden Folter aussetzte.
Eine unbekannte Stimme am Telefon: ebenso primitiv und verabscheuungswürdig wie ein Schmähbrief von jemandem, der sich nicht traute, mit seinem Namen zu dem Inhalt zu stehen.
Es war ein außergewöhnlich anstrengender Arbeitstag gewesen, und sie fühlte sich ausgelaugt, als sie sich mit der Tageszeitung auf dem Sessel niederließ und darauf wartete, dass das Teewasser kochen würde. Sie blätterte im Fernsehprogramm. Freitags gab es meistens ganz gute Unterhaltung. Sie würde sicher etwas finden, was ihr gefiel, etwas Leichtes für zwei, drei Stunden.
Und dann – ins Bett.
Sie machte sich ein Butterbrot, goss Wasser in einen großen Becher, legte einen Beutel Zitronentee hinein und las das Bladet, die einzige Zeitung, die sie abonniert hatte. Morgens überflog sie die Zeitung meistens nur, um sie abends dann gründlicher durchzulesen.
Das Telefon klingelte, als sie gerade die Familienseite las, und ließ sie zusammenzucken.
Jedes Mal, wenn es klingelte ...
Zuerst wollte sie einfach gar nicht rangehen.
Aber dann stand sie doch zögernd auf. Schließlich konnte es ihre Mutter sein. Oder die übersprudelnde Anna, die immer zum Plaudern aufgelegt war, besonders abends und ganz besonders am Freitag.
Sie musste sich entscheiden: Entweder sie ignorierte das Telefon ganz und gar, oder sie gab sich einen Ruck und ging dran.
Die Idee mit der Geheimnummer kam ihr wieder in den Sinn, wie schon so oft zuvor, gleichzeitig schallte das dritte Klingelzeichen durch das Haus.
Sie holte tief Luft, atmete aus und nahm den Hörer im Stehen ab.
»Ja?«, fragte sie bebend, auf alles gefasst.
»Spreche ich mit Dolly Nilsson?«
»Ja«, bestätigte sie.
Sie hatte die Stimme nicht wieder erkannt. Die Erleichterung ließ sie fast laut kichern.
Das war nicht er.
Der Anrufer hatte einen leicht singenden finnlandschwedischen Akzent. Er stellte sich mit einem Namen vor, den sie bereits nach Sekunden wieder vergessen hatte, wenn sie ihn überhaupt registriert hatte.
Sie hörte kaum zu, was er sagte.
Stattdessen dachte sie: Er ist es nicht. Wie schön.
Sie zwang sich, interessiert zuzuhören, verlor aber schnell die Konzentration. Teilnahmslos lauschte sie seinen Worten über die Beschaffung von Mitteln für krebskranke Kinder; wenn er ihr also ein Überweisungsformular schicken dürfe, dann werde sie dafür ca. zehn Ansichtskarten bekommen, mit Motiven von ...
»Tut mir Leid«, unterbrach sie seine Litanei. »Ich habe in letzter Zeit schon genug gespendet. Gerade letzte Woche habe ich erst einen Betrag für die Förderung Schwerhöriger gestiftet, oder was das war. Und im Januar habe ich dem Verein ›Rettet die Kinder‹ etwas gegeben. Irgendwann muss man auch mal nein sagen können.«
»Aber es geht doch um ...«
»Ich weiß«, sagte sie. »Natürlich sind solche Aktionen sehr lobenswert, keine Frage. Aber wie gesagt, im Augenblick nicht. Vielleicht nächstes Mal.«
»Könnte ich dann nicht trotzdem ein Überweisungsformular schicken? Falls Sie es sich noch anders überlegen?«
»Ja, das können Sie«, sagte sie, um ihn endlich loszuwerden. »Aber ich verspreche nichts.«
»Das ist schon ganz in Ordnung«, versicherte er ihr. »Dürfte ich dann um Ihre Adresse bitten?«
Sie gab sie ihm und verabschiedete sich. Gerade als sie schon den Hörer auflegen wollte, fing er noch einmal an.
»Ach, da ist nur noch eins.«
»Was ist denn nun noch?«, fragte sie ungeduldig.
»Ich möchte nur wissen, ob deine kleine Fotze wohl nackt ist?«
Eine vollkommen andere Stimme jetzt, eine Stimme, die sie wieder erkannte. Nur zu gut.
»Oder hast du Spitzenhöschen an?«
Kein singendes Finnlandschwedisch mehr, sondern der übliche, grobe, unangenehme Dialekt.
Das war er, unverkennbar, das Schwein hatte es geschafft, sie zu überrumpeln.
Sie sah, wie sich die Härchen auf ihren Unterarmen sträubten.
»Wir wollen uns da unten doch nicht erkälten, das wollen wir doch auf keinen Fall, oder? Denn dann macht es nicht so viel Spaß, wenn wir uns treffen, keinem von uns beiden. Es ist doch wirklich so, dass wir unglaublich gut zusammenpassen, meine ...«
Sie warf den Hörer auf, aber nicht schnell genug: Sie konnte noch sein Keuchen hören, so abstoßend, so erschreckend.
Ihr Herz pochte heftig. Sie hatte eine ganz trockene Kehle.
Sie saß da und schaute sich mehrere Minuten lang im Zimmer um, versuchte sich zu beruhigen. Es dauerte eine Weile, bis sie ihren Puls wieder unter Kontrolle hatte.
So ein Schweinehund!
Sie ekelte sich, fühlte sich gekränkt, ausgeliefert, nackt.
Ihr war, als hätten sich seine kranken geilen Augen im Hörer befunden und direkt durch ihre Kleidung hindurchgesehen, große Löcher hineingebrannt, nur um zu ihr vorzudringen.
Seine Dreistigkeit wuchs in beunruhigender Weise. Sich einfach als jemand auszugeben, der für krebskranke Kinder sammelte, sie in Sicherheit zu wiegen, wie herzlos. Das war irgendwie noch schlimmer als die bisherigen Anrufe, bei denen er mit seinem Stöhnen und seinen vulgären Andeutungen direkt zur Sache kam.
Sie sah ein, dass sie es nicht nur mit einer seelisch abnormen Person zu tun hatte, sondern mit jemandem, der vor nichts zurückschreckte.
Was würde er nächstes Mal machen?
Ein heftiger Wunsch nach einer heißen Dusche, nach Reinigung, überfiel sie. Es war wichtig, dieses klebrige Gefühl von Unbehagen wegzuspülen.
Es klingelte wieder.
Ihr Herz reagierte sofort mit einem heftigen Klopfen. Sie hatte das Gefühl, als dröhne es in ihrem Brustkorb und als übertöne das Pochen das scharfe Schrillen des Telefons.
Dolly blieb noch lange, nachdem wieder Stille im Haus eingekehrt war, in der gleichen Stellung sitzen.
Dann stand sie zögernd auf, drehte mehrere Runden im Zimmer und entschloss sich endlich.
Sie würde zwei Telefongespräche führen, sosehr es ihr auch widerstrebte.
Zuerst mit der Polizei. Dann mit Anna.
So konnte es nicht weitergehen. Sie musste einen Teil der Last abgeben, dieses eklige Wissen mit jemandem teilen. Der Terror musste ein Ende haben.
Sie rief bei der Polizei an und erklärte der Vermittlung mit wenigen Worten, worum es ging. Dann wurde sie mit jemandem verbunden, der Terje Andersson hieß und der geduldig ihrem etwas wirren Bericht von all dem zuhörte, was ihr in den letzten Tagen zugestoßen war.
»Sie werden doch etwas dagegen tun?«, fragte sie. »Es zumindest versuchen?«
»Wir haben von Ihnen eine Anzeige bekommen«, lautete die ausweichende Antwort.
»Ja, und?«
»Wir werden uns das anschauen.«
»Was bedeutet das? Was werden Sie sich anschauen?«
Dolly meinte ein leises Seufzen zu vernehmen, aber vielleicht irrte sie sich da auch.
Nach einigen Sekunden sagte Andersson: »Wir werden tun, was wir können. Bitte glauben Sie mir, dass ich großes Verständnis für Sie habe und mir vorstellen kann, wie Sie sich fühlen, nach all dem, was passiert ist. Das ist wirklich grässlich. Aber lassen Sie mich Ihnen eines sagen: Sie sind nicht die Einzige, die solchen üblen Scherzen ausgesetzt ist. Wir haben in den letzten Monaten mehrere ähnliche Anzeigen hereinbekommen. Einige andere Frauen haben sich aufgrund anonymer Telefongespräche der Art, wie Sie sie beschrieben haben, bei uns gemeldet.«
Aha, dachte Dolly. Dann bin ich also nicht allein.
Sie konnte sich nicht entscheiden, ob das nun ein Trost war oder nicht. Früher hatte sie immer gedacht, es sei ein Vorteil, wenn ein Wahnsinniger gleich mehrere Frauen angriff. Jetzt war sie sich dessen nicht mehr so sicher.
Andersson fuhr fort: »Lassen Sie den Kopf nicht hängen! Denken Sie daran, dass diese Männer, die bei Frauen anrufen und sie belästigen, fast nie physischen Kontakt zu ihren Opfern aufhehmen. Dazu sind sie viel zu feige.« Fast nie.
Die Worte des Polizisten hallten noch in ihr wider, als sie sich unter die Dusche stellte. Sie musste sich erst einmal reinigen, bevor sie es schaffen würde, Anna anzurufen.
Sie stand fast eine Viertelstunde unter dem heißen Strahl, aber es nützte nichts.
Als sie sich abtrocknete, fühlte sie sich schäbiger als je zuvor.
— Zweites Kapitel
Der Wind fühlte sich winterlich beißend, aber auch frühlingshaft und voller Verheißungen an, beides zugleich. Ihm schien, dass es milder geworden war – er verabscheute die Kälte –, auf jeden Fall biss der schneidende Wind nicht mehr so scharf wie noch vor ein paar Tagen.
Der dunkelblaue Mantel war ganz zugeknöpft, bis zum Hals hinauf. Und dennoch gelang es dem Wind, einen eisigen Finger darunter zu schieben, der ihn zu einem leichten Schaudern brachte. Der dünne Seidenschal bot keinen nennenswerten Schutz, verlieh ihm aber, wie zumindest er selbst fand, einen eleganten Touch. Und diesen gewissen Pfiff, der heute wichtiger für ihn war als je zuvor.
Er beschleunigte seine Schritte.
In die Manteltaschen hatte er zwei zusammengefaltete Abendzeitungen mit Reklamebeilagen gestopft, die er gerade am Hauptbahnhof gekauft hatte.
Er war auf dem Heimweg und bereute langsam, nicht den Wagen genommen zu haben. Aber er saß aus dienstlichen Gründen so oft hinterm Steuer, dass er gern die Gelegenheit zu einem Spaziergang nutzte, sobald sie sich bot. Das war auch das Einzige, was irgendeiner Art von sportlicher Betätigung nahe kam. Er war nie ein großer Freund körperlicher Anstrengungen gewesen, war sich aber im Klaren darüber, dass er ein Alter erreicht hatte, in dem es empfehlenswert war, sich fit zu halten.
Als er den Stortorget überquerte, bemerkte er, dass das Mittagsgeschäft bereits abgeebbt hatte. Die Stadt genoss einige Stunden wohlverdienter Nachmittagsruhe vor dem Trubel des Samstagabends.
Eigentlich war er nicht besonders begeistert von seinem jetzigen Wohnort. Nicht, dass er ihn nicht leiden konnte. So schlimm war es nun auch nicht. Die Stadt hatte einen gewissen Charme, der wohl in allererster Linie auf den Stadtteil zutraf, durch den er gerade ging: Gamleby, mit einem Gewimmel pittoresker Häuser in den malerischen Gassen und den gepflegten Grünanlagen.
Auch die Lage der Stadt war von Vorteil. Besonders schätzte er die Nähe zum Meer und die salzigen Bäder, die seine Sommer vergoldeten. So einen Luxus war er aus früheren Zeiten nicht gewohnt, als diese Freuden für Charterreisen in den Süden reserviert waren.
Und dennoch. Es war nicht wie daheim in Örebro, wo er geboren und aufgewachsen war und bis vor fünfzehn Jahren gelebt und gearbeitet hatte. Die Stadt war schon okay, aber trotz allem eine Spur zu klein, um ihm uneingeschränkt zuzusagen. Außerdem waren die Winter hier eindeutig kälter und windiger als in seiner Heimat.
Während er mit zielgerichteten Schritten durch die spätwinterlichen Straßen schritt, entsprach seine Erscheinung genau dem, was er war: ein wohlerzogener, erfolgreicher Vierziger mit einem ordentlichen Beruf.
Er wohnte mit seiner Frau Elisabeth in einer großzügigen Wohnung in einem alten Patrizierhaus in der Nähe des Krankenhauses, in bequemem Spazierabstand zum Zentrum.
Sie lebten jetzt zu zweit, nachdem beide Söhne ausgezogen waren. Die beiden waren schon zum Zeitpunkt des Umzugs von Örebro hierher fast flügge gewesen und hatten nur wenige Jahre in dem neuen Heim gelebt, in das sie nur unter brummenden, aber nicht besonders energischen Protesten umgezogen waren.
Anschließend hatten sie sich nach dem Studium in Göteborg beziehungsweise Lund jeweils eine respektable Arbeit beschafft, und obendrein war es beiden gelungen, eine Familie zu gründen.
Also Ruhe und Frieden an dieser Front.
Er öffnete die Wohnungstür, zog die Abendzeitungen aus den Taschen und legte sie auf den Flurtisch. Ein Prospekt fiel zu Boden. Er bückte sich, um ihn aufzuheben.
»Bist du’s, Hadar?«, war aus einem Zimmer rechts vom Eingang zu hören.
»Wer soll es denn sonst sein?«
»Ach, ich wollte es nur wissen.«
Nachdem er seinen Mantel auf einen Holzbügel gehängt hatte (er traute diesen umständlichen Metallkonstruktionen nicht), verzog er sich in die Küche und goss sich ein großes Glas fettarme Milch ein. Er trank es in einem Zug aus und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund, um eventuelle Spuren des Getränks wegzuwischen, die seine Mutter immer scherzhaft als Schnurrhaare bezeichnet hatte.
Er rauchte eine Zigarette, blätterte eine der Zeitungen flüchtig durch und ging dann ins Zimmer seiner Frau.
Wie lange war es schon her, dass sie ein gemeinsames Schlafzimmer gehabt hatten?
Sie saß vor dem Spiegel an ihrem Frisiertisch und konzentrierte sich voll und ganz darauf, ihre Lippen anzumalen. Schminkutensilien in Hülle und Fülle stapelten sich auf der Tischplatte. Er kannte niemanden, der sich mit Elisabeth messen konnte, was die Anzahl überflüssiger Accessoires betraf.
Ihr Haar war voller Lockenwickler, deren Ränder sich unter einem locker umgeschlungenen Handtuch abzeichneten, das den größten Teil ihres Kopfes bedeckte. Ihr Morgenrock war nicht zugeknöpft, er hing nachlässig um ihren drallen Körper. Er konnte ihren beigefarbenen, gut gefüllten BH sehen und ein großes Stück eines ihrer weißen, strumpflosen Beine. Das andere wurde fast zur Gänze von dem Morgenrock verdeckt. Durch die Fensterscheibe fiel das Tageslicht herein und ließ den Ohrring in ihrem linken Ohrläppchen funkeln. Er erinnerte sich daran, dass er früher daran geknabbert hatte. Jetzt konnte er sich nicht einmal mehr an den Geschmack erinnern.
»Wo warst du?«, fragte sie, ohne ihre mascaraeingerahmten Augen vom Spiegel zu lösen.
»Ich habe die Abendzeitungen gekauft. Hat jemand für mich angerufen?«
»Keine Menschenseele ... oder doch, ja, Mikael hat von sich hören lassen.«
»Aha. Und, alles in Ordnung bei ihm?«, fragte er, ohne bei der Sache zu sein.
Mikael war ihr jüngster Sohn.
»Ihnen geht es glänzend«, sagte sie und spitzte die Lippen, um zu kontrollieren, ob der Lippenstift auch dort war, wo er sein sollte. »Er und Lotta sind heute Abend eingeladen. Die Großeltern passen aufs Kind auf. Sie wollen zu ...«
Er hatte keine Lust, weiter zuzuhören, und ging zur Tür.
»Was gibt es zu essen?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Nicht, was Mikael und Lotta kriegen«, schnaubte er. »Was hast du für uns?«
»Es wird wohl was aus der Kühltruhe werden. Such dir selbst was aus.«
»Das kannst du tun.«
»Wie ist das Wetter?«, fragte sie.
»Der Jahreszeit entsprächend.«
»Es heißt entsprechend«, korrigierte sie ihn, immer noch ohne den Blick von ihrem Spiegelbild zu lösen.
»Musst du mich ständig verbessern? Du bist wirklich berufsgeschädigt, Frau Lehrerin, Pedantin durch und durch.«
»Beruhige dich«, sagte sie und schraubte die Hülle auf den Lippenstift.
Er schnappte sich die Abendzeitungen und ging ins Wohnzimmer, wo er sich ans Fenster setzte, um noch das restliche Tageslicht auszunutzen.
Er rechnete mit einem angenehmen Nachmittag. Vielleicht ein kleines Nickerchen, vielleicht ein richtig herausforderndes Wochenend-Kreuzworträtsel, vielleicht ein halbes, schläfriges Auge auf eines der Fußballspiele, die bald im Fernsehen gezeigt werden würden.
Die Hauptsache war, dass er etwas ausruhen konnte vor dem, was ihm heute Abend noch bevorstand.
Erregung stieg in ihm hoch, und er musste sich zügeln, um nicht allzu ungehemmt seiner Phantasie freien Lauf zu lassen.
Er sollte seine Kräfte besser sparen.
Jetzt brauchte er sie noch nicht.
Noch nicht. Aber bald.
Heute Abend.
Er konnte nicht still sitzen, musste aufstehen und im Zimmer herumlaufen.
»Hadar?«
»Ja.«
»Bist du so lieb und hilfst mir mal?«
Ihre Stimme klang schrill, als sie sich ihren Weg durch die Wohnung bahnte; war sie immer schon so durchdringend gewesen?
»Hadar, was machst du? Hörst du nicht? Komm mal her, sei so gut.«
»Ich komme«, sagte er und wünschte, es wäre schon fünf Stunden später.
— Drittes Kapitel
»Hallo Laila.«
»Ach, du bist’s.«
»Hast du jemand anders erwartet?«
»Absolut nicht.«
»Ich finde, du hast fast enttäuscht geklungen.«
»Da hast du dich geirrt. Wie ich mich nach dir sehne! Aber wie läuft es nun? Du kommst doch morgen? Wage es ja nicht, abzusagen!«
»Keine Sorge, ich komme schon. Ich wollte nur nochmal durchrufen, um das zu bestätigen. Es wird einfach schön sein, hier eine Weile rauszukommen, auch wenn es nur für ein paar Tage ist.«
»Das kannst du auch gut gebrauchen. Und ich habe dich endlich mal wieder bei mir. Das letzte Mal war ja nicht gerade erst gestern.«
»Du weißt doch, dass es bei mir in letzter Zeit etwas turbulent zugegangen ist.«
»Ja, ich weiß. Es ist doch wohl nichts ...«
Die Frage blieb in der Luft hängen, und Jasmin musste schmunzeln, als sie sich das Gesicht der Schwester vorstellte: die runden, gleichzeitig erwachsenen und kindlichen Züge, die Ponyfrisur, die trotzigen und dabei dennoch so gutgläubigen Augen.
»Nein, nein, nichts Neues unter der Sonne.«
»Dann hat Josef nicht ...«
Wieder blieb die Frage unvollständig.
»Lass uns darüber reden, wenn wir uns sehen, Laila.«
»Aber du musst mir wenigstens sagen, ob es Stefan und Maria gut geht!«
»Es ging ihnen zumindest ganz prima, als ich vor fünf Minuten mit ihnen telefoniert habe.«
»Wie schön. Du, das mit Josef ...«
»Können wir nicht morgen darüber reden?«
»Aber du hast doch etwas in der Richtung angedeutet, dass er möglicherweise versuchen könnte, das alleinige Sorgerecht für die Kinder zu bekommen.«
Jasmin unterdrückte ein Seufzen.
»Nicht nur möglicherweise, Laila. Er hat beschlossen, darum zu kämpfen.«
»Dann schlag zurück. Schlag zurück mit aller Kraft, dann hat er nicht die geringste Chance.«
»Aber da gibt’s ja diese Sache, weißt du.«
Schweigen.
»Du willst doch nicht etwa sagen, dass er so primitiv ist und den alten Dreck wieder hervorholt?«
»Doch, so primitiv ist er.«
»Aber das war doch nur dieses eine Mal, ein einziger Ausrutscher.«
»Zweimal.«
»Na, dann eben zweimal. Was macht das für einen Unterschied? Du bist doch jetzt trocken. Das ist doch alles längst vergessen.«
»Nicht für Josef.«
»So ein Mistkerl.«
»Ja, das ist er wirklich. Aber lass uns jetzt damit aufhören.«
»Okay. Wann kommst du morgen?«
»Gegen Abend, denke ich. Wollen wir sagen um sechs Uhr? Ich habe vormittags noch einiges zu tun, will aber so gegen Mittag losfahren, damit ich das Licht noch ausnutzen kann. Ich hasse es, im Dunkeln zu fahren, dabei habe ich immer das Gefühl, am Wegesrand überall Rehe zu sehen.«
»Die Straßen sind trocken, das wird kein Problem sein. Wenn du kommst, habe ich das Essen fertig. Etwas Besonderes für dich?«
Jasmin lachte. »Lass es eine Überraschung werden.«
»Wie du willst. Ach, übrigens, Jossie: Ich habe noch eine andere Überraschung für dich.«
»Du meinst doch nicht etwa ...«
»Was soll ich meinen?«
»Einen Mann? Laila! Sag schon!«
Lautes Lachen im Hörer.
»Du wirst es morgen sehen.«
»Es ist gemein, mich so auf die Folter zu spannen, und das von meiner eigenen Schwester. Nun sag schon, ist es ein Typ?«
»Du wirst dich noch etwas gedulden müssen.«
»Ach, bitte ...«
»Nützt alles nichts. Morgen, habe ich gesagt. Dann wirst du es erfahren, vorher nicht. Allerdings unter einer Bedingung.«
»Du stellst Bedingungen?«
»Ganz genau. Ich verlange von dir, dass du hier nicht anfängst sauber zu machen, wie du es sonst immer tust. Wage ja nicht, die Wohnung wieder total auf den Kopf zu stellen wie an Weihnachten. Ich warne dich.«
»Das kommt darauf an, wie es aussieht«, protestierte Jasmin. »Sei mir nicht böse, aber manchmal sieht es bei dir aus wie im Schweinestall. Da muss man sich ja fast schämen.«
»Du sollst dich hier erholen und ausspannen, und nicht mit Eimer und Besen loslegen. Du wirst ja schon nervös, wenn nicht alles blitzt und blinkt. Weißt du, dass du einen Putzfimmel hast? Aber das ist auch dein einziger Fehler. Nein, stimmt nicht. Du hast noch einen. Noch einen schlimmeren.«
»Und der wäre?«
»Du bist Josef gegenüber immer viel zu nachgiebig gewesen. Hast dich von ihm herumschubsen, dir auf der Nase herumtanzen lassen. Solange ich denken kann, hast du dich von diesem Machotyp herumkommandieren lassen. Und das ist nichts, was ich jetzt erst auf den Tisch bringe, weil ihr euch scheiden lassen wollt. Ich habe ihn noch nie gemocht. Das weißt du. Du musst doch auch zugeben, dass er dich auf das Schändlichste ausgenutzt hat?«
»Vielleicht ist es deshalb ja zu Ende gegangen«, musste Jasmin einräumen.
Ihre Schwester hatte ja Recht. Sie war einfach viel zu lange zu gutgläubig und nachgiebig gewesen. Josefs Wort war immer Gesetz für sie gewesen.
Die Schwestern plauderten noch einige Minuten lang und beendeten dann das Gespräch. Jasmin legte den Hörer auf. Laila hatte so aufgekratzt und erwartungsvoll geklungen, als hätte sie etwas ganz Besonderes vor. Bedeutete ihr Besuch ihr wirklich so viel? Auf jeden Fall war das sehr schmeichelhaft.
Jasmin blieb neben dem Telefon sitzen und grübelte darüber nach, warum eigentlich ihre Ehe so schief hatte laufen können. Wie konnte etwas, was noch vor ein paar Jahren so eine glühende Leidenschaft gewesen war, sich in so einen verbissenen Kampf verwandeln, in Drohungen und blanken Hass? Wo war das zärtliche, überschwängliche Gefühl des Verliebtseins geblieben?
War alles ein einziger Bluff gewesen, eine Illusion, eine Autosuggestion? Hatte sie sich nur eingebildet, bis über beide Ohren in Josef verliebt zu sein?
Aber konnte man sich überhaupt jemals sicher sein, wenn es um Gefühle ging?
Die Antwort auf diese Fragen erschien ihr plötzlich vollkommen uninteressant, wie etwas absolut Überholtes. Was wirklich zählte, war, was jetzt mit den Kindern geschehen würde. Warum sollte er so selbstherrlich über Stefans und Marias Zukunft bestimmen? Warum ging er ganz selbstverständlich davon aus, dass sie es viel besser bei ihm in London hätten als bei ihrer Mutter in Schweden?
Alles drehte sich nur um Prestige. So viel begriff sie. Josef dachte nicht in erster Linie an das Beste für die Kinder, sondern an sein Selbstwertgefühl. Das war ihm wichtiger als alles andere.
Typisch Josef, dachte sie verächtlich, sich und seine Bedürfnisse immer an erste Stelle zu setzen.
Von einer plötzlich aufflammenden Wut erfüllt, stand sie auf und trat ans Fenster, von wo aus sie auf den langsam abnehmenden Verkehr auf den Straßen dort unten schaute. Der Samstagabend hatte begonnen.
Jasmin beschloss, freiwillig keinen Zoll zu weichen.
Sie würde Josef bekämpfen, koste es, was es wolle.
Er würde seinen Willen nicht bekommen. Diesmal nicht.
Er, der große Karrierist, konnte ja gern in London schuften, während die Kinder dort lebten, wo sie hingehörten.
Bei ihr.
Bei dem Menschen, der ihnen das Leben geschenkt hatte.
— Viertes Kapitel
Das krampfhafte, ungleichmäßige Atmen zeigte ihm, dass sie unruhig schlief, und als sie vor sich hin wimmerte, war ihm klar, dass sie mal wieder einen Albtraum hatte.
Um sie nicht zu wecken, glitt er ganz vorsichtig aus dem Bett und schlich barfuß aus dem Schlafzimmer. In der Tür drehte er sich um und warf einen ängstlichen Blick auf seine Frau.
Eva-Louise lag auf dem Rücken. Ihre Lippen waren leicht geöffnet, die Nasenflügel bewegten sich bebend, als sie ein paar leise Schnarchlaute von sich gab, die eher einem Schluchzen ähnelten. Nach einer Weile drehte sie sich auf die Seite, und sofort hörte das Jammern auf.
Er liebte sie. Mehr als je zuvor.
Es schien ihm, als würde seine Liebe zu ihr mit jedem Tag größer werden. Und dabei war er doch bereits bei ihrer Verlobung vor fast zwanzig Jahren fest davon überzeugt gewesen, dass er auf dem Gipfel seiner Leidenschaft für diese Frau stand, die ihn den Rest seines Lebens begleiten sollte. Jetzt war er aufgeregt. Er konnte das Unbehagen nicht länger zügeln, das sich in ihm ausbreitete. Etwas stimmte nicht, etwas war mit ihr nicht in Ordnung. Sie war abwesend und brauste bei jeder Kleinigkeit auf, und sie wirkte bedrückt. Außerdem schlief sie schlecht, sie, die doch immer so unglaublich gut und tief hatte schlafen können. Wie oft hatte er sie um die Fähigkeit beneidet, so schnell und problemlos in den Tiefschlaf zu versinken, während er sich neben ihr drehte und wendete.
Doch in den letzten Nächten war sie es gewesen, die Schwierigkeiten mit dem Schlaf gehabt hatte. Sie hatte sich nicht beklagt, aber natürlich hatte er ihre Pein bemerkt, während er neben ihr lag und so tat, als schliefe er schon.
Er hatte sich nicht getraut, sie nach ihren Sorgen zu fragen, hatte vielmehr gehofft, sie würde sich ihm von selbst anvertrauen, sobald die Zeit dazu reif war. Intuitiv war ihm klar, dass Eva-Louise den ersten Schritt machen musste. Es würde schief laufen, wenn er seine eigene Beunruhigung zeigte. Am besten, er wahrte den Schein und wartete geduldig, auch wenn es ihm schwer fiel.
Ein schrecklicher Gedanke überfiel ihn. Vielleicht war sie ja ernsthaft krank, vielleicht hatte sie sich deshalb in letzter Zeit so sonderbar verhalten.
Die Idee erschreckte ihn zutiefst. Er konnte sich nicht vorstellen, wie er auf einen solchen Schicksalsschlag reagieren würde.
Mit aller Kraft schob er diese Gedanken beiseite.
Thure Castelbo ging ins Bad, wog sich automatisch, ohne überhaupt das Ergebnis zu registrieren, pinkelte und stellte sich unter die Dusche.
Er war ein etwas untersetzter, aber ziemlich durchtrainierter Mann mit markantem Kinn und durchdringendem Blick. Er stammte aus einer Bauemfamilie aus Südskånen. Sein Vater war ein begeisterter Lokalpatriot, der gern betonte, dass er südlich der Landesstraße geboren worden war, wie er die Straßenverbindung zwischen Trelleborg und Ystad zu bezeichnen pflegte.
»Das ist der Strich, der Schweden in zwei ungleiche Hälften teilt«, pflegte sein Vater zu sagen, und Thure fand diese Formulierung amüsant.
Zumindest die ersten sieben, acht Male.
Es war geplant gewesen, dass der älteste Sohn den Hof übernehmen sollte. Schlechte Zeiten (in Kombination mit misslungenen, weitreichenden Aktienspekulationen) hatten jedoch dazu geführt, dass der landwirtschaftliche Betrieb in Konkurs ging. Thure ging stattdessen zur Polizei, während sein jüngerer Bruder Måns eine Ausbildung als Elektriker in Ängelholm begann – er war inzwischen bei der Bahn in der gleichen Stadt beschäftigt.
Der Vater war enttäuscht von ihrer Berufswahl. Er hatte natürlich gehofft, die Söhne würden sich etwas suchen, das eine Verbindung zur Landwirtschaft hatte, aber er protestierte nur halbherzig und pflichtschuldig, wohl wissend, dass er selbst es gewesen war, der den Hof aufs Spiel gesetzt hatte, und niemand sonst.
Bis vor nicht einmal zehn Jahren hatte Thure den Nachnamen Mårtensson getragen, aber gegen seinen eigenen Willen hatte er einem Namenswechsel zugestimmt, initiiert von seiner Ehefrau. Eva-Louise stammte aus einer kleinen Stadt namens Slottshem und hielt es für eine phantastische Idee, daraus eine freie Teilübersetzung ins Englische zu machen und diese dann als Nachnamen zu benutzen.
Thure Mårtensson sah das anders.
Er fand die Idee peinlich und undurchführbar.
Dass er zum Schluss dann doch bei dem Namenswechsel mitmachte, lag einzig und allein an einer Sache: an seiner Liebe zu Eva-Louise. Er konnte sie ganz einfach nicht durch eine unumstößliche Haltung verletzen, aber zu seiner Ehrenrettung muss gesagt werden, dass er zumindest sehr lange für Mårtensson kämpfte. Der Name war zumindest nicht sang- und klanglos untergegangen.
Immer wieder hatte er sich Vorwürfe gemacht und gefragt, ob er denn wirklich lange genug standhaft gewesen war – noch heute hegte er gewisse Schuldgefühle, weil er sich hatte überreden lassen. Denn was war an Mårtensson so schlecht? Castelbo – das klang doch ziemlich snobistisch, und alle, die ihn kannten, wussten, dass er eine einfache, gradlinige Person ohne große Ambitionen war.
In einem Punkt war er jedoch unerschütterlich geblieben: Er hatte sich geweigert, diesen schmachvollen Namenswechsel seinem Vater und seinem Bruder selbst mitzuteilen.
»Es ist deine Idee gewesen, also erklär du ihnen jetzt auch, warum Mårtensson für dich nicht mehr gut genug ist, wo er doch mehrere hundert Jahre lang gut genug war.«
»Natürlich ist Mårtensson gut genug«, hatte sie ganz unbeschwert und fröhlich entgegnet. »Nur ist Castelbo einfach noch besser. Aber dem Angriff werde ich schon trotzen können.«
Er wusste, dass sie mit den südskånischen Mårtenssons gut zurechtkam, und sie hielt ihr Versprechen und redete mit Schwiegervater und Schwager. Beide akzeptierten den Namenswechsel (was blieb ihnen auch anderes übrig?) und schüttelten lächelnd den Kopf über diese erfindungsreiche junge Frau aus Slottshem, während sie gleichzeitig insgeheim Thures Mangel an Courage und Familienloyalität verfluchten.
Er hätte dagegenhalten müssen. Sie selbst konnten nichts ändern.
Nach der Dusche zog Thure Castelbo nur Jeans und T-Shirt an, da er heute freihatte, und zu seiner Überraschung fand er seinen ältesten Sohn Erik schon am Frühstückstisch. Der schlief doch sonst samstags immer lange.
»Schon auf?«
Erik begnügte sich mit einem mürrischen Kopfnicken als Antwort auf diese rhetorische Frage. Seine Morgenlaune war nicht die allerbeste.
Aber nach einem Teller Sauermilch und zwei Gläsern Orangensaft taute er allmählich auf. Vater und Sohn unterhielten sich gemütlich, und Erik machte sich zum Aufbruch bereit.
Er stand auf, nahm seinen Teller, hielt aber mitten in der Bewegung inne. Dann stellte er den Teller wieder hin und setzte sich.
»Papa?«
»Ja?«
»Ich muss dich was fragen.«
»Schieß nur los.«
»Weißt du noch, als ich klein war und dich gefragt habe, was du zu Weihnachten oder zum Geburtstag von mir geschenkt haben möchtest?«
Castelbo senior nickte und versuchte zu erraten, worauf sein Sohn wohl hinauswollte.
»Du hast dann immer gesagt, dass du keinen Plunder haben wollest, sondern ›einen braven Jungen‹. Du kannst dir nicht vorstellen, wie du mich mit diesen dummen Worten genervt hast. Ich wollte eine richtige Antwort, nicht so einen Spruch. Erinnerst du dich?«
»Natürlich erinnere ich mich daran, dass du immer wütend geworden bist. Das tat mir Leid. Ich wollte dich ja nicht verletzen. Aber was ...«
»Genau, und jetzt will ich nicht so eine dumme Antwort haben. Nicht noch einmal. Ich bin nicht mehr neun Jahre alt. Jetzt möchte ich die Wahrheit hören.«
»Ich verstehe nicht.«
»Gib mir eine richtige Antwort!«
»Dann stell erst mal deine Frage.«
»Was ist mit Mama los?«
»Was meinst du damit?«
»Habe ich nicht gesagt, du sollst diese Maske weglassen? Bist du blind oder was? Du siehst doch wohl auch, dass sie nicht die Alte ist. Warum ist sie beispielsweise jetzt nicht hier? Sie ist doch sonst immer die Erste beim Frühstück. Immer. Ich möchte wissen, was mit ihr nicht stimmt. Sie ist nicht wie sonst, schnauzt einen an, sobald man sie anspricht. Ich traue mich gar nicht, sie zu fragen, was eigentlich los ist. Sie ist doch wohl nicht krank?«
Etwas Frostiges umklammerte Thure Castelbos Herz.
»Nein, das kann ich mir nicht denken.«
»Aber du weißt es nicht?«
»Nein«, musste er zugeben.
»Du musst es doch auch gemerkt haben, oder? Du kennst sie schließlich am längsten. Siehst du wirklich nicht, dass sie sich merkwürdig benimmt?«
»Jetzt, wo du es sagst, muss ich zugeben ...« Er brach ab, als er ein leises Klirren aus dem oberen Stockwerk hörte.
»Sie ist aufgewacht«, flüsterte Thure.
Der Sohn beugte sich zu ihm vor und fragte leise: »Sie ist doch noch nicht in den Wechseljahren, oder? Ist sie schon so alt?«
Die Schritte auf der Treppe befreiten ihn von dem Zwang, darauf antworten zu müssen.
Im nächsten Augenblick stand sie in der Küche, in einem weißen Bademantel mit roten Passen. Sie blinzelte verschlafen.
»Ach, habt ihr schon fürs Frühstück gedeckt? Wie lieb von euch. Ich glaube, ich habe verschlafen. Habe gar nicht gemerkt, dass es schon so spät ist. Du hättest mich wecken sollen.«
»Ich dachte, du brauchst deinen Schlaf.«
»Nein, ich sollte lieber aufstehen, anstatt herumzuliegen bis weit in den Tag hinein.«
Erik gab seiner Mutter einen Kuss auf die Wange und warf seinem Vater einen wissenden Blick zu, dann ging er.
Bei der zweiten Tasse Tee wurde ihr Ton plötzlich scharf: »Eigentlich bin ich böse auf dich.«
Verwirrt ließ er die Zeitung sinken und schaute sie an. Sie lachte, aber ihr Lächeln war steif und unnatürlich, als bemühte sie sich krampfhaft, fröhlich auszusehen.
»Zumindest sollte ich das«, fuhr sie fort, »nach dem, was heute Nacht passiert ist.«
»Heute Nacht?«
»Ja, ich habe geträumt, dass du mit einer Japanerin aus warst, du Schurke, und du bist erst in den frühen Morgenstunden nach Hause gekommen. Du musst mit ihr geschlafen haben. Hast du denn gar keine Scham mehr?« Thure stieß einen Pfiff aus.
»Daran kann ich mich nicht mehr erinnern«, probierte er es.
»Du kannst dir nicht vorstellen, wie weh das tat.«
»War sie jung?«
Sie nickte.
»Und hübsch?«
»Das auch.«
»Na ja, sonst hätte sie mich wohl auch nicht interessiert.«
»Mach dich nur darüber lustig, du weißt ja nicht, was für ein Gefühl das war.«
Ihre Stimme kippte, sie ließ ihren Kopf auf den Tisch fallen, ihre Schultern zuckten vom Weinen.
Erschrocken und bestürzt sprang er auf, lief um den Tisch herum und umarmte sie.
»Fass mich nicht an!«, schrie sie, und er ließ sie sofort los, als hätte er sich an einer glühend heißen Herdplatte verbrannt.
Mittlerweile war seine bisherige Beunruhigung in Angst übergegangen. Da war etwas ernsthaft nicht in Ordnung, das war ganz offensichtlich. So unbeherrscht und hysterisch hatte sie sich noch nie verhalten.
»Liebling«, sagte er vorsichtig, »was ist mit dir los? Du weißt doch, dass ich dich nie hintergehen würde, nicht einmal im Traum.«
»Ich weiß«, bestätigte sie jammernd, aber ohne aufzuschauen. »Das ist es ja auch nicht, es ist was anderes.«
Er blieb reglos stehen, sorgsam darauf bedacht, sie nicht zu berühren.
Sag jetzt nicht, dass du krank bist. Alles, aber nicht das.
Die Minuten vergingen.
»Ich liebe dich so sehr«, sagte sie schließlich und wandte ihm ein tränenüberströmtes Gesicht zu.
Er wagte ein sanftes: »Ich dich auch.«
»Aber du weißt ja nicht, was passiert ist. Die letzten Tage waren der reinste Albtraum, ich habe mich nicht getraut, es dir zu erzählen, habe immer gehofft, es würde einfach aufhören. Aber er ist immer wieder dran gewesen, immer wieder, und jedes Mal ekliger.«
Berge von Fragen türmten sich in ihm auf, aber er war klug genug, sie nicht zu unterbrechen. Die Zeit war offenbar gekommen. Sollte er endlich erfahren, was sie so bedrückte?
»Er hat gesagt, ich dürfe es dir nicht erzählen, dann würde er noch schlimmere Sachen machen. Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie ekelhaft und bedrohlich er ist.«
Wer?, dachte er. Wovon redest du eigentlich?
Aber er schwieg weiter.
Sie stand auf und holte einen Bogen Haushaltspapier von der Anrichte. Damit wischte sie sich die Augen.
»Wie ich aussehe.«
»Du siehst reizend aus.«
»Wirklich?«
»Absolut.«
»Ganz sicher?«
»Ich schwöre es!«
»Bin ich reizender als diese Japanerin, diese junge, hübsche Frau, mit der du dich letzte Nacht vergnügt hast?«
»Gar kein Vergleich. Du übertriffst sie um Klassen.«
Sie lachte bleich.
»Eva-Louise, willst du nicht ...«
»Doch«, sagte sie und schob sich auf seinen Schoß. »Doch, das will ich.«
Und dann begann sie zu erzählen.
— Fünftes Kapitel
Parallel zum Stadtzentrum erstreckte sich ein zwei Kilometer langer Grünstreifen, der einfach nur »der Park« genannt wurde. Das heißt, im Augenblick war er nicht besonders grün. Die Bäume standen kahl und mit knorrigen Ästen da, warteten auf ihren Schmuck, der in sechs, vielleicht sieben Wochen wieder einen prächtigen Überfluss an Leben und Farben darbieten würde.
Am nördlichen Ende des Parks, nicht weit entfernt vom Hauptbahnhof, lagen ein Vogelteich und ein schönes Fachwerkhaus, das seit einem Jahr als Touristikbüro diente.
Hier befand sich auch eines der Gebäude, auf die man in der Stadt besonders stolz war: eine sorgfältig renovierte Badeanstalt mit Schwimmhalle, die schon mehr als ein Jahrhundert auf dem Buckel hatte.
Ein riesiges Schild informierte darüber, dass dieses gern besuchte Etablissement nunmehr unter dem treffenden Namen »Badehaus« figurierte. Aber wohl aus etwas kuriosen Gründen der Pietät befand sich der ursprüngliche Name noch auf einer neben dem Eingang befestigten Metallplatte: »Allgemeine Waschanstalt der Stadt«.
In den letzten Jahren war Sten Wall zu einem Stammgast des Badehauses geworden. Während er früher höchstens einmal im Vierteljahr hier zu Gast gewesen war, brachte er es jetzt auf mindestens einen Besuch pro Woche.
Er ging aber eigentlich nie in die Schwimmhalle, da es ihm peinlich war, seine ausufernde Körperfülle der Allgemeinheit zu zeigen. Es machte ihm jedoch nichts aus, sich im Saunabereich zu bewegen, wo er allzu vielen kritischen Blicken entging. Sich unter den anderen, oft ebenfalls nicht so wohlgeratenen Körpern unbekleidet zu zeigen, war irgendwie legitim, während der Kontrast zwischen sich und den durchtrainierten Jugendlichen, die draußen an den Bassins regierten, doch zu unappetitlich wäre. Das war zumindest seine eigene Einschätzung. Manchmal war er reichlich selbstkritisch.
Meistens fanden seine Saunabesuche während der freien Stunden am Wochenende statt. Da er allerdings reichlich Überstunden abzubummeln hatte, kam es aber dann und wann auch mal vor, dass er sich den Luxus eines angenehmen Saunabesuchs während der normalen Arbeitszeit gönnte.
Heute hatte er seinen freien Samstag und genoss in vollen Zügen die Trockensauna, die er momentan in herrlicher Einsamkeit benutzen konnte. Eigentlich zog er die Dampfsauna oder eine der anderen ›feuchteren‹ Varianten vor, aber dort herrschte so ein beängstigendes Gedränge, dass ihm die Entscheidung nicht schwer fiel.
Bereits nach wenigen Minuten begannen sich auf seinem fülligen Körper die Tropfen abzuzeichnen. Er wischte sich die Augen mit einem Handtuchzipfel ab und starrte dann fasziniert auf die Innenseite seiner Knöchel. Vor ein paar Monaten hatte er eine sonderbare Sache entdeckt, geradezu ein Phänomen.
Es war nämlich so, dass der Bereich um seinen linken Knöchel herum schnell mit einem Perlenband von Schweißtropfen besetzt war, während der rechte im Vergleich vollkommen trocken blieb. Zuerst glaubte er, es handele sich um einen merkwürdigen Zufall, aber das Muster blieb so. Jedes Mal.
Er schloss die Augen und döste vor sich hin. Als etwas vor der Saunakabine klapperte, zuckte er zusammen und betrachtete neugierig seine Füße.
Am linken Knöchel waren Horden von glänzenden Schweißperlen hervorgetreten, groß wie Glyzerintränen. Auf dem rechten konnte er dagegen nur ein leichtes Glänzen erkennen, keinerlei Andeutung zur Tropfenbildung.
Wall überlegte, ob er einen Arzt aufsuchen sollte, um herauszubekommen, warum so ein großer Unterschied zwischen zwei Füßen bestehen konnte, die doch den gleichen Besitzer hatten, musste aber selbst einsehen, dass er damit ja wohl Schindluder mit der Zeit der medizinischen Fachleute treiben würde.
Er hatte jetzt lange genug in der Hitze gesessen und machte sich bereit, seinen breiten Hintern zu heben, um draußen in den Genuss einer erfrischenden Abkühlung zu kommen. Da wurde die Tür aufgerissen. Herein stürmten drei lautstarke junge Männer und ließen sich auf der mittleren Bank nieder, womit sie dem Polizeibeamten sehr effektiv den Weg versperrten.
Rücksichtsvoll, wie er war, beschloss Wall, eine Weile mit seinem Abgang zu warten. Wenn er jetzt sofort ginge, könnten die jungen Eindringlinge ja denken, er habe etwas gegen sie (was ja eigentlich auch stimmte) und verlasse deshalb die Sauna demonstrativ.
Also schob er seine Pobacken wieder auf dem Handtuch zurecht und biss die Zähne zusammen, obwohl ihm bereits leicht schwindlig wurde. Als dann aber sein Puls sich deutlich erhöhte, war er gezwungen aufzubrechen.
Eine Entschuldigung murmelnd, kletterte er von seinem Platz hinunter, und die Jugendlichen machten ihm etwas widerstrebend Platz.
Es war ein herrliches Gefühl, in den Duschraum zu kommen. Er holte ein paar Mal tief Luft, während er wartete, dass sich das Herzklopfen wieder beruhigen würde.
Im nächsten Moment riss er die Augen vor Überraschung weit auf.
Auf dem nassen, rutschigen Kachelboden kam ihm eine Person entgegengeschlendert, die er noch niemals in dieser Umgebung gesehen hatte und von der er niemals erwartet hätte, sie überhaupt hier zu treffen.
Helge Boström.
Der Distriktsleiter trug altmodische Shorts, die ihm fast bis zu den Knien reichten. Er war so mager, dass seine Rippen deutlich unter der Haut hervorstachen, und in dem scharfen Licht der Neonröhren sah er fast ungesund weiß aus. Jedenfalls ist er bleicher als ich, stellte Wall fest, und das nicht ohne Befriedigung.
»Hallo, alter Eber! Ich wusste doch, dass ich dich hier treffen würde«, rief Boström zufrieden.
Wall konnte vor Verwunderung nur stumm nicken.
»Vor fünf Jahren habe ich Ethel versprochen, Sport zu treiben, dann ist es jetzt wohl an der Zeit, endlich damit anzufangen. Ich habe vor, draußen in der Halle ein paar Runden zu schwimmen, dann könnten wir hinterher miteinander reden. Oder willst du mitschwimmen?«
»Nein, ich war gerade in der Sauna. Willst du etwas Besonderes?«, wunderte Wall sich, der immer noch Probleme damit hatte, das unerwartete Auftauchen seines Kollegen zu verdauen.
»Nein, nur reden«, wiederholte Boström und tat anschließend etwas vollkommen Überraschendes.
Er fischte ein zerknittertes Päckchen Zigaretten aus einer seiner Shorttaschen und ein Feuerzeug aus der anderen. Inmitten dieser ganzen tropfenden Feuchtigkeit gelang es ihm gleich beim ersten Mal, die Zigarette anzuzünden, woraufhin er gierig den Rauch einsog.
Das ist bestimmt das erste Mal, dass hier drinnen jemand raucht, dachte Wall und machte ein kritisches Gesicht.
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Boström, »Rauchen verboten und so. Glaubst du, ich würde den Silja-Westin-Blick nicht sofort erkennen?«
Silja Westin war eine junge Staatsanwältin, die dem Distriktsleiter unerschrocken klargemacht hatte, dass sie es nicht dulden würde, wenn er in ihrer Gegenwart rauchte. Seitdem kam er nicht mehr mit ihr zurecht.
Boström nahm noch zwei Züge, drückte dann die kaum gerauchte Zigarette ohne sichtliche Verlegenheit in einer Wasserrinne an einer der Wände aus und warf die Kippe in einen Papierkorb.
»Jetzt ist es aber an der Zeit, sich draußen im Wasser zu quälen«, erklärte Boström hustend, »danach sehen wir uns in der Cafeteria, sagen wir in einer Viertelstunde, ja? Ich lade dich zum Kaffee ein.«
Wall war nicht in der Lage zu protestieren. Sein Kreislauf war immer noch zu sehr geschwächt, als dass er in der Lage gewesen wäre, einen Disput einzuleiten
.
Vermutlich ist etwas mit Ethel los, überlegte Wall, das hier hat ja wohl kaum etwas mit dem Job zu tun. Dann hätte er sich doch auf jeden Fall während der üblichen Arbeitszeit an mich gewandt und mich nicht hier aufgesucht. Und dieses Gerede, mit sportlicher Betätigung anfangen zu wollen, das war natürlich nur ein Vorwand.
Ab und zu benutzte Boström Wall als Diskussionspartner, als Zulieferer von Denkanstößen, auch in Fragen rein privaten Charakters.
Um so etwas in der Art würde es sich jetzt wohl auch handeln.
Wall spekulierte, dass es sich um eine Urlaubsreise im Sommer handeln könnte, und bereitete sich auf eine lange Litanei darüber vor, wie unglaublich anstrengend und nervend es war, sich auf Reisen zu begeben.
Helge Boström war ein hartnäckiger Gegner jeder räumlichen Veränderung überhaupt, und ganz besonders hasste er es, sich ins Ausland zu begeben.
Soweit Wall wusste, hatte der Chef abgesehen von einigen Dienstreisen – unter anderem ein paar in die USA – bisher nur zwei längere Auslandsaufenthalte absolviert, beide Male auf Drängen seiner Frau, die im Gegensatz zu ihrem Mann äußerst reiselustig war.
Wirklich ein Paar der Gegensätze, dachte Wall, sie hübsch, mollig, reiselustig, entdeckungsfreudig, Nichtraucherin und Weintrinkerin, er hässlich, mager, heimatverbunden, blasiert, Kettenraucher und fast alkoholabstinent.