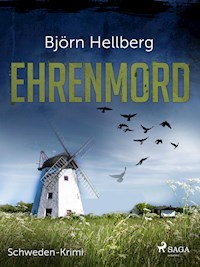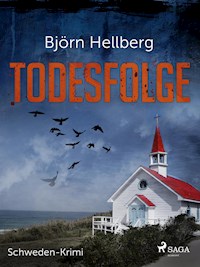
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sten Walls dritter Fall
- Sprache: Deutsch
Zwei merkwürdige Morde im Sektenmilieu: Erst wird der Pfarrer der Sekte "Die Gottesboten" mit roten High Heels ermordet, dann wird die gläubigste Anhängerin der religiösen Gemeinschaft in ihrer Badewanne ertränkt. An Verdächtigen mangelt es Kommissar Sten Wall nicht, da die Sekte sich nicht gerade beliebt gemacht hat, aber trotzdem gibt es keine Gewissheiten. Als dann auch noch ein Kollege von Wall gekidnappt wird, muss er so schnell wie möglich den oder die Täter finden.Höchste Spannung und viel Lokalkolorit verspricht die beliebte 23-teilige Krimi-Serie um den sympathischen schwedischen Kriminalkommissar Sten Wall. Die meisten Fälle spielen in der fiktiven Stadt namens Stad in der südschwedischen Provinz Schonen. Bei SAGA Egmont sind die Bände \"Ehrenmord\", \"Mauerblümchen\", \"Todesfolge\", \"Grabesblüte\" und \"Quotenmord\" erhältlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Björn Hellberg
Todesfolge - Schweden-Krimi
Saga
Todesfolge - Schweden-Krimi
ÜbersetztAstrid Arz
Coverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 2004, 2020 Björn Hellberg und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726444933
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Der erste Herbst
»Es ist also wirklich dein Ernst, dass wir ihn opfern sollen?«
»Du drückst dich so drastisch aus.«
»Aber darauf läuft es doch hinaus, oder?«
»Wir müssen ja nicht gleich das Schlimmste annehmen.«
»Er ist das Liebste, was wir haben.«
»Ja, auf der Erde. Ganz deiner Meinung.«
»Aber wir leben und schaffen nun mal hier auf der Erde. Jedes Leben hat seine Zeit.«
»Laura!«
»Ich wollte nichts Ketzerisches sagen.«
»Ich liebe ihn auch. Genauso sehr wie du.«
»Und trotzdem ...«
»Trotzdem was?«
»Trotzdem stimmst du einer ärztlichen Behandlung nicht zu.«
»Du bist doch selbst mit dem Standpunkt der Gemeinde einverstanden.«
»Die Gemeinde kann mich mal!«
»Bitte schrei doch nicht so.«
»Entschuldige, aber hier geht es um unseren Sohn, begreifst du das nicht? Und er kann gerettet werden, wenn du deine Härte ablegst.«
»Mit Härte hat das überhaupt nichts zu tun. Das solltest du begreifen.«
»Ich kämpfe um unser einziges Kind und sein Recht zu leben. Ein Achtjähriger, der noch alles vor sich hat!«
»Es gibt etwas, das wichtiger ist als wir Menschen.«
»Was kann wichtiger sein als unser Sohn?«
»Und das fragst du, nach all den Jahren? Die himmlischen Werte natürlich.«
»Für mich wird mein Kind immer Vorrang haben.«
»Schweig jetzt still! Versündige dich nicht, Frau. Was ist in dich gefahren? Dies ist das Haus Gottes, und ich dulde keine Entweihung, auch nicht aus deinem Mund.«
»Die Liebe zu meinem Sohn ist doch keine Entweihung. Zu unserem Sohn. Steht nicht in der Schrift, dass es die Pflicht der Mutter ist, ihre Nachkommenschaft zu schützen?«
»Vielleicht hast du nur nicht gewusst, was du da eben gesagt hast, also vergessen wir es.«
»Du gibst also nicht nach? Bist in dieser Frage nicht zu bewegen? Wirst deine Meinung nicht ändern?«
»Wir haben unser Schicksal nicht selbst in Händen. Die Entscheidung liegt in höheren Händen als denen des modernen Gesundheitswesens. Vertrauen wir darauf, dass sich alles zum Besten finden wird. Lass uns zusammen beten, um Klarheit zu finden. Fassen wir Zuversicht.«
»Bei dir hört sich das so einfach an, so ... harmlos.«
»Wir müssen uns an Gottes Wort halten, das weißt du so gut wie ich. Denk an Abraham, der bereit war, auf Befehl des Herrn seinen Isaak zu opfern.«
»Komm mir jetzt nicht wieder damit.«
»Er hatte das Messer erhoben, ohne jeden Zweifel bereit, sich dem göttlichen Befehl zu fügen, obwohl er Isaak so vollkommen liebte, so vorbehaltlos.«
»Ich bin nicht wie Abraham. Ich will nicht dazu beitragen, dass der, den ich am allermeisten liebe, ein viel zu frühes Ende nimmt.«
»Du weißt, was geschah. Gott hat den Ritus aufgehalten und ließ Isaak am Leben. Er wollte nur den Beweis von Abrahams vollkommener Treue. Den er bekam. Niemand kam zu Schaden. Fassen wir also Zuversicht, legen wir alles in die Hände des Herrn.«
»Und wenn das Schlimmste eintrifft?«
»Das wollen wir nicht hoffen.«
»Aber wenn doch?«
»Dann ist es Sein Wille. Es entzieht sich menschlichem Einfluss, wir können uns nur mit dem Unabänderlichen abfinden, ob wir wollen oder nicht.«
»Jetzt nimm doch endlich einmal Vernunft an! So weit muss es doch gar nicht kommen! Noch können wir den Verlauf stoppen.«
»Opfer hat es immer gegeben und wird es immer geben. Abraham ist bei weitem nicht der Einzige, der ...«
»Ich verachte Abraham, weil er sich nicht auf sein eigenes Urteil verließ, weil er nicht auf sein Herz hörte. Und ich bezweifle stark, dass er überhaupt echte und tiefe Gefühle für seinen Sohn hatte. Hätte er Isaak wirklich geliebt, dann wäre ihm nie auch nur in den Sinn gekommen, ihn zu töten, sondern er hätte so einen wahnsinnigen, unchristlichen Befehl an sich abprallen lassen.«
»Das will ich nicht gehört haben.«
»Eine Mutter hätte sich nie wie Abraham verhalten, ganz gleich, was Gott ihr befohlen hätte. Sie hätte ihm getrotzt, ohne sich um die Folgen zu scheren.«
»In der Geschichte von Gottes Befehl an Abraham geht es im Grunde um Glauben und Gehorsam.«
»Glaube und Gehorsam! Das zeichnete auch Hitlers Schergen aus, nicht wahr?«
»Schweig jetzt, Laura. Ich verstehe, dass du außer dir bist und nicht weißt, was du da sagst, aber du musst aufhören, bevor es zu spät ist, ist das klar?«
»Du lässt ja überhaupt nicht mit dir reden. Hast du denn gar kein Herz?«
»Bitte, liebe Laura, beruhige dich.«
»Liebst du mich?«
»Was für eine Frage. Ja, das weißt du doch. Ich habe dich immer geliebt. Jetzt mehr denn je.«
»Aber dann ...«
»Vertrau mir. Und Ihm.«
»Ich weiß, das sollte ich, aber es ist so schwer. So furchtbar, nicht zu wissen ... die ganze Zeit diese schreckliche Angst vor dem zu haben, was geschehen kann.«
»Glaube versetzt Berge, vergiss das nicht.«
»Dann muss ich es wohl versuchen. Aber wenn Lars ...«
»Wein nicht, Laura, bitte weine nicht.«
Der erste Winter
»Jetzt bist du also einverstanden? Nach all den Wochen?«
»Ja.«
»Und du wirst es dir nicht anders überlegen?«
»Für wen hältst du mich eigentlich? Glaubst du, dass ich etwas so Grausames täte? Dich erst in Hoffnungen wiegen und dann alles zurückziehen? So handelt kein verantwortungsvoller Mensch. Nicht einer. Nein, wenn ich etwas einmal gesagt habe, stehe ich zu meinem Wort. Das solltest du mittlerweile wissen.«
»Ach, wie wunderbar. Ich liebe dich.«
»Und ich dich.«
»Was hat dich zu diesem Umschwung bewegt?«
»Ich ertrage dein Leiden nicht länger. Und Lars’ Leiden auch nicht. Ihr beide bedeutet mir so ungeheuer viel, ich habe keine andere Wahl mehr. Es tut so unerträglich weh, mit ansehen zu müssen, wie sich die liebsten Menschen tagaus, tagein quälen.«
»Wenn du wüsstest, wie ich gehofft und gebetet habe, dass es so kommt! Wenn es jetzt nur nicht zu spät ist.«
»Das glaube ich nicht. Aber du verstehst natürlich, was das bedeutet?«
»Dass unser Sohn gerettet werden kann.«
»Natürlich. Aber ich denke vor allem an noch etwas anderes.«
»Was meinst du?«
»Das begreifst du sicher, wenn du nachdenkst.«
»Ach ja? Damit müssen wir uns dann eben abfinden.«
»Das sagst du so leichthin. Sind dir die Folgen nicht bewusst? Ist dir nicht klar, wie viel uns die Gottesboten bedeuten? Die Entwicklung, die auf uns zukommt, ist für mich schon jetzt die reinste Tragödie.«
»Aus der Gemeinde ausgeschlossen zu werden ist keine wahre Tragödie. Wenn Lars nicht mehr zu retten ist, erst dann müssten wir von einer richtig großen Tragödie reden, über die wir unmöglich hinwegkommen könnten.«
Der Frühling
»Prost.«
»Prost.«
»Ah, das geht runter wie Öl.«
»Genau, was ich jetzt brauchte. Übrigens, was meinst du ...«
»Ja?«
»Du hast ja die gesehen, mit der ich zusammenwohne.«
»Pirjo? Klar hab ich die gesehen.«
»Und was meinst du?«
»Die wird schon in Ordnung sein.«
»In Ordnung? Bist du blind, Mann? In Ordnung, die in Ordnung? Verdammter Lügner.«
»Was passt dir denn nicht an ihr?«
»Du hast ja keine Ahnung, was für eine phantastische Braut ich vorher hatte. Was anderes als die fette Kuh, die ich jetzt am Bein hab. Scheiße, das ist doch ein Witz, mit der kann man sich nicht mal auf der Straße zeigen.«
»Ich hab schon üblere Weiber gesehen als Pirjo.«
»Dann nimm du sie doch. Ich will sie nicht mehr.«
»Reg dich ab, sonst kochst du noch über. So schlimm kann es mit Pirjo doch wohl nicht sein. Sie ist vielleicht keine, nach der man sich auf der Straße umdreht, aber so verkehrt ist sie nun auch wieder nicht. Du bist bloß blau.«
»Blödsinn! Ich bin noch nie so nüchtern gewesen. Pirjo ... manchmal hab ich gute Lust, dem Weibsstück und ihren beschissenen Hurenbälgern die Luft zum Leben abzudrehen.«
»Warum bleibst du dann, wenn du das so siehst?«
»Gute Frage. Was hast du übrigens gesagt?«
»Warum haust du nicht ab?«
»Du weißt ja, wie es ist.«
»Vielleicht.«
»Du hättest Mia sehen sollen.«
»Hieß sie so?«
»Hä?«
»Mia, die hast du doch grade erwähnt, ist das die Sexbombe aus Stad?«
»Mia, so heißt sie. Verflucht hübsch. Riesenmöpse. ’ne echte Wuchtbrumme. Eins a im Bett.«
»Warum war dann Schluss mit der?«
»Wieso Schluss?«
»Wieso bist du nicht bei der Tussi, die eins a im Bett ist, statt bei dieser Pirjo und ihren Blagen?«
»Da war Schluss.«
»Das sag ich doch. Du hast sie also verlassen, diese phantastische Nummer eins, oder was?«
»Sie hat mit mir Schluss gemacht. Das ist alles die Schuld von diesem verdammten elenden schleimigen Scheißpriester. Wenn der Idiot ihr nicht lauter Grillen ins kleine Hirn gesetzt hätte, wär sie heute noch bei mir.«
»Kleines Hirn, große Möpse ...«
»Hör mir bloß damit auf! Mit Mia ging’s mir richtig gut, und ihr mit mir. Na ja, dann und wann hab ich ihr natürlich eine reingehauen, wenn sie sich zu dämlich anstellte, denn manchmal konnte sie sich schon ein wenig dämlich anstellen. Aber eine kleine Abreibung hin und wieder hat ihr ja wohl nicht geschadet. Die war prachtvoll und geil bis zum Abwinken, aber dann musste ja dieser Pastor kommen und uns alles kaputt machen ... Sieh mich jetzt an! Pirjo, da kann man ja gleich den Strick nehmen.«
»Du siehst ganz so aus, als ob du noch einen Rachenputzer brauchst. Und ein schönes Pils dazu.«
»Da sagst du was.«
»Geht auf meine Rechnung.«
»Danke. Aber bin ich nicht dran?«
»Genau genommen ...«
»Du musst wohl auch das hier übernehmen. Pirjo hält mich ziemlich knapp, nächste Woche kriegst du es wieder, versprochen. Du weißt ja, auf mich kannst du dich verlassen.«
»He da, komm mal her! Zwei Schnäpse und zwei große Bier – und zwar dalli. Wir haben nicht die Zeit, den ganzen Tag hier rumzuhängen und Löcher in die Luft zu starren.«
Der Sommer
»Warum hast du so lange gebraucht, um zur Tür zu kommen? Ich steh hier schon ewig und klingle und klopfe.«
»Ich hab geschlafen.«
»Das merkt man, Sverker. Du musst schon entschuldigen, aber du siehst schlimm aus. Und wie du riechst! So kann es nicht mehr lange weitergehen. Du musst dich zusammenreißen.«
»Na, so schlimm ist es auch wieder nicht. Es ist bloß noch so früh ...«
»Früh! Wir haben fast drei Uhr nachmittags.«
»Doch schon?«
»Bittest du mich nicht herein?«
»Wenn es hier bloß nicht so unaufgeräumt wäre.«
»Das ertrage ich.«
»Und dann der Gestank.«
»Wir lüften alles Schlechte aus.«
»Ein andermal. Mir geht’s heute nicht so gut.«
»Warte! Geh jetzt nicht gleich in die Küche, um einen Schluck gegen den Kater zu nehmen.«
»Sie müssen schon entschuldigen, Herr Pastor, aber eins muss ich sagen: Ich habe den allergrößten Respekt vor Ihnen, Herr Bravander, das wissen Sie, das wissen alle. Aber Sie verstehen nicht alles.«
»So viel verstehe ich wohl: Du bist viel zu versessen auf Alkohol, Bruder. Ich sehe doch, wie du leidest. Und wenn jemand so übel dran ist, ist es meine absolute Pflicht als Christenmensch, zu Hilfe zu kommen. Wie du hier überhaupt wohnst! Mitten in der Pampa. Mit Sperrholz an den Wänden. Wir müssen uns unterhalten, also lass mich bitte rein.«
»Ein andermal.«
»Anhaltend ungezügelter Alkoholkonsum führt zu Untergang und Verderben.«
»Aber das ist ja wohl doch meine Sache, Bravander.«
»Da bin ich anderer Meinung. Du bist krank. Und einen Kranken muss man versuchen zu heilen. Das versteht sich von selbst. Es ist einfach meine Pflicht als Christenmensch, dir zu helfen.«
»Steht nicht an irgendeiner Stelle in der Bibel, dass man sich um sich selber kümmern und nicht um die anderen scheren soll?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Jammerschade. So etwas sollte da stehen.«
»Versuch nicht, mich zum Lachen zu bringen. Darüber macht man keine Witze. Na los, lass mich jetzt rein!«
»Entschuldigung, Herr Pastor, aber mir geht’s nicht so gut. Wiedersehen.«
»Sverker Johansson! Mach auf, hörst du! Du bist so dickschädelig. Jetzt sei so gut und benimm dich wie ein zivilisierter Mensch. Mach die Tür auf, wie oft muss ich das noch sagen? Wenn du weiter so störrisch bist, hole ich die Polizei. Ich gehe jetzt, aber ich komme wieder. Glaub ja nicht, dass ich einen Bruder in Not allein lasse.«
»Wie lange müssen wir unsere Gefühle noch verheimlichen?«
»Nicht mehr lange. Wir legen die Karten auf den Tisch und fangen damit an, dass wir unsere Hochzeit im Herbst bekannt geben. Das ist das einzig Ehrliche.«
»Sind wir dazu bereit?«
»Unbedingt. Ich bin’s auf jeden Fall.«
»Dann bin ich es auch. Daran brauchst du nicht zu zweifeln.«
»Das mach ich auch nicht. Nicht einen Augenblick.«
»Aber was wird mit ... na ja, du weißt schon.«
»Der Gemeinde, meinst du?«
»Genau. Ich kann mir denken, dass sie es in den Kreisen nicht gerade gnädig aufnehmen.«
»Vielleicht.«
»Und was machen wir dann?«
»Wir heiraten trotzdem.«
»Mit oder ohne ihre Zustimmung?«
»Mit oder ohne ihre Zustimmung.«
»Und wenn du ausgeschlossen wirst?«
»Das werde ich schon nicht.«
»Ganz sicher?«
»Mein Urgroßvater hat die Gottesboten hier in der Stadt mitbegründet, mein Vater wurde sogar für den Rat vorgeschlagen. Sie können mich nie ausstoßen, und das wissen sie auch.«
»Ich liebe dich, Steve.«
»Du weißt ja, Martin, das beruht auf Gegenseitigkeit.«
»Ich weiß.«
Der zweite Herbst
1 Seit einigen Tagen leistete ein so selten gesehener wie unerwünschter Gefährte Agne Bravander Gesellschaft: die pure unverblümte Angst.
Er hatte sie seit dem Tag nicht mehr gekannt, als er beschlossen hatte, den Rest seines Erdenlebens dem Ruf zu weihen, der seit Jahren seine ganze Leidenschaft und sein Brotverdienst war.
Wer sein Schicksal in die Hände des Herrn legt, hat nichts zu fürchten.
Das war ein so klarer Grundsatz, dass er sich nie den Kopf über eine Alternative zerbrochen hatte.
Und doch war er nun zum ersten Mal seit seinen Jugendjahren verängstigt und fassungslos.
Nicht aus Sorge um sich selbst – er konnte sich ja an seinem unerschütterlichen Glauben festhalten –, sondern wegen der unausweichlichen Folgen, die sich ergeben würden, wenn ihm etwas zustieße.
Wenn ihm etwas zustieße ...
Ein beschönigender Ausdruck für das eigentlich Gemeinte.
Als Kind hatte Agne Bravander vor so vielem Angst gehabt. Von liebevollen und gottesfürchtigen Eltern überbehütend erzogen, hatte er sich vor der Welt außerhalb der Geborgenheit in den eigenen vier Wänden gefürchtet. Er war klein und schmächtig – Zweitkleinster der ganzen Klasse, einschließlich Mädchen – und war oft der Prügelknabe für brutale Mitschüler gewesen, vor allem auch, weil er sich kaum oder gar nicht zur Wehr setzte.
Doch nicht nur die Unterdrückung durch Gleichaltrige in der Schule hatte ihm Angst gemacht. Er hatte vor so vielem anderen gezittert: davor, dass eine Krankheit oder die Ungnade der Lehrer ihn treffen könnte, dass er sich im Unterricht blamierte, dass ihm ein Unglück zustieß, dass seine Eltern zu früh sterben könnten, davor, dass er die falschen Sachen zur falschen Zeit sagen könnte. Er hatte Angst vor Treppen und Höhen, vor Spinnen und Wintern, vor Tanzen und kochend heißem Wasser, vor Mädchen und Fangen und schließlich davor, in der Führerscheinprüfung durchzufallen – eine endlos lange bedrückende Liste, die von Tag zu Tag länger wurde.
Die dünne, besorgte Stimme seiner Mutter begleitete ihn fast ständig: Mach die Jacke zu, sonst erkältest du dich. Schau dich immer gut um, wenn du zur Schule radelst. Hast du deine Hausaufgaben ordentlich gemacht?Du wirst deinen Vater doch wohl nicht stören, jetzt, wo er über seine Predigt nachdenken muss? Du weißt doch, dass er seine Ruhe braucht, also stell doch bitte das Radio leiser, hörst du.
Seine Tage waren eine einzige Anhäufung aneinander gereihter Qualen, und manchmal hatte er sogar ernsthaft an das so ziemlich Unverzeihlichste und Verächtlichste überhaupt gedacht: Selbstmord.
Im Geiste sah er sich dann auf seiner Bahre liegen, kalt und reglos, und seine Eltern vor Trauer und Selbstvorwürfen zusammenbrechen. Diese Vorstellung trieb ihm solch demoralisierende Gedanken rasch wieder aus.
So überwand er das Problem – sein Glaube musste schon damals existiert haben, ohne dass er sich dessen bewusst gewesen wäre –, und als er achtzehn war, begegnete er Gott.
Eines Nachts in seinem Zimmer, Auge in Auge.
Am nächsten Morgen wusste er nicht, ob es ein Traum gewesen war oder ob es sich wirklich ereignet hatte, aber seine frühere Unsicherheit und Ängstlichkeit waren so gut wie verschwunden.
Zur maßlosen Freude seiner Eltern erzählte er, dass er es seinem Vater gleichtun und sich zum Pfarrer einer freikirchlichen Gemeinde ausbilden lassen wollte. An der überschwänglichen Reaktion erkannte er, dass sie Zweifel an dem Glauben ihres Sohnes gehabt hatten. Gerührt hatte er sich vorgenommen, sie nie zu enttäuschen.
Von Tag zu Tag wurde er mutiger, und mit einem Mal war die frühere Verzagtheit vollkommen verschwunden.
Ein für alle Mal, hatte er gedacht. Aber vor ein paar Wochen hatte sich die quälende Angst zurückgemeldet.
Nach über dreißig Jahren Pause.
Die Symptome erkannte er sofort wieder: die Unsicherheit, die Blicke über die Schulter, all das Abscheuliche, das er so lange Zeit los gewesen war.
Zum ersten Mal empfand er Erleichterung darüber, dass seine Eltern von ihm gegangen waren: Sie mussten ihn nicht in dieser Verfassung erleben. Aber nun gab es einen anderen Menschen, für den er Verantwortung hatte, eine Frau, die er anbetete, für die er alles tun würde. Und sie war ans Haus gebunden und ganz auf ihn angewiesen.
Er musste stark sein, schon allein für seine Frau. Denn etwas Böses bedrohte ihn. Bedrohte sie beide: ihr Glück, ihre gesamte Existenz.
Agne Bravander war ein nüchterner, alles andere als abergläubischer Mensch, der dem, was man im Allgemeinen Intuition nannte, skeptisch gegenüberstand. Doch nun wurde er von der Angst gepackt. Da war sie, so nah, dass er fast danach greifen konnte.
Und dabei ging es nicht nur um die unerklärlichen Schwingungen, die ihm zuerst aufgefallen waren. Es gab auch eindeutige Anzeichen wie die anonymen Anrufe im Büro und bei ihm zu Hause.
Aber am meisten beunruhigt hatte ihn der Zettel auf dem Fahrersitz im Auto.
Danke, für diese Abendstunde,
Danke, für den vergang’nen Tag
Den Text, der dem bekannten Lied »Danke« der freikirchlichen Erweckungsbewegung entstammte, hatte er sofort erkannt.
Aber warum? Was hatte die Botschaft zu bedeuten?
Diese zwei Zeilen erschreckten ihn mehr als alles andere. Die Theorie, dass es sich nur um einen harmlosen Scherz handelte, verwarf er sofort. Stattdessen schien ihm wahrscheinlicher, dass es sich um eine offene Drohung oder zumindest eine Warnung handelte. Hätte er nur die seltsame Botschaft erhalten, hätte es trotz allem etwas Harmloses sein können – aber im Zusammenspiel mit allem anderen ...
Danke, für diese Abendstunde,
Danke, für den vergang’nen Tag
Ihm kam es so vor, als beschwörten die Worte einen dramatischen Abschied herauf.
Wieder fragte er sich: Warum? Was hatte er falsch gemacht? Wodurch hatte er diese heftige Abneigung eines anderen auf sich gezogen? Und wie ernst war das Ganze eigentlich zu nehmen? Sollte er mit jemandem reden? Die Polizei verständigen?
Ratlos lenkte er das Auto durch die herbstdunklen Straßen in die Stadt.
Vielleicht war es eine Idee, ganz vorsichtig auszukundschaften, ob jemand anderem in der Gemeinde etwas Ähnliches widerfuhr. Würde er es wagen, im Rat darauf zu sprechen zu kommen? Womöglich hatte es der anonyme Plagegeist darauf abgesehen, den Gottesboten insgesamt zu schaden.
Wie Blitze fuhren die Gedanken durch seinen Kopf.
Konnte es sogar sein, dass ein Mitglied der Gottesboten dahinter steckte?
Beschämt über seine ketzerischen Grübeleien, schob er diese Frage beiseite.
Kurz dachte er über die ausgeschlossene Familie Samuelsson nach, die im Sommer von einer so entsetzlichen Tragödie getroffen worden war. Konnte es sein ...?
Doch auch den Gedanken verwarf er umgehend.
Er hatte sich doch rückhaltlos hinter das Ehepaar gestellt, vor und nach ihrem Ausschluss, hatte sich ausdrücklich für ihren Verbleib in der Gemeinschaft ausgesprochen, war zu einem höchst eigenmächtigen Abweichen von dem Kurs bereit gewesen, den die Gemeinde seit ihren Ursprüngen verfolgte.
Die anderen hatten allerdings für den Ausschluss gestimmt, und er hatte sich natürlich mit dem Ergebnis abfinden müssen. Die Gottesboten waren schließlich demokratisch organisiert.
Falls also die Samuelssons hier ihre Hände im Spiel hatten – was Gott verhüten mochte –, hätten sie sich auf die übrigen Ratsmitglieder konzentrieren müssen, nicht auf den Einzigen, der sich nach besten Kräften für sie eingesetzt hatte.
Agne Bravander kam in der Einfamilienhausgegend in Bro an, einem östlichen Stadtteil ein Stück hinter dem Krankenhaus. Als er sich seinem Haus näherte, wurde er wie gewohnt von Zärtlichkeit übermannt, während er das fragende Gesicht seiner Frau vor sich sah.
Sie durfte sich keine Sorgen machen. Um keinen Preis.
Der Gedanke, dass ihr etwas zustoßen könnte, vertiefte den Schrecken noch. Es durfte einfach nichts passieren!
Er war angelangt und stellte den Wagen in der Garagenauffahrt ab. Der Wind raschelte in den Laubhaufen. Er spürte die Abendluft auf den Wangen. Der Herbst ließ nicht auf sich warten, sondern kam mit großen Schritten.
Erschreckt fuhr er zusammen, als sich eine Gestalt aus der Dunkelheit auf der anderen Straßenseite löste. Ein dunkler Schatten kam näher, die Kapuze hochgezogen. Bravander ballte automatisch beide Hände zu Fäusten.
Aber als er merkte, dass da nur ein Mann seinen Hund, der kaum größer als eine ausgewachsene Ratte war, Gassi führte, entspannte er sich wieder und nickte dem Vorbeigehenden erleichtert zu. Dann ging er rasch um die Garagenecke zum Haus, nachdem er noch eben die Post aus dem Briefkasten geholt hatte, offenbar hauptsächlich Rechnungen und Reklame.
»Liebling, ich bin da«, rief er, während er seinen Mantel ablegte.
»Wie schön«, hörte er zur Antwort. »Ich habe so auf dich gewartet.«
»Es war ein bisschen mehr zu erledigen, als ich gedacht hatte. Entschuldige, dass ich so spät dran bin.«
»Ach, das macht doch nichts.«
»Ich hätte anrufen sollen.«
»Setz lieber Kaffee auf, bitte.«
»Sofort«, erwiderte er und ging zu ihr ins Zimmer.
Nancy Bravander saß an ihrem Lieblingsplatz, den Rollstuhl an einem Ende des Esstischs, drei Meter vom Fernseher entfernt. Sie stellte ihn mit der Fernbedienung aus.
»Du brauchst nicht ...«
»Da lief sowieso nichts Interessantes«, unterbrach sie ihn, »hab mir nur so ein wenig die Zeit vertrieben.«
»Kaffee kommt gleich, erst mal das«, sagte er, trat auf sie zu, beugte sich über sie und gab ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Er bemühte sich, so wie immer zu wirken. Sie durfte absolut nichts von dem mitbekommen, was an ihm nagte.
»Aber was ist mit dir, Agne?«, fragte sie, das Gesicht ihm zugewandt. »Ist etwas passiert?«
Er versuchte ihr auszuweichen, indem er einen heiteren Ton anschlug: »Passiert? Was um alles in der Welt soll denn einem wie mir schon passiert sein?«
»Etwas stimmt doch nicht. Denkst du, ich hätte keine Augen im Kopf?«
Sie liest in mir wie in einem offenen Buch. Was bin ich bloß für ein erbärmlicher Schauspieler! Das war ich schon immer, kann mich nicht verstellen. Muss mir mehr Mühe geben!
»Nancy, Liebes, wie kommst du nur darauf?«
»Sei nicht albern.«
»So glaub mir doch.«
Es dauerte lange, bis er sie beruhigt hatte. Und er war sich nicht sicher, dass es ihm gelungen war, als sie das Thema endlich aufgab.
Während er in der Küche mit dem Kaffee hantierte, kam ihm der Gedanke, auch Nancy könnte von dem verhassten Verfolger belästigt worden und deshalb so beunruhigt sein. Doch das Risiko schätzte er als minimal ein – so etwas hätte sie ihm doch sicherlich anvertraut. Nicht sie war diejenige, die Geheimnisse hatte.
Sie machten es sich gemütlich mit Kaffee und belegten Broten (Schinken und Meerrettich, Käse, Gurke und Paprika), die er mit geübter Hand hervorgezaubert hatte.
Als er anderthalb Stunden zu Hause war, nahm er sich endlich die Zeit, die Post durchzusehen. Ein unfrankierter Brief ohne Namen des Adressaten war wohl direkt in ihren Briefkasten eingeworfen worden. Schon bevor er den Umschlag öffnete, hatte er eine böse Vorahnung.
Und tatsächlich. Ein einzelner weißer Din-A4-Bogen steckte darin, auf dem die eine Zeile stand:
Danke, o Herr, auch für die Leiden, denn du meinst es gut.
Mehr nicht.
Aber es war mehr als genug.
2 Der Sommer versuchte sich gegen die Bedrängungen des Herbstes zu halten, solange es eben ging. Noch arrangierte er sich so einigermaßen mit dem raueren Ton seines Nachfolgers, der die Alleinherrschaft anstrebte. Denn diese Zeit des Jahres gehörte nun einmal traditionell dem Herbst. Mit der Hitze war es jedenfalls vorbei.
Aber sie hatten einen ausnehmend schönen September gehabt. Den heißesten und sonnigsten seit Menschengedenken. Und etwas von dieser verschwenderischen Großzügigkeit rettete sich noch in den Oktober hinein, keine zehn Wochen mehr vor Heiligabend. Der Monat hatte zwar mit heftigen Regengüssen angefangen. Danach war die Wärme aber wiedergekehrt, befördert von einer Sonne, die in diesem herrlichen Jahr 1999 offenbar einen Hang zum Exhibitionismus ausbildete.
Die Leute redeten übers Wetter wie nie. Und das wollte was heißen, weil die Leute schon immer übers Wetter geredet hatten, auch wenn es überhaupt nicht der Rede wert gewesen war.
Der Mann, der durch das etwas abgelegene ruhige Viertel lief, hatte keinen, mit dem er übers Wetter reden konnte. Und selbst wenn er jemanden zum Reden übers Wetter gehabt hätte, hätte er mit demjenigen nicht übers Wetter geredet, weil seine Gedanken um etwas ganz anderes kreisten.
Er ging mit hochgeschlagenem Kragen gegen den eher lauen Wind und wählte absichtlich verschiedene Routen, die ihn aber jedes Mal an den Ausgangspunkt zurückführten: ein Haus an einer Kreuzung in der Nähe des östlichen Kanals.
Nach einem zwanzigminütigen Spaziergang hatte er genug. Er stellte sich in den Schatten einer riesigen Kastanie in einer kleinen Grünanlage schräg gegenüber dem Gebäude, von dem ihn alle seine Wege dieses Abends weggeführt hatten.
Sein Gesicht zeigte einen angespannten, besorgten Ausdruck.
Etwas musste geschehen.
Zwei Stimmen stritten sich in seiner Brust.
Die eine sagte: »Warnungen reichen. Jedenfalls für den Anfang.«
Die andere entgegnete: »Überhaupt nicht.«
Ein erbittertes Hin und Her schloss sich an: »Natürlich reicht es.«
»Überhaupt nicht. Noch lange nicht. Wer schert sich schon um leere Worte?«
»Scharfe Drohungen können eine ausgezeichnete Wirkung erzeugen.«
»Quatsch! Worte tun nicht weh. Nur Taten.«
»Hörst du nicht! Eine Warnung ist genug.«
»Es reicht nicht, hab ich gesagt. Wie oft muss ich dir denn noch ...«
Nach einer Weile begann es in seinem Schädel eintönig zu rattern. Wie ein Zug, der auf fehlerhaft geschweißten Schienen vorandonnerte: reicht-reicht-nicht-reicht–reicht-nicht – reicht-reicht-nicht ...
Verzweifelt presste er die Hände auf seine Ohren, um den Lärm zu dämpfen.
Etwas musste also getan werden.
Und zwar schnell.
Die Wurzel des Übels musste ausgerissen werden, um weiteren Schaden zu begrenzen. Wenn er zuließ, dass es immer so weiterging, würde es bald zu spät sein. Dann halfen keine Operationen mehr. Er war gezwungen, die Verantwortung zu übernehmen. Jemand musste alles in Ordnung bringen, und das Schicksal hatte eindeutig ihm diesen Auftrag zugedacht, da offenbar niemand sonst die Probleme zu lösen vermochte.
Vorsichtig trat er einen Meter weiter in den Schatten zurück, als der Scheinwerfer eines Kastenwagens am anderen Ende der Straße in Sicht kam.
Das Fahrzeug fuhr vorbei, und der Mann mit dem hochgeschlagenen Mantelkragen horchte auf die Stimmen: reicht-reicht-nicht – reicht-reicht-nicht – reicht-reicht-nicht ...
Bis ihm schließlich klar war, auf welche von beiden er hören musste.
Es war ganz einfach seine Pflicht, da gab es kein Vertun.
Mit einem Mal kam ihm alles ganz klar und natürlich vor. Er hatte keinen Grund, länger zu zweifeln. Die Sache musste ihren Lauf nehmen.
Er sah, wie das Licht in einem der Fenster des Hauses, das er bewachte, ausging.
Jetzt hieß es volle Kraft voraus.
Aber es musste nicht unbedingt hier sein, nicht als Erstes. Die Hauptsache war, überhaupt anzufangen.
Die Reihenfolge an sich war nicht so wichtig, da ja der ganze Auftrag auszuführen war. Und wenn er einmal mit der Sanierung begonnen hatte, musste alles so schnell wie möglich abgewickelt werden.
Als er wegging, war er sich dessen bewusst, dass es keinen Weg zurück geben würde.
Er war zufrieden. Und das Allerbeste war, dass ihn die aufdringlichen Stimmen im Kopf nicht mehr plagten.
3 Das Bett war gemacht, das Geschirr vom Mittagessen gespült, das Staubsaugen erledigt, die Korrespondenz des Tages im Briefkasten: Endlich hatte sie etwas Zeit für sich.
Mia sah auf die Uhr.
Sie hatte noch reichlich Zeit.
Diesmal würde sie es schaffen, sich ordentlich vorzubereiten, anstatt überstürzt und mit Herzklopfen aufzubrechen. Letztes Mal hatte sie sich nur kurz unter den Armen gewaschen, Deo aufgesprayt und die Bluse gewechselt – alles war improvisiert, die knapp bemessenen Minuten mussten ausgenutzt werden.
Diesmal war es anders.
Sie ging ins Badezimmer und ließ Wasser in die Wanne.
Eine halbe Stunde im dampfenden Bad war für sie mit das Beste, was sie sich vorstellen konnte. Natürlich nicht das Allerbeste, aber gut genug. Darin konnte sie sich entspannen und sich frei fühlen. Es war ein Luxus. Und das Gefühl danach – nach der obligatorischen kalten Dusche – war so herrlich erfrischend.
Ingmar war ein leidenschaftlicher Saunagänger. Schon fast fanatisch. Einmal hatte er ihr sogar vorgeschlagen, dass sie sich eine Sauna im Keller einbauten. Das Projekt hatte sie abgeschmettert, denn es schien ihr keine besonders glückliche Idee zu sein. Sie ging nicht gern in die Sauna. Für sie gab es Wichtigeres im Leben.
»Eine überflüssige Geldausgabe«, verteidigte sie ihren Standpunkt. »Außerdem brauchen wir den Platz für anderes. Wir kriegen das Büro ja kaum unter. Und wir wollten doch die Firma ausbauen, oder?«
»Du hast sicher Recht«, hatte er gleich nachgegeben, wie so oft. »Wir wollen nichts überstürzen. Schließlich geht es um ziemlich viel Geld, das wir vielleicht woanders besser investieren können. Und natürlich, Mia, natürlich wollen wir expandieren.«
Manchmal ärgerte sie sich über seine Nachgiebigkeit. Er gab so leicht auf, beugte sich dem geringsten Widerstand, wie ein Rohr im Wind.
Aber meistens war sie natürlich zufrieden mit seiner Gefügigkeit. Sie war so praktisch.
So wie heute.
Das Wasser strömte aus dem Hahn.
Sie zog sich ein Kleidungsstück nach dem anderen aus und legte die Sachen fein säuberlich auf einen Haufen in den Wäschekorb aus weißem Stoff.
Den schwarzen Bügel-BH legte sie beiseite. Er gehörte zu ihren Plänen für den weiteren Verlauf des Abends.
Doch dann überlegte sie es sich anders. Es gab Alternativen. Und so wanderte auch der BH auf den Haufen im Wäschebehälter.
An der Rückseite des hohen Drehschranks mit den vielen Toilettenartikeln war ein zwei Meter hoher Spiegel angebracht. Kritisch musterte sie ihre Figur. Das war ein tägliches Ritual. In letzter Zeit ging sie dabei immer gründlicher vor, aufmerksam auf jedes kleine Anzeichen von Veränderung achtend.
Sie war sehr auf ihren Körper fixiert. Seit ein paar Monaten noch mehr als zuvor.
Vor wenigen Tagen war sie vierunddreißig geworden (Ingmar hatte sie in einem seltenen Anfall von Ausgelassenheit zu knoblauchgespickten Rinderrouladen mit Rotwein eingeladen), und ihre Sorge vor dem körperlichen Verfall wuchs.
Dabei hatte sie wirklich nicht den geringsten Grund dazu. Sie hatte eine rosigfeste Haut, einen wohlgerundeten Po und einen etwas fülligen Busen mit gerade vorstehenden Brustwarzen. Möglicherweise waren Taille und Oberschenkel etwas zu gut gepolstert. Aber das war kaum der Rede wert.
Einen kurzen Moment spürte sie ein Ziehen in der Leistengegend, während sie sich vorstellte, was sie an diesem Abend noch erwartete. Sie sehnte sich danach. Sehnte sich so, dass es wehtat.
Sie holte ein hellblaues Badelaken aus dem Schrank und legte es auf einen Hocker neben der Wanne, damit sie es gleich bei der Hand hatte, wenn sie fertig war. Als das Wasser knapp unter dem Badewannenrand stand, drehte sie den Hahn ab. Dann prüfte sie es mit einem Ellenbogen. Heiß – aber nicht siedend. Genau wie sie ihr Bad mochte.
Schwierig wurde es, als sie in die Wanne stieg. Das war der kritische Moment. Sie schnappte nach Luft, als hätte sie sich verletzt, musste sich erst nach und nach an die Hitze gewöhnen: erst die Füße, dann Waden, Schenkel und Gesäß, bis sie schließlich ganz eintauchte, sodass sie bis ans Kinn im Wasser lag.
Das Wohlbehagen stellte sich nicht unmittelbar ein. Gewöhnlich dauerte es ein paar Minuten, bis sich die Atmung normalisierte und der Körper sich dem brennend heißen Wasser angepasst hatte.
Sie streckte sich aus und schüttete Badesalz ins Wasser. Anschließend rührte sie mit den Händen um, damit sich die Kristalle verteilten.
Sie schloss die Augen und ließ ihren Gedanken freien Lauf.
Es war unvermeidlich, zunächst an das unmittelbar Bevorstehende zu denken. Es verschaffte ihr einen angenehmen Kitzel in der Magengrube, und sie bekam gerötete Wangen vor Erwartung. Sie musste sich beherrschen, um ihre Finger nicht Richtung Unterleib wandern zu lassen. Der Versuchung war schwer zu widerstehen. Sie konnte nicht behaupten, besonders stolz auf ihre Untreue zu sein.
Wie war es so weit gekommen?
Bei der Frage zog wie gewöhnlich der gesamte banale Hintergrund im Eiltempo vor ihrem inneren Auge vorbei. Wie sie schon mit sechzehn in diese Stadt gekommen war, um ihr Glück zu suchen, wie sie mit siebzehn schwanger geworden war, mit achtzehn eine Abtreibung gehabt hatte, jahrelang mit einem groben und ungehobelten Automechaniker zusammengewohnt hatte, den sie nach zermürbenden Szenen losgeworden war (danke, Herr Pastor, für die große Hilfe!), eine bessere Wahl getroffen und geheiratet hatte, anständig geworden war, eine anständige Mitinhaberin der Firma.
Durch und durch und alles andere als originell.
Es hätte schlimmer kommen können.
Verheiratet, anständig und ordentlich.
Jedenfalls solange ihr keiner auf die Schliche kam.
Aber war das Risiko wirklich ausgeschaltet? Wie sicher konnte sie sich genau genommen fühlen? War es nicht der reine Wahnsinn, die ereignislose, langweilige Eintönigkeit aufs Spiel zu setzen, die die letzten sieben Jahre ihren Alltag ausgemacht hatte?
Sekundenlang von Panik erfasst, hob sie sich sogar vor Verzweiflung ein Stück weit vom Wannenboden ab, ehe sie sich besann und zurücksinken ließ.
Vermutlich hatte sie nichts zu befürchten, selbst wenn ...
Was bedeutete ihr Ingmar eigentlich?
Sicherheit, natürlich – das vor allem.
Soziale Akzeptanz – wichtig in dem Milieu einer mittelgroßen Stadt.
Geordnete finanzielle Verhältnisse – nicht zu verachten (jedenfalls für jemanden, der bei null angefangen und Vergleichsmöglichkeiten hat).
Prestigegewinn – sie hatte es allen gezeigt, die an ihr gezweifelt hatten.
Jetzt war sie mit einem Vertrauen einflößenden, gesellschaftlich geachteten Mann verheiratet. Gut, einige rümpften die Nase über sein aufopferungsvolles, fast schon obsessives Engagement bei den Gottesboten, aber ansonsten hatte niemand etwas gegen ihn vorzubringen.
Ingmar Alvin brachte seinen Mitmenschen Wohlwollen entgegen. Langweilig und farblos, das war er wohl – aber er hatte sich nie etwas zuschulden kommen lassen. Niemand konnte etwas anderes behaupten, ohne unglaubwürdig zu wirken. Wäre er nur nicht so fade, so fromm, so schulmeisterlich und düster mit seinen Moralpredigten. Freundlich und hilfsbereit sein ist das eine, in einer kalten, egoistischen Welt sogar ausgesprochen erstrebenswert. Aber manchmal – nun ja, ziemlich häufig – hatte er ihr zu wenig Mumm in den Knochen.
Das war ein Rückfall in die Ausdrucksweise ihrer schäbigen Jahre mit Mattias.
Zu wenig Mumm in den Knochen ...
So etwas hätte sie nie, unter keinen Umständen, unter vier Augen zu Ingmar gesagt. So viel Respekt hatte sie vor ihm, dass sie den Mann, der ihr so viel Vertrauen entgegenbrachte, auf gar keinen Fall kränken wollte.
Und erotisch?
Sie verzog das Gesicht.
Dieser Teil ihrer Ehe war zweifellos der entbehrlichste, eine zeitraubende, klebrige, lust- und orgasmuslose Prozedur, auf die sie am liebsten ganz verzichtet hätte, der sie aber zu ihrem Glück nur höchst sporadisch ausgesetzt war – Ingmar hatte bei weitem nicht solche Gelüste wie der Mann, den sie bald treffen würde. Auch viel weniger Talent auf dem Gebiet, viel, viel weniger.
Sie versuchte sich einzureden, dass es aus diesem Grund nichts ausmachte, wenn sie ihren Mann mit einem anderen betrog, der mit ihrem Appetit auf Sex offenbar deutlich mehr anzufangen wusste.
Der Versuch, ihr Gewissen zu beschwichtigen, scheiterte jedoch kläglich. Sie durfte Ingmar nicht verletzen. Deshalb durfte niemand herausbekommen, was sie hinter seinem Rücken trieb; sie konnte nicht vorsichtig genug sein bei ihren außerehelichen Aktivitäten. Nicht auszumalen, wenn ...
Die Unruhe war da und ließ sich nicht zerstreuen. Jemand konnte etwas gesehen haben, jemand schöpfte vielleicht Verdacht. Waren sie – ihr Liebhaber und sie selbst – wirklich vorsichtig genug gewesen? Sie waren ja schon seit einer ganzen Weile zusammen, und neugierige Augen und Ohren gab es überall. Ihre Affäre konnte schon aufgeflogen sein. Wenn es wirklich hart auf hart käme, hätte sie dann die Kraft, sich von ihrem Liebhaber zu trennen?
Die Hauptsache war, dass Ingmar verschont wurde. Wenn er nur nie von ihrem Fremdgehen erfuhr!
Ingmar war und blieb für sie so etwas wie eine Vaterfigur. Dagegen fiel es ihr schwer, ihn sich als Vater eines eigenen Kindes vorzustellen, ihn sich als Vater ihres Kindes zu denken. Sie wusste nicht recht, warum, aber der Gedanke kam ihr absurd vor. Infolgedessen führten sie eine kinderlose Ehe. Er hatte sich ihrem Wunsch nie widersetzt, sondern sich ohne nennenswerte Diskussion gefügt.
Wie bei allem anderen.
Ihr Mann war elf Jahre älter als sie. Doch der Altersunterschied kam ihr bedeutend größer vor. Mehr als einmal hatte man sie für Vater und Tochter gehalten. Mia machte das immer sehr verlegen. Ingmar hingegen ließ sich nie etwas anmerken. Er war ein Meister der Selbstbeherrschung.
Mia hatte nie Angst vor ihm gehabt (nicht einmal jetzt, wo sie Grund dazu hatte, wenn sie an ihr gefährliches Spiel hinter seinem Rücken dachte) – Ingmars stoische Ruhe war ein wohltuender Gegenpol zu dem, was sie in ihrer vorigen Beziehung erlebt hatte, als sich ihr ständig vor Angst der Magen umgedreht hatte.
Ihre Ehe war nicht vollkommen, davor verschloss sie nicht die Augen. Aber so schlimm war es nicht, dass sie bereit gewesen wäre, sich um der Neugier willen auf fremdem Terrain zu erproben, alles aufs Spiel zu setzen. Denn im Grunde war sie zufrieden mit dem, was sie hatte: einen Ehemann, ein Zuhause und den kleinen Betrieb, den sie selbst in bescheidenem Umfang mit aufgebaut hatte.
Sie kam zu dem Schluss, dass sie ihre Ehe mit Ingmar absolut nicht bereute. Früher war es ihr schlechter gegangen. Viel schlechter. Und solch eine Zeit wollte sie auf keinen Fall noch einmal erleben.
Aber das Problem war, dass sie auch nicht bereit war, ihn, den anderen, zu verlassen, ihn, der ihr das gab, was Ingmar ihr nicht bieten konnte, all das, was sie brauchte, um sich als Frau zu fühlen.
Sie seufzte.
Sie musste versuchen, ihre Affäre zu beenden, auch wenn ihr nicht klar war, wie sie das schaffen sollte. Auf jeden Fall musste es ja noch nicht heute Abend sein.
Weit weg klingelte das Telefon.