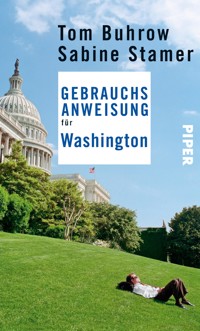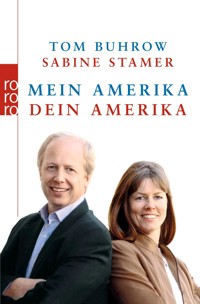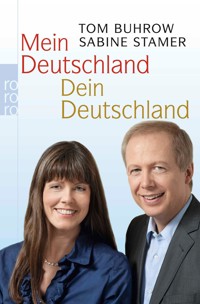
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Tom Buhrow und Sabine Stamer 2006 nach über zehn Jahren aus den USA nach Deutschland zurückkehrten, schrieben sie über ihre Erfahrungen das Buch «Mein Amerika – Dein Amerika». Es wurde ein persönliches, unterhaltsames Porträt der Vereinigten Staaten. Das Buch avancierte zum Bestseller. Nach vier Jahren zurück in Deutschland ziehen sie nun auf ähnliche Weise Bilanz und entdecken ihre alte Heimat neu. Wie lebt es sich in Deutschland heute, zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung? Das Buch ist keine Analyse, sondern ein persönlicher Erfahrungsbericht, ausgehend von privaten Erlebnissen, angereichert mit journalistischer Recherche. Die Anschauungen zweier Menschen, die zurückkamen, um Deutschland zu lieben, aber oft feststellten, dass Land und Leute nicht unbedingt geliebt werden wollen. Zentrale Themen wie soziale Gerechtigkeit, Ost-West-Entwicklung, Zuwanderung, Bildung und Erziehung betrachten die beiden Autoren aus verschiedenen Blickwinkeln und sind dabei durchaus nicht immer einer Meinung. Eben: Mein Deutschland – Dein Deutschland.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Tom Buhrow
Sabine Stamer
Mein Deutschland – dein Deutschland
Inhaltsverzeichnis
Nur Bares ist Wahres!
Ehrbare Kaufmannstraditionen
Im Schlaraffenland der Schnäppchenjäger
Zurück im deutschen Alltag
Letzter Halt vor der Zonengrenze
Nur nicht im falschen Chor singen!
Aus dem Plattenbau nach Afghanistan
Wendekinder machen sich selbständig
Blühende Landschaften, leuchtende Farben
Gedanken zur friedlichen Revolution
Glückskiller Schule
Zwischen Kadavergehorsam und Chaos
Künstler oder Kanzler
Ist Handy-Verkäufer eigentlich ein Beruf?
Es gibt nichts Gutes – außer man tut nix
Trüffel und Schampus für reiche Schulkinder
Familienmodelle: drei Jobs für zwei Personen
Zum Geburtstermin beim Rolling-Stones-Konzert
«Marathon – das packst du nicht!»
Es geht nicht ums Laufen, es geht ums Leben
Der arbeitslose Kunde
Mit Yoga in den Gartenbau
Traumjob oder einfach putzen?
Erfahrungen einer Arbeitsuchenden
Sherry beim Chef
Einer wird Millionär
Einreise nach Absurdistan
«Wenn Sie arbeiten, werden wir Sie nicht mehr los!»
«Das ist Deutschland!»
Flüchtlingsdasein im Zeitraffer
Schmelztiegel Amerika
Land der Arbeit, nicht der Almosen
Leben ohne Schweine-Mettwurst
Bericht zur Lage der Nation an einem Beispiel
Kann man Liebe kaufen?
Unser Europa der Eliten
Ein Porsche ist ein Porsche ist ein Porsche ...
Jeder hält sich für den kleinen Mann
Dank
Abbildungen
Nur Bares ist Wahres!
Ehrbare Kaufmannstraditionen
Heimkehrer nach Deutschland haben fast immer gemischte Gefühle. Manches fürchten sie: viele Regeln im Alltag, den Hang, sich gegenseitig zu kontrollieren, eine manchmal muffelige Art, miteinander umzugehen, und einiges mehr. Auf vieles freut man sich: vertraute Bräuche, Weihnachtsmärkte im Dezember, Fußball am Wochenende, frisches Brot in allen Variationen, saubere Bürgersteige, gute öffentliche Verkehrsmittel und einiges mehr. Dass wir unzufrieden mit unserem Land sind, scheint im Nachkriegsdeutschland dazuzugehören. Aber objektiv ist das meiste ziemlich prima: Endlich werden die Handwerker wieder wissen, was sie tun, und müssen nicht mehrmals kommen, um simple Handgriffe auszuführen. Es lebe die deutsche Wertarbeit, die deutsche Korrektheit – auch in Vertragsangelegenheiten. Hier werden Rechnungen pünktlich gezahlt, Vereinbarungen eingehalten, Verträge ernst genommen… Oder etwa nicht?
Nach zwölf Jahren Wanderschaft durchs Ausland steht unsere Rückkehr nach Deutschland an. Tom wird Moderator der «Tagesthemen» und soll im September 2006 in Hamburg anfangen. Von den USA aus bereiten wir in Etappen unsere Umsiedlung vor. Auf welche Schule kommen die Kinder? Wo werden wir wohnen? Solche Fragen kann man nicht in einem Rutsch klären. Man muss sich mehrmals vor Ort umsehen. Wir planen mehrere Heimatbesuche, machen Termine mit Schulen und Maklern. Als Nomade auf Auslandsposten lebt man zur Miete. Jetzt sieht es so aus, dass wir eine Weile an einem Ort bleiben werden, und wir entschließen uns, das Wagnis eines Hauskaufs einzugehen. Zunächst heißt es, mit möglichst vielen Maklern Termine zu machen und mit jedem neu auszuloten, was wir im Sinn haben. Dank Internet kann man wenigstens vorsortieren. Dann bündeln wir die Verabredungen, und auf geht’s nach Hamburg für eine knappe Woche.
Eins fällt sofort auf: Deutschland wird älter. Die meisten Immobilien, die wir uns anschauen, werden von Witwen bewohnt. Während Amerikaner mindestens zehnmal in ihrem Leben umziehen und dabei immer – sobald sie es sich leisten können – ein Haus verkaufen, um ein neues zu kaufen, scheint es in Deutschland nur zwei Gründe zu geben, das Eigenheim zu veräußern: Scheidung und Alter. Eine ältere Dame erklärt uns: «Ich wollte das Haus behalten, weil es groß genug ist, wenn mich mein Sohn mit seinen Enkelkindern besucht. Aber die Kinder kommen doch nicht so häufig, wie ich dachte. Meistens geht das husch, husch, und schon sind sie wieder weg. Dafür brauche ich das Haus nicht.» Sie hat bereits einen Platz im Seniorenheim. Andere Hausbesitzer wollen in eine kleinere Wohnung umziehen.
Bei einer Besichtigung öffnet der ebenfalls betagte Makler während des Rundgangs die Tür zu einer Abstellkammer. «Dies hier sollten vor allem Sie sich ansehen!» Er wendet sich an Sabine. «Das könnten Sie als Bügelzimmer nutzen. So etwas ist ja für die Hausfrau interessant.»
«Bei uns bügelt mein Mann!», erwidert Sabine. Verlegenes Lachen. Tom bemüht sich, besonders herzhaft zu lachen, damit der Makler die Antwort bloß nicht als Kritik an seinem Frauenbild versteht. Die Sorge ist unbegründet. Die Besitzerin des Hauses knüpft gleich an: «Meine Schwiegertochter lässt meinen Sohn mit allen möglichen Hausarbeiten allein. Ich sage immer: ‹Wen hast du da geheiratet?› Aber die Frauen sind heutzutage nicht mehr das, was wir früher waren!» Das Haus kommt – trotz Bügelraum – nicht in Frage.
Ein anderes Haus liegt an einer U-Bahn-Trasse, ist deswegen recht günstig zu haben. Das erscheint uns überlegenswert. Nachdem wir uns von den Bewohnern verabschiedet haben, folgt uns der Makler zum Auto und raunt uns zu: «Eigentlich ist das Haus schon so gut wie verkauft, aber es kann gut sein, dass der Notartermin noch platzt.» Dann könne er den Verkäufern beibringen, im Preis etwas nachzulassen. Wir sind offenbar Notnagel bei einem Schacher.
Vor jeder Abreise schärfen wir allen Maklern ein, uns zu verständigen, falls sich ein geeignetes Angebot finden sollte. Per E-Mail sollte das kein Problem sein; teure Auslandsgespräche sind nicht nötig. Aber sobald der Kunde weg ist, scheint er auch aus dem Sinn zu sein. Da waren unsere Wohnungssuchen in den USA einfacher, denn dort sind die Vorschriften für Makler kundenfreundlicher: Nicht der Mieter oder Käufer zahlt die Provision, sondern der Besitzer des Objekts. Schließlich arbeitet der Makler in dessen Interesse. Beide wollen den Preis möglichst hoch halten. Vor allem aber: Ob zur Miete oder zum Kauf – der Vermittler hat ein Objekt nur kurze Zeit exklusiv in seinem Portfolio. Danach geht es mitsamt allen Informationen über Zustand, Größe, Grundstück, Preisvorstellung inklusive Fotos an ein Zentralregister, auf das jeder Makler Zugriff hat. Ab dann beginnt der Konkurrenzkampf: Falls der ursprünglich beauftragte Makler einen Mieter oder Käufer findet, kann er die komplette Provision einstreichen. Falls ein anderer Makler den Kunden anschleppt, wird die Provision fifty-fifty geteilt. Das bringt alle auf Trab. Niemand kann sich auf seinem Monopol ausruhen und einfach abwarten, bis die Kunden von allein kommen. Für den Wohnungssuchenden bringt das große Vorteile: Er wendet sich an einen einzigen Makler, der den Überblick über den gesamten Markt vor Ort hat.
Auf eine solche Unterstützung können wir bei unserer Suche in Deutschland nicht zählen. Kein einziger Makler – und wir hatten zu vielen Kontakt, großen und kleinen Firmen – versorgt uns kontinuierlich mit Angeboten und wird für uns aktiv. Im Internet finden wir schließlich ein interessantes Haus in guter Lage, passend zu unseren Vorstellungen und Möglichkeiten – unter Vertrag bei einer Maklerin, mit der wir schon etliches angeschaut hatten und die uns versichert hatte, sofort Bescheid zu sagen, falls sie etwas Geeignetes sieht. Kunden aus ihrer Kartei darüber zu informieren, hielt die Dame offenbar für überflüssig. Wahrscheinlich war sie sicher, dieses Objekt schnell loszuwerden. Warum also extra eine E-Mail nach Washington schicken? Wir fragen uns, wofür man einen Makler eigentlich bezahlt. Er übernimmt ja nicht einmal die Garantie dafür, dass die von ihm gemachten Angaben über Fläche, Baujahr und den Zustand des Hauses stimmen.
Für den folgenden Monat organisieren wir unsere nächste Heimreise und besichtigen dieses Haus gleich als Erstes. Zum Glück war es noch nicht weg. Ob es doch einen Haken hatte? Uns blieb nicht viel Zeit. Andere Verabredungen, auch mit einigen Schulen in der Nähe, standen an. Etwas gehetzt schritten wir die Zimmer ab. Es heißt, wenn man die richtigen vier Wände gefunden habe, dann wisse man das auf Anhieb. So ist das hier für uns. Wir verabreden uns mit den Besitzern für denselben Abend zu einem ausgedehnteren zweiten Rundgang und eilen zum nächsten Termin. Unterwegs sagen wir beide das Gleiche: «Das könnte unser neues Zuhause werden.» Der zweite Besuch «unseres neuen Heims» am Abend bestätigt das. Es gefällt uns wirklich sehr. Wir unterhalten uns angeregt mit den Besitzern, einem überaus sympathischen älteren Ehepaar. Es stellt sich heraus, dass sie einen Teil des Gartens separat verkaufen wollen, was bedeutet, dass wir entweder die Summe obendrauf legen oder direkt vor unserer Küchentür ein neues Haus gebaut würde. Wir wollen nicht feilschen, von manchem Traum muss man sich eben verabschieden.
Am nächsten Tag erhalten wir einen Anruf des Besitzers. Seine Frau habe kaum schlafen können, denn wir seien genau die richtigen Käufer für dieses Haus. Sie selbst hätten hier ihre Kinder großgezogen und wünschten sich sehr, dass wieder eine Familie einziehe, die das Haus zu schätzen wisse. Sie möchten vermeiden, dass ein Investor alles abreißt und hässliche Eigentumswohnungen errichtet. Irgendwie müsse es doch möglich sein zusammenzukommen. Uns hüpft das Herz. Wir haben die Fotos von ihren Kindern gesehen, der Gedanke, dort die Tradition des munteren Familienlebens fortzuführen, ist uns sympathisch. Wir setzen uns noch am selben Abend zusammen, trinken eine Flasche Rotwein und essen Wurst. Die beiden scheinen unkompliziert zu sein, sie patent und offen, er bibliophil und an Kunst interessiert. Wir führen keine richtigen Verhandlungen, sondern ein offenes Gespräch über unsere Möglichkeiten und Grenzen. Sie verstehen, dass man nicht mehr bezahlen kann, als man hat; uns ist klar, dass man kein halbes Haus verschenken kann. Als wir uns trennen, sind wir uns nähergekommen – persönlich und finanziell. Noch vor dem Abflug unterbreitet uns der Verkäufer einen Kompromiss, der in unser Budget passt. Und so geht es zurück nach Amerika.
In den nächsten Wochen und Monaten klären wir von Washington aus all die vielen Dinge, die man klären muss, wenn man Hauseigentümer werden will. Wer je dahin kommt, für den ist es in den allermeisten Fällen die größte Investition seines Lebens. Zahlen hinter dem Komma spielen eine Rolle.
In Amerika gibt es eine Volksweisheit: «Wenn etwas so klingt, als sei es zu gut, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich nicht wahr.» Wir müssen im Rückblick eingestehen, dass wir vor lauter Verzückung einige dringende Fragen nicht stellten: Warum wurde das Haus nicht schon nach dem ersten öffentlichen Besichtigungstermin verkauft? Wir waren schließlich erst über einen Monat später angereist. Warum gab es nicht wesentlich mehr Interessenten? Warum will man ausgerechnet uns als Käufer, obwohl sicher ein höherer Marktpreis zu erzielen wäre? Wir spazieren in diesen Hauskauf wie die Weihnachtsgänse. Wir haben keine Ahnung von einer solchen Transaktion. Wir wohnen in Washington, und es ist etwas kompliziert, sich aus der Ferne ausreichend zu informieren. Als die ersten Warnsignale kommen, wollen wir sie nicht sehen.
Den Vertragsabschluss beim Notar vereinbaren wir für April und nehmen diesmal die Kinder mit. Da nun alles klar zu sein scheint, kann man es wagen, ihnen ihr zukünftiges Zuhause zu zeigen. Die Besitzer laden uns netterweise ein, in dieser Woche bei ihnen zu wohnen. «Mein Vater hat immer gesagt, man soll mindestens einmal probeweise in einem Haus übernachten, bevor man es kauft», sagt der Herr des Hauses. Zwischen uns ist eine beinah familiäre Sympathie gewachsen. Wir malen uns aus, wie wir in den kommenden Jahren gemeinsame Feste feiern werden. Unsere Bank findet langsam etwas seltsam, dass sie noch keinen Entwurf des Kaufvertrages erhalten hat. Aber wir denken uns nicht viel dabei. Nette Leute sind halt oft etwas nachlässig, und wir haben von mehreren Seiten gehört, dass die Besitzer einen guten Leumund haben.
Wir überlegen, welcher Notar am besten zu bestimmen ist, aber wir kennen in Hamburg niemanden, und außerdem ist ein Notar ja zur Unparteilichkeit verpflichtet, wie eine neutrale Amtsperson. Also akzeptieren wir den Notar des Verkäufers, ein Büro mit guter Reputation – und das Unglück nimmt seinen Lauf.
Beim Termin versichert der Notar, er habe das Grundbuch kürzlich eingesehen. Eine Kopie legt er nicht vor. Nun, sagen wir uns, da er wahrheitsgemäß beide Parteien unterrichten und aufklären muss, ist das nicht weiter schlimm. Dann erwähnt er plötzlich eine Dame, die im Grundbuch stehe und vom Verkäufer eine Leibrente erhalte. Das ist schon etwas seltsam: Von dieser Dame war vorher nie die Rede gewesen. Für die Leibrente sei weiterhin der Verkäufer zuständig, uns belaste das nicht, klärt uns der Notar auf. Wir übernehmen keine Verpflichtung, und der Verkäufer verspricht, die Angelegenheit bis zur Übergabe zu klären. Außerdem sagen wir uns immer wieder: Wir sind im rechtschaffenen Deutschland, in der korrektesten Stadt unseres ordentlichen Landes: Hamburg, das stolz auf seine ehrbaren Kaufmannstraditionen ist. Wir haben es mit dem honorigsten Berufsstand, den man sich vorstellen kann, zu tun. Wir sitzen bei einem Hamburger Notar! Was kann da schon dubios sein? Sonst würde er uns doch informieren, uns reinen Wein einschenken müssen. Wir unterschreiben. Und gehen abends mit den Verkäufern essen.
Unsere Fehler häufen sich. Wir sind nun im Grundbuch als Käufer vorgemerkt und fühlen uns abgesichert. Wir zahlen einen Abstand auf die Einrichtung, die wir übernehmen wollen. Die Courtage für die Maklerin überweisen wir nicht direkt, sondern dem Verkäufer, denn er kennt die Agentur und hat für uns einen bemerkenswerten Rabatt ausgehandelt. Deshalb scheint es nachvollziehbar, dass er das Geld weiterleiten will. Wir treffen Vorbereitungen für die nötigen Umbauten, beauftragen Handwerksbetriebe. Das alles organisieren wir aus der Ferne, sechstausend Kilometer weit weg in Washington. Dort bereiten wir den anderen Teil des Umzugs vor: einpacken, aussortieren, die 110-Volt-Geräte an Kollegen abgeben, Listen machen, was neu gekauft werden muss.
Zwischendurch kommt die höfliche Nachfrage der Maklerin, wann sie denn mit ihrer Provision rechnen könne. Aber die hatten wir doch dem Verkäufer längst überwiesen! Offenbar hat er sie nicht weitergeleitet. Wir haken telefonisch nach. «Es reicht, wenn die das zum Zeitpunkt der Übergabe bekommen, die sollen sich mal nicht so anstellen», so die Antwort. Uns ist das peinlich, wir überweisen die Provision ein zweites Mal – diesmal direkt an die Maklerin. Wir werden den Betrag am Ende vom Kaufpreis abziehen, kein Problem, beruhigen wir uns.
Irgendwann ist in Washington alles eingepackt, die Ladeklappe des Lkw verschlossen, wir sehen ihn die Straße hinunterfahren, Richtung Baltimore, von dort wird der Container per Schiff über den Atlantik in unsere neue Heimatstadt schaukeln. Irgendwann im August wird er dort ankommen. Dann wird auch unser schönes Haus fertig sein, wir werden auspacken und glücklich einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Die Zukunft sieht sonnig aus. Für die letzten Tage in Washington haben uns Kollegen Klapptische und Campinggeschirr geliehen. Wir schlafen auf Matratzen. Von unserem Hausstand haben wir nur noch Koffer mit Kleidung zurückbehalten und unser Laptop plus Telefon und Faxgerät.
Am Übergabetag, einem Freitag, spuckt das Fax auf einmal eine Nachricht des Hamburger Notars aus, dürre zehn Zeilen: Der Kaufpreis reiche nicht aus, um alle auf dem Haus lastenden Schulden abzulösen. Deshalb sei der Kaufvertrag «derzeit nicht durchführbar». Wir verstehen nur Bahnhof und versuchen, im Notariat anzurufen, aber dort ist inzwischen Feierabend. Dann ist Wochenende. Was hat das bloß zu bedeuten? Wir tappen im Dunkeln. Erst am Montag – nach drei Tagen der Ungewissheit – können wir das Notariat erreichen. Nun sind die Ansprechpartner in Urlaub gefahren. Funkstille! Was zum Teufel ist los?
Niemand weiß etwas Genaues. Aber offenbar gibt es einen bisher unbekannten Gläubiger des Verkäufers, der Rechte an dem Haus geltend macht. Bei der Bank ist eine entsprechende Forderung eingegangen. Bei uns noch nicht. Es ist verwirrend und beunruhigend. Die Frage ist nur: Wie beunruhigend? Geht alles den Bach runter? Müssen wir die Umbauarbeiten sofort stoppen? Noch hoffen wir, dass sich die Angelegenheit irgendwie aufklären wird.
Der Verkäufer beruhigt am Telefon: «Alles nur ein Irrtum. Meine Bank stellt sich wegen kleiner Formalitäten an. Das klärt sich innerhalb von Tagen.» Er ist auf dem Weg zu einem seiner zwei Ferienhäuser. Beruhigt sind wir keineswegs. Wir informieren eine Freundin, die für uns als Architektin die Umbauarbeiten beaufsichtigt, und warnen sie vor, dass die Arbeiten eventuell gestoppt werden müssen. Dann reißen, mitten in dem ganzen Schlamassel, die Kommunikationswege ab. Als Erstes stoppt die Internetverbindung, einige Tage später auch die Telefonleitung. Wir hatten wegen des Umzugs in Washington alle Verträge gekündigt. Das Handy funktioniert nur, wenn man vor die Haustür tritt.
Allein können wir kein Licht in dieses Dunkel bringen. Wir schalten einen Anwalt ein. Zu allem, was wir schon gezahlt oder angezahlt haben, läuft jetzt auch noch die Stundenuhr. Die Handwerker arbeiten weiter, bis der Anwalt Klarheit schafft. Wir bluten Geld, sitzen im Ausland ohne Internet und Telefon auf geliehenen Klappstühlen, und die Sorge wird größer: Ist da etwas oberfaul? Wir schlafen nur noch zwei, drei Stunden pro Nacht.
Toms Vater hält in der Heimat engen Kontakt zu Bank und Anwalt. Er ist uns wegen der Zeitverschiebung immer einige Stunden voraus und kann die neusten Informationen einholen. An einem Morgen bekommt Tom von ihm die Hiobsbotschaft. «Setz dich bitte», heißt es am anderen Ende. Das klingt nicht gut. Dann die Information: Das Haus ist hoffnungslos überschuldet. Es ist ein einziges Grab. Und in diesem Grab ist ein Teil unserer Ersparnisse bereits verschwunden. Blitzschnell schießt uns durch den Kopf, was das bedeutet: Wir sind in eine riesige Pleite hineingestolpert. Unmöglich, dass dieser Kauf noch irgendwie zu einem guten Ende kommt. All unsere Anzahlungen können wir abschreiben, die sehen wir nie wieder. Die Kaufsumme liegt auf dem Anderkonto eines Notariats, in dem wir niemanden erreichen.
Fließt das Geld jetzt ab, und wir bleiben auf den Schulden sitzen? Wo werden wir in Hamburg wohnen? Wo werden die Kinder zur Schule gehen? Wir müssen von vorn anfangen! Der Container schwimmt schon Richtung Hamburg auf hoher See. Sofort die Umbauten stoppen. Lieber Gott, die Umbauten! Da uns das Haus gar nicht gehört und wohl nie gehören wird, kann der Besitzer verlangen, dass alles wieder in den Urzustand zurückgebaut wird – auf unsere Kosten.
Diesen Moment werden wir unser Leben lang nicht mehr vergessen. Eine Falltür geht auf. Der Boden unter den Füßen ist einfach weg. Man fällt und fällt und denkt: «Irgendwann pralle ich auf», aber man fällt immer weiter. «Junge?», fragt Toms Vater in die Stille. «Junge, du MUSST jetzt die Nerven behalten!» Und dann sagt er den einzigen Satz, der in solchen Situationen zählt: «Du bist nicht allein. Wir sind Familie. Du wirst wieder auf die Füße kommen.»
Nicht: «Wie konntet ihr nur so leichtfertig sein?»
Nicht: «Warum habt ihr nicht vorher…?»
Nicht: «Mir kam das gleich komisch vor.»
Nur das Signal: «Wir sind Familie, irgendwie werden wir das zusammen schaffen.»
Von da an reagieren wir nur noch mechanisch, um den Schaden zu begrenzen. Das Wichtigste: den Kredit aus den Klauen des Notariats zurück zur Bank holen. Dann: Umbauten sofort stoppen. Wohin mit den Kindern, wenn wir in Deutschland eintreffen? Zum Glück sind Sommerferien. Also zu Großeltern und Paten mit ihnen. Den Hund bei Freunden in Washington lassen, bis wir wissen, wo wir überhaupt hinziehen. Wir beide erst mal ins Hotel in Hamburg. Wie lange ist der Container noch unterwegs? Wie lange haben wir Zeit, eine Wohnung zu suchen, bevor Lagerkosten entstehen? Werden die Kinder zweimal die Schule wechseln müssen? Die ersten Handwerkerrechnungen vom Umbau trudeln ein und müssen bezahlt werden.
Parallel recherchiert unser Anwalt das ganze traurige Bild zusammen. Wir haben bis dahin gedacht, ein Objekt könne gar nicht über seinen Wert belastet sein. Allein schon deshalb, weil eine Bank Privatleuten nur so viel Kredit gibt, wie sie abgesichert bekommt. Das ist ein Fehlschluss. Sie können sogar Ihr Fahrrad mit Millionen Euro belasten – wenn jemand so dumm ist, Ihr Fahrrad dafür als Sicherheit anzuerkennen! Das wird natürlich niemand tun. Aber umgekehrt ist die Sache nachvollziehbar: Sie haben schon Millionenschulden und als Besitz nur ein Fahrrad. Dann wird sich Ihr Gläubiger wenigstens dieses Fahrrad als Sicherheit verschreiben lassen, auch wenn der Gegenwert nicht im Geringsten seinen Forderungen entspricht.
So ähnlich war das mit unserem Haus beziehungsweise mit dem Haus, das eigentlich mal unseres werden sollte: Ein bisher unbekannter Gläubiger des Verkäufers hatte sich ins Grundbuch eintragen lassen, wohlgemerkt, nachdem das Objekt an den Makler gegangen war. An erster Stelle stand dort schon die Bank des Verkäufers. Alles in allem lasteten auf dem Objekt Schulden in vielfacher Höhe seines Wertes. Kein Interessent würde unter diesen Umständen einen Kaufvertrag unterschreiben. Kein Notar würde so eine aussichtslose Überschuldung unerwähnt lassen. Notare sind zur Neutralität verpflichtet. Dachten wir. Uns bleibt entweder Rückzug oder Flucht nach vorn. Wir entscheiden uns für Letzteres.
Als wir in Deutschland ankommen, hat unser Anwalt einen Mietvertrag für das Haus, das wir eigentlich kaufen wollten, ausgehandelt. Wir wissen wenigstens, wo wir den Container ausladen können. Aber das ist auch die einzige Gewissheit. Um einziehen zu können, müssen wir erst mal die Umbauten notdürftig beenden – also noch mehr Geld in dieses zweifelhafte Unternehmen stecken. Letztendlich, so trösten wir uns, ist es im Interesse aller, auch der Gläubiger und des Besitzers, dass wir dieses Haus kaufen. Wenn es zwangsversteigert werden muss, bringt es sicher weniger ein. Der Verkäufer gibt uns zu verstehen, wir sollten uns nicht so anstellen: «Was wollen Sie denn? Das Haus gehört doch Ihnen! Die kleinen Unklarheiten werden schnell beseitigt sein», meint er, «wahrscheinlich schon nächste Woche.»
Inzwischen hat Toms neuer Job praktisch begonnen. Noch nicht die Moderation selbst, aber der erste Wechsel des «Tagesthemen»-Moderators seit 15Jahren erfordert etliche Vorbereitungen. Tom lernt den Tagesablauf kennen und übt sich in die Gegebenheiten des Studios ein. Eine Reportagereise durch Deutschland steht an. Und nicht zuletzt gibt es ein enormes Presseinteresse. Natürlich sollen die «Tagesthemen» im Vordergrund stehen und nicht unser privates Unglück. Also heißt es: gut drauf sein, konzentriert und positiv. «Tolle neue Stadt», «tolle neue Lebensphase», «tolle neue Herausforderung». Das stimmt auch. Es gibt keine bessere Ablenkung, als sich in neue Arbeit zu stürzen. Und solche Belastungen zeigen einem erst, welche Nerven man hat, wenn es drauf ankommt.
Tom schmeißt sich in den Job, aber in den freien Stunden liegen wir niedergeschlagen auf dem Sofa. Vor den Kindern versuchen wir, so zu tun, als sei alles nicht so schlimm. Wir können uns nicht an diesem Haus erfreuen, das wir doch auf Anhieb so geliebt hatten. Wir haben keine Lust, Bilder aufzuhängen, machen nur das Nötigste. Immerhin, Hamburg zeigt sich von seiner schönen Seite. Wir genießen lange Spaziergänge und das viele Wasser in der Stadt. Wir starten ein paar Versuche, unserem klammen Verkäufer wenigstens einen Teil des bereits Gezahlten wieder aus der Tasche zu ziehen. «Morgen!», vertröstet er uns immer, oder «Übermorgen!», und schreibt uns Briefe, in denen unsere Kontonummer falsch angegeben ist. «Typisch!», sagt unser Anwalt. «Aktion vortäuschen, aber nix passiert.» Die Verhandlungen zwischen Verkäufer und Gläubigern verlaufen zäh.
Wir lassen unseren Anwalt allen Parteien mitteilen, dass wir zu einem bestimmten Termin endgültig vom Kaufvertrag zurücktreten werden. Und siehe da, wenige Tage vor diesem Termin wachen alle auf. Verkäufer und Gläubiger halten ein Krisentreffen ab und kommen zu einer Einigung. Der Weg zum Kauf des Hauses ist frei.
Schließlich sitzen wir alle wieder im Notariat, dasselbe Büro, ein anderer Notar. Der erste ist angeblich verhindert. Der Verkäufer tut so, als müssten nur ein paar Missverständnisse, die andere zu verschulden haben, aus dem Weg geräumt werden. Wir lassen kein einziges Wort, kein Komma im Entwurf ändern ohne telefonische Rücksprache mit unserem Anwalt. Ein bisschen haben wir gelernt.
Anschließend gehen wir beide an der Alster essen: Labskaus und Bier. Schampus soll es erst geben, wenn alles amtlich dokumentiert ist. Wir trauen dem Braten nicht mehr.
Es dauerte Monate, bis die Kopie des Grundbuchauszugs eintraf – Zeit zum Anstoßen! Bis alle bösen Geister aus dem Haus vertrieben waren, vergingen noch ungefähr zwei Jahre. Die größte Überraschung war die Erkenntnis, wie viel Spielraum ein Notar hat. Als alles geklärt war, beschwerten wir uns bei der Notarkammer. Deren Antwort lautete sinngemäß: Es sei zwar alles sehr schwierig gewesen, aber gegen Gesetze habe der Notar nicht verstoßen, und am Ende sei es doch zu einer Eigentumsübertragung gekommen. Natürlich kam uns das Sprichwort in den Sinn: Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Aber vielleicht waren wir nun auch zu misstrauisch geworden.
Im Schlaraffenland der Schnäppchenjäger
Zurück im deutschen Alltag
Wir landeten nach unserem Umzug in einem knallheißen Sommer. Während der Fußballweltmeisterschaft hatte die Hitze Deutschland sein Sommermärchen beschert. Bei unserer Ankunft war das längst vorbei, aber es herrschte immer noch Sonnenschein. Selbst im wettermäßig nicht verwöhnten Norden trübte kein Wölkchen den Himmel. Alle verbrachten die lauen Nächte in Straßencafés. Hier und da gab es ein wenig Streit, wie viel vom Bürgersteig die Wirte mit Tischen und Stühlen belegen dürfen. Uns fiel vor allem auf, dass es überall Bürgersteige gab. Nach zehn Jahren in Amerika, wo Gehwege in den meisten Vierteln gar nicht erst eingeplant werden, registrierten wir sie als grandiose Errungenschaft der Zivilisation.
In den ersten Monaten sahen wir Deutschland durch die amerikanische Brille und verglichen alles. Dabei wollten wir über die verschiedenen Sitten und Gebräuche gar nicht unbedingt urteilen, es fielen einfach Dinge auf, die uns inzwischen, nach vier Jahren, schon wieder selbstverständlich erscheinen: die Märkte, die Bäcker und die Schlachter zum Beispiel. Verkäufer, die etwas von ihrem Handwerk verstehen, halbstündige Vorträge über bestimmte Brot- oder Käsesorten und ihre Erzeugung halten können. Unsere Städte sind nicht nur zum Arbeiten und Konsumieren gut, man kann in ihnen herumschlendern.
Den Typus des Flaneurs gibt es nicht in den USA. Eine Stadt wie Los Angeles beispielsweise ist nur mit dem Auto erträglich. Rollt man auf vier Rädern den Boulevard hinunter, gleiten Palmen und riesige Werbeplakate am Auge vorbei. Zu Fuß unterwegs fühlt man sich wie in einem Gewerbepark. Von einem Plakat zum anderen läuft man eine Ewigkeit. Werbung ist sowieso nur im Vorbeifahren interessant. Es gibt nichts, wofür man aussteigen und stehen bleiben wollte. In deutschen und anderen europäischen Städten kann man flanieren: Man schlendert ohne Eile, verweilt hier und da, um etwas genauer zu betrachten. Unsere Innenstädte bieten eine enorme Lebensqualität.
Es hätte so schön sein können, aber bei all dem Ärger um das neue Haus, zwangsläufig «geparkt» in einem Hotel, war an entspanntes Genießen nicht zu denken. Außerdem hatten wir während des Umzugs natürlich sehr viel zu erledigen. Alle Elektrogeräte zum Beispiel – von der Kaffeemaschine bis zum Fernseher – mussten wegen der unterschiedlichen Voltzahl neu angeschafft werden. In Washington bieten sich Einkaufscenter und Geschäfte an feuchtheißen Tagen als angenehm kühle Zufluchtsorte an. Keinen Gedanken an den Umweltschutz verschwendend, öffnen sie weit ihre Pforten, während die Klimaanlagen auf vollen Touren laufen. So weht den erhitzten Kunden beim Einkaufen auf der Straße ein kühles Lüftchen an, das ihn magisch in den Laden zieht. Wir merkten, wie sehr man sich an diesen leichtfertigen Luxus gewöhnen kann, während wir schweißgebadet unsere Besorgungen erledigten. Und wenn wir am Sonntag feststellten, dass wir etwas Wichtiges vergessen hatten, dann hieß es warten bis Montag. Die Feiertagsstille kam uns manchmal seltsam vor, aber ehrlich gesagt, haben wir diese verordnete Ungeschäftigkeit in Amerika auch vermisst. Die sonntägliche Ruhe hat etwas Besonderes; das ganze Land tickt anders, langsamer und leiser. In Amerika dagegen scheint an Festtagen alles lauter und schneller zu werden. Alle sind in Bewegung und haben ein ähnliches Ziel: das nächste Einkaufszentrum. Dort wird man an diesen Tagen ganz besonders hofiert. Dort ist der Kunde wirklich König. In Deutschland scheint er darauf gar nicht so viel Wert zu legen. Das fällt vor allem in Discountern auf. Hier sind manche Sachen so spottbillig zu haben, dass man sich fragt, wie der Preis die Kosten noch decken kann und ob für einen anständigen Lohn der Angestellten etwas übrig bleibt.
In der Filiale eines Billigmarktes in unserer Nähe sind alle Waren, ob Getränke, Brot oder Gemüse, in Kartons gestapelt. Wir reißen an einer Pappe herum, um an zwei Tetrapaks Saft zu kommen, und nehmen uns vor, nächstes Mal ein Taschenmesser mitzubringen. Während Sabine sich abmüht, fährt ihr von hinten ein großer Lastkarren in die Hacken. Sie springt zur Seite, um den Verkäufer nicht zu stören bei seiner schweren und wichtigen Tätigkeit, für die er – das ist bekannt – nur einen minimalen Lohn erhält. Wortlos bugsiert er den Karren weiter durch die engen Gänge. Kunden können ganz schön im Weg sein, wenn die Ware ins Regal muss. Der Laden wirkt im Grunde wie ein Lagerraum. Hier werden Waren umgeschlagen, nicht Kunden glücklich gemacht. Das Einzige, was im Land der Schnäppchenjäger zählt, scheint der Preis zu sein, Service zählt nicht.
Zu fast jeder Tageszeit, nicht nur kurz nach Feierabend, bilden sich Schlangen an den Kassen. Wir verbringen ziemlich viel Zeit damit, darauf zu warten, dass wir unser Geld loswerden dürfen. Die blondierte Kassiererin fertigt eine Kundin ab. Dabei bringt sie nur ein einziges Wort über die Lippen, eine Zahl. Wortlos nimmt sie einen Schein entgegen; wortlos gibt sie das Wechselgeld heraus. Dann lehnt sie sich zurück und betrachtet eindringlich ihre Fingernägel, während sich die nächste Kundin beeilt, ihre Waren aufs Band zu legen. Erst als auch das letzte Wurstpäckchen auf dem Förderband ist, startet die Kassiererin mit dem Eintippen.
Während die Kundin vor uns bezahlt, schaufeln wir in Rekordgeschwindigkeit die Sachen aus dem vollen Einkaufswagen aufs Band, sind aber trotz aller Eile nicht rechtzeitig fertig. Die Dame an der Kasse lässt sich zurückfallen, betrachtet wieder ihre Fingernägel: Da, jetzt hat sie eine kleine Macke am linken Mittelfingernagel gefunden und poliert daran herum. Wir packen schneller, nicht weil wir das Gefühl hätten, sie erwarte das, aber die Schlange hinter uns wird immer länger, denn zurzeit sind nur zwei von vier Kassen geöffnet.
Natürlich wussten wir, dass uns in Deutschland niemand begrüßen würde: «Guten Tag und willkommen beim Discounter. Wollen Sie Ihre Sachen in eine Tüte oder einen Karton gepackt haben?» Solche unrealistischen Erwartungen hatten wir nicht. Wir ahnten allerdings nicht, dass der Einkauf zur sportlichen Betätigung werden würde. Die Kassiererin ist gut durchtrainiert, sie scannt wie eine Weltmeisterin – zu schnell für uns. Nur in letzter Sekunde verhindern wir, dass die Milchkartons die Tomaten und Äpfel langsam über den Rand des Kassenplatzes schieben. Tom hechtet an der Kasse vorbei und fängt den ersten Apfel auf. Ach so ist das: Die Theke hinter dem Kassenband ist offenbar absichtlich so kurz gebaut, damit der Kunde sich ja sputet. Die Kassiererin, wieder zurückgelehnt, starrt ins Leere. Einfach alles in den Wagen werfen und später sortieren, lautet die Devise, sonst hält man den Laden noch länger auf. Außer uns scheint sich niemand an dieser unbezahlten Akkordarbeit zu stören. Alle sind daran gewöhnt.
Mehr Service müsste bezahlt werden, die Preise würden steigen. Das gilt es auf jeden Fall zu verhindern! Wir fragen uns, ob auch eine Rolle spielt, dass man sich in Deutschland nicht gerne bedienen lässt. Es gibt kaum noch Parkplatzwächter, auf Bahnhöfen und Flughäfen nur noch selten Gepäckträger. Angestellte werden durch Automaten ersetzt, wo immer es möglich ist. Sind der sprichwörtliche Geiz und Sparzwänge wirklich der einzige Grund dafür? Im Taxi steigen Einzelfahrgäste häufig lieber vorne als hinten ein, obwohl das auch nicht weniger kostet. Aber hinten fühlt man sich wie einer, der sich bedienen lässt, vorne fühlen wir uns besser, auf einer Ebene mit dem Fahrer. Ein ausländischer Beobachter schrieb einmal, das sei ein Überbleibsel aus der NS-Zeit. Da habe es geheißen: «Volksgenossen lassen sich nicht chauffieren.» Was auch immer die Wurzeln dieser Einstellung sind: Wir wollen kein Vorne und Hinten, kein Oben und Unten akzeptieren. Das ist sympathisch, verhindert aber jede Menge Jobs im Dienstleistungsbereich. Ein Schuhputzer müsste in Deutschland wahrscheinlich verhungern. In Amerika sieht man das häufig: Der Kunde sitzt zeitunglesend oder telefonierend auf einem thronartigen Stuhl, während zu seinen Füßen ein Schuhputzer bürstet und wienert, was das Zeug hält. Während ein Shoe Shine Boy in New York recht gut verdienen kann, empfinden wir in Deutschland seinen Job zu Füßen anderer als demütigend und putzen unsere Schuhe lieber selber. Wir wollen eine gerechte Welt, und Gerechtigkeit bedeutet in Deutschland Gleichheit.
Vielleicht adaptiert Deutschland deshalb so begeistert das schwedische «Du». Seit wir Anfang der 1990er Jahre dieses Land verlassen haben, ist das Siezen aus der Mode gekommen. Wir haben nichts dagegen, es ist einfach ungewohnt. «Plan dir deine neue Küche!», fordert uns IKEA auf, und der ungefähr achtzehnjährige Jüngling mit Dreitagebart am Beratungstresen versichert Sabine: «Du kannst den Schrank auch in Weiß haben.» Wir siezen anfangs die anderen Eltern an der Schule unserer Töchter und denken, das sei selbstverständlich. Erst nach einigen Wochen fällt uns auf, dass wir damit überhaupt nicht im Trend liegen.
Zurück zu unserem Einkauf. Mit einem Blick in den Deckenspiegel wird geprüft, ob wir nicht heimlich gestohlene Kekse oder Tomaten vorbeischmuggeln wollen. «Heben Sie mal den Einkaufsbeutel hoch!», fordert die Kassiererin uns auf. Ein Kunde ist in Deutschland ein potenzieller Dieb. Die Verkäuferin eines Kaufhauses hat unserer Tochter einmal, da war sie gerade zehn Jahre alt, lauthals vorgeworfen, sie habe eine Kinderzeitschrift geklaut. Dabei hatte sie das Heft gerade am zehn Meter entfernten Zeitungsstand von ihrem Taschengeld bezahlt. Das Schluchzen über diese Anschuldigung war für eine halbe Stunde nicht zu stoppen. Die Verkäuferin hat sich weniger entschuldigt als gerechtfertigt. Natürlich wird auch in Amerika geklaut, aber dort hält man die Kontrollen in Grenzen; die durch Diebstahl entstandenen Kosten werden einfach auf die Preise umgelegt. Das empfinden Amerikaner als normal. «Warum soll ich dafür bezahlen, dass ein anderer klaut?», heißt es dagegen bei uns. Auch eine Umlage der Gebühren für die Nutzung von Kreditkarten empfinden deutsche Kunden eher als ungerecht. So gibt es inzwischen Geschäfte und Restaurants, die Kreditkarten-Benutzern eine extra Gebühr berechnen. In Amerika undenkbar.
In diesem Supermarkt dürfen wir die EC-Karte allerdings ungestraft nutzen. «Karte einschieben. Geheimzahl eintippen. Bestätigen!», fordert uns die Kassiererin auf, ohne uns auch nur eines Blickes zu würdigen. Falls die Angestellten mal sprechen, dann miteinander über unseren Kopf hinweg. Na, ist ja sonst auch öde, so ein Job. Also bezahlen und schnell aus dem Weg. Wir können nicht anders, wir denken an Washington, wo helfende Hände unsere Großeinkäufe flugs verstauten in zig Plastiktüten (die übrigens keinen Cent kosteten und niemandem ein schlechtes Gewissen machten). Hier haben wir natürlich unsere Leinenbeutel dabei. Alles ins Auto und den Einkaufswagen an seinen Platz bringen, damit wir unser Pfand zurückbekommen. Der Kunde als Ein-Euro-Jobber auf dem Parkplatz des Supermarkts.
Zu unseren Mitmenschen, die ebenfalls einkaufen oder denen wir später beim Spaziergang begegnen, nehmen wir nur selten Kontakt auf. Das scheint allerdings keine allgemein deutsche Spezialität zu sein, sondern sich auf bestimmte Regionen zu beschränken. Wenn uns in Hamburg ein Fremder anspricht, freiwillig und ohne dringenden Grund, dann ist es wahrscheinlich ein Süddeutscher. Begegnen sich zwei einheimische Spaziergänger an der Elbe, richten sie die Augen angestrengt auf ihre Schuhspitzen, die Lippen fest verschlossen. So schiebt man sich selbst auf dichtem Raum gruß- und blicklos aneinander vorbei. In Washington haben uns täglich völlig unbekannte Personen versichert, wie niedlich die Kinder oder wie hübsch die Farbe des Pullovers sei. Eine lachende Schwarze klopfte Sabine auf offener Straße vorsichtig auf den schwangeren Bauch und wollte wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen werde. «Viel Glück!», wünschte die unbekannte Straßenbekanntschaft. In Norddeutschland würden solche Vertraulichkeiten wahrscheinlich umgehend eine Frühgeburt einleiten. Weiter südlich kommt man etwas schneller ins Gespräch, da heißt es schon mal: «Drink doch eene mit!»
In den USA geht man gemeinhin erst mal vom Guten im Menschen aus. In Deutschland scheinen sich die Menschen skeptisch zu begegnen: «Ist er mein Freund oder mein Feind?», «Will sie was von mir?», «Ob sie nett ist?». Dementsprechend bewegen wir uns lieber auf sicherem Terrain und halten uns gerne an diejenigen, die wir kennen. Auf Partys bilden sich schnell Grüppchen von Freunden und Vertrauten. Fremde Gesichter werden oft nicht bemerkt. Das ist unangenehm für die Außenseiter, für die «Eingeweihten» allerdings hat es seinen Reiz, sich ganz auf ein Gespräch einzulassen, über Erziehungs- oder Scheidungsprobleme etwa, und nicht in Fünf-Minuten-Häppchen zu plaudern. Eine amerikanische Party ist dagegen eine Kontaktbörse, auf der man sich mit möglichst vielen Gästen kurz austauscht. Work the room nennt sich das und klingt für uns Deutsche nach Arbeit.
Dafür ist es dort wesentlich weniger anstrengend, das Gespräch zu beenden. «Es war nett, mit dir geplaudert zu haben!», das kann man auf einer deutschen Party nicht einfach sagen und weitergehen. Hier bleiben dem Gast im Grunde zwei Möglichkeiten: Er behauptet, leider (!) sehr dringend (!) zur Toilette zu müssen, oder gibt vor, nur kurz (!) das Glas nachfüllen zu wollen. In beiden Fällen kehrt er nicht zurück, alle Gesprächspartner ahnen das, denn jeder kennt das Spiel. Auch wenn man einen netten Abend vor Mitternacht beenden möchte, gilt es erfinderisch zu sein, da hier die Qualität einer Feier an ihrer Länge gemessen wird. Je später der Abend, desto besser die Party. Bloße Müdigkeit reicht als Entschuldigung keinesfalls, und man sagt natürlich erst recht nicht, dass fünf Stunden feiern einfach genug waren. Ein Flugzeug morgens um sechs oder ein Babysitter, der partout nicht bis zwei Uhr nachts bleiben kann – das ist das Mindeste, was anzuführen ist, um mit einem frühen Abschied den Gastgeber nicht zu kränken. Die Nächte, wo wir uns in Washington bis weit nach Mitternacht vergnügt haben, können wir dagegen an einer Hand abzählen. So lange bleibt man einfach nicht, so richtig ausgelassen sind Partys dort sehr selten. Und außerdem haben die Amerikaner längst nicht so viel Sitzfleisch.
In amerikanischen Restaurants wird ein und derselbe Tisch an einem Abend zwei- oder gar dreimal vergeben. Länger als zwei Stunden hielte es sowieso niemand am selben Platz aus. Für solch knappe Kalkulationen des Wirts hätten deutsche Gäste kein Verständnis. Dementsprechend darf sich ein Kneipenbesitzer nicht beschweren, wenn der Gast sich drei Stunden lang an einem Bier festhält. Die deutsche Tafelrunde sitzt gern lange und gemütlich vor leer gegessenen Tellern. Während wir hier lernen, dass ein guter Kellner erst abräumt, wenn alle fertig sind, wurde uns in den USA häufig der Teller entrissen, während wir noch am letzten Bissen kauten. Was dort als schneller Service gilt, kam für uns einem Rausschmiss gleich. Aber nach zehn Jahren Amerika hat sich unser Empfinden umgestellt: Abgenagte Knochen und Saucenreste wollen wir nun schnellstens loswerden.
Nach dem Essen machen wir Deutschen gerne einen Spaziergang, egal ob die Sonne scheint oder es regnet: Wir gehen «raus an die Luft». Ein Amerikaner fände das recht seltsam, zumindest solange er keinen Hund hat, der ihn an die Luft zwingt. Unsere Parks und Spazierwege sind am Wochenende voller Menschen. Mütter schicken ihre Kleinen bei Wind und Wetter raus ins Freie, mindestens einmal am Tag. Selbst im Winter lässt die Lust auf die freie Natur nicht nach. Karawanen ziehen in warmen Jacken, Mützen und Schals durch die eisigen Lande, vertreten sich die Beine, pumpen ihre Lungen voll mit Sauerstoff. Wir schließen uns an.
An vieles mussten wir uns erst wieder gewöhnen. Wir wollen keinesfalls behaupten, dass Eigenarten und Gepflogenheiten hier oder dort besser oder schlechter wären. Tatsächlich ist das meiste eine Frage des Geschmacks oder – eher noch – der Gewohnheit. Man liebt, was man kennt.
Letzter Halt vor der Zonengrenze
Nur nicht im falschen Chor singen!
Helmstedt, eine niedersächsische Kleinstadt im Naturpark Elm-Lappwald, macht heute über die Region hinaus nicht mehr viel von sich reden. Das war bis vor gar nicht langer Zeit anders. Rund vier Jahrzehnte lag bei Helmstedt der bedeutendste Grenzübergang zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Millionen Reisende passierten jährlich den Kontrollpunkt, um nach Berlin oder in die DDR, nach Polen oder in die Tschechoslowakei zu gelangen, kontrolliert vom Bundesgrenzschutz im westlichen Helmstedt und der Volkspolizei im östlichen Marienborn. Der Kontrollpunkt Helmstedt/Marienborn war nicht nur das Nadelöhr zwischen zwei deutschen Staaten, die hermetisch voneinander abgeschottet waren, sondern auch zwischen zwei verfeindeten Machtblöcken, dem sozialistischen und dem kapitalistischen Teil der Welt. Kaum ein Westdeutscher, der in den Jahren der Teilung nicht wartend im Grenzstau auf der A2 gestanden hätte. Viele Durchreisende entschlossen sich zu einer letzten Pause im Westen, bevor sie sich auf die holprige Autobahn im verwandten und doch so unbekannten Nachbarland wagten. So gelangte Helmstedt mit weniger als dreißigtausend Einwohnern zu ungewöhnlicher Berühmtheit.
Für uns ist Helmstedt von persönlicher Bedeutung. Hier im Zonenrandgebiet ist Sabine geboren und aufgewachsen.
Altbundeskanzler Willy Brandt sagte einmal, er habe sich nie als Westdeutscher gefühlt. «Wenn überhaupt, dann als Norddeutscher», fügte er hinzu. Als Tom das seinerzeit las, wurde ihm klar, dass er sich sehr wohl als Westdeutscher fühlte. Das Rheinland grenzt an die Niederlande, Belgien und Frankreich. Es war selbst in der alten Bundesrepublik die westlichste Region. In Köln gibt es noch viele französische Wörter aus der Zeit der Besetzung durch Napoleon: Portemonnaie für Geldbörse, Plumeau für Federbettdecke, Trottoir für Bürgersteig. Wenn Toms Großmutter bei Regenwetter rausging, sagte sie nie: «Ich nehme meinen Regenschirm.» Sie sagte: «Isch nämme minge Paraplü.» Nicht nur dieses Regionalbewusstsein sorgte für ein westdeutsches Grundgefühl. Auch das Leben in der Bundesrepublik, fest im Westen verankert, war eine Identität geworden. Sabine dagegen hatte die Grenze zur DDR immer vor Augen. Sie war gewissermaßen eine östliche Westdeutsche.
Wenn ich früher von Helmstedt sprach, schaute mich niemand fragend an. Meine Heimat war bekannt, nicht nur in Deutschland. «Ach Helmstedt, ja, das kenne ich!», bekam ich oft zu hören. «Dort haben wir auf der Fahrt nach Berlin mal Kaffee getrunken.» Als Studentin kam ich per Bahn immer nach Hause, ohne umzusteigen. Paris– Helmstedt– Berlin– Warschau hieß die Verbindung. Dabei zeichnete sich das beschauliche Städtchen – abgesehen von einer italienischen Eisdiele – keineswegs durch internationales Flair aus. Im Zug dagegen, vor allem im Mitropa-Bahnrestaurant, herrschte eine unverwechselbare Atmosphäre: kosmopolitisch, bohemehaft, verraucht. Die Mitropa, die bereits nach dem Ersten Weltkrieg deutsche Schlaf- und Speisewagen bewirtschaftete, war übrigens eine der ganz wenigen Aktiengesellschaften, die 45Jahre Sozialismus überstanden. «Letzter Westbahnhof vor der Grenze», verkündeten die Lautsprecher, bevor der Zug in Helmstedt einfuhr. Meist war ich die Einzige, die ausstieg, um zu bleiben. Dabei konnte ich mir Zeit lassen. Der Zug stand lange auf dem Gleis, denn die Grenzbeamten brauchten ewig, um die Pässe aller Mitreisenden zu kontrollieren. Auf dem Bahnsteig patrouillierten derweil Posten mit Wachhunden. Und das war nur die erste Kontrolle. Zehn Kilometer weiter in Marienborn dann dasselbe Spiel nochmal unter östlicher Regie. Aber da war ich schon ausgestiegen.