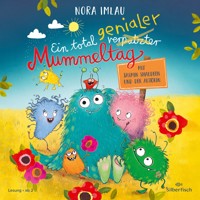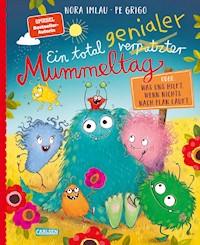10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Entspannte Eltern, zufriedene Kinder: So stellen wir uns ein gelungenes Familienleben vor. Zwischen Stress und Schuldgefühlen geht jedoch oft die Freude und Leichtigkeit im Zusammenleben verloren. Nora Imlau - Bestsellerautorin, Journalistin und Mutter von vier Kindern - kennt den Leidensdruck und die Orientierungssuche heutiger Mütter und Väter. Verständnisvoll und fachkundig leuchtet sie in ihrem Buch aus, wie ein modernes, liebevolles Familienleben gelingen kann: Die Bedürfnisse der Großen wie der Kleinen müssen gleichermaßen berücksichtigt werden. Dabei räumt sie mit den Mythen überhöhter Ideale moderner Elternschaft auf und zeigt, wie Eltern und ihre Kinder zu einem Familienleben finden, das Kraft gibt, statt Energie zu kosten. Ein bestärkendes Handbuch für alle, die mit Kindern authentisch und auf Augenhöhe leben und die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mein Familienkompass
Die Autorin
Nora Imlau, geboren 1983, ist Buchautorin, Journalistin und Referentin. Zu ihren Veröffentlichungen zählen: So viel Freude, so viel Wut, Schlaf gut, Baby! und Du bist anders, du bist gut.Journalistisch schreibt sie seit vielen Jahren u.a. für ELTERN und ELTERN family, ZEIT online, chrismon und wird von überregionalen Medien interviewt.Sie hält regelmäßig Vorträge sowohl auf Fachkongressen und Fortbildungen als auch bei Veranstaltungen im Bereich der Familienbildung. Mit ihrem Mann und ihren vier Kindern lebt sie in Süddeutschland.
Das Buch
Familien-Expertin Nora Imlau beschreibt, wie zwischen Eltern und Kindern eine Beziehung wachsen kann, die fürs Leben trägt. Entscheidend ist, wie wir miteinander umgehen - unter diesem Leitstern kann ein liebevolles Miteinander auf Augenhöhe gelingen. Mein Familienkompass sammelt nicht die Antworten auf ein spezifisches Erziehungsproblem, sondern widmet sich den ganz großen Fragen des Elternseins. Dabei räumt Nora Imlau mit überhöhten Idealen moderner Elternschaft auf und zeigt, wie Eltern und ihre Kinder zu einem Familienleben finden, das Kraft schenkt, statt nur Energie zu kosten.
Nora Imlau
Mein Familienkompass
Was brauch ich und was brauchst du?
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
ISBN 978-3-8437-2407-41. Auflage 2020© 2020 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinCovergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: © Maria HerzogAutorenfoto: © Christoph LuttenbergerAlle Rechte vorbehaltenE-Book powered by pepyrus.com
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Die besten Eltern der Welt
Wo wir herkommen
Frühe Prägungen
Glaubenssätze aufspüren und erkennen
Den eigenen Nordstern finden
Werte, die fürs Leben tragen
Was wir mitbringen
Von Steinzeitkindern und Klosterschülern
Wo wir stehen
Die Wissenschaft hat festgestellt …
Im Hier und Jetzt – und in der Zukunft
Nicht weniger Mensch
Endlich unperfekt
Großwerden ohne Gewalt
Kooperation statt Gehorsam
Wie Familie gelingen kann
Attachment Parenting – was spricht dafür, was dagegen?
Bindung als Schlüssel
Bedürfnisse als Richtschnur
Liebevolle Wegbegleiter
Reden, fragen und verstehen
Einfach ehrlich sein
Respektvolles Miteinander, ganz konkret
Selbstbestimmung, Fremdbestimmung: Wer führt?
Regeln, Grenzen, Konsequenzen
Eltern unter Druck
Gut genug ist gut genug
Wir und der Rest der Welt
Die ganz große Freiheit
Anhang
Statt einer Danksagung
Mein Familienkompass – Deine Kreativwerkstatt zum Buch
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Die besten Eltern der Welt
Widmung
Für MalteMein Nordstern bis du.
Die besten Eltern der Welt
Worauf kommt es an im Leben? Es gehört zum Elternwerden dazu, dass wir uns plötzlich die ganz großen Sinnfragen stellen. Schließlich wollen wir unsere Kinder nicht einfach nur irgendwie großkriegen. Nein: Wenn es eine Sache gibt, bei der wir wirklich nichts falsch machen wollen, dann ist es diese hier. Glücklich sollen unsere Kinder heranwachsen, geborgen und frei. Sie sollen mit beiden Beinen im Leben stehen und sich uns immer anvertrauen können. Sozial und rücksichtsvoll sollen sie sein, aufrecht und selbstbewusst, aber nicht arrogant. Wir wollen ihnen alles mitgeben, was sie für ein selbstbestimmtes, sinnerfülltes Leben brauchen. Wir wollen sie sich ausprobieren und auch mal auf die Nase fallen lassen, aber dann wollen wir da sein und ihnen dabei helfen, wieder aufzustehen. Kurz: Unseren Kindern soll es gut gehen, jetzt und in Zukunft. Und wir sind die Menschen, die uns dafür verantwortlich fühlen und die das möglich machen wollen und sollen – ihre Eltern.
Es ist nichts Ungewöhnliches, dass Eltern nur das Beste für ihre Kinder wollen. Das haben auch unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern getan, genau wie alle Generationen vor ihnen. Und genau wie wir selbst waren auch unsere Vorfahren geprägt von dem Zeitgeist, der ihre Epoche prägte: In Deutschland und seinen europäischen Nachbarländern wurden mit Beginn der Industrialisierung Struktur und Disziplin wichtige Erziehungsziele – Kinder sollten genauso reibungslos funktionieren wie die Maschinen in den Fabriken. Während der Nazi-Diktatur war die Staatsdoktrin, Kinder hart wie Kruppstahl zu erziehen – als willige Untertanen für Volk und Führer. In der DDR stellte gesellschaftlicher Zusammenhalt einen hohen Wert dar: Kinder sollten sich selbst nicht so wichtig nehmen, sich gut in Gruppen einfügen und ihre Eltern nicht von der Lohnarbeit abhalten. Und in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit sollten gehorsame und fleißige Töchter ihren Müttern im Haushalt zur Hand gehen und so helfen, das Familienidyll aufrechtzuerhalten, während ihre Brüder viel mehr Freiheiten genossen, aber kaum Gefühle zeigen durften. Mit dem Erstarken der Bindungsforschung wehte ab den späten 1960er-Jahren dann allmählich ein frischer Wind in immer mehr Kinderzimmer. Eltern fingen an, ihre Kinder als vollwertige Menschen anzusehen, die eben nur ein bisschen kleiner geraten waren – damals ein vollkommen neuer und revolutionärer Gedanke. Doch ihre eigene autoritäre Prägung konnten auch die folgenden Elterngenerationen nur langsam überwinden. Wir Eltern, die heute kleine bis mittelgroße Kinder haben, wurden zum größten Teil selbst in einer Art erzieherischer Umbruchphase groß: Einige von uns wurden bereits sehr frei und demokratisch erzogen, andere noch streng und repressiv. Vor allem aber war unsere Erziehung häufig von einer gewissen inneren Widersprüchlichkeit geprägt: Gehorsam war offiziell nicht mehr Erziehungsziel, wurde aber trotzdem irgendwie erwartet. Wir Kinder sollten durchaus auch mal unsere Meinung sagen – aber bitte die richtige. Und Nähe und Geborgenheit wurden uns weniger verwehrt als den Babys und Kleinkindern der Nachkriegsgeneration, doch die Angst vor dem Verzärteln schwang oft trotzdem noch mit. Wir sind die Generation der Kriegsenkel: Privilegiert groß geworden im Vergleich zu unseren Eltern und Großeltern, und trotzdem noch von deren Schmerz und Traumata geprägt. Und jetzt stehen wir vor der Aufgabe, die nächste Generation zu begleiten – in einer Zeit, in der es so wenig gesellschaftlichen Konsens über die richtige Erziehung gibt wie noch nie. Denn das, was Soziologen Wertepluralismus nennen – also das Phänomen, dass sich in unserer modernen Gesellschaft immer weniger von allen anerkannten Grundwerten finden lässt –, wirkt nun mitten in unseren Alltag hinein.
Dazu kommt, dass auch das Familienleben selbst heute so bunt und vielfältig ist wie nie zuvor: Eltern kommen immer häufiger aus unterschiedlichen Kulturen und bringen ihre ganz eigenen Prägungen rund ums Elternsein und Kinderhaben mit. Darüber hinaus ist Familie keine Frage der Blutsverwandtschaft mehr, sondern vor allem eine der Herzensbande. Da wachsen uns Bonuskinder ans Herz, da bereichern Pflegekinder unser Leben, da werden aus engen Freunden Wahlverwandte und aus Freunden Eltern, auch wenn sie nie ein Liebespaar waren. Manche Kinder wachsen mit Eltern auf, die getrennt sind, aber gemeinsam erziehen. Bei anderen ist es genau umgekehrt. Klar, dass sich dabei Fragen auftun, die sich früheren Elterngenerationen so nie gestellt haben.
Als Eltern einfach mit der Masse mitschwimmen: Das ist schwer geworden, weil es im Umgang mit Kindern momentan keinen Mainstream gibt, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Strömungen, die um den richtigen Weg ringen. Inmitten eines solchen gesellschaftlichen Diskurses selbst für ein Kind verantwortlich zu sein ist zweifelsohne anstrengend und herausfordernd, weil man gefühlt so viel falsch machen kann – egal, was man tut. Da verwundert es nicht, dass sich Eltern heute manchmal nach der der Einfachheit früherer Zeiten zurücksehnen, in der man eben einfach ganz normal seine Kinder erzog wie alle anderen auch und daraus keine Grundsatzentscheidung über die Wertebasis des eigenen Lebens machte. Doch so verständlich diese Sehnsucht ist, so trügerisch ist sie auch. Denn die Belastung, den eigenen Weg finden zu müssen, ist der Preis für eine der größten Errungenschaften unserer Zeit: die Freiheit, das eigene Leben selbstbestimmt gestalten zu können.
Doch wie stellen wir das ganz konkret an? Wie schaffen wir es, unseren Kindern die Eltern zu sein, die wir sein wollen? Seit knapp 15 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit genau dieser Frage – sowohl beruflich als auch privat. Denn alles, was ich als Fachjournalistin für Familienthemen über gelingende Eltern-Kind-Beziehungen und ein bindungsstarkes Miteinander erfahren und gelernt habe, wird im Leben mit meinen eigenen vier Kindern tagtäglich auf den Prüfstand gestellt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn man in schlauen Büchern gelesen hat, wie das mit dem achtsamen Begleiten auf Augenhöhe gehen soll – und dann im Alltag immer wieder krachend an den eigenen Ansprüchen scheitert. Ich kenne den immensen Druck, unter dem wir Eltern heute stehen, ebenso wie die Sehnsucht nach mehr Leichtigkeit im Zusammenleben mit unseren Kindern. Kann es wirklich richtig sein, dass sich der Alltag mit dem eigenen heiß geliebten Kind so unglaublich erschöpfend anfühlt? Ist es eigentlich normal, oft so verunsichert, so voller Schuldgefühle und Selbstzweifel zu sein?
Als ich im Jahr 2007 als junge Mutter damit begann, in der reichweitenstärksten deutschen Familienzeitschrift öffentlich darüber nachzudenken, wie ein neues, auf Bindung und Beziehung aufbauendes Miteinander zwischen Eltern und Kindern aussehen kann, war das im deutschsprachigen Raum ein Novum. Erziehungsratgeber und Elternzeitschriften waren darauf ausgelegt, Kinder zum Funktionieren zu bringen – liebevoll, aber konsequent. Seitdem ist viel passiert. Eine neue Elterngeneration begann zusehends, alte Glaubenssätze zu hinterfragen und das Prinzip Erziehung ganz neu zu denken. Und durch das Erstarken der Netzöffentlichkeit und der sozialen Medien taten immer mehr Eltern dies nicht still für sich, sondern für alle sichtbar. Elternforen, Familienblogs und Social-Media-Kanäle schossen wie Pilze aus dem Boden und zeigen heute die unendliche Vielfalt des modernen Elternseins. Die Neuorientierung und Sinnsuche, die im Leben junger Menschen mit dem Elternwerden einsetzt, ist damit keine rein private Erfahrung mehr, sondern ein von der Öffentlichkeit des Internets begleiteter und beeinflusster Prozess. Das hat viele Vorteile – Inspiration und Information zum Thema Elternsein zu finden war niemals leichter –, bringt jedoch auch neue Probleme mit sich: Die schiere Fülle der widersprüchlichen Tipps und Theorien kann nicht nur Neu-Eltern leicht erschlagen, die Selbstinszenierung scheinbar unfehlbarer Influencer-Eltern erhöht schnell den Perfektionsdruck im eigenen Leben, und die zum Teil heftige gegenseitige Verurteilung im Netz trägt ihren Teil dazu bei, dass immer mehr Familien das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, nicht zu genügen, zu versagen.
Der innige Wunsch, gute Eltern zu sein, gepaart mit heftigen Schuldgefühlen und schlimmer Versagensangst: Wie präsent diese Kombination in Familien heute ist, weiß ich aus all den Nachrichten, die mich täglich erreichen, aus den Fragerunden und Gesprächen mit Eltern im Rahmen meiner Vortragsreisen sowie aus meiner Zusammenarbeit mit Menschen, die in der Beratung und Begleitung von Familien tätig sind. Und nicht nur das: Ich spüre auch selbst, wie extrem der Druck auf Eltern seit meiner ersten Schwangerschaft zugenommen hat, wie viel schwerer es heute auch für mich als Mutter ist, selbstbewusst und zuversichtlich den eigenen Weg zu gehen, wenn hinter jeder Ecke das schlechte Gewissen lauert, nicht gut genug zu sein: Weil ich meine Kinder zu früh in Betreuung gebe, zu spät oder gar nicht. Weil meine Kinder aufräumen müssen oder ich ihnen alles hinterhertrage. Weil ich zu streng bin oder zu lasch, zu beschäftigt oder zu faul, zu verbissen in meinen Nachhaltigkeitsbestrebungen oder zu lax durch meine Bequemlichkeit, die den Planeten zerstört. Angesichts dieser Entwicklung hat sich auch der Fokus meiner Arbeit verändert: Ging es mir anfangs vor allem darum, Erwachsene stärker für kindliche Bedürfnisse zu sensibilisieren, so liegt der Schwerpunkt meiner Arbeit nun darauf, Familien Druck zu nehmen und Mut zu machen. Mut zu einem Miteinander, das auf vertrauensvolle Beziehungen auf Augenhöhe setzt statt auf Druck und Strafen. Aber auch den Mut, sich gegen Perfektionsdruck und Dauer-Schuldgefühle zu wehren und uns selbst als Eltern wieder zuzugestehen, echte Menschen mit Ecken und Kanten, Ängsten und Sorgen zu sein statt makellose Bedürfniserfüllungs-Automaten. Deshalb schreibe und spreche ich heute öffentlich offline wie online über alle Aspekte jenes bindungsstarken, zugewandten Elternseins, von dem ich glaube, das es Familien fit macht fürs 21. Jahrhundert: die schönen und die schmerzhaften, die schwierigen und die Aspekte, die die Leichtigkeit zurückbringen.
Von den vielen dankbaren Rückmeldungen, die mich seither erreicht haben, ist mir eine ganz besonders in Erinnerung geblieben. »Ich wünschte, deine Worte könnten mich tagtäglich in meinem Alltag begleiten«, schrieb mir eine Mutter nach einem Vortrag. »Wie ein Kompass, der mir hilft, meinen eigenen Weg nicht zu verlieren, und der mir die Sicherheit und das Selbstvertrauen gibt, das deine Texte in mir auslösen.« So kam ich auf die Idee, all das aufzuschreiben, was ich von Eltern so oft gefragt werde und was ich selbst so gerne gewusst hätte, als ich zum ersten Mal Mutter wurde: Worauf es im Zusammenleben mit Kindern wirklich ankommt. Wie wir es auf lange Sicht schaffen, die Bedürfnisse der Großen und der Kleinen unter einen Hut zu bekommen. Und wie eine Eltern-Kind-Beziehung entsteht, die Halt gibt und Raum zum Wachsen lässt, die auch Stürme und schwere Zeiten übersteht, und in der die Liebe zueinander stärker ist als alles andere. Ein Kompass, der Familien hilft, sich nicht im täglichen Klein-Klein zu verlieren, sondern das Wesentliche im Blick zu behalten: Wie wir mit unseren Kindern so umgehen, dass sie sie sich gut und liebenswert fühlen. Und wir selbst uns auch.
Wo wir herkommen
Frühe Prägungen
Wir Menschen sind sehr stolz auf unseren freien Willen. Nur allzu gerne glauben wir, alles, was wir tun, gründe auf unseren ureigensten Entscheidungen, getroffen auf der Basis guter Argumente. Doch die Wahrheit ist: Weit über die Hälfte unserer Entscheidungsfindungen passiert in unserem Unterbewusstsein, dort also, wo der rationale Teil unseres Gehirns gar nicht hinreicht. Stattdessen regieren dort unsere frühesten Prägungen, unsere Bedürfnisse und Wünsche, Sorgen und Ängste und flüstern uns ein, was der richtige Weg sei. Im Umgang mit unseren Kindern gilt das in ganz besonderem Maße. Denn was sich für uns als Eltern richtig oder falsch anfühlt, wird maßgeblich davon beeinflusst, wie wir selbst in unserer Kindheit behandelt wurden. Aus evolutionärer Sicht ist dieses unbewusste Abspeichern eigener Erziehungserfahrungen eine sinnvolle Strategie: Weil wir Menschen an so unterschiedlichen Orten und unter so verschiedenen Bedingungen leben, wäre ein angeborener Brutpflegeinstinkt, wie ihn die meisten Säugetiere haben, für uns wenig hilfreich – schließlich braucht ein Menschenbaby, das am Polarkreis geboren wird, ganz andere Fürsorge und Schutz als ein Kind, das in der Wüste aufwächst. Da macht es deutlich mehr Sinn, als Menschenkind zu verinnerlichen, was in dieser, der eigenen Kultur der richtige Umgang mit Kindern ist – und diesen dann später mit den eigenen Kindern zu reproduzieren. Die Sache hat nur einen Haken: Ungünstige Verhaltensweisen verfestigen sich so ebenso wie hilfreiche, denn als kleine Kinder sind wir nicht in der Lage, zwischen beiden zu unterscheiden. Das viel gelobte Bauchgefühl, auf das zu hören jungen Eltern so oft geraten wird, ist deshalb in vielen Fällen nichts weiter als eine wilde Mischung eigener Erfahrungswerte sowie Glaubenssätzen und Überzeugungen, die wir unbewusst aus unserer eigenen Kindheit mitgenommen haben, und die jetzt unser Denken und Fühlen in Bezug auf unsere eigenen Kinder prägen. Ob wir ein tobendes Kind als verzweifelt oder als tyrannisch empfinden, wurzelt zum Beispiel in dieser Prägung. Wie wir emotional auf Lärm, Stress und freche Widerworte reagieren, ebenfalls. Und auch die Frage, ob wir uns selbst als gute Eltern empfinden, hat entscheidend mit diesen frühkindlichen Erfahrungen zu tun.
Ein ganz typischer Umgang mit diesen unbewussten Prägungen ist es nun, sie zumindest scheinbar zu objektivieren. Das heißt: Wenn wir Bücher, Artikel oder Interviews zu Kinder- und Familienthemen lesen, dann am liebsten die, die unser unbewusstes Empfinden und unsere Weltsicht bestätigen. Und weil es für nahezu jede Überzeugung irgendeinen Experten gibt, der sie vertritt, ist es nicht schwer, sich seine eigenen Glaubenssätze auf diese Weise zu vergolden: »Der Hirnforscher neulich im Fernsehen fand schließlich auch, dass Kinder am besten ganz ohne Bildschirme aufwachsen sollten!«
Wie wir mit unseren Kindern umgehen, ist also zu einem viel kleineren Teil von unserer eigenen Wahl abhängig, als wir oft annehmen. Stattdessen ist es meist so, dass unser Unterbewusstsein die Entscheidung für uns bereits getroffen hat, und der rationale Teil unseres Gehirns nur noch die passende Erklärung sucht, damit wir uns selbst glauben lassen können, auf der Basis vernünftiger Gründe zu agieren. Das gilt übrigens auch dann, wenn wir unsere Kinder ganz bewusst anders erziehen wollen, als wir selbst groß geworden sind. Denn auch in der Abgrenzung von bestimmten Verhaltensweisen reproduzieren wir oft Muster unserer Vergangenheit und fallen dabei leicht von einem Extrem ins andere. Wer als Kind dickgefüttert wurde, rutscht – mit den besten Absichten, es anders zu machen – leicht in ein ebenso übergriffiges Verhalten am Esstisch, nur eben in die andere Richtung: kurzhalten statt mästen.
Wenn wir wirklich die Verantwortung dafür übernehmen wollen, wie wir mit unseren Kindern umgehen und welche Botschaften wir dabei weitergeben, müssen wir uns deshalb mit unseren eigenen Prägungen auseinandersetzen. Denn zu verstehen, welche Erfahrungen und Glaubenssätze uns wirklich antreiben, ist der erste Schritt dahin, unser Miteinander als Familie frei und selbstbestimmt so zu gestalten, wie wir es wollen.
Glaubenssätze aufspüren und erkennen
Sich mit der Frage zu befassen, wie wir mit unseren Kindern heute umgehen und wie wir vielleicht mit ihnen umgehen sollten, geht praktisch immer damit einher, auf bestimmte Ideen mit heftigem inneren Widerstand zu reagieren. Ein typisches Beispiel: In einem Zeitungsinterview sagt eine Expertin, Eltern sollten ihre Babys auch im Sinne einer gesunden Missbrauchsprophylaxe stets um Erlaubnis fragen, bevor sie sie wickeln – schließlich dringen sie dabei ja in ihre Intimsphäre ein. »Haben wir echt keine anderen Probleme?«, ist eine typische erste Reaktion, dicht gefolgt von: »Also, man kann’s auch echt übertreiben!« Diese spontan abwertenden, abtuenden Gedanken sind typische Selbstschutzmechanismen, eine Art automatischer Abwehrmechanismus unseres Gehirns gegen unbequeme Thesen und Argumente, die uns zwingen könnten, unsere tief verinnerlichten Glaubenssätze zu überdenken, was anstrengend und unbequem ist. Keine Sorge: Das ist ganz normal und macht uns nicht zu schlechten Menschen. Glaubenssätze sind nämlich tiefe Überzeugungen, die wir alle in uns tragen. Meist wurzeln sie in unserer frühen Kindheit. Viele haben wir unbewusst von unseren Eltern oder anderen Menschen aus unserer Umgebung übernommen, andere sind aus einem Wunsch der Abgrenzung heraus als Gegenpol zu an uns herangetragenen Botschaften entstanden.
Glaubenssätze können uns selbst oder andere betreffen, als moralische Überzeugungen oder als scheinbar objektive Fakten daherkommen, und sie sind per se weder richtig noch falsch, sondern schlicht erst mal vorhanden. Sie sind Botschaften, die wir verinnerlicht haben, die uns Halt geben und uns die Welt erklären. Uns selbst betreffend können solche Glaubenssätze zum Beispiel lauten: »Ich bin gut, so wie ich bin.« Oder eben auch: »Was auch immer ich tue, ich bin nicht gut genug.« Es gibt sehr spezifische Glaubenssätze (»Ich bin total unmusikalisch«) und sehr allgemeine (»Die Welt ist ein gefährlicher Ort.«). Doch auch scheinbare Alltagsweisheiten können zu Glaubenssätzen werden: »Wer im Winter keinen Schal trägt, wird krank«, wäre ein Beispiel dafür. Oder: »Apfelsaft ist gesünder als Limonade.« Es gibt Glaubenssätze, die sind faktisch richtig, und es gibt Glaubenssätze, die sind faktisch falsch. Doch weil wir so fest an sie glauben, fühlen sie sich selbst dann richtig an, wenn sie objektiv nicht stimmen – was wir an unserer eigenen emotionalen Reaktion merken, wenn sie in Frage gestellt werden. Ein Beispiel: Wenn ich jahrelang davon ausgehe, es sei ungesund, Wasser aus der Leitung zu trinken, und dann in der Zeitung ein Interview mit einer Expertin lese, die erklärt, Leitungswasser sei super Trinkwasser – dann ist die spannende Frage, wie ich auf diese Information reagiere. Eine Möglichkeit ist, dass ich ohne jede Aufregung anerkenne, dass meine bisherige Annahme anscheinend nicht richtig war, und sie korrigiere (egal, ob ich nun selbst in Zukunft Leitungswasser trinken will oder nicht). Die zweite Reaktionsmöglichkeit ist, dass ich eine seltsam emotionale Abwehr dem Expertenwissen gegenüber spüre. »Das kann doch nicht sein!«, wäre eine typische Reaktion. »Dieser komischen Trulla glaube ich das nicht!«. Und schließlich: »Ich WILL aber kein Leitungswasser trinken! Das ist EKLIG!« Spätestens an diesem Punkt haben wir die Sachebene verlassen und merken: Hier geht es um uns, um unsere Prägungen, um Botschaften, die wenig mit Fakten und viel mit gefühlten Wahrheiten zu tun haben.
Wir alle tragen Tausende solcher Glaubenssätze mit uns herum. Und oft sind sie uns nützlich: Sie helfen uns, in unübersichtlichen Situationen Entscheidungsparameter an der Hand zu haben (»Im Zweifelsfall kaufe ich immer das Markenprodukt«) und geben uns in einer sich ständig wandelnden Welt ein Gefühl von Sicherheit (»Wenn ich fleißig und sparsam bin, kann mir nichts passieren«). Sie haben uns durch unsere eigene Kindheit gebracht, durch Schulzeit und Erwachsenwerden. Doch weil wir sie nie bewusst angeschaut und überprüft haben, haben wir nie entdeckt, dass sich unter den Botschaften, die sich uns eingebrannt haben, auch schwierige, schädliche und schlicht falsche eingeschlichen haben, die uns das Leben und das Miteinander mit unseren Liebsten unnötig erschweren. Wenn wir uns auf den Weg machen, unsere Glaubenssätze aufzuspüren und zu hinterfragen, dann also nicht, um sie samt und sonders auszumerzen und ein ganz neuer Mensch zu werden. Es ist eher so, als würden wir Inventur machen: Wir gucken uns an, was wir haben, prüfen, was noch gut ist, und behalten dann nur, was wir gebrauchen können.
Wenn wir unseren eigenen Glaubenssätzen auf die Spur kommen sollen, sind solche spontanen Abwehrreflexe wertvolle Hinweisgeber, dass es hier etwas zu entdecken gibt. Wenn also – auch bei der Lektüre dieses Buches – an der einen oder anderen Stelle plötzlich Ärger oder gar Wut aufkommt und uns Sätze wie »Irgendwann ist jetzt aber auch mal gut« in den Sinn kommen, können wir diese spontane, emotionale Reaktion als Signal einordnen, dass wir hier einen unserer Glaubenssätze berühren, die wir alle in uns tragen. Es zwingt uns auch niemand, diese abzulegen oder zu überwinden. Aber es lohnt sich, sie uns anzusehen, kritisch zu überprüfen und dann zu entscheiden, ob wir sie behalten wollen.
Was müssen wir also tun, um unseren Kindern gute Eltern zu sein? Vor Antworten auf diese Frage können wir uns heute kaum retten. Jeder gibt seinen Senf dazu: Eltern und Freunde, Nachbarn und Kollegen und natürlich auch all die Erziehungsratgeber, die wir lesen. Dazu kommen die Experten-Tipps: die Hebamme sagt dies, die Kinderärztin das, und die Expertin im Frühstücksfernsehen wieder was anderes. Angesichts dieses Chaos widersprüchlichster Ratschläge ist es kein Wunder, dass viele Eltern irgendwann genervt die Ohren auf Durchzug stellen und beschließen: »Wir wursteln uns da jetzt einfach irgendwie durch, mit Bauchgefühl und gesundem Menschenverstand. So schwer kann das doch nicht sein!« Was für ein Befreiungsschlag: Sich frei zu machen von der Meinung der anderen und einfach dem eigenen Herzen zu folgen! Es gibt da leider nur ein Problem: Sowohl unsere Gedanken als auch unsere Gefühle in Bezug auf unsere Kinder entstehen nicht im luftleeren Raum und erwachsen niemals allein aus uns selbst heraus. Sie sind viel mehr die Quintessenz unserer Glaubenssätze und Prägungen, Überzeugungen, Hoffnungen und Ängste – und damit oft viel weniger unser individueller Weg, als wir oft glauben. Konkret heißt das: Auch wenn wir beschließen, nur noch auf uns selbst zu hören, wirken die Botschaften aus der Außenwelt nach wie vor in uns fort und beeinflussen, wie wir unsere Kinder sehen und wie wir mit ihnen umgehen. Ihre Wirkung ist dabei nicht immer gleich stark. Wenn es uns gut geht, wir uns sicher und selbstbewusst fühlen, ausgeschlafen und zuversichtlich sind, ist die Macht der Stimmen aus dem Außen sehr begrenzt. Mit nahezu traumwandlerischer Sicherheit bewegen wir uns in diesen Zeiten ganz intuitiv in unserer Elternrolle und sind gegen Kritik und Selbstzweifel nahezu immun. Doch es gibt im Leben mit Kindern ja auch andere Momente, viele andere Momente. In denen der Alltag nicht rund läuft, in denen wir uns erschöpft und ausgebrannt fühlen und in dem unser Nachwuchs sich ganz anders verhält, als wir es uns immer vorgestellt hatten. Diese Momente der Unsicherheit und Verletzlichkeit sind es, die den Nährboden bereiten für alte und verschüttete Botschaften, die plötzlich ungeheure Macht in uns entfalten – und uns oft zu jenen Eltern machen, die wir nie sein wollten. Wenn wir wirklich unseren eigenen Weg gehen wollen, müssen wir deshalb nicht aufhören zuzuhören, sondern im Gegenteil ganz genau Obacht geben, welche Botschaften über Eltern und Kinder an uns im Laufe unseres Lebens herangetragen wurden und immer noch werden, um dann zu entscheiden: Was davon wollen wir mitnehmen, und was lassen wir liegen?
Bei meinen Vorträgen erlebe ich es immer wieder, dass Eltern sich von mir wünschen, ich würde diese Sortierarbeit für sie erledigen. »Ist es denn nun okay, einen Dreijährigen zum Rausgehen zu zwingen?«, fragen sie. »Darf ich meiner Vierzehnjährigen abends ihr Handy wegnehmen?« »Muss ich als Mutter wirklich immer geduldig und verständnisvoll bleiben?« Und ich kann diesen Wunsch so gut nachvollziehen! Wie oft habe ich mich selbst danach gesehnt, dass jemand kommt und mir in papstähnlicher Unfehlbarkeit einen Freibrief ausstellt: »Ja, es ist okay, dass du dein Kindergartenkind fernsehen lässt, um in Ruhe das Baby schlafen zu legen! – Ja, du darfst Tomatensuppe aus der Tüte kochen. – Nein, jetzt abzustillen macht dich nicht zur schlechten Mutter!« Doch so verständlich diese Sehnsucht nach Absolution ist, so gefährlich ist sie auch. Denn sie bedeutet letztendlich, dass wir die Frage, was gutes Elternsein bedeutet, an irgendeine externe Instanz auslagern und dabei allgemeingültige Antworten erwarten – anstatt zu sehen, welche individuelle Antwort für uns als Familie gilt. Denn der Punkt ist doch: So wie sich keine zwei Familien gleichen, kann es auch keine allgemeingültigen Antworten auf spezifische Fragen des menschlichen Miteinanders geben. Schließlich spielt in jede Fragestellung so viel mehr herein, als in ein oder zwei Sätze passt: »Ist es okay, einen Dreijährigen zum Rausgehen zu zwingen, der wegen einer Atemwegserkrankung auf Kur an der Nordsee ist und am Strand sicher viel Spaß haben wird, sich jetzt akut gerade aber kaum vom Bällebad lösen kann?« Eine passende Antwort auf diese Frage sieht in jedem Fall ganz anders aus, als wenn wir von einem Dreijährigen sprechen, der nach einem langen Tag im Waldkindergarten gerade nur noch zu Hause bleiben und mit seiner Eisenbahn spielen will. Und wenn sein Papa dann aber trotzdem losmuss, weil die kleine Schwester einen Impftermin hat? Ändert sich die Antwort wieder. Und wieder, wenn jemand zu Hause bleiben und babysitten kann. Und so weiter, und so weiter.
Jedes kleine Detail kann die Einschätzung einer Situation verändern, und in der Frage, was für Kinder zumutbar ist und was nicht, geben oft winzige Nuancen den Ausschlag: Schiebe ich ein unwilliges Kind unsanft aus der Tür, oder gebe ich ihm einen liebevoll-aufmunternden Schubs? Blickt es in ein verständnisvolles oder in ein vorwurfsvolles Gesicht, wenn es schreit, dass es nicht nach draußen will? Werde ich langsamer oder schneller, geduldiger oder ungehaltener, wenn es sich gegen das Schuheanziehen sperrt? Diese kleinen Unterschiede mögen auf den ersten Blick marginal wirken, doch bei näherem Hinsehen sind sie ganz entscheidend. Denn das Klima in unseren Familien hängt viel weniger von unseren konkreten Handlungen als von der dahinterstehenden Haltung ab. Meine häufigste Antwort auf typische Interviewfragen, in der Medienschaffende sich von mir griffige Lösungen für typische Erziehungsprobleme wünschen, lautet deshalb: »Kommt drauf an.« Was wie eine Ausflucht klingen mag, ist in Wirklichkeit Ausdruck einer meiner tiefsten Grundüberzeugungen: Wenn wir über menschliches Miteinander sprechen, kommt es immer auf den Einzelfall an. Keine Regel, von der es nicht auch eine Ausnahme geben könnte, wenn es die Situation erfordert. Keine Meinung, die wir nicht revidieren könnten, wenn es die Lage nötig macht. Es gibt nicht den einen richtigen Weg, Kinder ins Leben zu begleiten, sondern unzählige, individuelle. Und wir müssen immer wieder aufs Neue entscheiden, wie ein angemessenes Verhalten in dieser oder jener spezifischen Situation für uns aussehen kann, darf und soll. Damit wir uns dabei nicht im Chaos der aufgeschnappten Tipps und Überzeugungen verlieren und mehr oder weniger willkürlich mal so, mal so agieren, ist es jedoch wichtig, dass wir uns der Basis all dieser Entscheidungen bewusst sind.
Wir müssen nicht auf jede spezifische Fragestellung vorbereitet sein, die das Elternsein so mit sich bringt, und nicht für jedes Problem, das sich möglicherweise irgendwann entlang des Weges auftut, bereits die Lösung kennen. Aber: Wir brauchen eine gemeinsame Wertebasis, die das Fundament unseres Familienlebens darstellt. Feste, klare Grundüberzeugungen, die auf unserem Bild von der Welt, von unseren Kindern und von uns selbst fußen. Haben wir diese Grundfesten unseres Familienlebens für uns klar vor Augen, haben wir gewissermaßen den Nordstern für unseren eigenen Familienkompass gefunden: jenen Fixpunkt, nach dem sich alle anderen Entscheidungen ausrichten. Selbst entscheiden zu dürfen, wie genau dieses Wertefundament der eigenen Familie aussehen soll, ist eins der größten Privilegien, die mit dem Elternsein einhergehen. Und eins der unheimlichsten: was für eine unglaubliche Verantwortung, selbst in sich den Nordstern finden zu müssen, an dem sich alles orientiert! Doch das Geniale ist: Wenn wir dieser Verantwortung nicht ausweichen, sondern uns der Aufgabe stellen, wirklich selbst zu definieren, was eigentlich die Basis unseres Familienlebens sein soll, werden auf einen Schlag alle anderen Alltagsentscheidungen viel, viel leichterfallen. Denn wer seinen Nordstern gefunden hat, verliert sich nicht mehr so leicht im Wegweiser-Dschungel, sondern nimmt einen Kompass in die Hand, justiert ihn und folgt fortan nur noch der Nadel, die in die richtige Richtung zeigt .
Den eigenen Nordstern finden
Die Wertebasis fürs eigene Familienleben zu finden, das klingt nach einer gewaltigen Aufgabe, ernst und schwer und tendenziell ziemlich überfordernd. Umso wichtiger ist es, sich daran zu erinnern, dass unsere Suche nach dem Nordstern keine komplexe Knobelaufgabe ist, die wir mit vor Anstrengung gerunzelter Stirn hochkonzentriert lösen müssen, sondern eher eine Art Suche nach dem Schatz. Diese ist ziemlich abwechslungsreich und spannend, manchmal ganz schön überraschend, hin und wieder sicher auch anstrengend – vor allem aber macht sie Spaß! Es ist diese Leichtigkeit, diese Freude am Spielen, die wir bei aller Ernsthaftigkeit, mit der wir uns den ganz großen Fragen des Familienlebens stellen, nicht verlieren sollten. Schließlich geht es hier um unsere Kinder – jene Menschen also, die hundertmal mehr lachen als wir, die aus jeder Situation ein Spiel machen können und die so viel Absurdität und Humor in unser Leben gebracht haben. Geben wir uns also selbst die Erlaubnis, auf dieser Suche zu spielen: mit unseren Erwartungen und Wünschen, Vorstellungen und Zielen. Wir können Luftschlösser bauen und Gruselszenarien entwerfen, Autoritäten vom Sockel schubsen und Ordnungssysteme auf den Kopf stellen. Und darauf vertrauen, dass – genau wie bei unseren Kindern auch – Spielen und Lernen eins sind, und all diese Gedankenspiele uns unserem Ziel näherbringen.
Humor und Leichtigkeit sind das eine – Scham und Schuldgefühle sind die andere Seite der Medaille, wenn wir uns mit unseren Überzeugungen und Glaubenssätzen auseinandersetzen. Viele Eltern kennen das Gefühl: Voller guter Vorsätze schlagen wir ein Buch über kindliche Entwicklung und Erziehung auf – und klappen es wenig später schuldbewusst wieder zu, weil uns im Zuge der Lektüre vor allem eins klar geworden ist: was wir alles falsch machen! Tatsächlich ist die Crux moderner Elternliteratur oft, dass sie mit absolut logischen Erklärungen aufwarten kann, warum geduldige, achtsame, reflektierte, liebevolle Eltern das Beste für Kinder sind – und die Lesenden dann damit allein lässt, bitteschön so zu werden. In der Folge entsteht bei vielen Eltern der Eindruck, es gäbe eben ein paar große Vorbilder, die diese ganze Familiensache mit Nerven wie Stahlseilen rocken und darüber kluge Bücher schreiben – und jede Menge Normalsterbliche, die diese Bücher dann lesen und tagtäglich an den darin abgesteckten, hohen Idealen scheitern. Deshalb an dieser Stelle ein wichtiger Disclaimer: »Über Familie zu schreiben« und »Familie zu leben« ist nicht dasselbe. Und sich auf Spurensuche zu begeben, wie ein gelingendes Familienleben im 21. Jahrhundert aussehen kann, ist nicht gleichbedeutend damit, automatisch alle Antworten zu kennen. Sich der eigenen Prägungen und Muster bewusst zu werden, die wir alle in unsere Elternrolle mitbringen, ist ein herausfordernder und manchmal schmerzhafter Prozess. Und es ist normal, sich im Zuge dieser Auseinandersetzung darüber klar zu werden, dass wir mit unseren Kindern längst nicht immer so gut umgehen, wie wir es eigentlich wollen. Das fühlt sich ziemlich fies an – egal, ob man es beim Schreiben oder beim Lesen eines Buches feststellt. Umso wichtiger ist es, sich bewusst zu machen, dass die eigenen Unzulänglichkeiten zu erkennen kein Grund für Scham oder Schuldgefühle ist – sondern eigentlich für unbändigen Stolz. Schließlich gibt es fast nichts Schwierigeres, als sich als Eltern einzugestehen, dass wir all unseren guten Absichten zum Trotz mit unseren Kindern Fehler machen. Nicht aus Bösartigkeit, sondern einfach, weil wir es in dem Moment nicht besser hinkriegen. Und die vielleicht unangenehmste Erkenntnis in diesem Zusammenhang ist, dass wir es niemals schaffen werden, all diese Fehler auszumerzen. Egal, wie sehr wir uns bemühen: Es wird uns nicht gelingen, immer hundertprozentig in Einklang mit unseren Wünschen und Werten zu leben. Einfach, weil wir Menschen sind, und es in unserer Natur liegt, fehlbar zu sein. Keiner handelt immer so, wie es richtig wäre. Doch das sollte uns nicht davon abhalten, uns trotzdem um ein Miteinander zu bemühen, das unseren Werten immer näher kommt.
Aus Schule, Ausbildung und Job kennen wir meist nur einen Umgang mit Fehlern: auf jeden Fall vermeiden, sonst gibt’s was auf die Mütze. Daher kommt auch unser Perfektionismus, unsere Härte uns selbst gegenüber: Fehler zu machen und trotzdem okay zu sein, wurde uns nicht beigebracht. Doch genau darum geht es bei dieser Spurensuche. Gut und richtig zu sein, wie wir sind, auch jetzt schon, am Anfang dieser Reise. Und uns trotzdem aufzumachen, mehr die zu werden, die wir sein wollen, im vollen Bewusstsein, dass wir dieses Ziel niemals vollkommen erreichen werden. Doch darum geht es ja auch nicht. Es geht um den Weg dahin, auf dem wir unseren Kindern näherkommen. Und uns selbst.
Werte, die fürs Leben tragen
Zufriedene Menschen haben eins gemeinsam: Sie leben im Großen und Ganzen im Einklang mit ihren eigenen Werten. Und kommen gleichzeitig damit klar, ihre eigenen Ideale niemals hundertprozentig zu erreichen. Viele Eltern kennen das aus leidvoller Erfahrung: Einer der größten Glücksräuber im Zusammenleben mit Kindern ist schließlich, dass wir dabei – zumindest gefühlt – ständig an unseren eigenen Ansprüchen scheitern. Schließlich wissen wir ja in der Theorie meist, wie wir gerne wären. Wir schaffen es nur oft nicht, auch wirklich so zu sein. Das heißt: Wenn wir uns für unser Familienleben mehr Zufriedenheit, mehr Lebensfreude, mehr Glück wünschen, kommen wir mit Oberflächenkosmetik nicht weiter. Egal, welche Erziehungstricks wir auch ausprobieren – passt unser Handeln nicht zu unserem Anspruch an uns selbst, werden Stress und Unzufriedenheit in unserem Leben immer wieder schnell die Überhand gewinnen. Wollen wir unser Familienleben wirklich auf neue Füße stellen, geht es deshalb ans Eingemachte. Dann schauen wir nämlich erst mal unter die Oberfläche und fragen uns, wer wir sind – und wer wir sein wollen. Dabei stoßen wir auf Fragen, die schon den klügsten Philosophen Kopfzerbrechen bereitet haben. Und auf die wir jetzt unsere ganz eigenen Antworten finden müssen: Was ist für mich moralisch richtiges Verhalten? Welche Verantwortung erwächst aus meiner Macht über einen anderen Menschen? Und wie kann ich die Würde meines Gegenübers auch dann wahren, wenn ich über ihn entscheide? Die Zeiten, in der Eltern sich mit der größten Selbstverständlichkeit moralisch über ihre Kinder stellten und von ihnen blinden Gehorsam erwarteten, ohne darin auch nur das kleinste Problem zu sehen, sind zum Glück vorbei. Heute will die überwältigende Mehrheit der Eltern bewusst auf ganz andere Werte setzen: Liebe, Respekt, Ehrlichkeit, Vertrauen. Der Teufel steckt dabei, wie so oft, im Detail. Klar will ich meinem Kind nicht bewusst weh tun – aber was, wenn mein Kind mich ständig haut und beißt? Oder wenn ich für mich selbst den moralischen Maßstab anlege, mein Kind nicht anlügen zu wollen – muss dieselbe Regel dann umgekehrt auch für mein Kind gelten? Und wenn es sich mit meinen Werten nicht verträgt, meinem Kind gegenüber meine körperliche Überlegenheit auszunutzen, ich mich jedoch gleichzeitig unbedingt für seine Sicherheit und Gesundheit verantwortlich fühle – was mache ich dann mit hartnäckigen Zahnputzverweigerern, Schutzimpfungshassern und Windelwechselwegläufern? Von diesen und ähnlichen ethischen Knackpunkten wird später noch genauer die Rede sein. Für den Moment ist erst mal wichtig, festzuhalten, dass genau solche Fragen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir unseren Umgang mit unseren Kindern mit unseren Werten in Einklang bringen wollen. Wir versuchen nämlich nicht mehr, mit einem Trick unser Kind dazu zubekommen, zu tun, was wir wollen, sondern machen uns Gedanken über die moralischen Implikationen unseres Handelns für uns und unsere Kinder. Was vermitteln wir ihnen in diesem Moment über sich und über uns? Was lehren wir sie über Verantwortung und Beziehung, Liebe und Macht? Dieser Paradigmenwechsel ist ganz entscheidend, denn er zeigt, dass wir schon mittendrin sind, unseren eigenen Familienkompass zu justieren und unsere Elternschaft auf die Basis unserer eigenen ethischen Grundüberzeugungen zu stellen. Der zweite Schritt ist dann: rauszukriegen, wie wir auch wirklich ganz konkret so leben können, dass sich die schuldgefühlschwere Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit in unserem Leben endlich schließt oder zumindest verringert. Dafür müssen wir an beiden Enden ansetzen: an unseren unerbittlich hohen Idealen und an unserer stressigen Lebenswirklichkeit. Denn so lange unser Perfektionismus und unser Alltagsstress sich gegenseitig befeuern, können wir nur verlieren. Schaffen wir es hingegen, Strategien zu entwickeln, unser Handeln immer öfter in Einklang mit unseren Werten zu bringen, können wir regelrecht spüren, wie eine riesige Last langsam von uns abfällt. Damit das gelingt, brauchen wir einen weiteren Perspektivwechsel: weg von den Bedürfnissen unserer Kinder allein und hin zu den Bedürfnissen von uns allen, der ganzen Familie, den Großen wie den Kleinen. Denn die ethischen Maßstäbe, die wir in Hinblick auf unseren Umgang mit unseren Kindern ziemlich leicht entwickeln konnten, können nur dann zur Basis unseres Familienlebens werden, wenn sie für alle gelten. Das heißt also: auch für uns. All die Sanftheit, die Geduld und das Verständnis, das wir unseren Kindern so gerne entgegenbringen wollen, zieht nämlich dann erst wirklich in unseren Alltag ein, wenn wir sie uns auch selbst entgegenbringen. Und das ist gar nicht so leicht, vor allem, wenn wir es nicht von klein auf gelernt haben. Im weiteren Text werden wir deshalb genauer ansehen, was es uns Eltern heute so schwer macht, nett zu uns selbst zu sein – und wie wir das ändern können.
Unser Familienleben nach unserem eigenen moralischen Kompass auszurichten und dann auch wirklich danach zu leben, ist nichts, was von heute auf morgen passiert. »Was brauche ich und was brauchst du?« – diese Frage bezieht sich vielmehr auf einen Navigationsprozess, der niemals ganz endet und trotzdem dafür sorgt, dass wir als Familie zufriedener, sicherer und klarer werden. Nicht, weil wir plötzlich keine Fehler mehr machen würden. Sondern weil sich unser Elternsein plötzlich echt anfühlt. Ehrlich. Nach uns selbst. Weil unsere Kinder uns kennenlernen dürfen und wir sie, neugierig, offen und unverstellt. Ohne dass uns alte Glaubenssätze den Blick aufeinander verstellen.
Was wir in der Hand haben
Es ist ein weit verbreiteter Mythos, dass wir Erwachsenen Kindern bestimmte Werte quasi anerziehen könnten. »Wir haben unsere Kinder noch zu Anstand und Höflichkeit erzogen« – solche und ähnliche Sätze kennen alle Eltern. Tatsächlich ist die Sache mit der Werteerziehung gar nicht so einfach. Schließlich sind Kinder keine kleinen Computer, denen man bestimmte Inhalte einfach aufs Betriebssystem spielen könnte. Zwar nehmen sie, neugierig und lernfreudig wie sie sind, garantiert etwas davon mit, wie wir mit ihnen umgehen. Doch die Vorstellung der gezielten, planmäßigen Installation bestimmter Werte und Normen in ihnen ist eine Illusion. Denn Kinder bedienen sich aus den ihnen angetragenen Erziehungsbemühungen vielmehr wie bei einem großen Buffet: Von manchem nehmen sie ganz viel, von anderem nur sehr wenig, wieder anderes lassen sie ganz liegen, und wird es ihnen aufgezwungen, lassen sie es diskret im Mülleimer verschwinden. Konkret heißt das: Erhebe ich Höflichkeit zum Erziehungsziel und achte deshalb streng darauf, dass mein Kind immer brav grüßt, bitte und danke sagt und Erwachsene im Gespräch nicht unterbricht, kann dieses Vorgehen – je nach Kind – zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Möglichkeit eins: Mein Kind nimmt meine Erziehungsversuche dankbar an und entwickelt sich zu eben jenem höflichen Erwachsenen, den ich heranziehen wollte – Bingo! Möglichkeit zwei: Mein Kind ist latent genervt von meinem Höflichkeitsfimmel und entwickelt zusehends mehr Widerstand gegen die eingeforderten Umgangsformen. Als Erwachsene vermeidet es deshalb so gut es geht soziale Situationen, die eine gewisse Etikette erfordern, profitiert in seinem beruflichen Umfeld aber durchaus von seiner Knigge-Festigkeit. Möglichkeit drei: Je mehr ich auf Umgangsformen poche, desto bedrängter fühlt sich mein Kind, weshalb es irgendwann in den offenen Widerstand geht und die größtmögliche Distanz zu meinen Wertvorstellungen sucht. Statt Anlageberater oder Anwalt zu werden, wie ich es mir heimlich gewünscht hatte, entscheidet es sich für ein Aussteigerleben in einer Wagenburg und ist fortan nie wieder mit Benimmregeln in jedweder Form konfrontiert. Darüber hinaus sind vom unbeeindruckten Abperlen-Lassen bis zur zwanghaften Verinnerlichung natürlich noch viele weitere Outcomes möglich, die meisten mit Sicherheit gänzlich undramatisch, aber eben auch nicht wirklich steuerbar. Und das ist der Punkt: Klar können wir uns wünschen, unseren Kindern bestimmte Werte mitzugeben. Doch wir überschätzen unsere Macht, wenn wir glauben, sie ihnen durch die richtige Erziehung quasi einprogrammieren zu können. Ein schönes Beispiel dafür ist die Geschichte einer Journalistin, die im Sommer 2019 für das Magazin Süddeutsche Zeitung Familie aufschrieb, wie sie ihrem Sohn, der in großer Freiheit groß werden sollte, nur einen einzigen Wert mitgeben wollte: die Liebe zu Büchern. Das Kind bekam also ein großes Bücherregal, jeden Tag mehrere Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen, und die schönsten Kinderbücher der Weltliteratur geschenkt. Am Ende all dieser Bemühungen stand ein sportlicher, lebensfroher junger Mann, der nicht das geringste Interesse am Lesen hatte – und die ganze für ihn liebevoll zusammengestellte Bibliothek bei seinem Auszug aus dem Elternhaus einfach stehen ließ. Die Geschichte eines Scheiterns? Nur wenn man gelungene Erziehung an ihrem Ziel festmacht. Und nicht an dem Weg dorthin, auf dem wir von unseren Kindern lernen dürfen, dass es unmöglich ist, einen anderen Menschen nach unseren Wünschen zu formen – aber ein echtes Geschenk, ihn dabei zu begleiten, er selbst zu werden.
Ein Fundament fürs Familienleben
Jeder Mensch braucht einen moralischen Kompass. Denn wir alle stehen tagtäglich vor unzähligen Entscheidungen, die uns die Verantwortung auferlegen, die richtige Wahl zu treffen. Die Grundüberzeugungen und Ideale, die uns in diesen Entscheidungen leiten, werden Werte genannt. Unser inneres Wertegerüst, an dem wir uns gerade in moralisch kniffligen Situationen entlanghangeln, entsteht wie bereits erwähnt zunächst durch das, was wir selbst als Kinder erfahren, verändert sich jedoch durch bewusste Reflexion und Auseinandersetzung mit anderen Wertvorstellungen, die uns im Laufe unseres Lebens begegnen. Das heißt: Unsere Werte sind kein in Stein gemeißeltes unveränderliches Fundament unseres Denkens und Handelns, sondern ein veränderliches System, indem sich persönliche Reifungs- und Entwicklungsprozesse maßgeblich widerspiegeln. Tatsächlich ist der Begriff Werte etymologisch eng mit dem Verb werden verwandt. Unsere Werte beschreiben also nicht primär, wie wir sind, sondern wie wir werden wollen. Sie stellen ein Ziel dar, ein Ideal, etwas, wonach wir streben. Und das nicht für uns allein: Als Eltern haben wir automatisch auch die verantwortungsvolle Rolle inne, Werte weiterzugeben und somit den Grundstein zu legen für das eigene Wertesystem unserer Kinder, das sich dann natürlich ebenfalls mit den Jahren verändern und wandeln wird.
Welche Werte wir unseren Kindern fürs Leben mitgeben wollen, hängt maßgeblich davon ab, wie wir uns ihr späteres Leben vorstellen. So ist es vielen Eltern beispielsweise ein wichtiges Anliegen, dass ihr Kind später in seinem Beruf gut klarkommt. Und weil die Arbeitswelt ihrer eigenen Erfahrung nach streng hierarchisch organisiert ist, kommen sie zu dem Schluss, ihrem Kind Werte wie Pünktlichkeit, Höflichkeit, Fleiß und Anpassungsfähigkeit vermitteln zu wollen, die es zu einem guten Arbeitnehmer machen: »Mit seinem Boss kann es später schließlich auch nicht über jede Aufgabe diskutieren!« Auch Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz und Fairness stehen als Werte hoch im Kurs – schließlich sollen unsere Kinder sympathische und beliebte Zeitgenossen werden. Nun ist gegen all diese Werte an sich natürlich überhaupt nichts einzuwenden; es gibt nur ein Problem: Ein moralischer Kompass lässt sich nicht nach Belieben zusammenbauen. Er entwickelt sich viel mehr aus all den Erfahrungen, die ein junger Mensch im Laufe seines Lebens macht, und ist stets auch geprägt von seiner eigenen Persönlichkeit. Wir können unsere Kinder also nicht zu Höflichkeit, Respekt, Ehrlichkeit und Fairness erziehen – wir können ihnen diese Werte nur selbst vorleben und ihnen so ein Angebot machen, wie sie ihre persönliche Wertebasis gestalten könnten. Anstatt uns also darauf zu versteifen, welche Werte wir unseren Kindern mitgeben wollen, tun wir gut daran, uns über unsere eigene Wertebasis klar zu werden. Wenn wir über Werte in der Erziehung sprechen, dann reden wir so oft darüber, wie unsere Kinder einmal sein sollen, aber so wenig darüber, welche moralischen Wertmaßstäbe für unser eigenes Handeln gelten – als hätte das eine nichts mit dem anderen zu tun:
»Man muss immer die Wahrheit sagen!«, erklären wir also unserem Kind – und erzählen ihm dann, der Nikolaus käme nur zu braven Kindern.
»Sachen wegnehmen ist verboten!«, mahnen wir streng auf dem Spielplatz – und ziehen später zur Strafe die Spielkonsole ein.
»Niemand hat das Recht, einem anderen Menschen weh zu tun!«, verkünden wir – und packen das tobende Kind kurze Zeit später unsanft am Arm, weil es nicht nach Hause will.
»Erpressen ist niemals okay«, sagen wir im Brustton der Überzeugung – um fünf Minuten später zu drohen: »Wenn du jetzt nicht sofort aufhörst, gibt es heute Abend kein Fernsehen!«
»Am wichtigsten ist es, Respekt zu haben«, beteuern wir. Und schimpfen und drohen und strafen und erpressen und behandeln unsere Kinder auf eine Weise, die wir ganz klar als respektlos empfänden, würde jemand mit uns so umgehen.
Diese Widersprüchlichkeit zwischen den Werten, die wir vor uns theoretisch her tragen, und unserer tatsächlichen Umsetzung, markiert kein individuelles Scheitern, sondern offenbart ein strukturelles Problem: Wir leben in einer Gesellschaft, die an sich den Anspruch hat, alle Menschen menschenwürdig zu behandeln. Und unterliegen gleichzeitig alle der kulturellen Prägung, im Umgang mit Kindern dabei nicht die gleichen Wertmaßstäbe anzulegen wie bei Erwachsenen. Das sorgt für jede Menge Zündstoff. Denn viele Kinder spüren diese Ungerechtigkeit und lehnen sich dagegen auf. Und weil sie in diesem Widerstand sich ganz und gar nicht so verhalten, wie es unseren Wertevorstellungen für sie entspricht, reagieren wir oft mit mehr Strenge, mehr Härte, mehr Durchsetzungskraft – und entfernen uns damit selbst immer weiter von den Werten, die wir ihnen doch eigentlich vermitteln wollten. Es ist eine Mammutaufgabe, diese kulturellen Prägungen quasi im Alleingang überwinden zu wollen. Und es ist unmöglich, das zu schaffen, ohne dabei immer wieder zu stolpern und zu straucheln. Doch den Gedanken loszulassen, unseren Kindern bestimmte Eigenschaften anerziehen zu können, die wir für wichtig halten, und uns stattdessen darauf zu besinnen, ob unser alltäglicher Umgang miteinander eigentlich unseren eigenen Werten entspricht – das ist es, was wir als Eltern tun können, um unserer Familie ein Fundament zu geben, das wirklich fürs Leben trägt.
Was wir mitbringen
Bevor wir Eltern werden, haben wir alle Erfahrungen gemacht, die uns geprägt haben. Und diese prägen wiederum, wie wir als Eltern sind – daran führt kein Weg vorbei. Klar können wir uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen, ungünstige Muster identifizieren, alte Glaubenssätze hinterfragen und ablegen. Doch das ändert nichts daran, dass wir einen Rucksack dabeihaben auf unserer Reise und dass dessen Inhalt Einfluss darauf hat, wie wir heute in bestimmten Situationen reagieren. Für viele Eltern ist das eine bittere Erkenntnis: Da haben sie sich all das Wissen über kindliche Bedürfnisse angelesen und sich ein Bild davon gemacht, wie sie sein wollen – und dann kommen ihnen ihre eigenen Themen in die Quere. Wer selbst beispielsweise mit Essstörungen zu kämpfen hat, wird sich unglaublich schwer damit tun, in das Essverhalten der eigenen Kinder nicht regulierend einzugreifen. Da reicht es nicht, kognitiv verstanden zu haben, warum selbstbestimmtes Essen gut und richtig ist – da wirken Traumata, die wir nicht einfach so per Willenskraft mal eben in den Griff kriegen können. Wenn wir darüber sprechen wollen, was wir unseren Kindern in unserem Familienleben vorleben und so weitergeben, müssen wir auch diese Botschaften im Blick haben, die wir nicht bewusst steuern können. Das fällt vielen Eltern sehr schwer, denn was wir in unserem Rucksack mit uns herumschleppen, unterminiert oft das, was wir unseren Kindern eigentlich mitgeben wollen. Etwa: ein gesundes Körpergefühl. Oder: das Selbstbewusstsein, das wir selbst immer gern gehabt hätten. Das fühlt sich schnell wie Versagen an. Dabei ist es nur menschlich, dass wir unseren Kindern nicht nur das weitergeben, was wir ihnen wünschen. Sondern auch, was uns geprägt hat. Das heißt: Selbst wenn sich mehrere Familien eine ähnliche Wertebasis für ihr Familienleben wünschen, starten sie dabei an sehr unterschiedlichen Ausgangspunkten. Wer selbst in der eigenen Kindheit viel Respekt erfahren hat, tut sich leichter, das Erlebte weiterzutragen, als derjenige, der den wertschätzenden Umgang mit Kindern erst erlernen muss wie eine komplizierte Fremdsprache. Wer keine Verlustängste mit sich herumträgt, wird sich mit dem Loslassen leichter tun als derjenige, der schon so oft in seinem Leben verlassen wurde. Und wer keine jahrelange schwierige Kinderwunsch-Geschichte hinter sich hat, kommt mit den Ängsten des Elternseins oft besser klar als wer schon oft erfahren hat, wie fragil das Leben ist. Anstatt uns also mit anderen zu vergleichen, denen dieses liebevolle Eltern-Ding irgendwie viel leichter zu fallen scheint, ist es ganz wichtig, wertschätzend und großzügig mit uns selbst zu sein. Wir Menschen sind verschieden. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen im Gepäck, unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung und tragen unterschiedliche Narben mit uns herum, die größtenteils unsichtbar sind. Natürlich fallen uns deshalb viele Dinge auch unterschiedlich schwer. Doch das macht uns nicht zu schlechteren Eltern. Denn ja, vielleicht bringen wir durch unsere eigene Lebensgeschichte ein Thema ins Leben unseres Kindes ein, das wir ihm gerne erspart hätten. Doch das liegt nicht in unserer Hand. Was wir hingegen in der Hand haben, ist, wie wir damit umgehen. Wir können nicht jede Prägung abschütteln und nicht jedes Muster überwinden, aber wir können darauf achten, wo sich Botschaften aus unserer Vergangenheit auf unser Familienleben heute auswirken, und Schritt für Schritt Strategien entwickeln, ungünstige Muster immer häufiger durch günstigere zu ersetzen. Wir können Verantwortung übernehmen und um Verzeihung bitten, wenn unsere inneren Dämonen mal wieder mit uns durchgegangen sind. Vor allem aber können wir mit unseren Kindern darüber sprechen, warum uns manche Dinge schwerfallen, weshalb wir in bestimmten Situationen so reagieren, wie wir es tun, und dass es niemals, niemals ihre Schuld ist, wenn sie mit ihrem Verhalten an unseren alten Verletzungen rühren. Allein das zu hören, kann für ein Kind schon die Welt bedeuten.
Um mit unseren Kindern neue Wege gehen zu können, müssen wir uns also bewusst sein, wie stark uns die Vergangenheit prägt. Und das gleich in mehrerer Hinsicht. Zum einen tragen wir unsere ganz persönlichen Lebenserfahrungen mit uns herum: unsere eigene Bindungsgeschichte, unsere Kindheitserinnerungen, Ängste und Glaubenssätze, die sich aus unserer Biografie heraus entwickelt haben. Auch unsere Familiengeschichte hat Einfluss darauf, wie wir heute fühlen und handeln. So gehen Traumapsychologen etwa davon aus, dass schlimme Angst- und Gewalterfahrungen nicht nur die unmittelbar davon Betroffenen traumatisieren, sondern dass diese tiefen seelischen Verletzungen noch bis zu in ihren Kindern, Enkeln, Urenkeln und Ururenkeln nachwirken – ungefähr vier Generationen lang. Eine mögliche Erklärung dafür, dass sogenannte transgenerationale Traumata von Eltern auf Kinder und von denen auf die Enkel und Urenkel übertragen werden können, liegt in der sogenannten Epigenetik, also der Tatsache, dass das menschliche Genom durch Erfahrungen veränderbar ist. Einschneidende Erlebnisse können also nicht nur in unserer Seele Spuren hinterlassen, sondern auch in unserer DNA. Und zwar, indem sie die Zellaktivität bestimmter Teile des menschlichen Erbguts wie einen Lichtschalter an- oder ausknipsen. Ein besonders eindrucksvoller Beleg dafür ist ein Experiment der Schweizer Neurowissenschaftlerin Isabelle Mansuy. Ihr Team setzte Mäusebabys einem Trennungstrauma aus, indem sie sie als Neugeborene von der Mutter separierten. Frühere Untersuchungen hatten bereits gezeigt, dass ein solches Erlebnis in der Psyche der kleinen Säugetiere deutliche Spuren hinterlässt: Sie neigen hinterher zu Depressionen oder unsozialem Verhalten; beides klassische Traumafolgen, die sich auch in mehreren Folgegenerationen noch beobachten lassen. Um zu überprüfen, ob diese Verhaltensweisen an die nächste Generation allein durch das elterliche Vorbild weitergegeben werden, zeugten die Wissenschaftler mittels künstlicher Befruchtung Nachwuchs traumatisierter Mäuse und ließen sie von einer unbelasteten Leihmutter austragen. Trotzdem zeigten die Mäusekinder Traumafolgen, selbst wenn sie nur in dritter oder vierter Generation von traumatisierten Tieren abstammten. Nun sind Mäuse natürlich keine Menschen, doch es mehren sich die Hinweise darauf, dass Traumata auch bei uns nach demselben Wirkprinzip weitergegeben, aber auch wieder gelöst werden können. Epigenetikerin Mansuy zeigte nämlich auch: Wachsen Mäusekinder mit ererbten Traumata in einer positiven und anregenden Umgebung mit sicheren Bindungserfahrungen auf, modifiziert sich dadurch ihr Erbgut erneut. Die stressbedingten Verhaltensänderungen verschwinden nach und nach, und ihre eigenen Kinder verhalten sich genauso wie Mäusebabys, in deren Ahnenreihe es keine traumatischen Erfahrungen gab.
Dasselbe Wirkprinzip beschreibt die renommierte Traumatherapeutin Prof. Dr. med. Luise Reddemann in ihren Büchern über die psychologischen Nachwirkungen von Kriegskindheit und NS-Erziehung auf die Folgegenerationen. Sie spricht in diesem Zusammenhang von »unbewussten Kanälen«, über die Traumata über Generationen hinweg weitergegeben werden. Und zwar vor allem in Stresssituationen, in denen in Eltern Ängste und Ohnmachtserfahrungen aus der Vergangenheit anklingen, die ihre Kinder dann mit ihren feinen Antennen in sich aufnehmen – eine Dynamik, die durch eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte durchbrochen werden kann. Das zeigt: Nicht nur unsere eigene Lebensgeschichte, auch die unserer Vorfahren hat Einfluss darauf, wie seelisch stabil wir als Erwachsene dastehen. Doch es braucht nur ein Glied in der Kette, das sein ererbtes Trauma überwindet, um die Weiterreichung des Schmerzes von einer Generation zur nächsten zu unterbrechen.
Von Steinzeitkindern und Klosterschülern
Neben unserer individuellen Geschichte tragen wir alle auch ein Stück Menschheitsgeschichte in uns, die viele unserer intuitiven Verhaltensmuster aus evolutionären Wirkmechanismen heraus bis heute trägt, sowie die Spuren von mehreren hundert Jahren Kindererziehung. Sie alle beeinflussen nämlich das gesellschaftliche, politische und kulturelle Klima, in dem wir heute Eltern sind – und damit auch uns.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.