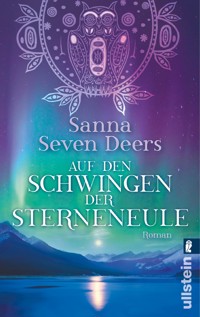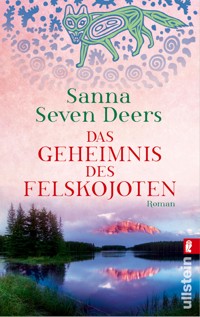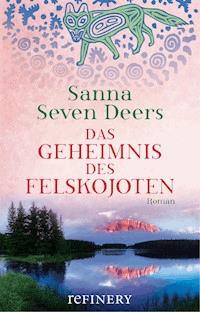7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Mit Anfang 20 ist Sanna unglücklich mit ihrem gutbürgerlichen Leben in Hamburg – bis sie sich Hals über Kopf in den kanadischen Indianer David verliebt. Anfangs spricht alles dagegen: Er ist sechzehn Jahre älter, sie eine "Weiße" aus Deutschland. Niemand kann sich vorstellen, wie dieses ungleiche Paar jemals miteinander glücklich werden könnte. Doch schon bald merkt sie: David ist die Liebe ihres Lebens. In ihrer stimmungsvollen Autobiographie erzählt Sanna Seven Deers von ihrer mittlerweile 17-jährigen Ehe mit David und dem gemeinsamen Leben mit den vier Kindern auf einer abgeschiedenen Ranch in der kanadischen Wildnis. Dabei entführt sie ihre Leser nicht nur in die unberührte Natur, sondern auch in eine Welt voll Abenteuer und indianischer Mystik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Ähnliche
Sanna Seven Deers
Mein Herz in deinem weiten Land
Als weiße Indianerin in den kanadischen Bergen
David Seven Deers
Knaur e-books
Über dieses Buch
Mit Anfang Zwanzig ist Sanna unglücklich mit ihrem gutbürgerlichen Leben in Hamburg – bis sie sich Hals über Kopf in den kanadischen Indianer David verliebt. Und bald merkt sie: Das ist die Liebe ihres Lebens. In ihrer stimmungsvollen Autobiographie erzählt Sanna Seven Deers von ihrer mittlerweile achtzehnjährigen Ehe mit David und dem gemeinsamen Leben mit den vier Kindern auf einer abgeschiedenen Ranch in der kanadischen Wildnis. Dabei entführt sie ihre Leser nicht nur in die unberührte Natur, sondern auch in eine Welt voll Abenteuer und indianischer Mystik.
Inhaltsübersicht
The hungry wolf favours the freedom of the hunt rather than the chewed bone thrown to him by man.
(Der hungrige Wolf zieht die Freiheit der Jagd dem angekauten Knochen vor, den der Mensch ihm hinwirft.)
Altes Sprichwort der Coast-Salish-Indianer
Begegnungen
Draußen stürmte und regnete es so heftig, als wäre es Herbst und nicht Ende Juli. Im Inneren des Pick-ups war es ungewöhnlich still. David konzentrierte sich auf die kurvige Bergstraße, und Sam und Haley, gerade zwei und vier Jahre alt, starrten auf die hohen Zedern, die dicht gedrängt zu beiden Seiten des Highways wuchsen. Da zog plötzlich dichter Nebel auf und behinderte die Sicht so sehr, dass David den Pick-up auf Schritttempo abbremsen und zur Sicherheit auch noch die Warnblinklichter einschalten musste.
Landschaft und Wetter spiegelten das wider, was ich in diesem Augenblick empfand: Traurigkeit und ein bisschen Wehmut, aber gleichzeitig auch die Hoffnung, dass sich der Nebel nach dem Sturm lichten und die Sonne wieder auf uns herabscheinen würde – auf uns und ein besseres Leben, nicht nur für David und mich, sondern vor allem für Haley, Sam und das Baby, das in mir wuchs.
Ich warf einen Blick in den Rückspiegel und sah den Berg aus sperrigem Hausrat, mit dem der Pick-up beladen war. Hausrat, der nicht mit in den Umzugswagen gepasst hatte. Wir ließen tatsächlich all das zurück, was wir uns seit unserer Ankunft in British Columbia vor fünf Jahren aufgebaut hatten, und wagten abermals einen Neuanfang. Einen Neuanfang in der Wildnis weit oben in den Bergen von British Columbias Boundary Region, dem Grenzgebiet, das sich zwischen dem Okanagan Valley und den Kootenay Mountains entlang der US-Grenze erstreckt.
Nachdem wir für unser Haus in der Nähe der Kleinstadt Hope lange Zeit keinen Käufer gefunden hatten, war David und mir klar geworden, dass etwas geschehen musste. David, der wie viele Indianer sehr offen für die Stimmen der Geistwesen ist, folgte ihrem Rat und baute am Anfang der langen Einfahrt ein neues Tor aus Zedernholz, das für Davids Stamm eine besondere Rolle spielt. Diese symbolische Tat würde dazu beitragen, dass sich das Haus verkaufen ließe, das hatten ihm die Geistwesen versprochen. Obendrein wechselten wir zur Sicherheit den Makler.
Der neue Makler war sehr ambitioniert und von Anfang an begeistert von unserem Haus. Sechs Wochen später hatte er bereits einen Käufer gefunden. Und das nach der langen Zeit, in der uns die erste Maklerin erklärt hatte, unser Haus sei zu teuer und darüber hinaus wegen der abgeschiedenen Lage nur schwer verkäuflich. Prompt hatte sich ein Jahr lang in dieser Hinsicht nichts getan. Der neue Makler hingegen vertrat die Ansicht, man könne alles verkaufen, solange man als Verkäufer hinter seiner Ware stehe. Der Mann hatte absolut recht, wie sich zeigen sollte. Und wenn dann die Geistwesen noch gütig gestimmt sind, steht eine Sache wirklich unter einem guten Stern. Ich denke noch oft an den Hausverkauf zurück, wenn jemand behauptet, etwas sei unmöglich. Dann lächle ich nur und denke mir meinen Teil.
Der Umzug selbst kam daher jedoch für uns recht plötzlich. Der Käufer wollte so schnell wie möglich das Grundstück nutzen und bot uns einen Aufschlag, wenn wir innerhalb von vierzehn Tagen ausziehen würden. Da wir jeden Cent brauchen konnten, waren wir darauf eingegangen und hatten in der kurzen Zeit nicht nur unseren gesamten Hausrat für den Umzug verpackt, sondern auch Davids unzählige Werkzeuge aus der riesigen Halle, in der er seine wunderschönen Marmor- und Granitskulpturen fertigte.
Wenn ich heute zurückdenke, weiß ich nicht, woher ich damals die Kraft nahm, den gesamten Haushalt so kurzfristig und ohne Hilfe in Kisten zu verstauen. Schließlich hatte ich nebenbei ja auch Haley und Sam zu versorgen, war im vierten Monat schwanger und kämpfte noch immer mit starker Übelkeit. Die vierzehn Tage zogen wie ein Wirbelwind an mir vorbei, und ich kann mich nicht an Einzelheiten erinnern, außer dass Haley und Sam die Kisten, die ich gerade fertiggepackt hatte, hinter meinem Rücken gern wieder ausräumten.
Doch nun war der Tag des Umzugs gekommen, und wir befanden uns auf dem Weg nach Greenwood, einem kleinen Ort gute vierhundert Kilometer von unserem bisherigen Zuhause entfernt.
Ein Seufzer entfuhr mir beim Blick aus dem Wagenfenster. Der Nebel hing noch immer in dichten Schwaden zwischen den Zedern und erschien mir in diesem Moment wie ein guter Freund. Manchmal ist es am besten, keine klare Sicht auf das zu haben, was die Zukunft für einen bereithält, sonst würde man womöglich den nächsten Schritt gar nicht erst wagen.
Dieser Umzug war für mich bereits der fünfte innerhalb der letzten fünf Jahre, und wir hatten uns inzwischen einiges aufgebaut. In den ersten dreiundzwanzig Jahren meines Lebens war ich nur ein einziges Mal umgezogen. Doch dann lernte ich David kennen und ging mit ihm in seine Heimat, nach Kanada. Hier hatten wir zunächst bei seiner Familie auf dem Reservat in Chilliwack gelebt. Später waren wir dann in die Nähe von Hope aufs Land gezogen und wohnten zunächst für ein Jahr zur Miete, ganz in der Nähe des Grundstückes, auf dem wir unser eigenes Haus bauen wollten. Doch auch dort sollten wir nur zwei Jahre bleiben. Uns lockte ein abgelegenes Grundstück in den schroffen, aber wunderschönen Fraser-Canyon. Und nun zog es uns erneut weiter, diesmal gleich vierhundert Kilometer.
In Kanada ist es nichts Außergewöhnliches, oft umzuziehen. Die meisten Kanadier wechseln ihren Wohnsitz alle drei bis vier Jahre, sie gehen dorthin, wo es Arbeitsplätze gibt. Für mich aber war es bereits ein riesiger Schritt gewesen, nach Kanada auszuwandern, und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich einmal ein solch rastloses Dasein führen würde. Allein wäre es mir auch nicht eingefallen, mich von einem Abenteuer ins nächste zu stürzen. Es lag an David, der – rastlos und voller Energie – viel abenteuerlustiger ist als ich. Auch heute noch, wo mein Leben nach außen hin recht ruhig erscheint, verspricht jeder neue Tag ein Abenteuer. Und eigentlich bin ich David dafür sehr dankbar.
Manche Dinge entfalten sich auf seltsame Weise. Und als ich mit meiner Familie im Pick-up saß mit Blick auf das Spiel der Nebelschwaden zwischen den Zedern, schweiften meine Gedanken zurück zu der Zeit, in der ich David im Hamburger Museum für Völkerkunde kennengelernt hatte.
Es war im Herbst 1994. Ich steckte mitten in meiner Ausbildung zur Finanzwirtin und studierte an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Warum ich das Studium damals überhaupt angefangen habe, kann ich heute nicht mehr genau sagen. Ich wollte nach dem Abi gleich eine Ausbildung oder ein Studium beginnen, statt meine Zeit zu vertrödeln. Doch die Aussicht, noch mehrere Jahre mit lernen verbringen zu müssen, bevor ich einen guten Job bekommen konnte, hing wie eine dunkle Wolke über mir. Ich hatte die Schule und alles, was damit zu tun hatte, gründlich satt. Und ich hielt mich nicht gerne inmitten vieler Menschen auf. Das Studium an der Fachhochschule war vergleichsweise kurz, ich bekam ein Ausbildungsgehalt und konnte auf eigenen Beinen stehen. Das sprach mich an. Aber schon nach einigen Wochen wurde mir klar, dass Finanzwissenschaft einfach nicht das Richtige für mich war. Doch nun kamen mir wieder einmal die gesellschaftlichen Zwänge dazwischen. Man brach doch nicht einfach ein Studium ab, das taten nur Versager! Deshalb wollte ich mich irgendwie durch die drei Jahre Ausbildungszeit kämpfen und den Abschluss machen, koste es, was es wolle. Heute würde ich anders entscheiden, aber das Leben wäre nicht das, was es ist, wenn man als junger Mensch schon mit Erfahrung und Weisheit gesegnet wäre.
Ich glaube, nicht einmal meine Familie bekam etwas von dem inneren Kampf mit, den ich während der letzten Schuljahre und des Studiums täglich mit mir selbst ausfocht. Ich bemühte mich sehr, mich mit einem »normalen« Leben abzufinden, aber mein Herz war nicht bei der Sache. Ich redete mir ein, dass das, was ich tat, richtig sei. Man erlernte nun mal einen Beruf oder studierte, ging anschließend dreißig oder vierzig Jahre jeden Morgen zur Arbeit und freute sich auf den Urlaub. Alle Träume, die man sonst hatte, hob man sich bis zur Rente auf. Bis dahin waren es ja nur noch ein paar Jahrzehnte.
Mir wurde in dieser Zeit oft gesagt, dass man zufrieden sein musste, einen Job und eine Wohnung zu haben. Mein Verstand stimmte dieser Aussage vollkommen zu. Es ist nicht gut, sich etwas zu wünschen, was man nicht haben kann. Das macht einen nur unzufrieden. Man freut sich besser über all die Dinge, die einem tagtäglich beschert werden: Gesundheit, eine Arbeitsstelle, ein Zuhause, genug zu essen und Geborgenheit. Warum nur gelang es mir nicht, mit diesem normalen Leben zufrieden zu sein?
Nach einigen Überlegungen kam ich zu dem Schluss, etwas müsse mit mir nicht in Ordnung sein. Ich war schon immer sehr offen für Neues und Andersartiges gewesen und interessierte mich seit Teenagerzeiten für Heilkräuter und alternative Medizin. Also begann ich, mich in dieser Richtung weiterzubilden. Ich belegte Bachblüten- und Reiki-Seminare und tauchte in das Wissen über das Legen der Tarotkarten ein. Doch auch dieser Weg brachte mich nur bis zu einem bestimmten Punkt auf meiner Suche nach mir selbst, bevor ich auf eine Sackgasse stieß.
Eines Abends erzählte mein Vater mir, er habe im Radio von einem Indianer gehört, der im Hamburger Museum für Völkerkunde einen Totempfahl schnitze. Und da er wusste, dass ich mich für andere Kulturen – und besonders für die der Indianer – interessierte, schlug er mir vor, dort vorbeizuschauen.
Jahrelang war ich sicher, dass mein Vater mir ganz bestimmt nicht von dem Indianer im Museum erzählt hätte, wenn er gewusst hätte, was mein Besuch dort nach sich ziehen würde. Welche Eltern würden das schon tun? Heute weiß ich: Das Leben mancher Menschen ist durch das Schicksal miteinander verwoben. Ich glaube fest daran, dass ich David auch ohne den Hinweis meines Vaters kennengelernt hätte.
Unsicher bin ich mir allerdings bei der Frage, ob ich damals ins Museum gegangen wäre, wenn ich gewusst hätte, wie sehr mein Leben dadurch auf den Kopf gestellt werden würde. Denn es ist eine Sache, mit sich und seinem Leben nicht zufrieden zu sein. Aber Veränderungen anzunehmen und umzusetzen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Da jedoch niemand die Zukunft kennt – was ich für eine sehr positive Einrichtung halte –, ging ich damals ganz offen und unvoreingenommen ins Museum für Völkerkunde.
Sobald ich die Treppe zum Innenhof erreicht hatte, wo David an einem zwölf Meter langen Totempfahl schnitzte, spürte ich, dass etwas Besonderes in der Luft lag. Dort herrschte eine vollkommen andere Atmosphäre als im Museum. Nicht der würzige Rauch des flackernden Lagerfeuers zog mich die Stufen hinunter und zu dem riesigen Zedernstamm, an dem David arbeitete, sondern vielmehr ein starkes Gefühl der Verbundenheit.
Bei meinem ersten Besuch traute ich mich nicht, David anzusprechen. Und das nicht nur wegen der Tatsache, dass er mich blonde Hamburgerin mit seiner äußeren Erscheinung – den langen dunklen Haaren, dem ebenmäßigen Gesicht und seinem muskulösen Körper – ungemein beeindruckte. Es waren noch einige andere Besucher dort, und viele davon schienen David schon länger zu kennen. Zudem war ich mir nicht sicher, ob David Deutsch beherrschte. Ihn vor so vielen Menschen anzusprechen fiel mir schüchternem Mädchen überhaupt nicht ein, schon gar nicht, wenn ich vielleicht noch zwei Brocken Englisch hervorkramen musste. Aber ich beobachtete ihn, stellte fest, mit welcher Liebe und Hingabe er seiner Arbeit nachging und mit welchem Respekt er den Menschen, die ihn ansprachen, begegnete. Dabei schien es für ihn keinen Unterschied zu machen, ob es sich um den Museumsdirektor oder die Putzfrau handelte. Das imponierte mir sehr.
Als ich mich an diesem Tag auf den Weg nach Hause machte, wusste ich, dass ich wiederkommen würde. Und das tat ich dann auch. Da es Ende November war und David im Freien arbeitete, dachte ich mir, es sei eine gute Idee, ihm etwas Warmes zu trinken mitzubringen. Als ich also das nächste Mal die Treppe zum Innenhof hinunterstieg, hatte ich eine Thermoskanne mit heißem Kakao und selbstgebackene Kekse dabei. Wie David mir später erzählte, hatte er schon eine ganze Sammlung an Thermoskannen und Keksen in seinem Zimmer, die andere Damen für ihn abgegeben hatten. Mein Plan war also nicht sehr originell. Aber für mich war es ein guter Weg, um mit ihm ins Gespräch zu kommen, denn ich hatte mir geschworen, nicht eher zu gehen, bevor ich das Mitgebrachte irgendwie persönlich bei ihm abgeliefert hatte. Ich musste also irgendetwas zu ihm sagen. Was genau das gewesen ist, weiß ich heute nicht mehr. Das ist wahrscheinlich auch besser so, denn ich habe das unangenehme Gefühl, dass es nicht sehr einfallsreich war. Auf jeden Fall nahm David den Kakao und die Kekse mit einer so würdevollen Miene und Dankbarkeit entgegen, als wäre ich die Erste gewesen, die ihn mit einer derartigen Fürsorge bedacht hatte.
In den nächsten Wochen ertappte ich mich dabei, wie ich immer öfter ins Museum fuhr. Es war inzwischen Dezember, und draußen war es grau und ungemütlich. Im Innenhof des Museums brannte jedoch stets Davids Lagerfeuer, dessen Wärme noch viel weiter auszustrahlen schien als auf das Kopfsteinpflaster unter der Feuerschale. Einmal in der Woche lud David zu einem Gesprächsabend im Museum ein. Eine Schar interessierter Menschen versammelte sich dazu um das Feuer, während David von seiner Kultur erzählte und aus einem Buch die Geschichte seines Volkes vorlas. Diese Abende waren immer sehr gut besucht, aber es gab viele andere Tage, an denen ich fast alleine dort war und wir die Gelegenheit hatten, uns zu unterhalten und besser kennenzulernen.
Für mich war es eine neue Erfahrung, aus eigenem Antrieb Zeit mit jemandem zu verbringen, der so viel älter war als ich. Unsere Gespräche halfen mir damals sehr dabei, besser mit mir selbst klarzukommen. David ließ sich nie anmerken, wenn meine Worte oder Taten in seinen Augen lächerlich waren. Das rechne ich ihm noch heute sehr hoch an, und ich bezweifle ernsthaft, dass ich als 36-jähriger Mann so viel Verständnis für eine Zwanzigjährige aufgebracht hätte wie er damals für mich. Weltverständnis und Lebenserfahrung unterscheiden sich bei Menschen mit einer solchen Altersdifferenz doch sehr deutlich. Dazu kam, dass David seit seinem vierzehnten Lebensjahr auf sich allein gestellt war. Jahrelang war er per Anhalter in Kanada, Europa und den USA unterwegs gewesen und hatte in England, Spanien und Deutschland gelebt. Ich dagegen hatte noch nicht einmal an einem Schüleraustausch teilgenommen.
Als wir gute zwei Jahre später verheiratet waren und nach Kanada übersiedelten, war mir immer noch nicht ganz klar, warum David sich unter den Tausenden von Besuchern, die ihm während seiner dreijährigen Arbeit im Museum begegnet waren, ausgerechnet für mich entschieden hatte. Und viele seiner weiblichen Fans, vor allem die aus seiner Altersklasse, stimmten mir in meiner Verwunderung sicherlich zu. Tatsache ist, dass anfangs weder David noch ich an eine Beziehung gedacht hatten, die über eine bloße Freundschaft hinausging. Wir verbrachten viel Zeit miteinander, fühlten uns in der Gegenwart des anderen wohl, aber die gesellschaftlichen Ansichten über unseren Altersunterschied standen unausgesprochen zwischen uns.
Kurz nach Weihnachten hatten wir zu diesem Punkt eine sehr offene Unterhaltung. David sagte mir, dass sich unter anderen Umständen aus unserer Freundschaft etwas sehr Schönes hätte entwickeln können. Ich fühlte dasselbe und sagte es ihm auch. Aber da die Lage nun einmal so war, wie sie war, hielten wir es beide für besser, die Dinge auf sich beruhen zu lassen. Den Gedanken, dass David bald nach Kanada zurückkehren und unsere Freundschaft dann im Sande verlaufen würde, verbannte ich bewusst aus meinen Gedanken.
Dann kam der Tag, der alles auf den Kopf stellte und uns zeigte, dass gesellschaftliche Erwartungen niemals ausreichen, um zwei liebende Menschen voneinander fernzuhalten. David hatte mich für den Neujahrstag zum Reiten bei Freunden auf dem Land in der Nähe von Lübeck eingeladen. Ich hatte den Silvesterabend mit meiner Freundin verbracht, extra keinen Alkohol getrunken und mich schon sehr auf den bevorstehenden Tag gefreut.
Doch als ich an jenem Morgen aufwachte, stellte ich fest, dass es heftig geschneit hatte. Ich besaß meinen Führerschein noch nicht lange, weshalb mir etwas mulmig bei dem Gedanken war, auf einer verschneiten Autobahn von Hamburg nach Lübeck zu fahren, besonders weil ich keinerlei Erfahrung mit glatten und schneebedeckten Straßen hatte. Heute denke ich oft, dass ich verrückt gewesen sein muss. Ich schaffte es bei der Eisglätte kaum aus der Tiefgarage. Doch ich hatte David versprochen, den Tag mit ihm zu verbringen, und es gab nichts auf der Welt, was mich davon hätte abbringen können.
David erzählte mir später, dass er in der Silvesternacht die warnenden Stimmen der Geistwesen gehört habe und er deshalb auf ein bedeutsames Ereignis gefasst gewesen sei. Aber selbst er war nicht auf das vorbereitet, was an diesem Tag tatsächlich passierte.
Ich verließ Hamburg guter Dinge. Die Straßen waren noch voller Schnee, denn es war acht Uhr am Neujahrsmorgen, aber ich fuhr langsam und hatte zum Glück genügend Zeit eingeplant. Die Autobahn war jedoch bereits geräumt, und ich konnte aufatmen. Die Fahrt verlief problemlos, bis ich in Lübeck das Räumfahrzeug einholte. In meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich mir, dass ich es ruhig überholen könne, schließlich hatte ich Winterreifen montiert und eine Verabredung einzuhalten, und das Räumfahrzeug fuhr schrecklich langsam.
Ein paar Kilometer weiter holte diese Entscheidung mich dann auf unheilvolle Weise ein. Mein Vorderreifen streifte den Bordstein der linken Fahrspur, mein Wagen geriet ins Schleudern, und ich trat auf die Bremse. Das Auto überschlug sich mehrere Male vornüber und kam nach scheinbar unendlich langer Zeit und mit lautem Krachen auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Das war mein großes Glück, ansonsten wären womöglich andere Autos in meinen Wagen hineingedonnert und die Sache wäre noch viel schlimmer ausgegangen.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was mir im Augenblick des Unfalls durch den Kopf ging. Ich weiß nur, dass mein Herz ein paar Sekunden lang aussetzte. Es war der Moment, in dem ich dachte, mein Leben sei vorbei. Dann stützte ich mich mit aller Kraft an der Wagendecke ab und schrie aus Leibeskräften: »Nein! Hilf mir, Gott!«
Nachdem der Wagen zum Stehen gekommen war, vermochte ich mich eine Zeitlang nicht zu rühren. Ich hatte einen Schock erlitten, was mir damals aber nicht bewusst war. Ein BMW-Fahrer hielt an, beschwerte sich, dass ich kein Warndreieck aufgestellt hatte, und fuhr einfach weiter. Ich wollte aussteigen, zitterte aber so sehr, dass ich es nicht schaffte, vom Sitz loszukommen. Windschutz- und Heckscheibe waren zerbrochen, überall lagen Glasscherben. Den Auspuff fand ich hinter dem Wagen auf dem Seitenstreifen, und das gesamte Auto war nur noch ein zerbeulter Haufen Metall. Mir jedoch schien nichts zu fehlen. Es kam mir wie ein Wunder vor.
Schließlich eilte mir ein etwa Dreißigjähriger zu Hilfe. Er verständigte meine Eltern, David und die Polizei.
Die Unfallaufnahme entwickelte sich zu einer wahren Geduldsprobe. Der Beamte war davon überzeugt, dass ich zu viel getrunken hatte, und er ließ sich davon auch nicht durch meine negativen Testergebnisse abbringen.
Als endlich alles zu Papier gebracht worden war, stand ich vor dem Problem, wie ich vom Unfallort fortkommen sollte. Ich befand mich ziemlich genau in der Mitte zwischen Hamburg und meinem eigentlichen Ziel. Natürlich hätte ich meine Eltern bitten können, mich abzuholen. Aber dann wäre der gemeinsame Tag mit David dahin gewesen. Meine Eltern hätten mich aus elterlicher Fürsorge ins Krankenhaus gebracht, um sicherzustellen, dass mir auch wirklich nichts fehlte, und mir dann sicher gesagt, dass das Ganze sowieso nur eine meiner Schnapsideen gewesen sei.
Ich weiß, dass man so einen Unfall nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Aber ich hatte nicht einmal eine Beule am Kopf, lediglich einen klitzekleinen Kratzer auf der Wange, der von der zerbrochenen Windschutzscheibe herrührte. Und ich spürte ganz eindeutig, dass mir auch innerlich nichts fehlte. Mein Entschluss stand daher fest: Ich würde zu David weiterfahren.
Ich fragte den Mann, der die Polizei benachrichtigt hatte, ob er mich mitnehmen könne. Normalerweise wäre ich nie im Leben auf die Idee gekommen, zu einem Fremden ins Auto zu steigen. Aber mein Schutzengel hatte mir an diesem Morgen schon einmal zur Seite gestanden, und ich hoffte, dass er auch den Rest des Tages über mich wachen würde. Etwas drängte mich. Mir war klar, ich musste ganz einfach zu David gelangen – auf welchem Weg auch immer.
Der Fremde lieferte mich netterweise ohne Umweg bei der verabredeten Adresse ab. Ich klingelte, David öffnete die Tür und nahm mich fest in die Arme. In diesem Augenblick wusste ich mit Bestimmtheit, dass mein Entschluss, nach dem Unfall zu ihm zu fahren, richtig gewesen war. Doch erst im Nachhinein wurde mir klar, welche Rolle diese Entscheidung für mein weiteres Leben spielte. Sie stellte die Weichen für meine Zukunft. An diesem Tag wechselte ich das Gleis, änderte mein Schicksal. Seitdem haben David und ich, mit Ausnahme von ein paar Wochen, jeden Augenblick unseres Lebens zusammen verbracht. Dieser Tag liegt nun über zwanzig Jahre zurück.
Wagnis
Unsere Fahrt neigte sich ihrem Ende zu. Der Regen ließ nach, und der Nebel verzog sich langsam. Wir hatten das Okanagan Valley, British Columbias größtes Obst- und Weinanbaugebiet, hinter uns gelassen und fuhren nun über ein weitläufiges Hochplateau. Sanfte Hügel, auf deren grasbewachsenen Hängen Rinder grasten, erstreckten sich zu beiden Seiten des Highways. Die Luft war nach dem Regen klar und frisch, und eine kühle Brise wehte durch das halbgeöffnete Fenster in den Wagen.
Schon bald erreichten wir den höchsten Punkt des Plateaus. Von dort aus hatte man einen großartigen Ausblick auf die schneebedeckten Bergketten in der Nähe der Städte Keremeos und Princeton, gute eineinhalb Fahrstunden entfernt.
Schließlich führte der Highway hinab in eine kleine Senke, in der sich eine wild zusammengewürfelte Ansammlung von Häusern befand.
»Mama, was steht dort auf dem Schild?«, fragte Haley vom Rücksitz aus.
»Bridesville«, erwiderte ich. »So heißt der Ort hier.«
»Was für ein schöner Name«, stellte Haley fest.
»Ich habe gehört, dass viele Bräute extra hier vorbeifahren und Briefe und Karten beim hiesigen Postamt abstempeln lassen, nur weil darauf der Name Bridesville, also Brautdorf, steht«, erzählte ich den Kindern.
»Das will ich auch machen, wenn ich heirate«, erklärte Haley sofort.
Doch als wir den Ort schließlich erreichten, änderte sie ihre Meinung recht schnell, und ich konnte es ihr nicht verübeln. Bridesville machte seinem Namen wirklich keine Ehre. Eigentlich handelte es sich auch gar nicht um einen richtigen Ort, sondern lediglich um eine mickrige Ansammlung von alten, heruntergekommenen Häusern und Trailern. Diese mobilen Wohncontainer waren entlang einer schmalen Straße neben dem Highway geparkt. Überall lag Sperrmüll herum, Zäune waren halb umgekippt, und das Unkraut wuchs meterhoch.
»Hier sieht es überhaupt nicht nach Hochzeit aus«, stellte Haley enttäuscht fest. »Eher wie im Reservat.«
Ich musste schmunzeln. So vieles im Leben war ein Trugbild. Auch viele Facetten meiner neuen Heimat waren nicht so, wie ich mir diese anfangs vorgestellt hatte – aber wann gingen Träume schon in Erfüllung? Das Gerede über Hochzeiten und Bräute erinnerte mich jedenfalls an meine eigene Hochzeit, oder besser gesagt an meine beiden Hochzeiten. Denn wenn man es genau nimmt, hatte ich gleich zweimal geheiratet – allerdings ein und denselben Mann.
Doch bis es dazu kam, musste erst ein wenig Zeit vergehen, auch wenn mich jeder Tag nach dem Unfall auf der schneebedeckten Autobahn diesem Ereignis näher gebracht hatte. Nur ahnte ich das damals noch nicht, denn mein neues Glück mit David bestand anfangs keineswegs immer aus Sonnenschein. Im Gegenteil. Es zogen schon recht bald die ersten Gewitterwolken am Himmel auf. Ein Anruf bei meinen Eltern am Unfalltag hatte mir den Eindruck vermittelt, dass sie mehr um mein Auto besorgt waren, das mittlerweile mit Totalschaden auf einem Schrottplatz seine letzte Ruhestätte gefunden hatte, als um mein Wohlergehen. Das stimmte so natürlich nicht, und nun, da ich selbst Mutter bin, erscheint mir vieles in ganz anderem Licht, aber damals kam es mir so vor. Und der Abend, an dem ich meinen Eltern David offiziell vorstellte, verlief ebenfalls alles andere als rosig. Das darf man nicht falsch verstehen, ich habe großartige Eltern, aber selbst für die wunderbarsten Eltern kann es schwer sein, plötzlich mit einem zukünftigen Schwiegersohn konfrontiert zu werden, der nicht nur aus einem ganz anderen kulturellen Umfeld stammt, sondern die Tochter auch noch ans andere Ende der Welt »verschleppen« will. Nun hatte ich bisher meine Eltern immer in meine Entscheidungen einbezogen, hatte auf ihren Rat gehört und sie um ihren Segen dafür gebeten. Diesmal jedoch hatte ich meine Entscheidung ganz allein getroffen und war nicht bereit, von ihr abzuweichen. Natürlich war das der Beginn meines Abnabelungsprozesses, der vielleicht später als bei meinen Freunden eingesetzt hatte, der aber – wie für jeden Menschen – unumgänglich war. Ich hatte mich auf den Weg gemacht, mich selbst zu finden.
Die Reaktion meiner Eltern war nicht außergewöhnlich. Von vielen meiner sogenannten Freunde bekam ich zu hören, dass David keine ernsten Absichten hege und mich fallenlassen werde, sobald er jemanden fand, der ihm besser gefiel oder mehr zu bieten hatte. Natürlich glaubt niemand, der frischverliebt ist, die Seifenblase seiner Träume könnte platzen. Trotzdem nagen solche negativen Kommentare an der Seele, und ich ertappte mich mehr als einmal dabei, meine Beziehung zu David sehr genau unter die Lupe zu nehmen. Niemand begibt sich freiwillig in eine Situation, von der er weiß, dass sie ihm das Herz brechen wird – und ich bin die Letzte, die ihr Herz zum Spaß auf den Auktionstisch legt. Aber David hat mir nie Anlass zu der Annahme gegeben, jemand zu sein, der andere ausnutzt. Ganz im Gegenteil: Er ist ein Mann, der sagt, was er denkt, und tut, was er für richtig hält. Und ich wusste, dass es auch für ihn nicht leicht sein musste, im Angesicht aller Zweifler zu unserer Liebe zu stehen.
Darum machte ich einen weiteren Schritt nach vorn, fort von meinem »alten Selbst«. Ich sagte mir: »Vielleicht sehe ich die Dinge durch eine rosarote Brille, vielleicht bin ich so naiv, wie andere es darstellen, vielleicht wird David ohne mich nach Kanada zurückkehren und mich vergessen, während mein Herz auf der Strecke bleibt.« Aber ich sah auch eine sehr große Chance, dass ich mich nicht täuschte und unsere Liebe zu dem heranwachsen könnte, was sie heute ist. Es war, als habe sich der Vorhang des Schicksals ein ganz kleines bisschen gelüftet – nicht weit genug, um in die Zukunft zu sehen, aber genug, um etwas zu wittern, das für die meisten Menschen eine ungeheure Anziehungskraft besitzt: Freiheit. Freiheit von gesellschaftlichen Zwängen, Freiheit von einem Leben ohne Sinn, Freiheit von meinem alten Selbst. Unsere Liebe war die Chance auf einen kompletten Neuanfang und ein erfülltes, glückliches Leben. Und ich war bereit, dafür alles zu riskieren.
Alles hat seinen Preis und seine dunklen Seiten, das war mir klar. Aber daran wollte ich vorerst nicht denken. Mein neues Motto lautete: ein Tag nach dem anderen. Und an dieses Motto halte ich mich noch heute. Oft türmen sich Dinge vor einem auf und wachsen zu einem scheinbar unüberwindbaren Berg an. Man fühlt sich wie gelähmt, und jegliche Lebensfreude verblasst. Ich verabscheue dieses Gefühl, diese Machtlosigkeit, diese Starre. Darum sprach ich mir selbst Mut zu und dachte: Heute ist heute. Heute bin ich glücklich, heute ist David bei mir. Das reicht. Was morgen geschehen mag, darum werde ich mich morgen kümmern. Nicht eher.
Dieser neuen Einstellung wegen wurde ich reichlich beschenkt. David hatte vor, nach seiner Rückkehr nach Kanada seinem Volk zu helfen, ein traditionelles Rundhaus, ein Zeremonienhaus, zu bauen, um dem Verfall seiner Kultur entgegenzuwirken und den Menschen ein Stück ihres Stolzes zurückzugeben. Ich sollte ihm dabei zur Seite stehen. Und so hatte ich plötzlich ein Ziel, war Teil eines Ganzen.
Eine Bekannte fragte mich, als ich ihr von dem Vorhaben erzählte, was denn meine Rolle sein würde, wenn wir erst im Reservat lebten und das Zeremonienhaus bauten. Ich verstand sie damals nicht. Ich war zu überwältigt von dem Gedanken, an etwas Wichtigem teilhaben zu dürfen.
Eines Tages, als wir an einem kühlen Wintertag durch die Holsteinische Schweiz spazieren gingen, unterhielten David und ich uns über die Bemerkung meiner Bekannten. Ich erinnere mich noch gut, wie David vor der Kulisse der kahlen Laubbäume stehen blieb, meine Hände in seine nahm und mich ernst ansah. Dann fragte er mich ganz direkt: »Was willst du mit deinem Leben anfangen?«
Dazu muss man verstehen, dass in der indianischen Kultur jeder sein Leben auf eine Weise gestaltet, die einen möglichst großen Nutzen für andere darstellt. Der Wunsch nach persönlichem, materiellem Reichtum wird abgelehnt. Man schwelgt nicht selbst im Überfluss, während die Familienangehörigen (und dazu zählen nicht nur die unmittelbaren Familienmitglieder, sondern der gesamte Stamm wird als Familie betrachtet) in Armut leben. Viele Indianer halten sich inzwischen zwar nicht mehr an diesen Grundsatz, aber für David gilt er heute noch genauso wie für seine Vorfahren. Daher war seine einfache Frage an mich sehr viel tiefgründiger, als ich damals annahm.
Man mag es meiner Naivität zuschreiben, aber ich antwortete David das, was ich in dem Augenblick in meinem Herzen verspürte: Ich wollte Menschen helfen. Wie, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass ich helfen wollte. Auf welche Art und Weise auch immer. Diese Erkenntnis verschaffte mir unglaubliche Erleichterung. Nach langen Jahren der Ungewissheit war mir endlich bewusst geworden, was ich wirklich wollte. Mein Ziel war vielleicht noch nicht sehr klar definiert, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung. Das spürte ich ganz deutlich.
Umso mehr freute ich mich, als David mich im Herbst 1995 einlud, mit ihm nach Kanada zu fliegen, um seine Familie im Reservat kennenzulernen. Vielleicht würde sich daraus eine Aufgabe für mich ergeben.
Vor unserer Abreise geschah dann etwas, das mich vollkommen unerwartet traf: David bat mich, noch vor der Reise seine Frau zu werden – nicht durch ein Stück Papier, das irgendein Standesbeamter ausfüllte, sondern durch eine althergebrachte indianische Zeremonie, die im Innenhof des Museums abgehalten werden sollte. Dort, wo David an dem Totempfahl arbeitete und wir uns kennengelernt hatten. Die Zeremonie sollte mit der heiligen Pfeife bekundet werden und uns für den Rest unseres Lebens vereinen.
Die heilige Pfeife bindet die Teilnehmer an die Versprechen, die sie während der Zeremonie abgeben. Das gilt für Zeremonien jeglicher Art und ist genau der Punkt, den die Weißen nie richtig verstanden haben, auch damals nicht, als die europäischen Neuankömmlinge Verträge mit den indianischen Stämmen aushandeln wollten. Für sie war das Ergebnis lediglich eine Reihe von Worten auf einem Stück Papier, für die Indianer hingegen war es ein Bündnis für die Ewigkeit. Worte, die mit der heiligen Pfeife besiegelt werden, stellen lebenslange Versprechen dar.
Die Zeremonie bedeutete eine große Entscheidung für mich. Für immer und ewig ist eine lange Zeit, wenn man erst 21 Jahre alt ist. Trotzdem war ich überglücklich und zögerte nicht mit meiner Antwort.
Eine Frage jedoch brannte mir auf der Zunge: Warum gerade jetzt? Davids Antwort war ganz einfach. Für die Geister seiner Ahnen musste deutlich sein, wer zu ihnen kam und aus welchem Grund. Dazu muss man wissen, dass in der indianischen Kultur der Respekt für die Ahnen und die Geistwesen an erster Stelle steht. Und somit auch für David. Er wollte mit der Zeremonie vor allem die Ahnen und Geister um ihren Segen bitten und ihnen kundgeben, dass wir von nun an bis an unser Lebensende eine Einheit bilden würden.
Verständlicherweise war ich vor Beginn der Zeremonie sehr aufgeregt. Es war das erste Mal, dass ich an etwas Derartigem teilnahm, und ich hatte Angst, etwas falsch zu machen. Doch die Feier verlief ohne Zwischenfälle und war viel unkomplizierter, als ich es mir vorgestellt hatte. Es ist leider nicht erlaubt, Außenstehenden den genauen Verlauf oder die Worte und Gesänge weiterzugeben, die bei den verschiedenen Zeremonien benutzt werden. Nur, dass Feuer bei allen Zeremonien eine wichtige Rolle spielt. Und so brannte dann auch für uns ein Feuer im Innenhof des Museums, während wir den Ahnen und Geistwesen mit unseren Gesängen und Gebeten mitteilten, dass wir von nun an Mann und Frau und unsere Leben eins waren, und sie um ihren Segen baten.
Unsere vierwöchige Reise nach Kanada war für mich der erste Aufenthalt in Nordamerika überhaupt. Ich hatte schon viel über diesen wunderschönen Kontinent gelesen und auch bei Freunden, die in den USA oder in Kanada Urlaub gemacht hatten, Fotos gesehen. Aber nichts glich dem Moment, als ich mit eigenen Augen die dicht bewaldeten Coast Mountains sah, die Vancouver seine einzigartige Kulisse geben. Wild und ungezähmt schienen sie der Zivilisation Widerstand zu leisten. Es war, als könnte ich eine jahrtausendealte Stimme hören, die mich über alle Schranken von Raum und Zeit hinweg zu sich rief – die Stimme der indianischen Ahnen, der Menschen, die das Land durchstreift und auf ihm gelebt hatten, lange bevor der weiße Mann seinen Fuß auf diesen Kontinent gesetzt hatte. Sie flüsterte mir etwas zu und pflanzte einen Samen in mein Herz, der schnell zu einem Spross heranwuchs und meine Liebe für dieses wilde Land für immer besiegelte. Die endlosen Wälder, die ungezähmten Ströme und einsamen Bergketten, sie alle zogen mich auf magische Weise an. Sie lockten mich mit ihrem Versprechen auf Freiheit, flößten mir gleichzeitig aber auch Respekt vor ihren Urgewalten ein.
Allein das Gefühl, der Wildnis so nahe sein zu dürfen, machte mich glücklich. Sie wirklich berühren zu können, davon war ich allerdings noch weit entfernt. Zunächst einmal mussten wir aus Vancouver herauskommen.
Im Vergleich zu anderen Großstädten ist Vancouver eine sehr schöne grüne Stadt, an der ich nichts auszusetzen hatte außer dem schrecklichen Gewirr der elektrischen Leitungen, das sich wie ein Spinnennetz über die gesamte Stadt zog und mir das Gefühl gab, eingesperrt zu sein. Ich war daher nicht traurig, dass wir sie schon bald hinter uns ließen.
Es war nicht nur die Landschaft, die mich auf dieser ersten Fahrt überwältigte. Alles in Kanada schien um einige Dimensionen größer zu sein als in Deutschland: die Straßen, die Autos, die Häuser. Die Lastwagen waren von geradezu beängstigender Größe und die Supermärkte riesig. Hier kaufte man Mehl nicht in Ein-Kilo-Paketen, sondern in Zehn-Kilo-Säcken und Waschpulverkonzentrat in Kartons, in denen man ein großes Paar Winterstiefel unterbringen konnte.
Sofort fiel mir aber auch auf, dass der Service viel besser war als in Deutschland. Das Personal in den Geschäften und Restaurants war freundlicher und in den meisten Fällen bereit, einem weiterzuhelfen – auch wenn der Laden das gewünschte Produkt oder den benötigten Service nicht anbot. Insgesamt schien das Leben hier weniger hektisch zu sein, und die Menschen waren gelassener. Diese Gegebenheiten gefielen mir sehr.
Die ganze Zeit über wusste ich: David wollte mir Land und Leute zeigen, und ich sollte mir durch den Kopf gehen lassen, ob ich mir vorstellen könnte, hier zu leben. Natürlich wollte er mir vor allem das Reservat und seine Familie näherbringen. Ich wusste, wie wichtig das für ihn war, und dementsprechend aufgeregt war ich dann auch, als wir mit unserem Mietwagen an dem Schild anlangten, auf dem der Name des Reservats stand.
David hatte mich schon in Deutschland bezüglich der Zustände in den Reservaten in Nordamerika gewarnt, aber Erzählungen sind oft nichts im Vergleich zu dem Moment, in dem man etwas mit eigenen Augen sieht. Dazu muss ich anmerken, dass das Reservat, in dem Davids Familie lebt, im Vergleich zu anderen noch recht gut in Schuss ist. Es gibt einen Gemeindesaal, einen Spielplatz und ein kleines Bürogebäude. Die Straßen sind geschottert und bestehen nicht nur aus nackter Erde, und die Grünflächen der Gemeinde werden stets frisch gemäht. Aber die nächstgelegene Stadt hatte den Deich zum Schutz vor Hochwasser des Fraser Rivers so gebaut, dass er dem Reservat keinen Schutz bot, so dass oft schon während der Schneeschmelze Land unter herrschte. Und wenn man genauer hinblickte, konnte man die Armut nicht übersehen. Die heruntergekommenen Gebäude sprangen einem überall sofort ins Auge. Auch heute noch sind viele Fenster mit Sperrholzplatten zugenagelt, und bei den meisten Häusern blättert die Farbe von den Wänden. Gärten gibt es so gut wie keine, stattdessen stapeln sich Berge von Sperrmüll, wohin man auch blickt. Herrenlose, struppige Hunde laufen in wilden Rudeln durch die Straßen, und verwahrloste Kinder spielen zwischen den Häusern, neben denen allerdings fast in jedem Fall ein nagelneuer Wagen geparkt ist.