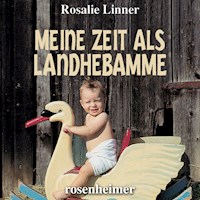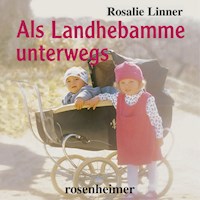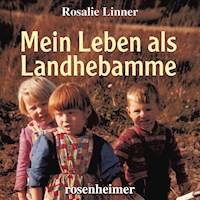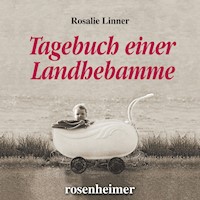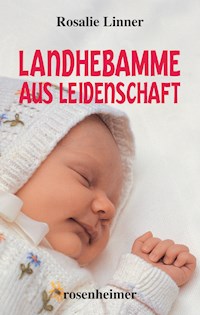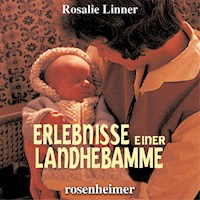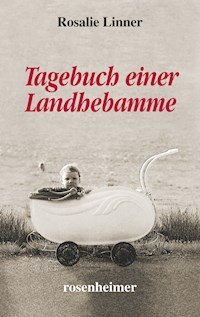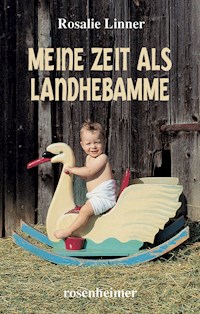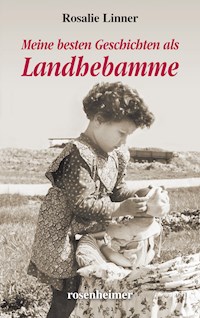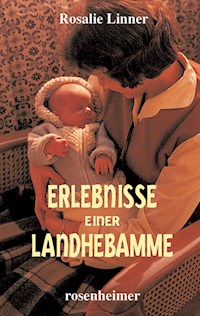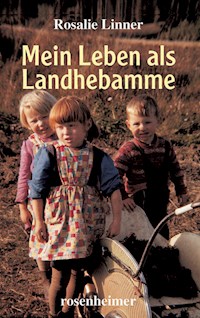
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rosalie Linner erzählt Erlebnisse aus ihrer fast 40-jährigen Berufstätigkeit als Landhebamme. Die Autorin schildert nicht nur die Freuden und Leiden, die sie in dieser Zeit begleiteten, sondern auch die Tücken, die ihr Beruf oft mit sich brachte. Der Leser erfährt etwas über die einfachen Lebensverhältnisse der werdenden Mütter, über problematische und glückliche Ehen und natürlich über die vielen Kinder, die Rosalie Linner zur Welt gebracht hat. Ein Buch, das unterhaltsame Lektüre und zeitgeschichtliches Dokument zugleich ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2012
© 2016 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Titelbild: Die Bildertruhe Karin Naulin und Partner, Ainring; Fotograf: Heinz Ehrenkäufer Lektorat: Dr. Elisabeth Hirschberger, München Satz: SF-Design GmbH, Stefan Felder, Rosenheim
eISBN 978-3-475-54530-6 (epub)
Worum geht es im Buch?
Rosalie Linner
Mein Leben als Landhebamme
Rosalie Linner hat mit ihren beiden Büchern „Tagebuch einer Landhebamme“ und „Als Landhebamme unterwegs“ viele begeisterte Leserinnen und Leser gefunden.
Ihr drittes autobiografisches Werk enthält neue, bisher unveröffentlichte Texte über ihre Arbeit als Landhebamme. Die Autorin schildert darin nicht nur die Freuden und Leiden, sondern auch die Tücken, die ihr oft gar nicht einfacher Beruf mit sich brachte. Wir erfahren auch eine Menge über die Menschen, mit denen sie zu tun hatte, ebenso wie über die einfachen Lebensverhältnisse, über problematische und glückliche Ehen und natürlich über die vielen Kinder, denen Rosalie Linner zum Leben verhalf.
Ein Buch, das unterhaltsame Lektüre und zeitgeschichtliches Dokument zugleich ist.
Inhalt
Vorwort
Ein Albtraum
Verhängnisvolle Liebe
Wo bleibt der Stammhalter?
Endlich ein Bub?
nde gut, alles gut?
u viel des Guten
nvernunft tut selten gut
acht Reichtum glücklich?
rm an Geld, reich an Kindern
Innerlich arm
Herzenskälte
Immer nur Kälte
Mehr Glück als Verstand
Wer zu spät kommt
Wer kann hier Recht sprechen?
Lügen haben kurze Beine
Rein vor Gott und den Menschen
Göttlicher und menschlicher Beistand
Zwischen Himmel und Erde
Komik und Tragik
Tragik
Ausgleichende Gerechtigkeit
Schlusswort
Vorwort
1943. Eine Bombennacht in einem Luftschutzkeller in Frankfurt am Main: Enge, Angst und die Detonationen in nächster Nähe . Es ist die Nacht, in der die damals 25-jährige Rosalie Linner ein Erlebnis hat, das prägend für ihr weiteres Leben wird: In einer Ecke des Kellers liegt eine junge Frau in den Wehen . Linner, die damals außer einem Erste-Hilfe-Kurs keinerlei einschlägige Vorkenntnisse hat, hilft und tut instinktiv das Richtige . Inmitten von Zerstörung und Tod kommt ein gesundes Kind zur Welt.
Einige Jahre später, in den mageren Zeiten bald nach dem Krieg, hat die energische Geburtshelferin von Frankfurt ihre Berufung zum Beruf gemacht. Es sind noch etliche Hürden zu überwinden, ehe die gebürtige Bayerwäldlerin schließlich in Oberbayern die begehrte Niederlassungserlaubnis als Landhebamme bekommt
Fast vier Jahrzehnte lang ist sie von da ab unterwegs, um Kindern zum Leben zu verhelfen . Oft in abgelegenen Gehöften, bei Wind und Wetter, zunächst viele Jahre noch mit dem Fahrrad. Sie muss immer wieder improvisieren, wenn es unerwartete Komplikationen bei der Geburt gibt und, mangels Telefon und Auto, keine Möglichkeit besteht, noch rechtzeitig einen Arzt herbeizurufen
Für die einfachen Leute, mit denen sie vielfach zu tun hat, ist sie nicht nur Geburtshelferin, sondern auch Seelentrösterin und oft genug Doktor-Ersatz . So erhält sie einen tiefen Einblick in deren Lebensumstände, ihre Nöte und Sorgen, ihre großen und kleinen Freuden, ihre Sehnsüchte und Ängste . Sie bekommt aus nächster Nähe mit, ob ein Kind mit Freude erwartet wird oder unerwünscht ist, sie erfährt von Eheschwierigkeiten, von enttäuschter Liebe und von Reibereien mit den Eltern, den Schwiegereltern oder der Verwandtschaft. Echte Religiosität und tiefes Gottvertrauen erlebt sie ebenso wie manchmal geradezu kuriosen Aberglauben, Misstrauen oder Gleichgültigkeit gegenüber dem eigenen Mann oder der Frau ebenso wie bedingungslose Liebe und Anhänglichkeit an den Partner.
Es versteht sich von selbst, dass eine solche Frau viel zu sagen hat. In ihren beiden Büchern »Tagebuch einer Landhebamme« und »Als Landhebamme unterwegs« hat sie Episoden aus ihrer langjährigen Berufspraxis erzählt und uns dabei immer wieder auch Anlass zum Nachdenken über uns selbst und über unsere Zeit gegeben . Die große Resonanz, die diese beiden Werke gefunden haben, haben Rosalie Linner und uns ermutigt, ein drittes Buch dieser Art in Angriff zu nehmen – mit neuen, bisher unveröffentlichten Geschichten Es lässt vor unseren Augen ein anschauliches Bild vom Wirken einer Landhebamme in den Nachkriegsjahren, der Wirtschaftswunderzeit und in den Tagen entstehen, als im Zeichen des medizinischen Fortschritts – oder einfach eines modischen Trends? – Hausgeburten zur Seltenheit wurden .
Der Verlag
Ein Albtraum
Es war das Los der Landhebamme und damit auch das meine, sich immer bereitzuhalten, um jedem Abruf Folge leisten zu können, auch wenn der Hilferuf bewusst oder unbewusst vorgetäuscht war. Sei es am Tag oder bei Nacht, bei Sturm oder Gewitter, es gab kein Pardon, selbst wenn der Abruf zu einer Zeit kam, die höchst ungelegen war.
Es war ein heißer Sommertag, die Luft flimmerte schon am Morgen und alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass heute ein kräftiges Gewitter kommen würde, das sich voraussichtlich gegen Abend entladen wird. Ich verabschiedete mich gerade von der Huberin am Holz, die heute ihr drittes Kind bekommen hatte, als die ersten Gewitterwolken im Westen heraufzogen. »Jetzt kommst grad noch rechtzeitig heim, bevor es das Regnen anfängt«, meinte besorgt die Huberin.
»Das wird heute ein arges Gewitter, weil die Viecher so damisch sind«, prophezeite der Huber am Holz, »und die Ross’, die führn sich auf, als wenn sie verrückt wärn. «
Ich trat kräftig in die Pedale meines Fahrrades, um vor dem Gewitter, das immer näher heranrückte, noch heimzukommen. Eine Ringelnatter kroch quer über die Straße und verschwand im Gebüsch; sie spürte wohl auch die kommende Gefahr.
Schnaufend erreichte ich mein Zuhause, froh, ein schützendes Dach über meinem Kopf zu haben, wenn sich das Unwetter entlädt. Müde von der anstrengenden Strampelei, freute ich mich, daheim zu sein, ein wenig Ruhe zu haben. Doch diese Freude war von kurzer Dauer, denn das Telefon klingelte. »Du musst gleich zu der Daxbergerin auf den Brandberg kommen, soll ich dir ausrichten.« Es war die Wirtin vom Stempfl, die mir diese Nachricht übermittelte. Um die Wichtigkeit dieser Botschaft zu unterstreichen, fuhr sie fort: »Die alte Daxbergerin war da, ganz aufgeregt war sie, weil es bei ihrer Schwiegertochter, der Emmi, so weit ist. Sie hat sich gleich wieder auf den Weg gemacht, weil das Wetter schon hinten steht und nass werden möcht sie auch net, hat s’ gemeint.«
»Komm, wir müssen fort, wir zwei, wenn’s auch schwer fällt«, sagte ich zu meinem treuen Drahtesel, mit dem ich gelegentlich geheime Zwiegespräche hielt. Der Weg führte über eine steinige, holprige Straße, über furchige Wiesenwege, bis mich der Wald aufnahm. Bald fielen die ersten schweren Tropfen. Ich kam an der Waldlichtung an, von wo aus man den Brandberg vor sich hatte. Der hatte mir schon des Öfteren Kummer bereitet. Es regnete jetzt in Strömen und gleichzeitig setzte ein Tosen und Brausen ein, Sturm und Regen peitschten um mein Gesicht, Blitz und Donner lehrten mich das Fürchten. Alle Naturgewalten schienen losgelassen. Ich bemühte mich mit aller Kraft, vorwärts zu kommen, um den schützenden Wald zu erreichen, der den tobenden Sturm wenigstens teilweise von mir abhielt. Da fiel mit einem furchtbaren Krach hinter mir ein großer Baum, abgeknickt von dem heftigen Sturm, auf den Waldweg, der nun hinter mir blockiert war. Bald darauf noch einmal dieser ohrenbetäubende Lärm. Ein zweiter Riese fiel etwas weiter vorne ebenfalls auf den Weg, den ich unbedingt nehmen musste. Ich konnte weder vor noch zurück. Auch ein Ausweichen zur Seite war nicht möglich wegen dem steilen Berghang auf der einen und dem Abgrund auf der anderen Seite. Ich war eingesperrt. Mit dem Fahrrad gab es kein Weiterkommen mehr. Ich musste sehen, wie ich zu Fuß den höchsten Punkt des Brandberges erreichen konnte. Den Hebammenkoffer hielt ich fest in meiner Hand, musste aber dann feststellen, dass ich beide Hände freihalten musste, um überhaupt vorwärts zu kommen. Mit dem Riemen, mit dem ich diesen für mich wichtigsten Gegenstand am Fahrrad festschnallte, nahm ich den Koffer über meine Schultern und versuchte unter Sturm, Donner und Blitz, und manchmal auch auf allen Vieren, die steilere Abkürzung den Berg hinaufzukommen Völlig durchnässt erreichte ich das Plateau und bald das kleine Häusl der Daxbergers, in dem eine werdende Mutter vermutlich ängstlich und ungeduldig auf mich wartete.
Bei meinem Anblick hörte ich die alte Daxbergerin ausrufen: »Du bist ja nass wie ein Hund«, als ich die Kleidung unter dem Vordach des Hauses ausschüttelte. »Das ist aber auch ein Sauwetter wie selten eines«, stellte die Daxbergerin anschließend fest und meinte gutmütig: »Geh hinein in die Stube, setz dich nieder und schnauf dich aus, pressieren tut’s eh net!«
Ich höre wohl nicht richtig, überlegte ich, ich werde diesen schwierigen Weg doch nicht umsonst gemacht haben. Die alte Daxbergerin kannte ich schon lange und wusste, dass ihr Gerede häufig ein wenig wirr, zusammenhanglos und ohne rechten Sinn war. Ich betrat eine geräumige Stube, die zu ebener Erde lag, und wusste einen Augenblick lang nicht, was ich sagen sollte. Ich vergaß sogar den Gruß, den die Höflichkeit normalerweise erfordert. Statt eine werdende Mutter vorzufinden, die mit heftigen Wehen kämpfte, sah ich die Emmi am Nudelbrett mit kräftigen, flinken Armen einen Teig verarbeiten, der, wie es schien, mühelos durch ihre Hände ging. Man konnte ihr ansehen, mit wie viel Begeisterung sie diese Arbeit tat, als sie eine Teigkugel nach der anderen auf dem Nudelbrett anordnete. Lachend sah sie mir entgegen, ab und zu eine Haarsträhne aus ihrem Gesicht wischend, um sich dann wieder hingebungsvoll ihrem Teig zuzuwenden. Meinen Ärger, meine Enttäuschung schien sie nicht zu bemerken, als sie zu sprechen begann: »Hast bestimmt gemeint, ich krieg heute schon mein Kind, wie dich die Stempfl-Wirtin antelefoniert hat, aber die Mutter hat auch gemeint, es ist besser, wenn wir dich holen lassen, auch wenn’s noch net so weit ist, weil ich noch nix spür.«
Nur mühsam fand ich meine Sprache wieder. Der Ärger über das Verhalten dieser beiden Frauen war tief, wenn ich an die Strapazen dachte, die hinter mir lagen. »Da jagst du mich bei diesem Wetter auf den Brandberg, einfach so, weil es dir Spaß macht?«, fragte ich verärgert. Meinen Zorn musste sie inzwischen bemerkt haben, als sie einlenkend antwortete: »Nix für ungut, aber umsonst hätt ich dich net holen lassen.« Gespannt wartete ich auf eine Erklärung der Emmi, die nun doch etwas schuldbewusst dreinschaute. Sie sagte: »Heute ist mir etwas ganz Furchtbares passiert.« Dabei bekreuzigten sich die beiden Frauen, als ob sie noch im Nachhinein die bösen Geister verscheuchen müssten. Emmi unterbrach ihre Arbeit, als sie mir die mysteriöse Geschichte erzählte, in der ein Pfefferstreuer eine wichtige Rolle spielte und sie in Angst und Schrecken versetzte. »Heut Nacht hab ich geträumt, du bist zu mir auf den Brandberg net raufkommen, als ich dich gebraucht hätt. Das allein ist ja schon ein Unglück. Die Angst in der Nacht, die war grausam, und dann in der Früh ist mir das passiert: Ich hab das Pfefferbüchsl umgekippt und der Pfeffer hat sich auf dem Tisch und auf dem Boden verteilt; ist das net schrecklich?«
Betroffen und schweigsam hörte die alte Daxbergerin die Erzählung ihrer Schwiegertochter an, der jedes Lächeln aus dem Gesicht entschwunden war. Stattdessen bildeten sich zwei steile Falten auf ihrer Stirn, die Angst und Unsicherheit ausdrückten. Still stand sie vor mir, die Emmi, noch ganz unter dem Eindruck des Geschehenen und in Erwartung des bevorstehenden Unglücks, das über die Daxbergers kommen wird.
Ein Pfefferstreuer, überlegte ich. Deswegen eine solche Aufregung. Von meiner Schinderei ganz zu schweigen. Es war, als ob mich der Brandberg immer wieder schikanieren wollte; des Öfteren hatte ich schon Probleme mit ihm gehabt.
Nach dem ausführlichen Bericht der Emmi saßen nun beide Frauen mit ihren Gedanken beschäftigt auf ihren angestammten Plätzen in der Stube. Sie sahen ihr kleines Glück in dem bescheidenen Häusl aufs Äußerste bedroht, und man konnte dieser Bedrohung nichts entgegensetzen, denn gegen höhere Gewalt gab es keine Hilfe.
Der Aberglaube ist in diesen Menschen tief verwurzelt, und ganz besonders in denen, die in der Einsamkeit leben. Gegen diese Einstellung kann man nicht angehen, mit keinem Argument, mit keiner logischen Erklärung. Vorstellungen, die seit Generationen Gültigkeit haben, kann man mit Worten allein nicht abtun. Man muss die Gedanken, die das Innere dieser Menschen bewegen, verstehen lernen. Der zutiefst verwurzelte Aberglaube dieser beiden Frauen war die logische Erklärung für ihr Verhalten.
Die Emmi wischte sich in Gedanken an die vorangegangenen Ereignisse den Schweiß von der Stirn und erwartete von mir einen Trost, eine Erklärung, eine Hilfe, was auch immer. Vergessen war für Emmi der Nudelteig, der auf seine weitere Verarbeitung wartete. Sie gab sich weiter ihren trüben Gedanken hin, die sie, wie zu sehen war, erheblich belasteten. Wir hatten ein langes Gespräch, bei dem auch die alte Mutter aufmerksam zuhörte. Ich versuchte, ihr diesen Aberglauben auszureden, der in Anbetracht ihres Zustandes keine gute Voraussetzung für die Geburt ihres Kindes sei. Sie sollte sich mit guten, positiven Gedanken beschäftigen, die auch ihrem Kind zugute kommen könnten, erklärte ich ihr.
Emmi war eine aufmerksame Zuhörerin und, wie ich meinte, etwas getröstet. Zwischen den Gesprächen kamen jedoch immer wieder Zweifel, ob meine Worte glaubhaft seien, denn schon die Großeltern hatten gewusst, dass solche Zeichen Vorboten von Unglück sind. »Du meinst, dass das net stimmt, was meine Großmami allerweil gesagt hat, das mit dem Pfefferbüchsl, mein ich?« Gespannt wartete die Emmi auf meine Antwort.
»Das ist Aberglaube, Emmi«, versicherte ich ihr, »du solltest dich nicht an diese Weissagungen halten, denn nur deiner Ungeschicklichkeit ist es zuzuschreiben, dass dieses Malheur passiert ist. «
Inzwischen hatte sich die Natur draußen etwas beruhigt, es regnete nur noch leicht, sodass ich einen besseren Heimweg erwarten konnte. Mit ein paar tröstenden Worten verabschiedete ich mich von Emmi, als die alte Daxbergerin zur Tür hereinkam, deren Abwesenheit ich erst jetzt bemerkte. »Möchtest schon gehn?«, fragte sie. »Nix für ungut«, entschuldigte sich auch die Mutter, »dass wir dich bei dem Sauwetter da heraufgesprengt haben. Aber wir haben halt Angst gehabt, wir zwei. Mein Bub, der Michi, der ihr Mann ist«, dabei zeigte sie auf Emmi, die immer noch zweifelnd meinen Worten zuhörte, »der wird uns richtig schimpfen, wenn er heimkommt und erfährt, dass wir dich wegen dem ausgeschütteten Pfefferbüchsl auf den Brandberg raufgeholt haben, und noch dazu bei dem Sauwetter«, wiederholte sie sich. Sie wirkte ein wenig schuldbewusst, aber doch zufrieden, dass ich die Emmi in ihren seelischen Nöten nicht allein gelassen habe. Ein wenig gebückt, mit bloßen Füßen, ihr Kopftuch, das sie tief in ihr Gesicht gezogen hatte, voller Laub und Tannennadeln, so, als käme sie gerade vom Wald, stand sie mir klein und müde gegenüber. Ihre Hände zitterten ein wenig, als sie mir eine bunte Blechschüssel reichte mit den Worten: »Das hab ich noch geschwind vom Wald für dich reingeholt, damit du net ganz umsonst da raufkommen bist … und bei dem Wetter.«
»Dann sag ich halt Vergelt’s Gott. « Herrlich frische Steinpilze in allen Größen waren es, die die alte Daxbergerin für mich im nahen Wald gesucht hatte. Diese so liebenswerte Geste berührte und beschämte mich gleichermaßen. Im Stillen schämte ich mich über meinen Ärger, als ich die Dankbarkeit dieser in der Abgeschiedenheit lebenden Menschen sah, die außer ihrem Glauben an Gott auch ihren Aberglauben lebten.
Nach mehreren Wochen rief man mich wieder auf den Brandberg; dieses Mal war der Ruf nach mir gerechtfertigt. Die Emmi erwartete mich schweißtriefend, mit großen, ängstlichen Augen. Ich kannte den Grund ihrer Angstgefühle, denn der verschüttete Pfeffer spukte, wie zu sehen war, immer noch in ihrem Kopf.
»Meinst, es wird gut gehen?«, fragte sie mich des Öfteren. Ihre Zweifel waren deutlich in ihr Gesicht geschrieben.
»Natürlich wird es gut gehen«, antwortete ich auf die immer gleiche ruhelose Frage. »Du bist gesund und was die Geburt angeht, ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Oder denkst du immer noch an den verstreuten Pfeffer von damals?«
Emmi schwieg zu dieser Frage.
Da wusste ich mit Bestimmtheit, dass diese Begebenheit in ihrem Inneren immer noch lebte. Nach mehreren Stunden, welche die Emmi in Unsicherheit und Sorge verbrachte, kam das mit Ungeduld und verhaltener Freude erwartete Kind zum Leben. Die Nabelschnurumschlingung um den Hals des Kindes, die in diesem Fall aber keine akute Bedrohung für das Kind gewesen ist, war eine Abweichung vom Normalen, die manchmal zu Schwierigkeiten im Geburtsverlauf führen kann. Doch dieses kleine Mädchen hatte alles gut überstanden, es lebte, und Mutter und Kind ging es bestens.
Eltern und Großmutter standen staunend vor dem kleinen Wunder, das allen Unkenrufen zum Trotz frisch und gesund war. Die Abweichung im Verlauf der Geburt, die man nie ganz ausschließen kann, verschwieg ich den Eltern gegenüber. Emmi hätte sie mit Sicherheit dem verschütteten Pfeffer angelastet. Niemand erfuhr etwas davon, denn manchmal ist Schweigen die bessere Lösung. Nur mein Tagebuch kennt diese Wahrheit. Hier kam es mir wieder so recht zu Bewusstsein, dass Aberglaube die Menschen bis ins tiefste Innere erfassen kann, wofür auch echte Religiosität kein Hinderungsgrund ist.
Verhängnisvolle Liebe
Es war nichts Ungewöhnliches, besonders im ländlichen Gebiet, dass ein unehelich geborenes Kind zwar unerwünscht war, aber doch angenommen wurde, weil es nun einmal da war. Kam gelegentlich ein zweites, ebenfalls unehelich geborenes Kind dazu, so gab es nicht nur vermehrten Ärger, Schwierigkeiten und böse Worte, die kein Ende nehmen wollten. Vor allem war der gute Ruf der jungen, unehelichen Mutter dahin und die Heiratschancen waren sehr gering geworden. Kam es dann doch noch zu einer Heirat, so verhießen solche Verbindungen nichts Gutes. Wie oft hörte ich: »Wär ich doch allein geblieben mit meinen Kindern!« Immer wieder beklagten sich diese Mütter, wenn sich der Ehemann als äußerst schwierig erwies und die Vorwürfe über die »ledigen Bankerten« kein Ende nehmen wollten. Kam dann noch dazu, dass diese Kinder Schläge statt Zuwendung von ihrem Stiefvater bekamen, so war das für die Mutter ein seelisches Trauma. »Ich muss trotz allem schweigen«, hieß es dann, »er hat mir und den Kindern ein Zuhause gegeben. «
Ein solches Zuhause ist aber eine fragwürdige Angelegenheit, es fehlt etwas ganz Entscheidendes: die Liebe, die gegenseitige Zuneigung, das Dasein füreinander. In solchen Familien sah ich meist verstörte Kinder, traurige, verängstigte Jugendliche, die zwar ein Dach über dem Kopf, aber keine eigentliche Heimat hatten. Kamen dann noch eigene Kinder dazu, so wurden deutliche Grenzen gesetzt: hier die Eigenen, dort die Fremden, die Unerwünschten, die man zwangsläufig dulden musste. Ich erlebte dieses Trauma immer wieder, auch wenn nach außen hin Harmonie demonstriert wurde. Die großen Kinderaugen erzählten oft von unausgesprochenem, tiefem Leid. Es war mir häufig unverständlich, wie sich manche dieser Mütter duckten, stillhielten gegenüber ihren Ehemännern, keinen Widerspruch kannten und ständig in der Furcht lebten, eventuellen Ausschreitungen begegnen zu müssen.
Es war die Zeit des Aufschwunges. Der Krieg hatte seine Spuren hinterlassen, aber es gab berechtigte Hoffnung auf ein neues, besseres Leben. Auch auf dem Land wurde der Umbruch zum Besseren sichtbar. Der Bauernstand holte mit neuen, modernen Arbeitsgeräten auf, Haus und Hof wurden modernisiert, die Arbeit wurde erleichtert. Auf meinen Dienstwegen nahm ich diese Veränderungen mit Bewunderung und Staunen war. Ein neues Zeitalter war im Kommen.
Vroni, die langjährige Stütze der verwitweten Stetterbäuerin, die kein Dienstbote im eigentlichen Sinn war, sondern die zum Hof und zur Familie gehörte, wurde von allen, die sie kannten, als Stetter-Vroni geschätzt und geachtet. Eine tüchtige, umsichtige junge Frau, die ihre ganze Kraft in diesem Hof einsetzte, so, als sei er ihr eigener. Vroni dachte nicht an Heirat, wie es schien, sie war mit ihrem Leben auf dem Stetterhof zufrieden, für den sie von früh bis spät rackerte. Hin und wieder gab es Bewerber, aber zu einer festen Bindung kam es nicht.
Jahre vergingen und plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie sich den Dreißigern näherte und dass es Zeit würde, einen eigenen Hausstand zu haben. Mit einem Mal sah die Vroni, dass sie die besten Jahre ihres Lebens nicht genutzt hatte, dass sich nun keine Bewerber mehr fänden, die sich um sie bemühen würden. Ihre Heiratschancen waren trotz ihrer Tüchtigkeit gering geworden.
Aber dann kam die Wende im Leben der Vroni und – wie ich meine – eine schicksalhafte, folgenschwere Wende, der sie nicht entgehen konnte, nicht entgehen wollte. Ein junger Mann, der in einem nahe gelegenen Betrieb arbeitete, bemühte sich um sie, besser gesagt, verfügte über sie, weil er außer finanziellen Vorteilen noch anderes erwarten konnte. Vroni, die nun im Hochgefühl einer nie gekannten Liebe lebte, war in ihr gefangen. Auf alle wohlgemeinten Warnungen der besorgten Bäuerin achtete sie nicht, sie war wie verzaubert, sie war nicht mehr sie selbst.
Ein Jahr verging. Für Vroni war es ein Jahr höchsten Glücks, aber auch tiefer Sorgen. An einem regnerischen Tag begegnete sie mir, als ich von einer Wochenpflege kam, und um mit mir sprechen zu können, hielt sie mich an. Ich hatte richtig vermutet: Vroni wird in einigen Monaten meine Hilfe brauchen. Ihr sonst so klarer Blick wirkte müde, die ersten Fältchen bildeten sich um Mund und Augen, sie wirkte älter, als sie in Wirklichkeit war. Ihre einst so helle, lebensfrohe Stimme war gedämpft und unsicher. Vroni, diese liebenswerte, junge Frau, die ich von früher her kannte, hatte sich verändert, sie war eine andere geworden. Ich erfuhr von ihr, dass sie von Konstantin dieses Kind erwarte und dass er eine Heirat vor der Geburt dieses Kindes, die sie sich so sehr gewünscht habe, abgelehnt hätte. »Ich muss es hinnehmen, obwohl es mich sehr bedrückt«, sagte sie verbittert. Einige Monate nach diesem Gespräch wurde ein gesunder Bub geboren und Vroni nahm ihn liebevoll in ihre Arme und streichelte sein nasses Köpfchen. Ihre etwas herben Gesichtszüge wurden dabei weich, warm, mütterlich. Den Namen des Kindes bestimmte allein die Vroni, weil sich Konstantin nicht sehen ließ. Sie nahm dies ohne Widerspruch hin. Auch sonst sprach sie nicht über den Kindesvater und sein Verhalten. Konnte sie nicht oder wollte sie nicht? Das war schwer zu beantworten, denn Vroni wollte niemandem Einblick in ihr Inneres geben.
Nach einer Woche brachte ich die Mutter und ihr Kind aus dem Krankenhaus auf den Stettnerhof zurück. Die mütterliche, warmherzige Bäuerin hatte für den Empfang der beiden alles mit sehr viel Sorgfalt vorbereitet. »Meine Kinder sind eh schon groß und genug Platz haben wir auch. Es wird schon gehen«, meinte diese gütige Frau zu mir. Wieder einmal war ich froh, dass ein ungewolltes Kind ein echtes Zuhause gefunden hatte.
Zu Vroni meinte ich abschließend: »Wäre es nicht besser, du würdest dich von diesem Mann trennen? Sein Verhalten gefällt mir nicht. Und was das Kind angeht, kann es hier unter so guten Bedingungen aufwachsen. Du bist auf diesen Mann nicht angewiesen. Es ist sehr fraglich, ob sich Konstantin nach einem zweiten Kind, mit dem du nach großer Wahrscheinlichkeit rechnen musst, zu einer Heirat entschließen wird.« Vroni sah mich an und sagte mit fester Stimme: »Konstantin und das Kind gehören zu mir, daran wird sich nichts ändern.«
Vroni ging wieder ihrer Arbeit auf dem Stetterhof nach und versorgte zusammen mit der Bäuerin ihr Kind, das gut gedieh und keinerlei Sorgen machte. Konstantin ließ sich immer weniger sehen, seine Besuche wurden immer rarer und das Interesse für sein Kind war, wenn überhaupt, gering. Seinen Urlaub verbrachte er weitab von Vroni und seinem Sohn.
Wiederum verging ein Jahr, das dem Stetterhof reiche Ernte einbrachte. Zufrieden blickte man auf dieses segensreiche Jahr zurück, welches den Wohlstand des Hofes vermehrte. Vroni erwartete, wie vorauszusehen war, ihr zweites Kind. Sie kam zu dessen Geburt zu mir, nachdem Andreas erst ein Jahr alt geworden war. Auch dieses Mal bestimmte die Mutter den Namen des Kindes, weil der Vater nicht bereit war, sich bei Mutter und Kind während der Frist von einer Woche, in der die standesamtliche Meldung vorgenommen werden musste, zu melden. Die Enttäuschung war der Vroni ins Gesicht geschrieben, aber sie schwieg auch dieses Mal. Hin und wieder überraschte ich sie, wenn sie am Krankenhausfenster stand und sehnsüchtig auf den Weg sah, der zum Eingang des Hauses führte. Sie wartete auf ihn, Konstantin, der sie immer wieder enttäuschte und dem sie stets verzeihen konnte. Auch das zweite Kind fand Platz auf dem Stetterhof, dessen Menschen an dem Leid anderer nicht vorbeischauen können, die bereit sind, in der Not zu helfen, auch wenn eigene Interessen zurückstehen müssen. Beide Buben konnten dadurch zusammen aufwachsen; ihnen blieb das Heim erspart, eine gute Voraussetzung für ihr späteres Leben.
Von einer Heirat mit Konstantin war immer noch keine Rede, und wie es schien, hatte Vroni resigniert. Widerstandslos fügte sie sich in das Unabänderliche. Ich sprach auch dieses Mal ihre Beziehung zu Konstantin an: »Willst noch immer an diesem Mann festhalten, obwohl du siehst, dass er keine feste Bindung mit dir will?«.
Diesmal schwieg die Vroni zu meiner Frage. Ich sah aber die Tränen in ihren Augen.
Als ich mich zum Gehen wandte, stand plötzlich die Stetterbäuerin vor mir. Ihre Miene war besorgt, als sie über die Beziehung dieser beiden Menschen mit mir sprach: »Dieser unverschämte Kerl«, sagte sie. Man sah ihr den Ärger an, als sie diese Worte aussprach. »Der nimmt das Dirndl aus wie eine Weihnachtsgans. Ständig kommt er, fordert Geld von ihr, bedrängt sie, dass der kleine Besitz ihrer Mutter endlich an sie übergehen soll. Die Gründe dafür sind allzu deutlich«, ärgerte sich die Stetterbäuerin. Aber Vronis Mutter sah den Lauf der Dinge so, wie sie in Wirklichkeit waren, und entschied anders. Aufgebracht berichtete die Stetterbäuerin weiter: »Er zahlt keine Alimente, er will nur nehmen, niemals geben, und öffentlich lässt er sich mit der Vroni nirgends sehen und das ärgert mich.«
»Sein Auftreten«, sprach sie weiter, »ist rücksichtslos, fordernd, gelegentlich sogar drohend und die Vroni schweigt dazu«, resümierte die Stetterin. »Sie ist für keinen noch so guten Rat aufnahmefähig. Die Vroni ist ihm hörig. Nichts und niemand wird sie von ihm trennen können. Das weiß er und seine Forderungen werden immer unverschämter.« Vroni war in den Fängen dieses Mannes, sie war ihm verfallen, ihm, der sie rücksichtslos ausnützte und immer wieder zutiefst demütigte. Die Liebe hatte diese junge Frau zur Sklavin gemacht. Ein böses Erwachen war vorauszusehen.
Das bäuerliche Jahr verging im Kreis der Jahreszeiten; es ging seinem Ende zu. Es war wieder ein gutes Jahr gewesen für den Stetterhof. Es wurde gesät, gearbeitet und reiche Ernte eingefahren. Man freute sich auf die geruhsame Zeit, die nun kommen würde. Die letzten Adventstage brachten Sturm und Schnee und Kälte und es waren nur noch wenige Tage bis Weihnachten, dem Friedensfest. In der Christnacht stand ich wieder, wie so oft, an einem Kreißbett. Vroni erwartete ihr drittes Kind, dem ich zum Leben verhelfen sollte. Alle guten Ratschläge und Ermahnungen hatte diese Frau, wie zu sehen war, nicht angenommen. Sie musste die Schwierigkeiten, die Belastungen, die mit einem dritten Kind auf sie zukamen, notgedrungen auf sich nehmen. Denn auch dieses Mal kam es zu keiner Heirat mit Konstantin, dem Kindesvater.
Wurde er gelegentlich von Bekannten und Kollegen daraufhin angesprochen und gefragt, welche Schwierigkeiten der Legalisierung des Verhältnisses mit Vroni im Wege stehen, dann antwortete er zynisch: »Ich heirate, wann es mir passt und wen ich will, aber nicht die Vroni.« Das war deutlich und es war zu erkennen, dass er sie nur für seine Zwecke benutzte. Nach diesem Ausspruch, der auch Vroni zu Ohren gekommen war, mieden ihn die Leute im Dorf auf ihre Weise. Sie gaben ihm zu verstehen, dass er nicht mehr zu ihnen gehörte, und wenn er sie ansprechen wollte, drehten sich die meisten um und gaben so zu erkennen, dass sie keinen Kontakt mit einem so ehrlosen Menschen wünschten. Nur Vroni nahm ihn wieder in ihre schützenden Arme. Was wollte er mehr.
Auch das dritte Kind fand Aufnahme im Stetterhof und konnte mit seinen beiden Geschwistern unter der Obhut seiner Mutter aufwachsen. Diese großartige Stetterbäuerin tat dies ganz selbstverständlich, aus Christenpflicht, wie sie mir sagte, und um den Kindern das Heim zu ersparen. Obwohl sie das Verhalten beider Eltern kritisierte, stand sie doch, wie sie meinte, zu ihrer Verantwortung, weil sie glaubte, »aus so einem Heim geht keine Liebe hervor«.
»Wie soll da ein Kind ein rechter Mensch werden, die verkümmern ja. Nein, nein, das möchte ich den Kindern von der Vroni nicht antun.«
Diese dankte es ihr mit dem Einsatz ihrer ganzen Arbeitskraft und Loyalität dem Hof und seinen Besitzern gegenüber. Gelegentlich sah ich, wenn mich der Weg am Stetterhof vorbeiführte, nach Vroni und ihren Kindern, die heranwuchsen, gut gediehen, und die von ihrer Illegalität und den widrigen Umständen um ihr Dasein nichts wussten. Noch nicht. Vroni achtete sehr auf meine Anweisungen und Ratschläge, die ich ihr in Bezug auf die Kinder gab; sie stellte mir Fragen, und ihr Wohlergehen lag ihr sehr am Herzen. Doch wenn es um Konstantin und sein verantwortungsloses Verhalten ging, blockte sie ab. Ich fand keinen Zugang zu ihrem Inneren. Es war ein Teufelskreis.
Noch einmal musste Vroni als uneheliche Mutter ihr inzwischen viertes Kind zur Welt bringen. Sie tat es wortlos und unter Tränen. »Es ist mein Schicksal«, meinte sie zu mir. »Ich kann ihm nicht entgehen, ich muss es annehmen, ob ich will oder nicht. «
Als ich auch diesen kleinen Buben auf den Stetterhof brachte, kamen mir doch Bedenken, ob er wohl auch noch ein Zuhause hier finden wird, so wie seine Geschwister, die hier frei, naturverbunden, ohne größeren Zwang leben und aufwachsen durften. Meine Zweifel beseitigte die Stetterbäuern, als sie auch dieses Kind in ihre Arme nahm und unter zärtlichen Worten in sein Bettchen legte. Eine großartige Frau und Mutter, die Nächstenliebe nicht nur kannte, sondern sie auch mit allen Konsequenzen lebte, so, als sei dies ganz selbstverständlich. Der kleine Robert aber schien nicht für diese Welt geschaffen. Ein lebensfrohes, gesundes Kind, so glaubte man, das seinen Geschwistern in nichts nachstand, fing nach einigen Jahren zu kränkeln an und weder Ärzte noch Heilpraktiker konnten hier helfen. Der kleine Robert starb. Vroni nahm stumm, mit versteinertem Gesicht, den Tod ihres Kindes wahr. Tränen hatte sie keine mehr. Diese Mutter hatte schon zu viel geweint.
Wieder vergingen Jahre. Die ersten grauen Strähnen zeigten sich in Vronis Haar. Waren sie Spuren ihrer verhängnisvollen, aussichtslosen Liebe, an der sie mit jeder Faser ihres Herzens hing? Sie gewährte niemandem Einblick in ihr Inneres und so trug sie das Los, das sie sich selber aufgebürdet hatte, allein, still, ohne zu murren. Sie wollte keine Hilfe, auch nicht von denen, die ihr nahe standen. Dann kam ihr das Schicksal auf eine andere, erfreuliche Weise zu Hilfe. Eine kleine Erbschaft und ihr Erspartes ermöglichten es ihr, ein Haus zu erwerben, das für sie und ihre Kinder später eine Heimat werden sollte. Die Buben waren inzwischen herangewachsen, die zwei größeren befanden sich in einer Lehre, während der jüngere noch zur Schule ging.
Die Stetterbäuerin freute sich mit Vroni über diese gute Wende, weil sie wusste, dass diese drei Kinder, die sie mit großgezogen hatte, ein ordentliches Zuhause erwartete. Einmal wird diese unglückselige Beziehung ihr Ende finden, sodass Vroni mit ihren Kindern in Frieden und frei von allen Zwängen leben kann, so glaubten und hofften alle, die Vroni und ihr Schicksal kannten. Doch für diese Frau gab es, wie es schien, kein dauerhaftes Glück. Verstrickt in diese unglückliche Liebe, die sie wie eine Art Virus befallen hatte, musste sie den bitteren Weg ihres Lebens zu Ende gehen.
Eine schicksalhafte Wende bahnte sich wieder einmal an An einem warmen, sonnigen Herbsttag, der die Natur noch einmal in allen Farben leuchten ließ, begegnete mir Vroni auf einem Wiesenweg, den sie mit müden Schritten entlangkam. Das warme Tuch, das sie um ihre Schultern gelegt hatte, hielt sie trotz der wärmenden Herbstsonne fest an sich gepresst. Sie fröstelte. Ich ging ihr entgegen, um ein paar Worte mit ihr zu wechseln und mich nach ihr und ihren Kindern zu erkundigen.
»Ja, die Buben sind gesund«, antwortete sie auf meine Frage, »in der Schule sind s’ auch gut mitgekommen, ich kann mit ihnen zufrieden sein.« Es folgte eine kurze Stille, bis sie weitersprach: »Meine Füße taugen nix mehr, mir ist grad so, als ob ich krank werden tät, da hab ich mir überlegt, dass ein Auto gar net so verkehrt wär, weil das Radfahren so beschwerlich wird für mich. Ja, und dann hab ich mir ein Auto gekauft. Ein rotes Auto hab ich jetzt. Den Führerschein hab ich ja schon lang, bloß ein Auto hab ich net gehabt.«
Ich sagte ihr, dass ich ihre Entscheidung prima fände, wo die Buben doch auch bald alt genug wären, um ein Auto steuern zu können.
Dies war mein letztes Gespräch mit Vroni.
Viele Male ging ich mit ihr den Kreuzweg, der ihr auferlegt war, tröstend, beratend mit und hielt ihr immer wieder die Aussichtslosigkeit ihrer unglücklichen Liebe vor Augen. Heute, nach langen Jahren, bedauere ich, dass es mir trotz aller Mühe nicht gelungen ist, zu ihrem Inneren Zugang zu finden. Sie trug ihr Schicksal allein; sie wollte niemandem ihre verletzte Seele zeigen. Sie wusste wohl um die Wertlosigkeit dieses Mannes, und doch kam sie von dieser verhängnisvollen Beziehung, die ihr Leben zerstörte, nicht los. Nun war Vroni stolze Besitzerin eines roten Autos, das ihr ihre Beschwerden erleichtern sollte.
Doch was ich von der Stetterbäuerin zu hören bekam, war kaum zu glauben. Nicht Vroni, sondern Konstantin war ständig mit dem Wagen unterwegs, den sie bezahlt hatte und der auf ihren Namen zugelassen war. Er verfügte über das Fahrzeug so, als sei es das seine, und Vroni fuhr mit ihren müden, kranken Beinen wieder mit dem Fahrrad.
Was zu dieser Zeit niemand wusste: Auch Vronis Haus ging in Konstantins Besitz über wie das rote Auto, das Vroni so sehr liebte. Es war alles notariell geregelt, abgeschlossen, ganz legal, durch Vronis Unterschrift hatte alles seine Richtigkeit. Das spätere Zuhause ihrer drei Buben, das sie mit ihren Ersparnissen und der Erbschaft gekauft hatte, nahm Konstantin in seinen Besitz. Die Hintergründe dieser Übergabe kannte niemand.
Vronis Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends. Krankenhausaufenthalte wurden in immer kürzeren Abständen notwendig. Andreas, den älteren Sohn, fragte ich nach dem Befinden seiner Mutter, und er gab mir zu Antwort: »Der Mama geht’s net gut, weil sie uns auf einmal nimmer schimpft.«
Konstantin nutzte Vronis Krankenhausaufenthalt auf seine Weise. Mit Papier und Kugelschreiber ausgerüstet kam er an ihr Krankenbett und forderte eine Vollmacht über ihr Konto. Und nicht nur das: Er drängte zu einer schriftlichen Erklärung, dass er im Falle ihres Todes als alleiniger Erbe eingesetzt sei.
Dazu kam es aber nicht, denn die Kranke war am Ende ihrer körperlichen Kräfte und nicht mehr in der Lage, eine Unterschrift zu leisten. Im Krankenhaus erkannte man sehr bald die Absicht dieses Mannes und man hatte ein Auge auf ihn.
Das Ende eines unglücklichen, verpfuschten Lebens nahte.
Konstantin muss wohl lange nachgedacht haben, um zu erkennen, dass er nur durch eine Heirat mit Vroni zu seinem Ziel, das er unbedingt erreichen wollte, kommen konnte. Der Sterbenden wollte er nun das geben, was er ihr zwanzig Jahre verweigert hatte, seinen Namen. Aber diese Überlegung war zum Scheitern verurteilt durch Vronis klare Antwort: »Nein, es ist zu spät, ich hab zu lange darauf gewartet.«
Doch Konstantin gab nicht auf. Er rückte ein zweites Mal an. Dieses Mal mit Blumen, die er ihr schenken wollte, um sie doch noch umzustimmen. Hatte er doch zwanzig Jahre alles erreicht, was er erreichen wollte. Es war ihm unverständlich, warum es nun Schranken für ihn geben sollte.
Doch dieses Mal war es wirklich zu spät Die Blumen bekam die tote Vroni, für die lebende hatte es keine Blumen gegeben. Die geplagte Frau war still und schmerzlos heimgegangen. Die Tragik ihres Lebens hatte ein Ende gefunden.
Vronis Leben war trotz aller Widerwärtigkeiten nicht umsonst gewesen. Ihre drei Buben sind gute, rechtschaffene Männer geworden, die in ihren Berufen recht erfolgreich sind. Ihre Mutter hatte ihnen keine nennenswerten materiellen Werte hinterlassen, diese hatte sie ihrer verhängnisvollen Liebe geopfert. Aber Fleiß, Anstand und Gerechtigkeitssinn hat sie ihnen als ihr Erbe mitgegeben. Wäre zu hoffen, dass sie nicht wie ihre Mutter einer zerstörerischen, verhängnisvollen Liebe verfallen werden.
Wo bleibt der Stammhalter?
Des Öfteren erlebte ich Ehemänner, die sich darüber ärgerten, statt dem erwünschten Sohn eine Tochter annehmen zu müssen. Häufig wurde die Frau für dieses Geschick verantwortlich gemacht. Obwohl man mit Beweisen nicht aufwarten konnte, blieb man der Einfachheit halber bei dieser Erklärung.
Die Leitl-Bäuerin, eine stille, verängstigte Frau, erwartete ihr fünftes Kind, zu dessen Geburt ich an einem späten Sommerabend gerufen wurde. Der Abend ging schon bald in die Nacht über, auf Wiesen und Feldern ist es nach einem langen Tagwerk still geworden.
»Gut, dass du da bist, heut ist alles anders als sonst«, begrüßte mich die Leitl-Bäuerin, »vielleicht kommt diesmal doch der Bub, allem Anschein nach. Mei, wär ich froh, mein Mann, der Bauer, du kennst ihn ja, den Dickkopf, hat sich schon beim ersten Dirndl aufgeregt und ein Theater gemacht, weil das Dirndl kein Bub war. Du hast ihn damals getröstet und gesagt, der Bub kommt schon noch. Mittlerweile haben wir jetzt vier Dirndln. Und jedes Mal der gleiche Ärger. Jetzt hoffen wir halt, dass dieses Mal der Bub kommt.«
Es war einelange Rede,gan zunge wohnt vonder Leitin, die sich immer bescheiden im Hintergrund hielt und nicht auffallen wollte. Eine bedrückte, gedemütigte Frau, die mehr Kummer als Freude kannte.
»Mir wär ein Dirndl grad so recht«, sprach sie weiter, »aber der Bauer, du weißt ja, wie die Männer sind.«
Das Geschlecht des Kindes schien für die Leitl-Bäuerin ein echtes Problem zu sein, immer wieder kam sie darauf zurück, ängstlich und hoffend. Wie sehr wird sie diese Sorge bis zur Geburt dieses Kindes geplagt haben!
Da ich bestimmte Komplikationen bei der Geburt dieses Kindes befürchset hatte, nahm ich die Leitl-Bäuerin mit in das Krankenhaus. »Bringt mir ja einen Buben heim!«, hörte ich den Leitl-Bauern ihr noch nachrufen.
Auch im Krankenhaus konnte man die dringende Frage der Leitlerin, ob Bub oder Mädchen, nicht beantworten, denn Ultraschall gab es damals noch nicht. Also musste man sich bis zur Geburt des Kindes gedulden. Nach langen, sehr schmerzhaften Wehen und mit ärztlicher Hilfe wurde das mit so viel Sorge erwartete Kind geboren. Aber nicht der ersehnte Hoferbe kam zum Leben, es war ein Mädchen, das den ersten Schrei tat und das nicht dem Wunsch der Eltern, vorwiegend dem des Vaters, entsprach.
Die Mutter weinte, als ich ihr das Kind in den Arm legte, das trotz der Anstrengung einen gesunden Eindruck machte. Sie nahm es liebevoll an sich, obwohl es nicht den Erwartungen entsprochen hatte. Diese Mutter liebte ihr Kind, wenn es auch nicht der Namensträger, der Hoferbe war, den der Vater so sehnlichst herbeiwünschte. Fürsorglich legte sie immer wieder den Arm um ihr kleines Mädchen, als wollte sie es schützen vor den vermutlich kommenden cholerischen Ausbrüchen des Vaters.
Am nächsten Morgen kam der Leitl-Bauer schon sehr früh mit einem Strauß Blumen in den Händen, um seinen Sohn zu sehen, wie er mir sagte.
»Es ist doch ein Bub?«, fragte er, schon ein wenig zweifelnd.
»Nein«, antwortete ich, »es ist ein gesundfes Mädchen, mit dem du dich abfinden musst.«
»Was, ein Dirndl«, schrie er, »das darf’s doch net geben!« Ich sah, wie seine Gesichtsfarbe sich veränderte, seine Augen verrieten Wut und höchste Empörung. Mit lautem Druck auf die Türklinke öffnete er das Zimmer der Wöchnerin, um sie zur Rechenschaft zu ziehen.
Ich folgte ihm, weil ich einen seiner Ausbrüche befürchtete und die Mutter in dieser Lage nicht allein lassen wollte.
»Das fünfte Weiberleut bringst du mir in’s Haus!«, schrie er, »eine Schand ist das! Kannst du nix als Dirndln auf d’Welt bringen, ha? Fünf Dirndln, nie ein Bub! Wenn ich das früher gewusst hätt, dich hätt ich nie geheiratet, nie!«, wiederholte er sich.
Die Leitl-Bäuerin zuckte bei diesen Worten zusammen, so als erwarte sie noch Schlimmeres. Ihre Augen waren voller Angst auf ihren Mann gerichtet, der alle guten Manieren vergessen hatte.
Doch plötzlich erinnerte er sich an die Blumen, die er immer noch in der Hand hielt, und dann geschah das Unglaubliche: Mit ein paar kräftigen Schlägen auf das Metallgestänge des Krankenbettes zerschlug er die roten Nelken, sodass er nur noch die kopflosen Stängel in seiner Hand hielt und die zerfetzten Blüten sich auf Bett und Fußboden verteilten. »Das fünfte Dirndl bringt mir die auf den Hof, das fünfte!«, wiederholte er schreiend.
Ich stand wie geschockt vor diesem Ausbruch. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Ich wollte diesen Mann, der wie von Sinnen war, gerade bitten, zu gehen, als die Leitl-Bäuerin sich aufrichtete und zu sprechen begann. In diesem Augenblick schien es, als sei ihr Selbstbewusstsein, das lange Jahre durch diesen Mann untergraben worden war, zurückgekehrt. Es war, als seien in dieser Frau und Mutter durch diese massive Demütigung und die Ablehnung ihres Kindes ganz neue Kräfte hervorgerufen worden. »Geh mir aus den Augen«, sagte sie gefährlich leise zu ihrem Mann. »Ich will dich nie mehr sehen. Zu dir auf den Leitl-Hof geh ich nimmer zurück. Ich verlasse dich und meine Kinder nehm ich mit. Das war dein letzter Auftritt, den du dir geleistet hast, und nun verschwinde!«
Der Leitl-Bauer stand da, mit offenem Mund und wie erstarrt. War das noch seine Bäuerin? Das hier war eine Rebellion, ein Aufstand gegen ihn, den Leitl-Bauern, von seiner eigenen Frau inszeniert, von ihr, die er nie für vollwertig gehalten hatte. Es war ihm anzusehen, dass er die Welt nicht mehr verstand.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht? Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Weitere E-Books von Rosalie Linner
Tagebuch einer Landhebamme
elSBN 978-3-475-54357-9 (epub)
Diese Aufzeichnungen von Rosalie Linner über die Jahre 1943 bis 1980 spiegeln das weite Spektrum der Arbeit einer Landhebamme wider: Von freudig erwarteten, aber auch von unerwünschten Kindern ist die Rede, von der Freude und den Nöten in den Familien. Als in seiner Art einmaliges Zeitund Alltagsdokument sowie als historisches Zeugnis eines ganzen Berufsstandes sind Frau Linners Aufzeichnungen gar nicht hoch genug einzuschätzen.
Rosalie Linner schildert beeindruckende Fälle und Begebenheiten und geht dabei auch auf heute sehr aktuelle Themen und Fragen ein, wie zum Beispiel Adoptionen, Vaterschaftsprozesse, behinderte Kinder, Gewalt gegen Frauen und Kindesmissbrauch. Den Leser erwartet ein spannender Bericht.
Meine besten Geschichten als Landhebamme
eISBN 978-3-475-54377-7 (epub)
Rosalie Linner war fast 40 Jahre als Hebamme in ländlichen Gebieten tätig und hat dabei 4000 Kindern auf die Welt geholfen. Eine solche Frau hat viel zu erzählen. Für die werdenden Mütter war sie nicht nur Geburtshelferin, sondern auch Seelentrösterin und oft genug Doktor-Ersatz. So musste sie nicht nur manche dramatische Geburt zu einem guten Ende bringen. Sie erhielt auch einen tiefen Einblick in die Sorgen und Freuden, Träume und Ängste ihrer Schützlinge. Sie wusste, ob ein Kind sehnsüchtig erwartet oder unerwünscht war, sie erfuhr von Eheproblemen, Reibereien innerhalb der Verwandtschaft und enttäuschter Liebe. Dieser Band vereint die besten Geschichten, die Rosalie Linner über ihr langes Berufsleben im Lauf der Jahre niedergeschrieben hat.
Meine Zeit als Landhebamme
eISBN 978-3-475-54531-3 (epub)
Rosalie Linner hat viel erlebt in der Zeit, da sie als Landhebamme insgesamt über 4000 Kindern ans Licht der Welt half. Eine Fülle von Geschichten, in denen Freud und Leid der Familien oft nah beieinander liegen, kennen viele bereits aus Bänden wie „Tagebuch einer Landhebamme“ oder „Als Landhebamme unterwegs“. Für dieses Buch hat sie wiederum in Erinnerungen und Aufzeichnungen die interessantesten Begegnungen mit Müttern und Schwiegermüttern, Vätern und Großvätern und vor allem mit den Kleinsten gefunden und für ihre zahlreichen Leser niedergeschrieben.
Landhebamme aus Leidenschaft
eISBN 978-3-475-54532-0 (epub)
Geschichten vom Land, Schicksale von Familien und Lebenswege von Kindern: Rosalie Linner hat viel gesehen in ihrem langen Berufsleben als Landhebamme. 4000 Geburten hat sie betreut und die unterschiedlichsten Menschen an einem Wendepunkt ihres Lebens kennen gelernt, wenn ein Kind zur Welt kam. Viele freudige und glückliche, aber auch traurige und rührende Erlebnisse weiß die Autorin zu berichten, und Freunde ihrer Bücher wissen, dass ihr stets das Wohl von Mutter und Kind über alles ging. Dafür hat sie sich ihr Leben lang mit aller Kraft und bewundernswertem Mut eingesetzt.
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com