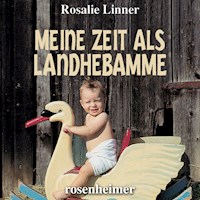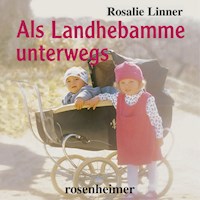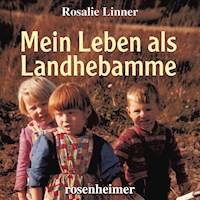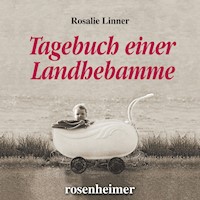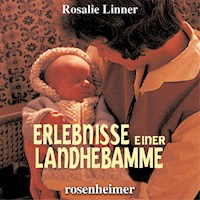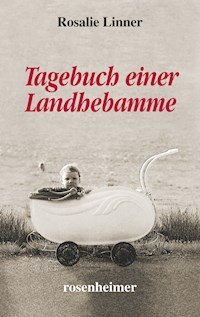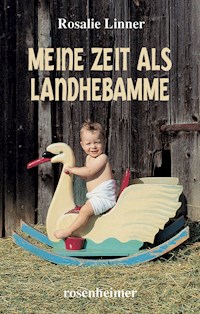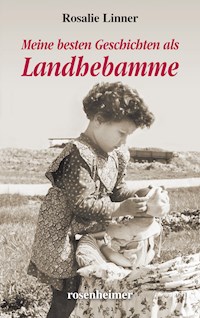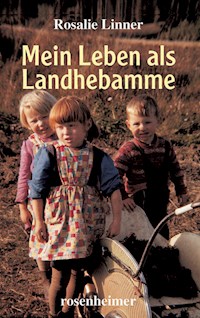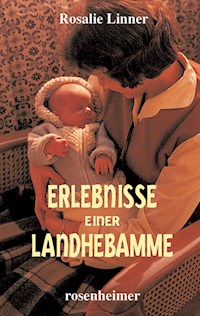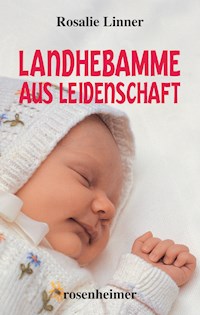
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Geschichten vom Land, Schicksale von Familien und Lebenswege von Kindern: Rosalie Linner hat viel gesehen in ihrem langen Berufsleben als Landhebamme. 4000 Geburten hat sie betreut und die unterschiedlichsten Menschen an einem Wendepunkt ihres Lebens kennen gelernt, wenn ein Kind zur Welt kam. Viele freudige und glückliche, aber auch traurige und rührende Erlebnisse weiß die Autorin zu berichten, und Freunde ihrer Bücher wissen, dass ihr stets das Wohl von Mutter und Kind über alles ging. Dafür hat sie sich ihr Leben lang mit aller Kraft und bewundernswertem Mut eingesetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2004
© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Titelfoto: Klaus G. Förg, Rosenheim Satz: Pro libris Verlagsdienstleistungen, Villingen-Schwenningen
Worum geht es im Buch?
Rosalie Linner
Landhebamme aus Leidenschaft
Geschichten vom Land, Schicksale von Familien und Lebenswege von Kindern: Rosalie Linner hat viel gesehen in ihrem langen Berufsleben als Landhebamme. 4000 Geburten hat sie betreut und die unterschiedlichsten Menschen an einem Wendepunkt ihres Lebens kennen gelernt, wenn ein Kind zur Welt kam. Viele freudige und glückliche, aber auch traurige und rührende Erlebnisse weiß die Autorin zu berichten, und Freunde ihrer Bücher wissen, dass ihr stets das Wohl von Mutter und Kind über alles ging. Dafür hat sie sich ihr Leben lang mit aller Kraft und bewundernswertem Mut eingesetzt.
Inhalt
Der ungeliebte Name
Ein Tag im Advent
Die Schnapstherapie
Unerfüllte Sehnsucht
Väter
Die Stimme des Blutes
Unter Polizeischutz
Verlorene Heimat
Mama, die Stallmagd
In Bedrängnis
Das Findelkind
Eine Frau sucht ihren Weg
Der Welt Undank
Die Selbstverwirklichung
Geburtsbeistand wider Willen
Flüchtlingsschicksal
Die ungewöhnliche Erbfolge
Rückblick
Der Wandel der Zeit
Wohin geht der Weg
Der ungeliebte Name
Es war ein typischer Februar mit Stürmen und Schneetreiben, mit Eis und Kälte. Erbarmungslos hatte man mit zugeschneiten Wegen und Straßen zu kämpfen, wenn man gezwungen war, sich diesem winterlichen Wetter zu stellen. Vorsorglich ließ ich mein Fahrzeug an der kleinen Kapelle, die im Schutz von zwei mächtigen Buchen stand, stehen, denn das letzte Stück Weges hinauf zur Anhöhe war hoffnungslos von Schnee zugeweht.
Schon von weitem beobachtete ich, wie Martin Gschwendtner, der Besitzer des bescheidenen Anwesens, sich plagte, den Weg zu seinem Haus frei zu halten.
»So ein Sauwetter, ein miserables«, schimpfte er, »die ganze Arbeit is umsonst, weil’s hinter einem gleich wieder zugweht is«, begrüßte er mich, als ich auf das Haus zukam.
Der Schneesturm verschluckte seine Worte, so dass die Verständigung hier draußen recht schwierig war. Doch er schien mich zu erwarten, denn der Gschwendtner hielt in seiner Arbeit inne, wischte sich den Schweiß vom Gesicht und kam auf mich zu. Mit einem festen Griff nach meiner Hebammentasche nahm er mir diese aus der Hand, was mir den mühsamen Weg zum Haus erleichtern sollte, und meinte dabei: »Die Mädi wart eh schon auf dich, und die Fanny, die meinige, aa. Meinst, dass alles gut geht?«
Sorge stand bei dieser Frage auf seinem Gesicht, wusste ich doch, wie sehr sein Herz an seiner Einzigen hing, die er seit ihrem ersten Lebenstag liebevoll »Mädi« nannte. Statt seine Frage zu beantworten, fragte ich zurück: »Nennst du sie immer noch Mädi?«
»Für mich wird sie die Mädi bleiben, solang i leb. Aber sie schimpft eh scho immer, weil s’ den Namen net mag.«
»Nun wird es aber bald Zeit, dass du dich auf ihren richtigen Namen besinnst, nachdem du Großvater wirst«, meinte ich. Unter dem Vordach des Hauses klopfte ich mir den Schnee von Kleidung und Schuhen und betrat die Stube. Wie lange war es her, dass ich Christl, der werdenden Mutter, zum Leben verholfen hatte! Wie doch die Zeit vergeht. Nun war die nächste Generation an der Reihe, um das Erbe der Vorfahren fortzusetzen. Doch hier, bei den Gschwendtners, gab es einen kleinen Schönheitsfehler. Denn die Christl musste als uneheliche Mutter ihr Kind gebären, weil Vater Gschwendtner den Vater des Kindes und eigentlich zukünftigen Schwiegersohn als seinen Nachfolger ablehnte. Er wollte ihn unter gar keinen Umständen anerkennen. Christl musste sich fügen, wenn es auch schmerzte, und damit zurechtkommen, dass ihr Kind als nicht legitim registriert werden würde. Diese Tatsache verbitterte auch Mutter Gschwendtner. Sie klagte ihren Mann an: »Dir mit deiner Sturheit habn wir es zu verdanken, dass des Kind jetzt als lediger Bankert auf d’Welt kommt. Nur du bist schuld an dieser Blamage.« Mit tiefer Verärgerung sprach sie diese Worte. Als ich entgegnete, von Blamage könnte gar keine Rede sein, wo doch der Georg ein rechtschaffener, liebenswerter junger Mann wäre und ein tüchtiger Fachmann in der Werkstatt seines Onkels noch dazu, bestätigten Mutter und Christl meine Aussage mit heftigem Kopfnicken.
Bis zur Geburt dieses Kindes hatten wir eine längere Wartezeit vor uns. Aus Angst und Sorge wegen dem kommenden Ereignis hatte man mich schon sehr früh geholt, und so konnte ich nicht nur in aller Ruhe die geburtshilflichen Vorbereitungen treffen, es war auch genug Zeit, die familiären Probleme anzuhören. Dabei waren meine Meinung und mein Rat als Außenstehende in dieser verzwickten Lage erwünscht und gefragt. »Warum magst du den Georg net?«, fragte ich den Gschwendtner. »A so halt«, war seine nichts sagende Antwort, die man entweder benutzte, wenn einem nichts Besseres einfiel, oder wenn man zu keiner Aussage bereit war. Nach kurzer Überlegung glaubte er dann doch die richtigen Worte gefunden zu haben. »I brauch einen Bauern auf dem Hof, verstehst mich, und wenn sich schon einer Georg nennt, statt Schorsch, wie sich’s ghört, dann reicht’s mir scho. I mag ihn net, den Autoflicker, den herglaufenen, der soll unser Mädi stehen lassen, den brauchen wir net, den net.« Es war inhaltsleeres, bedeutungsloses Geschwätz, was der Gschwendtner da vorbrachte, und seine Argumente waren keinesfalls zu akzeptieren.
Da meldete sich Christl zu Wort: »Geh, Vater, ich versteh dich net, ich mag den Georg und seinen Nam’ auch, weil er schön is, der Nam’, mein i, und du sollst net allaweil Mädi zu mir sagn.« Verärgert über die Zurechtweisung seiner Tochter antwortete der Gschwendtner etwas lauter, als es sonst seine Art war: »Soll des Kind vielleicht auch Georg heißen, weil dir der Nam’ aa so gfällt. So was Hochgschraubt’s, so was Damisch’s. I hab nix dagegen, wenn der Nam’ Georg auf dem Papier steht, aber sagn tut man Schorsch oder Schorschi oder, wenn er noch klein is, Schorscherl. Des sind angstammte Namen, aber Georg, naa, nia.« Die Mutter sah ihren Mann missmutig an, ließ das Strickzeug auf den Schoß fallen und sagte verärgert: »Wie ein Mensch bloß so hitzköpfig sein kann und dem Dirndl sei Lebn so schwer machen mag. Wegen nix und wieder nix.« Dabei wandte sie sich zu mir herüber und erwartete offenbar Bestätigung und Zustimmung. Ich musste Mutter Gschwendtners Worte unterstreichen und machte dies dem Vater deutlich: »Wenn der Name der einzige Grund für deine Ablehnung des jungen Mannes ist, dann ist das aber schwer zu verstehen. Oder hast du vielleicht andere Gründe, andere Argumente? Ist es die Angst um deine Tochter, die dir von diesem Mann weggenommen werden könnte, dass ihre Liebe dann erstrangig ihrem Mann und dem Kind gehört? Wenn ja, dann musst aber auch du dich mit diesem ewigen, naturgegebenen Gesetz abfinden, denn daran kann niemand etwas ändern.« Missmutig zurrte er an dem Weidengeflecht, um einen demolierten Futterkorb wieder brauchbar zu machen, den er gerade in Händen hielt.
Es vergingen Stunden um Stunden, und das Gerangel um den zukünftigen Vater des Kindes und Ehemann seiner Tochter, den der Gschwendtner nicht anerkennen wollte, obwohl es keinen vernünftigen Grund für sein starres Verhalten gab, war ein scheinbar unerschöpfliches Thema, das kein Ende nahm. Die Geburt machte Fortschritte, und so wurde über die leidige Sache bald immer weniger gesprochen.
Draußen tobte ein schauriger Schneesturm, der mit aller Gewalt an Türen und Fenstern rüttelte. Die Dämmerung kam, und der Gschwendtner wurde immer unruhiger. »Diesem Herglaufenen«, schimpfte er, »hat sie’s zu verdanken, die Mädi, dass sie so plagt wird. Dieser Mensch wird mir allaweil unsympathischer.« In seinem Mitleid um Mädi, seine Einzige, war dieser Mann wirklich zu bedauern. Angst und Sorge um sein Kind sowie Wut und Verärgerung über den Kindsvater, der seine Christl in diese schwierige Lage gebracht hatte, waren deutlich in seinem Gesicht zu lesen. »Mei, Dirndl«, rief er bekümmert aus, »wenn dir bloß zum helfen wär.« Dabei fiel sein verzweifelter Blick auf mich, doch ich war ebenfalls zum Warten gezwungen. »Geh, Vater, jammer net allaweil, freu dich halt auch über unser Kind«, sprach ihn die Christl hin und wieder an.
Ich empfahl schließlich dem überbesorgten werdenden Großvater, die Christl in Ruhe zu lassen, damit sie sich auf die kommenden Stunden konzentrieren und besinnen könne, denn seine Angst war bestimmt keine gute Hilfe für die bevorstehende Geburt. Die werdende Mutter wollte mit mir allein sein. Auch die Gegenwart und den gut gemeinten Zuspruch der Mutter wollte sie nun nicht mehr und schickte die beiden – wohl auch aus Sorge um die Eltern – hinaus. Oder gab es andere Gründe, die ich nicht kannte? Vermutlich hätte sie sich ihren Georg am Kreißbett gewünscht, hätte seine Hand und seinen Trost spüren wollen, doch diese Erleichterung gab es für sie nicht. Georg war in diesem Hause nicht erwünscht, und selbst wenn er vom Schwiegervater nicht abgelehnt worden wäre, so war es damals doch undenkbar, dass ein unehelicher Vater bei der Geburt seines Kindes anwesend war. Dies hätte nach dem Empfinden der Menschen gegen alle guten Sitten verstoßen, und die musste man auf jeden Fall wahren.
Die schweren Schritte des Vaters vor der Tür verschluckte der gewaltige Sturm, der um das Haus tobte. Christl spürte die Unruhe ihres Vaters, der sich wie ein Gefangener seiner selbst verhielt. Aber auch diese Stunden des zermürbenden Wartens gingen zu Ende, und Christl konzentrierte sich auf die letzten Wehen, die das Ende des Geburtsverlaufes ankündigten. Immer wieder suchte sie meine Hand, von der Stütze und Hilfe ausgehen sollte, vielleicht auch Trost in dieser Stunde.
»Ob jetzt, in diesem Moment, Georg an mich denkt?«, fragte mich die werdende Mutter. »Aber nein, er weiß ja gar nicht, was jetzt gerade geschieht.«
»Vielleicht weiß er es doch«, gab ich ihr zur Antwort. »Es wäre möglich, dass er spürt, dass sein Kind zur Welt kommt. Du denkst doch ganz intensiv an ihn, sonst würdest du nicht fragen.«
Christl nickte nur, sonst schwieg sie. Sie wollte mir ihre Gedanken, die um Georg, den Vater ihres Kindes, kreisten, nicht mitteilen.
»Es könnte auch sein«, sprach ich weiter, »dass er mich auf dem Weg zu dir gesehen hat und seine Schlüsse daraus gezogen hat. Ich bin ganz sicher, dass er an dich denkt.«
»Mei, wär des schön«, freute sich Christl. »Ach bitte, ich wär Ihnen so dankbar, wenn Sie den Georg verständigen würden, wenn der Bub da is und dass sie ihm sagen, dass er natürlich Georg heißen wird und net anders.«
»Mit diesem Namen wird es Schwierigkeiten geben«, gab ich zu bedenken, »aber warten wir ab.« Doch die Sorgen um den Namen des Kindes wurden gegenstandslos, als sich mit lautem Schrei ein gesundes Mädchen auf dem Gschwendtner-Hof zum Leben meldete. Die schweren Schritte vor der Tür waren plötzlich verstummt. Nur der ungeduldige Schrei des Kindes, das gegen die Kälte dieser Welt protestierte, war zu hören. Ein leises Klopfen an der Tür, und die Großeltern betraten die Stube. »Gott sei Dank!«, hörte ich als erstes Martin Gschwendtners Stimme. »Vergelts Gott ..., weil’s vorbei is, mei, bin i froh«, fügte die Großmutter hinzu und strich liebevoll über das Köpfchen des Kindes.
»Is er gsund, der Bub?«, wollte der junge Großvater wissen.
Das ist eine Frage, die vorrangig ist und immer als erste gestellt wird, weil sie für die meisten Menschen den höchsten Wert besitzt. Alles Weitere wird dadurch in den Hintergrund gedrängt. So war es auch bei Martin Gschwendtner, der ja mit Namen seine Probleme hatte, und doch erkundigte er sich endlich zögernd: »Und ... wie heißt er denn?« Es wurde ganz still im Raum, als erwarte man die Antwort auf eine der wichtigsten Fragen der Welt, als die junge Mutter antwortete: »Martina, weil’s a Dirndl is!«
»A Dirndl, ja so was«, hörte ich die beiden erstaunt und fast ungläubig ausrufen. Ein kurzer Moment des Nachdenkens folgte, dann kam die Stimme der Großmutter, die sich nun ihrem Mann zuwandte: »Ja, dann hat des Dirndl ja dein’ Nam’ ... Martina, hm, is des a Freud!« Ich sah, wie der Gschwendtner sich kurz abwendete, sich verstohlen über die Augen fuhr und dann mit lautem Geräusch die Nase putzte, um so die Peinlichkeit der Rührung zu überbrücken. Ein uneheliches Kind, das man im Allgemeinen abwertend als »lediger Bankert« bezeichnete, wurde hier mit viel Freude und sehr großer Liebe aufgenommen, und es sollte später der Sonnenschein seiner Familie sein.
Trotz der Februarstürme draußen war dies ein schöner Tag und auch für mich eine glückliche Erfahrung. Beide Großeltern bestaunten dieses kleine Menschenkind, das ihnen hier in die Wiege gelegt worden war und das sie ganz als das ihre betrachteten.
Es war zehn Uhr abends, als ich den Heimweg antrat. Wege und Stege waren wie vorher unauffindbar vom Schneesturm zugeweht, und mein Fahrzeug war hoffnungslos eingeschneit. Über den kürzeren Fußweg, der durch den Wald führte und wo ich wenigstens eine leichte Spur des einstigen Weges erkennen konnte, ging ich die paar Kilometer zu Fuß in den Ort zurück. Die Schmiede war noch beleuchtet und die angrenzende Autowerkstätte ebenfalls. Es herrschte, wie es schien, noch nächtlicher Betrieb, und Georg war vermutlich mit der notwendigen Reparatur eines Fahrzeuges beschäftigt. Die quietschende Werkstatttüre machte ihn auf den Besucher aufmerksam. Er kam, auf dem Boden liegend, ölverschmiert unter einem Auto hervorgekrochen.
»Am späten Abend bist du noch so fleißig?«, begrüßte ich ihn. Mein Erscheinen ließ ihn wohl ahnen, was ich zu sagen hatte. Mit offenem Mund starrte er mich an, abwartend, stumm und nicht fähig, auch nur ein Wort zu sagen.
»Hast du deine Sprache verloren?«, fragte ich ihn belustigt. »Ich habe eine gute Nachricht für dich.« Er schaute mich fragend an, immer noch ein wenig überrascht durch meinen Besuch.
»Die Christl«, kam dann seine Antwort. Ich nickte, und dann brachte ich ihm die Nachricht, die er längst und mit Sorge erwartet hatte.
»Es ist ein Mädchen, schön und gesund: Ich wünsche euch beiden Glück, Georg.«
Die Putzwolle, mit der er seine Hände schon die ganze Zeit bearbeitet hatte, fiel zu Boden, und nun kam die Erlösung: »Es is vorbei, mei, bin ich froh!« Lange Reden schätzte er nicht, der Georg. Doch diese wenigen Worte ließen einen kleinen Einblick in sein Inneres zu. Etwas hilflos stand er vor mir, seine Gedanken waren jetzt bei seiner Christl und dem kleinen Mädchen, das nun zu ihm gehörte, aber auch bei Vater Gschwendtner, der ihn nicht akzeptieren wollte und der den Namen Georg als Grund für sein Verhalten angab. Gleich darauf gab der junge Mann mir seine Not zu erkennen. »Wenn der Gschwendtner bloß net so stur und so schwierig wär, dann wären Christl und ich längst verheiratet, aber ohne Segen vom Vater, des mag man halt aa net.«
»Des Kind wird manches ändern, auch die Einstellung von Christls Vater, glaub mir, aus Erfahrung weiß ich das«, tröstete ich ihn.
»Er könnt mich auch Schorsch nennen, wenn ihm der Georg net gfällt. Daran darf’s doch net liegen. Es is scho ein Kreuz«, seufzte er.
Ich versuchte, ihm zu erklären, dass Martin Gschwendtner mit einer besonderen Liebe an seinem einzigen Kind hing, dass er es an keinen Mann verlieren wollte, mit dem er die Liebe seiner Tochter dann teilen müsste. Aus dieser Sicht könnte man sein Verhalten vielleicht ein wenig verstehen.
»Er mag halt seine Christl«, sagte ich.
»Aber ich mag sie auch!«, ereiferte sich der Georg. »Mich soll er auch verstehn, der Gschwendtner, auch wenn meine Lieb zu ihr a andere is als die seine.« Die konsequente und ungewöhnlich lange Rede des jungen Mannes überraschte mich. Sie zeigte aber auch, wie voll dieses Herz von Liebe und von Kummer war. Auf der Suche nach einem brauchbaren Ausweg aus dieser Lage kamen wir überein, dass mich Georg jetzt nach Hause bringen sollte und wir morgen gemeinsam auf den Gschwendtner-Hof fahren würden. Dieser Vorschlag war von meiner Seite auch nicht ganz selbstlos, denn Georg würde mein Vehikel wieder flott machen können, das mit Sicherheit eingefroren war. Es war klar, dass Georg im Vergleich mit mir der bessere Fahrzeuglenker war, der es trotz der widrigen Wetterverhältnisse mühelos schaffte, bis zur Haustüre des Gschwendtner-Hofes zu fahren. Ich war mir sicher, dass uns Christls Vater schon längst erspäht hatte, noch bevor Georg sein Auto parken konnte.
Mit verbissener Miene beschäftige er sich wieder mit seinem Weidenkorb, an dem er kraftvoll zerrte und zog, als wir eintraten. Es war nun an mir, die Initiative zu ergreifen, um in ein Gespräch zu kommen, das hoffentlich eine gute Wendung in die ganze Sache bringen sollte. »Heut schaust aber finster drein, Vater Gschwendtner«, sprach ich ihn an. Ich erzählte ihm, dass mich Georg hierher gebracht habe, weil mein Auto den gestrigen Schneesturm nicht überstanden habe. »Und seine kleine Martina, die möcht er halt auch sehen, und hat als Vater auch das Recht dazu, meine ich.«
»So, hat er das, aber ich sag nein, der hat kein Recht net da herin«, gab er zur Antwort, wobei er wiederum kräftig an den Weidespänen zog. Seine Wut war nicht zu übersehen.
Doch dann hörten wir die Stimme der Mutter: »Freilich steht ihm des Recht zu, des wär ja noch schöner, wenn er sein Kind net sehen dürft. Setz dich nieder«, wandte sie sich an Georg, »denn so is’s besser zum Reden.« Sie bot ihm Platz an, ohne ihn beim Namen zu nennen.
Während ich die junge Mutter versorgte und auf den Besuch vorbereitete, gab es nebenan vielleicht ein lebhaftes Gespräch, das eventuell hoffen ließ. Jedenfalls stellte ich mir das so vor. Doch es war nur ein Wunschgedanke meinerseits, denn der Vater Gschwendtner blieb bei seinem Nein. Ohne lange Fragen zu stellen, führte ich Georg zu Christl und seinem Kind.
Ein Aufleuchten ging über das Gesicht der jungen Mutter. Ich hatte wohl das Richtige getan und die beiden für eine kurze, kostbare Zeit glücklich gemacht. Ich schloss leise die Tür, und die beiden waren allein. Die Worte, die gesprochen wurden, gehörten nur ihnen.
Stille umgab uns, niemand wollte ein Gespräch, aber wenige Tage später kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall, der in dieser Familie andere Gewichtungen verursachte und die Wende brachte.
»Der Vater is zsammgfalln«, eröffnete mir die Mutter, als ich zu meiner Wochenbettpflege kam und ich die Weidenkörbe betrachtete, die unberührt in der Stubenecke lagen. »Der Arm geht nimmer so recht und der Binkel am Kopf (das Wort bedeutet »Beule«) tut ihm halt so weh, weil er auf den Beton aufgschlagn is. Es is schoo ein Kreuz.«
Ein wenig zusammengesunken saß er auf seinem Stuhl, der Gschwendtner-Bauer, der von gestern auf heut zu einem Häufchen Elend geworden war. »Was sagt denn der Arzt zu diesem Missgeschick?«, wollte ich wissen.
»I hab halt den Bader gholt, damit er den Arm verbindt, weil er so runterghängt is. Aber der hat halt gmeint, dass mein Mann a Schlagl gstreift hat.«
Dieser leichte Schlaganfall führte dazu, dass von diesem Tag an auf dem Gschwendtner-Hof alles anders wurde.
Auch dieser Winter mit seinen ungewöhnlich stürmischen Februartagen ging vorbei, und bald zeigte sich der Frühling von seiner schönsten Seite. Der Arzt kümmerte sich, so weit es möglich war, um die körperlichen Beschwerden seines Patienten, des Gschwendtner-Bauern. Seiner kranken Seele aber, an der er selbst am meisten litt, nahm sich der Pfarrer an, wenn er ihm einen Besuch abstattete und ihn belehrte, wie nahe er dem Jenseits gewesen sei. »Da sieht man’s wieder, Gschwendtner«, meinte er, »wie schnell es gehen kann mit einem. Der Weg in die Ewigkeit is oft gar net weit. Und jetzt sorg dafür, dass die beiden endlich heiraten, damit alles seine Ordnung hat und seine Richtigkeit. Du musst dei Dirndl frei lassen, du kannst es net für dich beanspruchen. Es is dir nur geliehen, von oben her, und es is nicht dein Besitz, des musst du bedenken. Und nun muss sie ihren eigenen Weg gehen, wenn’s auch für euch beide schmerzhaft is.« Und wer wollte den Worten des Herrn Hochwürden schon widersprechen? Auch der Gschwendtner tat es nicht.
Es war ein wunderschöner und herrlicher Maientag, als hätte ihn Gott in ganz besonderer Weise gesegnet, als Georg seine Christl zum Altar in die Kirche führte. »A schöns Paar«, hörte ich die Leute tuscheln, ›und ein glückliches‹, sagte ich in meinen Gedanken und freute mich, dass nach so viel Wirrnissen alles zu einem guten Ende gekommen war. Es wurde eine überaus glückliche Ehe der beiden.
Die Schmiede mit Autowerkstätte ging bald in Georgs Besitz über. Onkel Blasius wusste, dass er sein Lebenswerk in tüchtige und rührige Hände legte, als er mir von seinen Plänen berichtete. »Und der Theres, der Meinigen, Gott hab sie selig, is’s gwiss aa recht«, war seine feste Überzeugung.
Vater Gschwendtners labile Gesundheit und die damit verbundenen Beschwerden zwangen ihn, den landwirtschaftlichen Betrieb aufzugeben. Er tat dies mit Weh in seinem Herzen, dieser naturverbundene Mann, der außer der Liebe zu seiner Mädi nur die Liebe zu seiner Heimat, dem Gschwendtner-Hof, kannte. Die kleine Martina stapfte schon wacker in das zweite Lebensjahr und fand in ihrem Großvater ihre Bezugsperson, die immer mit Engelsgeduld zuhörte, erklärte, beschützte, auch als Christl ihr zweites Kind erwartete.
Die Krankheit hatte Vater Gschwendtner zum Guten verändert, er wurde nachdenklich. Der Name seines Schwiegersohnes kam nicht mehr zur Sprache, und Georg, sein zweites Enkelkind, umgab er wieder mit seiner uneingeschränkten Liebe. »Die Welt is halt anders worn«, sagte er einmal zu mir, »und besser gwiss net. Auch die Namen sind nimmer des, was sie mal waren.«
Sie wollen wissen, wie es weitergeht? Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Weitere E-Books von Rosalie Linner
Tagebuch einer Landhebamme
eISBN 978-3-475-54357-9 (epub)
Diese Aufzeichnungen von Rosalie Linner über die Jahre 1943 bis 1980 spiegeln das weite Spektrum der Arbeit einer Landhebamme wider: Von freudig erwarteten, aber auch von unerwünschten Kindern ist die Rede, von der Freude und den Nöten in den Familien. Als in seiner Art einmaliges Zeit- und Alltagsdokument sowie als historisches Zeugnis eines ganzen Berufsstandes sind Frau Linners Aufzeichnungen gar nicht hoch genug einzuschätzen.
Rosalie Linner schildert beeindruckende Fälle und Begebenheiten und geht dabei auch auf heute sehr aktuelle Themen und Fragen ein, wie zum Beispiel Adoptionen, Vaterschaftsprozesse, behinderte Kinder, Gewalt gegen Frauen und Kindesmissbrauch. Den Leser erwartet ein spannender Bericht.
Meine besten Geschichten als Landhebamme
eISBN 978-3-475-54377-7 (epub)
Rosalie Linner war fast 40 Jahre als Hebamme in ländlichen Gebieten tätig und hat dabei 4000 Kindern auf die Welt geholfen. Eine solche Frau hat viel zu erzählen. Für die werdenden Mütter war sie nicht nur Geburtshelferin, sondern auch Seelentrösterin und oft genug Doktor-Ersatz. So musste sie nicht nur manche dramatische Geburt zu einem guten Ende bringen. Sie erhielt auch einen tiefen Einblick in die Sorgen und Freuden, Träume und Ängste ihrer Schützlinge. Sie wusste, ob ein Kind sehnsüchtig erwartet oder unerwünscht war, sie erfuhr von Eheproblemen, Reibereien innerhalb der Verwandtschaft und enttäuschter Liebe. Dieser Band vereint die besten Geschichten, die Rosalie Linner über ihr langes Berufsleben im Lauf der Jahre niedergeschrieben hat.
Mein Leben als Landhebamme
eISBN 978-3-475-54530-6 (epub)
Rosalie Linner hat mit ihren beiden Büchern „Tagebuch einer Landhebamme“ und „Als Landhebamme unterwegs“ viele begeisterte Leserinnen und Leser gefunden.
Ihr drittes autobiografisches Werk enthält neue, bisher unveröffentlichte Texte über ihre Arbeit als Landhebamme. Die Autorin schildert darin nicht nur die Freuden und Leiden, sondern auch die Tücken, die ihr oft gar nicht einfacher Beruf mit sich brachte. Wir erfahren auch eine Menge über die Menschen, mit denen sie zu tun hatte, ebenso wie über die einfachen Lebensverhältnisse, über problematische und glückliche Ehen und natürlich über die vielen Kinder, denen Rosalie Linner zum Leben verhalf.
Meine Zeit als Landhebamme
eISBN 978-3-475-54531-3 (epub)
Rosalie Linner hat viel erlebt in der Zeit, da sie als Landhebamme insgesamt über 4000 Kindern ans Licht der Welt half. Eine Fülle von Geschichten, in denen Freud und Leid der Familien oft nah beieinander liegen, kennen viele bereits aus Bänden wie „Tagebuch einer Landhebamme“ oder „Als Landhebamme unterwegs“. Für dieses Buch hat sie wiederum in Erinnerungen und Aufzeichnungen die interessantesten Begegnungen mit Müttern und Schwiegermüttern, Vätern und Großvätern und vor allem mit den Kleinsten gefunden und für ihre zahlreichen Leser niedergeschrieben.
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com