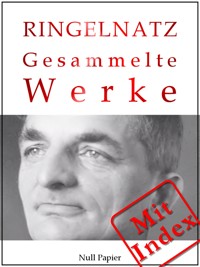Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eindrucksvoll, aber auf gewohnt humoristische Weise erzählt Joachim Ringelnatz in seiner Autobiographie Geschichten aus seinem bewegten Leben. Von der Kindheit über seine Zeit bei der Marine sowie seine schriftstellerischen Anfänge bis hin zum Ersten Weltkrieg berichtet der Autor über seinen Werdegang und seine persönlichen Erinnerungen. Dabei zeigt er sich wortgewandt, bildhaft und poetisch – ein echter Ringelnatz. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joachim Ringelnatz
Mein Leben bis zum Kriege
Saga
Mein Leben bis zum Kriege
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1931, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728015834
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Meiner Freundin Wanjka,
Frau Selma Des Coudres
Frühestes
Ein Dienstmädchen trug mich auf dem Arm oder führte mich an der Hand. Es war noch jemand dabei. Wir standen am Rande eines trostlos schlammfarbenen Wassers, das in die Strasse eingedrungen war und — wenn mein Kleinkindergehirn recht verstand — immer höher stieg. Und der Himmel war gewittergelb. So schlimm, so trostlos war das!
Das Dienstmädchen machte mich offenbar gern gruseln. Denn andermal zog sie mich auf einem Friedhof trotz meines weinenden und schreienden Protestes vor ein Kreuz, an das ein grosser, schreckeneinflössender, nackter Mann genagelt war.
Das ist meine am weitesten zurückreichende Erinnerung.
Von den Eltern oder Geschwistern erfuhr ich später kleine Geschichtchen. Man fand mich, der ich eben gehen gelernt hatte, auf dem Aussensims eines hohen Fensters stehend, und ich jubelte: „Sonne! Sonne!“ — Wenig später war ich einmal verschwunden. Der beste Freund meines Vaters brachte mich wieder. Er hatte mich mitten auf dem weit entlegenen Marktplatz angetroffen. Aber das wurde mir, wie gesagt, erst später berichtet. Ich kann es nicht nachprüfen und kann auch damit nichts für meine Selbstbetrachtung anfangen.
Von dem, worauf ich mich besinne, was ich noch weiss, zurückgedacht: Hat alles seine Frucht gebracht. So oder so.
An der Alten Elster
An der Stelle, wo wir wohnten, floss die Alte Elster zwischen zerklüfteten Anhängen trüb und ernst dahin. Unsere Strasse säumte ihr linkes Ufer und hiess danach „An der Alten Elster“.
Von unserem hohen Stockwerk aus hatten wir über den Fluss hinweg einen weiten Ausblick. Da waren — für uns Kinder unermessliche — blumige Wiesen. Ich sah über diesem Gelände einen Fallschirmabsprung aus einem Freiballon. Der Schirm entfaltete sich nicht. Aus den Gesprächen erwachsener Leute entrahm ich dann, dass der kühne Springer ein Bein gebrochen hätte. Hinter der Wiese parallel zum Fluss eine Chaussee mit gleichmässigen Bäumen. Um eine gewisse Stunde schritt dort eine lange Reihe von gleich aussehenden Bauersfrauen mit Tragkörben vorbei. Wie Tillergirls. Berta machte mich lachend darauf aufmerksam, dass diese Weiber plötzlich alle wie auf Kommando stillstanden und Pipi machten. Ich verstand Berta nicht ganz.
Noch weiter im Hintergrund lag die Sporthalle. Ich sah sie abbrennen. Berta hatte mich dazu geweckt.
An der Alten Elster spielte meine Kindheit, spielten drei Geschwister: Meine zwei Jahre ältere Schwester, mein vier Jahre älterer Bruder und ich. Die Altersunterschiede waren derzeit belanglos. Wir hatten unsere Freunde und Freundinnen. Auch das Geschlecht spielte keine Rolle. Es waren verwahrloste Armeleutekinder unter uns. Wir hatten auch Feinde und führten erbitterte und unbedacht gefährliche Schlachten mit ihnen. Die von der Fregestrasse waren besonders rohes Pack.
Abgesehen von den allgemeinen, überlieferten Kinderspielen unternahmen wir, was Grossstadtkindern nach gegebenen dürftigen Gelegenheiten einfällt. Ein Lastwagen — ohne Pferde, ohne Kutscher — wurde erklettert. Eins von uns machte sich an der Bremse zu schaffen. Wie schrien wir, als der Wagen plötzlich ins Rollen geriet! Ein schimpfender Riese brachte ihn endlich zum Stehen.
Beim Soldatenspiel trugen die Ruhmreichsten von uns schwere Metallschilde, geflochten aus den Blechstreifen vom Abfall einer Blechfabrik. Wir kamen mit Beulen, Blut und Teerflecken bedeckt nach Hause und wurden bestraft oder gescholten. Gescholten auch dann zum Beispiel, als Ottilie und ich eines Tages der Mutter freudestrahlend ein totes Huhn brachten, ein Strandgut, das wir mit Aufregung und Lebensgefahr aus dem Wasser geborgen hatten. Mit Ottilie hatte ich eine Geheimsprache: Die Mongseberrongsprache. Mongseberrong hiess bei uns Stachelbeere. Was wir aber weiter in dieser Sprache redeten, war purer, unverständlicher Quatsch und wurde nur vor anderen Kindern gequasselt, um uns als Ausländer sächsisch wichtig zu tun. — Wir drangen in fremde Hausflure ein, durchstreiften forschend wunderreiche Kellergänge. Weil uns niemand so ernst nahm, um einzuschreiten, stolperte meine Schwester in der Düsterheit und fiel in einen Korb mit Harzer Käse. — Wir fanden ausgespuckte Pflaumenkerne im Hof, knackten sie mit unseren Stiefelabsätzen auf und assen die blausäurigen Kerne. Unsere empfindlichen Eltern verübelten uns diesen Sport. — Bei manchen Spielen gebrauchten wir Metallstücke, Tonkugeln, Holzpflöckchen und anderes. Aber fremdartiges Material reizte unsere Neugier am meisten. — Wir kamen zu spät, mit bösem Gewissen, nach irgend etwas abscheulich stinkend, heim ins Elterngericht.
Für mich war der grösste Eindruck der Fluss mit seiner Uferromantik. Zwischen den Löchern und dem wirren Gestrüpp der steilen Abhänge kletternd, kämpfend, forschend, erlebte ich die Abenteuer meiner Sehnsucht voraus. Der Fluss trug seltsame Gegenstände vorbei. Am andern Ufer war eine Pferdeschwemme. Es war ein spannendes Schauspiel, wenn dort Rosse ins Wasser geritten oder geführt wurden. Einmal, zweimal trieben dort Leichen an. Noch unheimlicher waren die hohen alten Pappeln an unserem Ufer. Die hohen Pappeln mit ihrem zitternden und schillernden Blättermillionen-Gewoge. Im Sturme neigten sie sich so beängstigend tief hin und her, als drohten sie, jeden Moment auf uns hereinzubrechen. Sie rauschten unsagbar unheimlich in meine einsame Kinderphantasie.
Wenn der kleine, verwachsene Brotmann zu meinen Eltern kam, erhielt er von uns die angesammelten Knochenreste für den mageren Hund, der sein Wägelchen ziehen half. Vom Fenster aus sahen wir dann zu, wie das Brotmännchen sich auf das Holzgeländer unter die Pappeln setzte und die für seinen Hund bestimmten Knochen erst selber noch einmal gründlich abnagte.
Wo die Pappelallee endete, stand hinter einem verstachelten Zaun zwischen wucherndem Unkraut ein fahles, totes Haus. Unter uns Kindern war die Überzeugung verbreitet, dass dort Jack hauste. Der berüchtigte Jack, von dem wir sangen:
Seht einmal, dort sitzt er,
Jack, der Bauchaufschlitzer.
Holte sich ein Weibchen,
Schnitt ihm auf das Leibchen,
Holt sich Lung’ und Leber raus,
Machte sich ein Frühstück draus.
Ich habe ein Ölbild gemalt, dem ich den Titel „Am Fluss“ gab. Und mein Rowohlt-Buch „Flugzeuggedanken“ enthält ein Gedicht: „An der Alten Elster“:
Wenn die Pappeln an dem Uferhange
Schrecklich sich im Sturme bogen,
Hu, wie war mir kleinem Kinde bange! —
Drohend gelb ist unten Fluss gezogen.
Jenseits, an der Pferdeschwemme,
Zog einmal ein Mann mit einer Stange
Eine Leiche an das Land.
Meine Butterbemme
Biss ein Hund mir aus der Hand. —
O wie war mir bange,
Als der grosse Hund plötzlich neben mir stand!
Längs des steilen Abhangs waren
Büsche, Höhlen, Übergangsgefahren. —
Dumme abenteuerliche Spiele liessen
Mich nach niemand anvertrauten Träumen
Allzuoft und allzulange
Schulzeit, Gunst und Förderndes versäumen. —
Hulewind beugte die Pappelriesen.
O wie war mir bange!
Pappeln, Hang und Fluss, wo dieses Kind
Soviel heimlichstes Erleben hatte,
Sind nicht mehr. Mir spiegelt dort der glatte
Asphalt Wolken, wie sie heute sind.
Beide Arbeiten entstanden 1929, beide entkeimt aus den Erinnerungen an meine Kindheit an der Alten Elster, sechsunddreissig Jahre und länger zurück.
Unsere Spiele daheim
Man liess uns viel ohne Aufsicht im Freien. Gott weiss, wo ich mich umhertrieb. Aber ich kam weit herum und sammelte verwundert Kleine Erfahrungen.
Wenn aber das Wetter oder ein Machtwort der Eltern uns zwang, zu Hause zu bleiben, dann waren wir schön selbständig genug, uns miteinander oder einzeln zu beschäftigen. Es gab glücklicherweise damals in solchen Bürgerkreisen noch nicht viel und nicht so vollkommenes Kinderspielzeug wie heute. Das wenige, was der Weihnachtsmann vereint mit Grossmama und einem wohlhabenden Onkel uns brachten — etwa ein Tivoli-Spiel, eine Gliederpuppe oder ein Brummkreisel aus Blech — das ging heiter schnell entzwei. Erst das Experimentieren mit den Trümmern schuf wahres, weil schöpferisches Vergnügen. Das Wrack des Tivoli-Spieles fuhr noch herrlich in der Badewanne zur See. Die Gliederpuppe (das ist jetzt pure Lüge von mir, aber es hätte so sein können), also die Gliederpuppe wurde, weil das meiste das von abhanden gekommen war, immer wieder von neuem begraben; mit Zeremonien, die nicht auf Erlebnis basieren konnten. Begräbnisspiel.
Und in dem Kreisel (das ist nun wieder wirklich wahr), in dem Kreisel, den ich neugierig und mit grosser Anstrengung oben geöffnet hatte, und der seitdem nicht mehr brummte, kochte ich über einem Spiritusflämmchen: — Petroleum. Wollte wissen, was daraus entstünde. In mir steckte ein alchimistisches Genie, vielleicht von einer weitverzweigten Verwandtschaft mit dem Porzellanmacher Böttger her. Der Kreisel erhitzte sich. Ich war im Begriff — — Leider kam meine Mutter hinzu, sah, dass ich dieses chemische Experiment auf dem Fensterbrett unter schön gebauschten Tüllgardinen vornahm. Und verdarb mir die ganze überraschung.
Meine Bleisoldaten liebte ich heiss. Besonders die schlichten und die im Kampfe beschädigten, nie die prunkvollen. In den grossen Schlachten, die ich aufstellte und aufführte, war ich ernsthaft darauf bedacht, gerecht zu entscheiden. Ich stellte die Parteien im Handgemenge durcheinander. Leicht explodierende Bomben (gebogene Korsettstäbchen aus Fischbein, mit einem Fädchen haardünn gesichert) verteilte ich unter sie, und dann warf ich meine Geschosse (Stanniolkapseln) blindlings von weitem hinein. Derart gerecht war auch eine Kampfübung, in der ich mich persönlich einsetzte. Auf meinem Spieltisch türmte ich hoch und kipplig mehrere Stühle übereinander. Dann stürmte ich mit geschlossenen Augen, wild um mich schlagend und aufheulend, in diesen gefährlichen Aufbau hinein, der über mir zusammenbrach. Aus diesem Feld der Ehre ging ich zwar stets als Sieger hervor, aber ich war stolz, wenn ich eine Beule oder gar eine Schramme davontrug. Und ich wusste, dass ich zum Beispiel mir ein Auge hätte einstossen können. Ich schien zum Kriegsmann geboren.
Wie harmlos dagegen waren die Spiele mit Ottilie.
„Klavierstunde.“ Das Klavier war die abgeräumte Marmorplatte eines Waschtisches. Darauf hämmerten wir vierhändig mit unseren Fingern und schmetterten Melodien dazu. Aber das war nur Nebensache. Das Wichtige dabei war die Treppe, die zum Waschtisch führte: Alle Stühle, Zisch, Bank, Fussbänkchen in geschwungener Linie dahinführend aufgestellt. Diesen Weg zu beschreiten, war etwas, was uns ergötzte. Warum wohl? Wo lag der Schlüssel zu dieser verrückten Idee?
Ganz durchsichtig dagegen folgendes, oft stundenlang wiederholtes Spiel:
Ottilie kauerte unter dem kleinen Tisch. Ich ging auf dem Tisch mit lauten Trampelschritten hin und her. Ottilie klopfte an.
Ich: „Herein!“
Ottilie krabbelte unterm Tisch hervor: „Guten Tag, Herr Müller!“
Ich: „Guten Tag, Frau Meier!“
Ottilie: „Verzeihen Sie, ich muss mich beschweren über den furchtbaren Lärm.“
Ich: „Verzeihen Sie, es soll nicht wieder vorkommen.“
Das Spiel war aus, begann abermals, nur dass Ottilie jetzt auf der Tischplatte wohnte und ich darunter.
Künstlerische Sachen begannen. Ich malte Bildchen, ich dichtete Verschen und Prosa. Schliesslich ein ganzes, illustriertes Büchlein zum Geburtstag meines Vaters.
Wir stellten nach Guckkastenerfahrung ein Panorama zusammen. Die Petroleumlampe durchleuchtete einen Hintergrund, auf den ich eine schöne Polarlandschaft gemalt hatte. Rosa, grün. Davor stand plastisch auf blauem Papier-Eis und Watteschnee ein kleiner Holzschlitten, der aus Holzstäbchen und Bindfaden angefertigt war. Ottilie arrangierte den Zuschauerraum, holte die Eltern als Publikum herbei und überreichte die Eintrittskarten. Dann klingelte sie und zog den Vorhang auf.
Meine Eltern sprachen sich sehr anerkennend aus, und Vater schenkte uns ein paar Pfennige für Kirschen.
Solche und ähnliche Theatervorstellungen gaben wir nun öfters. Da wir uns aber immer weniger Mühe dabei gaben, weil es uns nur mehr auf Vaters Kirschengeld ankam, so erklärte Papa eines Tages mit einer ironischen Bemerkung diesen Erwerbszweig ein für allemal für erloschen.
Wir verfielen auf ein ehrlicheres, wenn auch mühevolleres Unternehmen. Unser Fussboden bestand aus gestrichenen Bohlen. Mit der Zeit waren zwischen den Bohlen Ritzen entstanden, in die sich Staub und Kleindreck verlor. Nun lagen wir drei Geschwister der Länge nach auf dem Bauche und kratzten und schnippsten mit Stricknadeln aus den Ritzen heraus, was da seit Jahren sich angesammelt hatte. Knöpfe, Stecknadeln, Nähnadeln, Haarnadeln, aufregend ein Pfennig, Perlen, hurra ein Groschen, vor allem aber viel wolliger und stäubender Schmutz.
Es regte sich bei mir auch eine gewisse Neigung für Mystisches. Ich tat vor meinen Geschwistern geheimnisvoll mit einer Art von Hausgeist. Dieser Geist war äusserlich in einem Holzknauf auf einem bestimmten Pfosten meines Bettes verkörpert, und er hiess Pinko. Was es für eine innere Bewandtnis mit ihm hatte, verriet ich nie. Ich verrate es auch jetzt nicht.
Unsere Dienstmädchen
Vermutlich hingen unsere Dienstmädchen nicht sonderlich an uns Kindern, wenigstens nicht an mir. Wir waren wild und unordentlich. Meine Ungezogenheiten, mein Trotz und meine Hosen gaben den Dienstboten allzu häufig Anlass zu Klagen.
Apropos Hosen. Ich war so weit gediehen, dass meine Geschicklichkeit und mein Schamgefühl es ablehnten, mir noch ferner die Hosenklappe von Fanny schliessen zu lassen. Aber der Besuch des Klo’s ohne sie war für mich etwas Schreckliches. Denn ich glaubte an böse Geister, und gerade in der Einsamkeit jener schmalen, düsteren Zelle empfand ich peinigende Furcht. Während meines eiligen Aufenthaltes dort suchte ich das unsichtbare Gespenst durch verlogen freundliche Worte oder Gedanken zu beschwichtigen. In dem Moment aber, da ich das Lokal verlassen und die Sicherheit des Korridors erreicht hatte, schmetterte ich die Tür hinter mir zu und rief dem bösen Geist noch ein höhnisches Schimpfwort nach. Immer das gleiche: „Dumm bist du!“
Das fiel meinen Eltern mit der Zeit auf. Sie lockten die Bewandtnis aus mir heraus. Das Klosett hiess von da an bei uns der „Dummbiste“.
Tante Kunze hatte wieder, wie alljährlich, zum Nikolaus drei Wachsstöcke und drei Pfefferkuchen für uns drei Kinder gesandt. In der Nacht wachte ich auf und sah ein Gespenst.
„Ottilie!“ rief ich leise und entsetzt. „Siehst du das Gespenst?“
Ottilie antwortete nicht. Aber ich sah das Gespenst deutlich trotz der Dunkelheit. Es war weiss und wallte nach rechts und dann nach links und dann in der Richtung nach Ottiliens Bett. Ich schloss die Augen vor Angst. Als ich sie wieder öffnete, war die böse Erscheinung verschwunden.
„Ottilie“, rief ich nun lauter, „hast du das Gespenst gesehen?“
Ottilie sagte nach einiger Zeit flüsternd: „Ja! Ich habe Angst. Sei ganz still!“
Am nächsten Morgen fehlte auf meinem Teller der Pfefferkuchen von Tante Kunze.
Tür zuschmettern! — Ich war wirklich ein besonders trotziger Junge, zumal meiner Mutter gegenüber, vielleicht weil die auch solch harten Kopf besass. Hatte ich mich über sie geärgert, weil sie einen Ärger über mich ausgelassen hatte, so ging ich plötzlich aus dem Zimmer und schmetterte die Tür hinter mir zu. Ich hörte die kleine nervöse Person bei dem Knall aufschreien. Ich wusste: Jetzt kommt sie. Ich wartete auf dem Gang. Sie stürzte heraus, griff nach Vaters resolutem Ziegenhainer und schlug damit wütend hinten auf mich ein. Ich stand steif, stolz, unbeweglich still, wie ein Indianer aus dem herrlichen Lederstrumpf. Bis Mutter von mir abliess. Ich glaube, sie lächelte, denn sie hatte wohl etwas Sinn für Humor oder mindestens für Komik. Heute fahre ich selber aus der Haut, wenn ich Türen schmettern höre.
Einen gleichen passiven männlichen Sieg glaubte ich davonzutragen, wenn ich nach einem Gekränktsein mittags schweigsam zwar Suppe und Fleischgericht mitass, aber dann, als das Dessert aufgetischt wurde, mich erhob und, auf diesen leckersten Teil des Menüs verzichtend, die Stube verliess. Meine Eltern reagierten darauf sehr vernünftig, sie lachten nur.
Anna sang, wenn meine Eltern abwesend waren, ganz hingegeben. Sie sang so laut, dass im oberen und unteren Stockwerk geklopft wurde. Sie sang nach der Melodie „Seht ihr drei Rosse vor dem Wagen“ ein Lied mit dem ergreifenden Refrain:
Ich will mein Haupt auf Schienen legen,
Dieweil der Zug von Breslau kam.
Eins von unseren Mädchen war mit einem Droschkenkutscher verlobt. Als dieser einmal mit seiner Braut und einer Innungsgesellschaft einen Ausflug unternahm, erhielt ich die Erlaubnis mitzureisen.
Ich werde in meinen Schilderungen nicht korrekt chronologisch bleiben können, sondern manchmal vorgreifen oder zurückgreifen. Aber diese Fahrt von etwa 15 Droschken, besetzt mit Droschkenkutscherbräuten, muss weit zurückliegen. Das Dienstmädchen hatte mich wohl mitgenommen, um meinen Eltern eine Gefälligkeit zu erweisen, denn die waren für damalige Zeit immer herzlich und verständnisvoll dem Personal gegenüber. Bei der Droschkenfahrt war ich blödes Kind wahrscheinlich der frei vergnügten, primitiven Gesellschaft etwas im Wege. Mir klingt von dieser Partie noch eine Bemerkung nach, ungefähr so: „Gebt dem Bengel recht viel Kuchen zu fressen, der ist Feines gewöhnt.“ — Das stimmte gar nicht einmal. Wir kriegten alltags zum Kaffee keine Butter aufs Brot.
Man hielt uns an, im Haushalt und sonstens mitzuhelfen. Ich durfte sogar manchmal im Atelier meines Vaters mittun. Papa war damals Musterzeichner. Er entwarf Muster zu Tapeten. Und er hatte zwei Gehilfen. Er hätte damals mehr haben können, denn es war seine Glanzzeit. Aber er war nicht der Mann, das pekuniär auszuwerten. Wir hatten damals sogar zwei Dienstmädchen.
Die Gehilfen waren über das Selbstverständliche der Situation hinaus sehr lieb zu mir. Einer liess mich stets auf seinen Schultern reiten, wenn er vom Atelier über den Hof nach unsrer Wohnung ging. Er erlaubte mir auch, mich vor seiner Staffelei bäuchlings auf einen Drehstuhl zu legen. Ich spielte dann Karussell, indem ich mich so im Kreise drehen liess.
Sehr geehrt fühlte ich mich, wenn ich die Linien eines auf Pauspapier gezeichneten Musters mit Stecknadeln nachstechen durfte. Zu Küchenarbeiten brachte uns Mutter, indem sie an unseren Ehrgeiz appellierte oder uns als Belohnung Topfschleckereien verhiess. Sie war eine hervorragend gute Köchin, die nicht nur ihre heimatliche, ostpreussische Küche beherrschte. Wir halfen in der Küche begeistert. Wir kauften ein. Wir wiegten Petersilie. Wir wuschen auf, trockneten ab. Wir putzten, schabten, schuppten, schälten, weinten über geriebenen Zwiebeln, schnitten und in den Daumen und lernten allerhand. Ob wir dabei die Dienstmädchen entlasteten oder ihnen hinderlich waren, weiss ich nicht.
Ich weiss vieles nicht mehr. Es scheint mir ein Glück zu sein, wenn man vieles vergisst. Denn sonst würde man vor Erlebtem nichts Neues mehr erleben.
Berta war ein schönes, sehr energisches Mädchen. Ich glaube, ihretwegen gab es zwischen meinen Eltern eine Zeitlang heftige Auseinandersetzungen. Die wurden zwar im Nebenzimmer geführt. Aber wir hörten aus dem Unverständlichen doch das Wesentliche Heraus und waren über dieses, wenn auch nur kurze Zerwürfnis zwischen Vater und Mutter sehr unglücklich. Ich besinne mich, dass ich dazukam, als meine Mutter sich aus dem Fenster stürzen wollte, und dass ich aufschluchzend ihre Füsse umklammerte.
Berta wurde entlassen. Später machte sie sich als Löwenbändigerin einen grossen Namen. Der Höhepunkt ihrer Schaunummer war, wenn sie ihren Kopf in den Rachen eines Löwen hielt. Dabei soll sie eines Tages umgekommen sein. Cläre Heliot nannte sie sich als Artistin. Sie oder ein anderes robustes Dienstmädchen war es, der ich einmal, als meine Eltern nicht daheim waren, plötzlich an die Beine griff. Meine Männlichkeit war erwacht und brachte mir sofort eine schallende Ohrfeige ein.
Des Jahres Feste
Aber das ist ja überall nahezu das gleiche. Zum Geburtstag wurde man beschenkt und genoss besondere Nachsicht, besondere Aufmerksamkeiten.
Ostern legte der Osterhase, legten später Eltern, Tanten und Grossmama Eier in immer grösseren Formaten.
Pfingsten spielte keine sonderliche Rolle, da mein Vater ein Mann in freiem Beruf war.
Der Weihnachtsbescherung gingen besondere intime, überlieferte oder eingeführte Gebräuche, Scherzchen und Sentimentalitäten voraus, und ebensolche familiär geheiligte Bräuche folgten. Es liegt mir fern, mich darüber lustig zu machen. Ich will nur hier auf das in allen Variationen so oft geschilderte Thema nicht weiter eingehen. Weihnachten war auch uns Kindern in jedem Jahr das Fest der Seligkeit, der Herzlichkeit, der Anhänglichkeit, des Reichtums, des Glücks.
Und zu Silvester kriegten wir Pfannkuchen, durften Punsch trinken und um Mitternacht leicht angeheitert am offenen Fenster lauschen. Draussen, drunten läuteten die Glocken, rief man „Prost Neujahr“, knallte Feuerwerk. Auch wir durften einmal mutig, als wär’s was, aus dem Fenster brüllen: „Prost Neujahr!“
In der Volksschule
Wenn ich träume, dann immer Schlimmes, das heisst Beängstigendes, Quälendes. Trostlos und hilflos erlebe ich in dem Zustand unlogische, peinvolle Situationen. Meistens leide ich darin als Soldat unter Vorgesetzten oder als Schüler unter Lehrern.
Mein erster Schultag — in der Vierten Bürgerschule in Leipzig — war durch eine übliche grosse Zuckertüte versüsst. Der zählt also nicht mit.
Ich lernte das Abc und „Summ summ summ, Bienchen summ herum“ und anderes Fundamentale. Aber ich lernte gewiss nicht leicht. Denn bald bekam ich Nachhilfestunden bei einem Lehrer, dem ich im Vorzimmer gebogene Stecknadeln ins Ledersofa einbohrte. Allerdings mehr, um einem zweiten Nachhilfebedürftigen zu imponieren, als um den Lehrer zu schädigen.
Wie abscheulich fasst sich Kreide an! Wie hässlich nimmt sie sich, trocken verwischt, auf einem schwarzen Brett aus. Wie stechend empörend kann ein Schieferstift auf einer Schiefertafel quietschen.
Aber ein Schwamm ist schön. Wenn er nass, richtig nass ist. Und noch schöner ist eine dunkle Schwammdose aus poliertem Holz, zumal sie sich zu hundert nicht aufoktroyierten Spielereien verwenden lässt. Wundersam sind alte, abgenutzte Schulpulte. Ihre Maserung, ihre Tintenflecke und Astlöcher gaben mir die erste, vielleicht einschneidendste Anregung zu meinen Malerei betreffenden Wünschen. Imposant ist ein neuer Schulranzen aus Seehundsfell. Dass die, die sich an ihn gewöhnen und ihn gar tragen müssen, seine Vorzüge allmählich vergessen und ihn gelegentlich ohne Bedenken als Wurfgeschoss benutzen, das bestätigt ein natürliches Gesetz.
Schwer ist das Einleben in Pünktlichkeit. Bedrückend ist jede ungütige, unbegriffene Überlegenheit. Und hässlich, niederträchtig ist ein Rohrstock, wenn er sadistisch einwillig oder kleinhirnig jähzornig als Strafmittel gebraucht wird. Uns schlug man damals in gewissen Fällen mit dem Lineal auf die spitz hinzuhaltenden Fingernägel. Tat schauderhaft weh.
Beneidenswert, nie wiederkommend ist der rechenkunstlose, schnell vergessende, unbesonnen zugreifende, freinaschende Taumel unserer jüngsten Gehzeit und Lernzeit.
Schon in der Bürgerschule wurden wir Kleinen in Klassen-, Rassen- und Massenkämpfe verwickelt. Schulen fochten gegen Schulen. Kinder einer Gegend schlugen sich mit solchen einer andern Gegend.
Einmal raste ich, von einer Überzahl roher, steinewerfender Feinde verfolgt, atemlos durch die Waldstrasse. Ich prallte dabei gegen einen Erwachsenen, der dort mit einem anderen Herrn im Gespräch stand, mich nun erschreckt auffing und gleich erkannte. Es war ein Lehrer, nicht meiner, aber an meiner Schule. Ausserdem schriftstellerte er, wie ich von meinem Vater mit Interesse vernommen hatte. Als ich befragt von meiner Flucht und meinen Verfolgern erzählte, streichelte er mich und sagte etwas zu seinem Bekannten, worin die Worte vorkamen „Da läuft solch Kind wie ein gehetztes Reh“.
Gymnasium
Ich kam auf das Königliche Staatsgymnasium, wo mein Bruder bereits eine höhere Klasse besuchte. Nicht lange hielt die Freude über eine grüne Mütze mit silberner Litze an. Das grosse, ernste Schulgebäude und der finstere Rektor im zerknitterten Frack flössten mir gleicherweise Schrecken ein. Nun brach das grausige Latein über mich herein; und andere Fächer, vorgetragen, eingepaukt und abgefragt von respektfordernden Dunkelmenschen, vor denen mein Herz sich von Anfang an verschloss. Der einzige interessante Mann schien mir der Turnlehrer Dr. Gasch. Weil er eine Nase aus Hühnerfleisch hatte, von einem Duell her.
Unter den Mitschülern lernte ich gute und lustige Kameraden kennen, mit denen ich Fussball spielte, Tauschgeschäfte betrieb oder gegen die Zöglinge des Thomasgymnasiums zu Felde zog.
Damals trug ich lange blonde Locken. Da ich mit einem dunklen Sammetanzug und weissem Spitzenkragen bekleidet war, sah ich wohl recht nett aus. Aber wegen der langen Haare wurde ich oft gehänselt. Man zog mich im Scherz und im Ernst daran. Schliesslich legten die Lehrer meinen Eltern nahe, mir diese auffallende und unmännliche Schönheit kürzen zu lassen, was denn auch zu meiner Befriedigung geschah.
Ach, das Lernen fiel so schwer. Draussen gab es Schlittschuhbahnen und im Sommer eine moderne, freie Schwimmanstalt. Dort konnte man von hohen und höheren Sprungbrettern, sogar von einer Schaukel abspringen. Oder man liess sich auf dem heissen Asphalt von der Sonne bräunen. Wenn man dazu sich ein Blatt auf die Brust legte und es stundenlang in Geduld ertrug, dann hatte man hinterher auf der dunklen Haut ein helles Muster. Herr Wallwitz, mein Schwimmlehrer, packte mich rauh und norddeutsch an. Er stiess mich, wenn ich nicht springen wollte, ohne weiteres ins Wasser. Und liess mein Mut nach, so gab er die Leine locker, dass ich tüchtig Wasser schluckte und spuckte und verwirrte mich nachher noch durch seinen kühlen, treffsicheren Spott.
Dem Restaurateur der Schwimmanstalt durfte ich an Hochbetriebstagen beim Verkaufen von Würstchen helfen. Dabei entwendete ich einmal Kleingeld aus der Kasse. Das wurde nie entdeckt und betraf auch nur eine Wenigkeit. Aber mein Gewissen blieb lange davon bedrückt.
Ich schaute einer Feuersbrunft zu. Mehrere Lagerschuppen brannten lichterloh. Ursache war: Das Stroh von Eierkisten hatte sich entzündet.
Die Menschenmenge, in der ich stand, war nur durch ein schmales Flüsschen von dem Brandherd getrennt. Wir sahen, wie drüben Arbeiter die Gelegenheit benutzten, um sich Eier beiseite zu schaffen. Als ihnen das nicht mehr möglich war, fingen sie an, die rohen Eier über das Flüsschen auf uns Neugierige zu werfen. Jeder Treffer gab selbstverständlich grosses Hallo. Aber wir blieben alle tapfer stehen. Wen’s trifft, den trifft’s. Es war wie in einer Schlacht.
Ich schrieb eine kleine Humoreske in sächsischem Dialekt, „Änne Heringsgeschichde“. Vermutlich überfeilte mein Vater die Sache noch etwas. Die „Fliegenden Blätter“ oder die „Meggendorfer Blätter“ druckten das Dichtwerk und zahlten zwanzig Mark dafür.
Das war meine erste Publikation und war mein erstes Honorar.
Die Stunden im Gymnasium vergingen so unsagbar freudlos, langsam. Trotzdem ich eine Fülle von Unter-der-Bank-Spielen ersann und hinter dem Rücken des Vordermanns stets eine Sonderbeschäftigung oder Privatlektüre hatte. Mein liebstes Buch war „Der Waldläufer“.
Ich stibitzte meinem Nachbarn das Frühstücksbrot, eine Klappstulle. Zwischen die beiden Brothälften legte ich Papier, das ich dann, so weit es überragte, abschnitt. Worauf ich das Brot zurücklegte, um mich in der Pause zu amüsieren, wenn jener Junge sich während des Rauens Papierstücke aus dem Munde zog.
Keines der Lehrfächer regte mich an. Ich war in allen schlecht. Sogar im deutschen Aufsatz, für den ich durch meinen schriftstellernden Vater mehr mitbekommen hatte als die andern Knaben. Im Zeichnen versagte ich völlig. Ich brachte es nicht fertig, ein einigermassen sauberes Quadrat zu zeichnen. Fortan durfte ich die allgemeinen Zeichenübungen nicht mehr mitmachen, sondern musste mich während des Unterrichts unbeteiligt auf eine Sonderbank setzen, wo es mir überlassen blieb, einen hässlichen Gipsdackel abzuzeichnen. Hundertmal habe ich ihn gezeichnet. Er wurde immer unkenntlicher.
Auch der Gesangslehrer wusste nichts mit mir anzufangen. Denn ich hatte mir an dem Tage des Tauchaschen Jahrmarktes als halbnackter Gassensiour den Kehlkopf ein für allemal kaputt geschrien. — Es kam vor, dass Schüler aus den elterlichen Gärten Sträusse mitbrachten und einem Lehrer überreichten. Um meinen Musikdirektor zu versöhnen, brachte ich auch ihm einmal ein Bukett mit, das ich unterwegs eilig in den städtischen Anlagen gepflückt hatte. Da es aber nach der weit herbstlichen Jahreszeit nur aus blütenlosen Strauchzweigen und kahlen Kräutern bestand, warf es der Lehrer aus dem Fenster, verprügelte mich noch einmal, und von da an war ich vom Gesangunterricht dispensiert, bekam allerdings durch ein Versehen in den Jahreszeugnissen immer eine I in diesem Fach.
Auf dem Fleischerplatz standen zur Zeit der Messe aufregende Schaubuden. Hinter einem Gitter sah man einen Gefangenen in Ketten, der unermüdlich eine Tretmühle bewegte. Unter einem zähnefletschenden Bären hob und senkte sich der zerfleischte Busen einer Frau. Eine Portion Eis mit Pappteller und Blechlöffel kostete fünf Pfennige. Türkischer Honig war noch preiswerter. Auf dem Karussell galt es, im Vorbeifahren nach einem vorgehaltenen Ring zu haschen, der eine Freifahrt garantierte.
In der Schule war’s trostlos. Schönschrift und Orthographie brachten mich zur Verzweiflung. Kein Lehrer mochte mich leiden. Meine Hefte waren schmierig. Glaubte ich mich unbeobachtet, so trieb ich Allotria. In den Pausen war ich nicht zu bändigen. Ich wurde verpetzt oder erwischt und immer wieder bestraft. Strafarbeiten, Nachsitzen, Arrest, schliesslich Karzer. — Immer neue Lügen erfand ich, um den Eltern das zu verbergen und mein verspätetes Heimkommen zu rechtfertigen. Aber direkte Briefe oder persönliche Rücksprachen brachten alles an den Tag, und die halbjährlichen Zensuren klagten in einer düsteren Sprache.
„— — Leider mussten wir sogar einem der Schüler im Betragen eine Fünf erteilen —“ sagte der Rektor in seiner feierlichen Aktusrede zu Ostern. Ich hatte der Rede nicht zugehört, aber als der Rex an jene Bemerkung meinen Namen knüpfte und in der Totenstille der Aula sich auf einmal ein paar hundert Menschen nach mir umsahen, versteckte ich schnell und verlegen etwas, worin ich gelesen hatte. Die Fünf im Betragen konnte auf irgendein ehrenrühriges Vergehen deuten. Man beglaubigte mir, dass zwar so etwas nicht vorläge, dass aber die Unsumme von kleinen Untaten und — — —
Mich drückte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich zur Schule ging oder von der Schule kam. An einem Wintermittag hatte ich mit anderen Schülern eine Strafstunde absolviert und verliess das Gymnasium. Neben mir lief mein auch betroffener Freund Martin Fischer die Treppe hinab. Vor der Schule war der schmutzige Schnee zu hohen Haufen zusammengeschaufelt. Fischer und ich schwiegen, uns war nicht wohl zumut. Aber unverabredet stürzten wir uns, unten angelangt, beide gleichzeitig mit dem Kopf voran in einen Schneehaufen. Als wir mit Schnee und Dreck bedeckt wieder auftauchten, ergab sich eine lustige Erklärung. Unabhängig voneinander waren wir beide auf denselben Gedanken verfallen: Zu Hause lieber sagen „Schneeballschlacht“ als „Nachsitzen müssen“.
Meine Eltern hatten inzwischen die Wohnung an der Alten Elfter aufgegeben und hübsche Parterreräume in der Poniatowskistrasse gemietet. Eine Glasveranda gehörte dazu und ein Garten mit einem Springbrunnen.
Ein Springbrunnen war immer schön, bleibt immer schön, für Kinder in der Stadt eine unerschöpfliche Quelle der Unterhaltung. Zwei hohe Kastanien standen im Garten. Die eine musste abgesägt werden, weil sie zu viel Licht wegnahm. Es war ein aufregendes Schauspiel, als sie stürzte und dabei mit den äussersten Ausläufern ihrer Krone unsere Fenster streifte. — In den Türrahmen der Gartenlaube hängten wir eine Hängematte als Schaukel auf. Ich verhakte mich mit den Zähnen darin, als ich meiner Schwester im Haschen nachlief. Meine Vorderzähne standen nach oben. Aber der Zahnarzt renkte das schnell wieder ein. Ich war ja so jung. — Einen schattigen, armseligen Winkel neben der Verandatreppe überliess man mir auf meine Bitte als Privatbeet. Selbst der Efeu gedieh dort nur spärlich, und trotz aller Mühe brachte ich nicht mehr als eine Kartoffel zum Keimen. — Auch meine tiefen Grabungen dort nach verborgenen Schätzen und Altertümern blieben ohne Erfolg. Es war ein geheimnisvoll lokkender Trieb in mir, etwas zu entdecken, etwas zu erfinden, etwas zu finden.
Mitunter fand ich auch etwas, ein Goldkettchen, andermal einen Spazierstock. Einmal sogar einen zusammengerollten Teppich. Der war aber so gross und schwer, dass ich ihn nur mit Hilfe von zwei Kameraden keuchend nach Hause brachte. Und dann setzte Mutter zu meiner höchsten und ehrlichen Entrüstung durch, dass wir dieses wertvolle Stück wieder nach dem Hofdurchgang zurückschleppten, wo ich es gefunden hatte.
Bei meinen alchimistischen Versuchen brachte ich elektrischen Strom aus Wolfgangs Trockenbatterie und angerusste Glasscherben mit Urin in Verbindung. Das Resultat war: Kleine aufsteigende Bläschen. Und im übrigen wie immer Flecken und Schaden an Kleidern und Möbeln.
Auf der anderen Seite unseres Hauses führte ein Weg zu dem Fluss Elster. Dort war der Anlegeplatz für einen, nein, für den einzigen Vergnügungsdampfer von Leipzig. Und zwar an der Stelle, wo Marschall Poniatowski 1813 ertrank. Der Dampfer war immerhin so gross, dass er in dem schmalen Fluss nie wenden, sondern nur vor- und rückwärts fahren konnte. Auf diesem Dampfer mitzureisen, war mir höchste Wonne. Ich kannte bald das Schiffspersonal und fühlte mich sehr seemännisch, wenn ich an Sonntagen den einsteigenden Fahrgästen die Billetts abnehmen oder zur Abfahrt die Glocke schlagen durfte.
All das war so viel ergötzlicher als Schularbeiten. Ich bestand das erste Examen im Gymnasium nicht, musste deshalb Sexta noch ein zweites Jahr durchmachen. Mein Vater ermahnte mich, erteilte mir Vorwürfe, redete, wie man so sagt „einmal vernünftig“, mit mir, drohte. Half alles nichts. Ich war in diesen Angelegenheiten so scheu geworden, dass ich nur noch auf den Ton, nicht auf den Sinn der Worte hörte.
Bei festlichen Gelegenheiten führten meine Eltern den Gästen ein sehr seltenes Schaustück vor, das Vater einmal aus Paris mitgebracht hatte. Es war ein, mich deucht, nahezu lebensgrosser Pfau aus Metall, aber mit richtigem Pfauengefieder. Der wurde auf den Tisch gestellt und begann dann, wenn sein Uhrwerk aufgezogen war, sich anmutig zu bewegen. Nicht etwa gleichmässig. O nein! Er trippelte ein paar Schritte vorwärts, blieb stehen, wendete sich plötzlich oder trat zurück, und auf einmal schlug er ein Rad. Über dieses kostbare Kunstwerk waren die Motten gekommen und hatten die Federn zerstört. Da eine Reparaturwerkstätte dafür in Leipzig nicht zu finden war, wurde der metallene Balg irgendwo verwahrt, wo ich ihn aufstöberte und entführte. Stundenlang lag ich in den nächsten Tagen unter meinem Bett und ging dort in der Verborgenheit mit einem Stemmeisen dem Vogel zu Leibe. Bis ich die zauberhafte Mechanik seines Inneren in Zahnräder, Rädchen, Spiralen, Achsen und Splitter zertrennt hatte. Mir ist, als wären Wolfgang und Ottilie dabei beteiligt gewesen, aber jedenfalls wurde ich von Mutter mit Recht als Hauptschuldiger dem Vater zugeführt. Es war das einzige Mal, dass mich mein Vater schlug. Sonst — zum Beispiel, als er dahinterkam, dass ich teure Lexika meines Bruders heimlich beim Antiquar verkauft und das Geld verjubelt hatte — war sein Verhalten ein anderes, obwohl von mir weit mehr gefürchtet. Ich wurde dann in sein Zimmer gerufen, wo er am Schreibtisch sass. Er begann mit strengen, sachlichen Worten, die, je zerknirschter sie mich machten, immer weicher wurden. Bis ich in Tränen ausbrach, worauf mein Vater seinen Klemmer verlor, meinen Kopf an seine stachlige Backe zog und sich selber Tränen aus den Augen wischte. Mit irgendeiner versöhnlichen und gütigen Betrachtung oder Ermahnung entliess er mich dann. — Wir Kinder liebten „Väterchen“ über die Massen. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass ich einmal seinen Tod überwinden würde.
Wie kam ich nur dazu, und warum konnte es niemand verhindern, dass ich in der Schule wie daheim so gar nicht gut tat, immer wieder auf Verbotenes aus war, alberne, eitle Streiche und sogar Roheiten beging? Wie war es möglich, dass ich zum Beispiel längere Zeit hindurch Tiere quälte? Nicht nur, wie die meisten Kinder tun, Maikäfer, Schmetterlinge in unzulängliche Gehäuse einsperrte und sie in plumper Behandlung lädierte oder fallen liess. Ich riss Fliegen die Flügel aus. Entsetzlich grausam behandelte ich einen Kolbenkäfer aus dem Aquarium meines älteren und verständigeren Bruders. Ich legte den Käfer rücklings auf den äusseren Fenstersims und begoss ihn mit Schwefelsäure, von deren schrecklicher Wirkung ich unterrichtet war. Nie werde ich den Anblick vergessen, wie das Insekt vor Schmerz hochschnellte und vom Sims herab auf die Strasse fiel. Aber auch damals schon überkam mich ein Grausen.
Es war keine Spur von sadistischen Gelüsten in mir. Aber warum quälte ich Tiere? Aus Wissbegierde? Ich spiesste Libellen und Schmetterlinge auf, um eine Sammlung anzulegen, wie Onkel Wolfram das mustergültig tat. Aber ich handhabte diesen Sport mit unzureichenden Kenntnissen und Mitteln. Ich wollte Tiere Konservieren, setzte eine kleine lebende Schleie in Spiritus, Brennspiritus, der sie rasch betäubte. Aber nachts liess mir’s keine Ruhe. Ich stand auf, entzündete ein Streichholz und beleuchtete das Einmachglas. Wie tief erschrak ich, als die Schleie plötzlich anfing, lebhaft mit dem Schwanz zu schlagen.
Ganz offensichtliche Gewinnsucht war es, wenn ich im Zoologischen Garten den Strauss oben fütterte und ihm unten gleichzeitig Federn ausrupfte. Oder wenn ich vergeblich das Stachelschwein heranzulocken suchte, um ihm einen Stachel auszureissen, aus dem ich mir einen Federhalter machen wollte. — Als ich einmal das Kamel, da es dicht am Gitter stand, in den Wanst zwickte, machte das Tier — wie um mir eine Lehre zu erteilen — eine geringe Bewegung, durch die mein Zeigefinger zwischen Gitterstab und Kamelbauch eingeklemmt wurde. Noch nicht schmerzhaft, aber immerhin so, dass ich eine Minute lang bedenklich gefangen war.
Die Ferien hatten uns in die Sommerfrische gebracht. Und ich zählte zehn Jahre, als mein Vater mich und meine älteren Geschwister in Frauenpriessnitz in Thüringen taufen liess. Bei dieser Zeremonie gebrauchte der Pastor eine Art Sahnenkännchen. Über dieses Kännchen und über den ungewöhnlich tief herabhängenden Hosenboden des Küsters brach ich in ein nicht zu unterdrückendes Lachen aus.
Ferien! Das Wort klang wie Freiheit. Vater nahm uns dann meist nach Thüringen mit. Durch dieses, sein engeres Heimatland, führte er uns in herrlichen Wanderungen. Er wusste dabei ebenso lustig wie spannend zu erzählen, und er kannte die Gegend und ihre Geschichte genau. Auch durften wir uns genügend allein umhertummeln, Wolfgang Steine sammelnd, ich Insekten, Schlangen und Eidechsen fangend, Ottilie Blumen und Beeren pflückend.
Das einzige Verlockende am Königlichen Staatsgymnasium waren Senfgurken, die der Pedell selber einlegte, und davon er uns gegen geringe Bezahlung verkaufte. Sie zergingen auf der Zunge wie Butter und schmeckten ungleich köstlicher als die gewohnten Mahlzeiten daheim. Obwohl Mutter, wie gesagt, sehr gut kochte. Mit Liebe kochte! Hatten wir Gäste zu Hause, so bekam sie in der Küche vor Eifer und Aufregung eine purpurrote Glanznase.
Wir Kinder mussten das essen, was die Eltern wählten und mussten im allgemeinen aufessen, was uns aufgelegt war. Wir hatten Lieblingsgerichte, die uns zum Geburtstag beschert wurden. Auf meinem Weihnachtswunschzettel stand einmal „Ich wünsche mir eine lederne Hose und ein Stück Butter“. Ich meinte eine Reithose. Die Butter, ein ganzes Pfund, erhielt ich, durfte sie aber nicht, wie ich das erträumt hatte, auf einmal aufessen.
Ich verabscheute Linsen. Einst hatte ich nachsitzen müssen und kam um eine Stunde zu spät heim. Nun sollte ich nachessen, und es gab Linsen. Da ich indessen allein im Zimmer war, verteilte ich das Gericht nach allen Seiten. Ein paar Löffel ins Ofenloch, ein paar Löffel hinters Büfett, ein paar zwischen die Sofapolster, und so fort. Auch die tiefen Schnitzereien an unserem eichenen Esstisch boten Verstecke, um mittags unbeliebte Bissen via Serviette verschwinden zu lassen. Bob, der Dackel, war in dieser Beziehung auch stets auf unserer Seite.
Wir naschten selbstverständlich gern Süssigkeiten. Zu Ostern schenkte mir der reiche Onkel Karl einen Gigerlstock aus massiver Schokolade. Donnerwetter! — Kostbare Geschenke erhielten wir sonst nur von dem fernen Onkel Martin, der als Kapitän ein Schiff an der chinesischen Küste führte. — Freigebig waren unsere Eltern beide, und wir wurden es ebenfalls.
Ich wurde auch in der Quinta nicht versetzt, sondern musste ein neues Jahr dort bleiben. Das hatte den einzigen Vorzug, dass ich von den neuen Klassengenossen zunächst als Älterer respektiert wurde. — Meine Zeugnisse verschlechterten sich.
Unter Führung des Lehrers unternahm unsere Klasse einen Tagesausflug nach Schkeuditz. In einem Gartenrestaurant kehrten wir ein. Dort stand ein Automat, der eine Henne darstellte, die für zehn Pfennige ein mit Bonbons gefülltes Ei legte. Ein Konpennäler von mir kam auf einen geschickten Betrug. Wenn man nämlich, nachdem der Groschen in den Schlitz gefallen war, hinten in die Henne griff und auf einen gewissen Schnapper drückte, dann konnte man noch gratis weitere Eier erlangen. Mehrere von uns Jungens hatten sich bereits derart bereichert, als ich erst von dem Trick erfuhr. Das wollte ich auch versuchen. Ich warf ein Groschenstück ein, drückte hinten auf den Schnapper. Weil aber ein anderer Schüler in diesem Moment an der Kurbel drehte, wurde mein Finger eingeklemmt, und ich war mit der Hand im Popo der Henne gefangen. Der Wirt musste gerufen werden.
„Haben wir den Dieb endlich!“ sagte er und versetzte mir eine Ohrfeige. „Wieviel Eier hast du denn schon herausgeholt?“
„Noch keins — ich wollte nur — —“
Er gab mir Wehrlosem wieder eine Ohrfeige. „Wieviel?“
„Eins“, log ich, um nur loszukommen.
(Bums Ohrfeige.) „Wieviel?“
„Zwei.“
(Bums Ohrfeige.) „Wieviel?“
„Noch keins!“ rief ich aufheulend. Darauf befreite mich der Wirt aus meiner Lage.
Eine gute Freundschaft verband mich mit dem Sohn des Universitätsrektors Sievers. Er konnte genau so ein gellendes Kriegsgeheul ausstossen wie ich. Ausserdem musste ich ihm auf dem Schulweg spannende Geschichten erzählen, die ich immer improvisiert verlängerte, um Sievers recht lange zum Begleiter zu haben. Mein liebster Freund wurde Martin Fischer. Er hatte keinen Vater mehr. Seine Mutter war eine sarkastische Frau, die mich manchmal verspottete wegen meiner unmodischen Kleidung oder meiner krummen Beine. Fischer spielte hingegeben Geige. Mit ihm kam ich auch zum erstenmal in Gespräche über Erotik. Er hatte eine auffallend hübsche Schwester. Ich lobte sie und ihre Kleider vor ihm. Er lobte meine Schwester und deren Kleider, sodann schwärmten wir von Damenwäsche und sprachen uns derart allmählich immer intimer aus.
Mein Vater beschlagnahmte eine Sammlung von Ansichtskarten, die ich mir angelegt hatte, und auf denen halbnackte Mädchen zu sehen waren. Er beschlagnahmte auch ein sehr aufregendes Buch, das ich von einem Freund eingetauscht hatte, und das den Titel trug „Der Frauenhandel in Wisconsin“. Nie habe ich das Buch wiedergesehen und suche es noch heute.
Das zweite Quintajahr ging zu Ende. Meine Aussichten waren hoffnungslos. Es ereignete sich ein Zwischenfall, der dem Fass den Boden ausschlug. Meine Eltern hatten mir ein Jahresabonnement für den Zoo geschenkt. Weil dieser Tiergarten direkt neben dem Gymnasium lag, benutzte ich alle Pausen, um hinüberzulaufen. Nun war dort seit einiger Zeit eine Völkerschau zu sehen, und zwar frei Samoaner mit dreiundzwanzig Samoanerinnen. Herrliche, stattliche Gestalten. Die Frauen trugen nur ein hemdartiges Gewand und steckten sich Blumen ins Haar.
Ich befand mich in den Pubertätsjahren und konnte mich an den bronzefarbenen, dunkelhaarigen Weibern nicht sattsehen. Da mein kleines Taschengeld für Geschenke nicht ausreichte, entwendete ich zu Hause nach und nach unseren gesamten Christbaumschmuck. Bald trugen alle dreiundzwanzig Insulanerinnen Glaskugeln, kleine Weihnachtsmänner, Schokoladeherzen und Zuckerfiguren, Wachsengel und Ketten im Haar. Sie dankten mir, indem sie mich anlächelten oder über mein blondes Haar strichen, was mich beseligte. Aber eine von ihnen erfüllte mir eines Tages meinen Wunsch, mir ein „H“ auf den Unterarm einzustechen. Das geschah in der grossen Unterrichtspause. Die dauerte eine Viertelstunde, das Tätowieren aber einundeinehalbe Stunde: Es tat ein bisschen weh und kostete auch ein Tröpfchen Blut.
„Wo bist du gewäsen?“ fragte der Lehrer, als ich unter atemloser und schadenfroher Spannung meiner Klassengenossen den Schulraum betrat. Ich wusste: Nun ist alles aus. Aufrecht ging ich an dem Lehrer vorbei an meinen Platz und sagte, jedes Wort stolz betonend: „Ich habe mich tätowieren lassen!“
Es war aus. Consilium abeundi.
Meine Onkels
Vaters Bruder war unser Onkel Karl. Er besass eine Fabrik. Es ging ihm gut. Seine wohlhabend und gut erzogenen Kinder wurden uns immer wieder als Musterbeispiele hingestellt. Das waren Mädchen, apart und sicher wie ihre Mutter, die Tante Emmy. Nur dass wir vor deren kühler Liebenswürdigkeit nie zutraulich wurden. Onkel aber trat grossgebend, breit, natürlich und lustig auf. — „Kinder“, sagte er, als ich so alt war wie ihr jetzt, da habe ich euren Vater manchmal so lange gekitzelt, bis er seine Laubsäge, oder was ich gerade wünschte, mir schenkte. Er ist ja so kitzlig. Nun passt auf: Wenn er jetzt hereinkommt, dann überfallt ihr ihn und piekst ihn so lange mit dem Zeigefinger in die Seiten, bis er euch eine Mark spendiert.“ — Wir jubelten über diesen Einfall. Vater betrat die Stube. Wir stürzten auf ihn und pieksten in seinen Bauch und seine Seiten. Er aber, der schon längst nicht mehr kitzlig war, verstand gar nicht, was wir wollten. Unsere Enttäuschung löste der Onkel Doch noch in Freude auf. — Onkel Karl war ein stattlicher Mann. Er legte seine Nase zeitweilig nachts in Gips, um sie schöner zu formen. Ein Dienstmädchen verriet uns das.
Der Bruder meiner Mutter war Onkel Martin, der Kapitän in China, den wir vorläufig nur aus Bildern und Erzählungen kannten. Er sandte wertvolle Geschenke zu den Festen, Silberbecher, geschnitzte Waffen, alte Vasen und Holzschnitte. Mir goldene Manschettenknöpfe, die ich heute noch trage. Und eine goldene Schlipsnadel. Dann einen Spazierstock aus Ebenholz. Auch seine silberne Uhr, die ihm einmal ins Note oder ins Gelbe — — in irgendein farbiges Meer gefallen war, und die ein Taucher zufällig wiederfand.
Zu Weihnachten erhielt Ottilie von Onkel Martin entzückende, weisse, prachtvoll bestickte Seide für ein Kleid. Ich warf ein glühendes Streichholz auf den Stoff und hinderte meine Schwester gewaltsam, das zu entfernen. Auf ihr Gezeter sprangen Mutter und Bruder hinzu. Sie entdeckten, dass mein Streichholz ein angekohltes, aber längst ausgekohltes Zündholz war. An der Stelle, wo Verkohlt und Unverbrannt sich trafen, hatte ich einen schmalen roten Stanniolstreifen um das Hölzchen gewunden. Der wirkte in der Kerzenbeleuchtung wie Glut. Ich freute mich meiner kleinen Erfindung.
„Streichholz gross, Streichholz klein,
Armes Streichholz, ganz allein.“
(Alter Spielreim)
Den Onkel Fries in Marksuhl besuchten wir während der Sommerfrische. Er war ein rauher Weidmann, der selbst vor dem Kaiser, der gelegentlich bei ihm jagte, kein Blatt vor den Mund nahm. Zu dem herrlichen Gutshof gehörte ein alter gespenstischer Turm. Die Fledermäuse, die sich in dessen Gebälk aufhängten, brannte ein Knecht von Zeit zu Zeit am Tag, wenn sie schliefen, mit einer brennenden Kerze herunter. — Ich sah lebendig gerupfte Puten und Hühner ohne Kopf, die noch lange fürchterlich zuckten.
Auf einer der schönen Spazierfahrten, bei denen ein Jagdhund neben den Pferden herlief, warf der Onkel seinen Schlüsselbund ins Dickicht. Als wir auf der Rückfahrt in die Oberförsterei eins bogen, rief Fries dem Jagdhund zu: „Such! Verloren!“ Eine Stunde später brachte das Tier den Schlüsselbund an unseren Abendtisch im Garten. — Früchte gab’s in Hülle und Fülle. Beim Einfahren des Korns hatte ich einmal auf einer Kreuzotter gesessen, was mir einen heldenhaften Nimbus verlieh.
Zuweilen ritt meine Mutter mit dem Onkel aus. Man musste der kleinen Frau dann erst auf eine Kiste helfen, damit sie aufs Pferd kam.
Vom Onkel Hilgenfeld, Theologe in Jena, und von dessen Familie sind mir nur noch eine tiefe Bassstimme und Stachelbeeren in Erinnerung.
Und der Leipziger Professor und Prediger Georg Rietschel und seine Angehörigen traten für mich erst viel später in Erscheinung.
Wir hatten viele Nenn-Onkels.
Edwin Bormann, sächsischer Dialetztdichter und wissenschaftlicher Verfechter der Idee, die Shakespeare-Dramen hätten eigentlich Bacon zum Verfasser. Onkel Bormann war in allem von einer unvergleichlichen, oft pedantischen Gewissenhaftigkeit, was mich sehr für seine Bacon-Theorie einnahm, über die ich im übrigen nichts Näheres wusste. Aber er schien mir andererseits nicht immer logisch. Sein Sohn, mein lieber Gespiele Fritz, erbat sich einmal 50 Pfennige, um sich ein Radrennen anzusehen. Sein Vater gab ihm die mit der Ermahnung, dann pünktlich heimzukommen. — Fritz kam pünktlich heim, berichtete exakt und anschaulich von dem Verlauf der einzelnen Rennfahrten, auch von dem entsetzlichen, tödlichen Sturz eines Fahrers. Worauf der Vater ihn übers Knie regte, gründlich verwichste und dabei ausrief: „Solch grausiges Schauspiel siehst du Rohling dir an!“
Bormanns besassen ein eigenes Haus mit Garten in einem traulichen alten Winkel der Stadt. Mit ihren Kindern haben wir dort herrlich gespielt. Zwischen Suse und mir bestand eine eigens erdachte Begrüssung, der Hexenkuss, bei dem wir uns mit den Nasen berührten.
Julius Lohmeyer schrieb Kinderbücher und anderes und liebte Kinder. Dieser Onkel lebte in Berlin. Er war stets modisch gekleidet. Über seine katastrophale Zerstreutheit hörten wir immer neue Anekdoten oder erlebten sie mit. Einmal war er und waren wir bei einem anderen Onkel zu Gast, dem Zeichenlehrer und Kassenmaler Flinzer. Lohmeyer musste die Gesellschaft frühzeitig verlassen, um den Zug noch zu erreichen. Alles drängte sich auf den Balkon, um dem Freunde Abschiedsgrüsse nachzuwinken. Onkel Lohmeyer trug einen seidenhaarigen Zylinderhut, den ich schon einmal in unserem Vorraum zu Mutters Entsetzen ausführlich gegen den Strich gebürstet hatte. Mit diesem Hut winkte er nun der Gesellschaft zurück, als er eine Droschke bestieg. Er hatte aber gleichzeitig einen zweiten, versehentlich mitgenommenen Zylinderhut auf dem Kopf.
Auch der Anatom Wilhelm Roux war einer von meinen berühmten Nenn-Onkeln. Mit ihm kam ich aber kaum in Berührung. Es gab auch Freunde von Vater, die wir Kinder nicht mit Onkel anredeten.
Von Johannes Trojan wusste ich, dass er Sitzredakteur des „Kladderadatsch“ war und für einen guten und witzigen Dichter galt. Ich konnte mich auch davon überzeugen, dass er viel von Getränken und Pflanzen wusste und mit Kindern entzückend umzugehen verstand.
Der Dichter Victor Blüthgen schenkte meinen poetischen Anfängen freundliche Aufmerksamkeit und manches Lob. Deswegen gefiel er mir. Seiner Frau oder seiner Schwester oder, Gott weiss wem, trug ich zur Hochzeit als Page gekleidet die Schleppe. Da man mir aber Wein zu trinken gegeben hatte und ich übermüde war, trat ich mehrmals auf die Schleppe, worüber die Braut sehr unhold zu mir war.
Mein Vater war mit sehr viel merkwürdigen Zeitgenossen bekannt. Er suchte uns die Art und Bedeutung derselben klarzumachen, und es freute ihn sichtlich, wenn sich uns Gelegenheit bot, solche Leute persönlich kennenzulernen. Uns Kindern machte das nur selten Spass. Meistens fühlten wir uns vor Respekt und Verlegenheit unglücklich, und es blieb uns auch nichts übrig, als blöde zu schweigen oder mit Ja und Nein zu antworten.
„Ich gehe jetzt auf einen Sprung in dieses Haus, um Moritz Busch zu besuchen“, sagte Papa und erklärte mir nochmals eilig, wer Moritz Busch war. Dann liess er mich allein warten. Aber sehr bald kam er zurück und sagte: „Der alte Busch will dich sehen. Du kennst ausserdem seine Nichte.“
Ich seine Nichte kennen?? Und da stand ich nun dem kleinen Herrn gegenüber, der der Eckermann Bismarcks gewesen war. Und ich wurde noch verdatterter, als ich in seiner Nichte ein Mädchen wiedererkannte, dem ich einmal auf der Eisbahn den Hof gemacht und ein Veilchensträusschen überreicht hatte. — Man quälte mich indessen nicht lange.
So zeigte uns Vater öfters berühmte oder originelle Menschen. Was er dazu sagte, war immer exakt gewusst und ohne Überhebung aus einer ganz bescheidenen Neutralität heraus gesprochen. Er selbst blieb gern im Schatten. Nur war ich leider viel zu unreif und abgelenkt, um solchen Ausführungen die Aufmerksamkeit zu schenken, deren sie wert waren.
Trotzdem ist mir von allen Gesprächen Vaters und von jeder Erzählung aus seiner Jugend, aus seiner Pariser Zeit, aus seinem Leben immer ein Pünktchen im Gedächtnis geblieben. Ich meine: Ich könnte heute daraus ein deutliches Bild zusammensetzen. Vaters Bild. Leider erst heute. Manchmal meine ich sogar, ich könnte daraus mein eigenes Bild zusammensetzen.
Auf der Presse
Frau Fischer nahm ihren Sohn vom Gymnasium fort und brachte ihn auf eine jener Drillschulen, die wir Presse nannten. Auch mich steckte man in ein solches Institut. Es hiess nach seinem Direktor „Tollersche Privat-Realschule“. In der Stadt war diese Schule berüchtigt.
Latein fiel weg. In den andern Fächern fand ich mich dort um einen Grad besser zurecht als im Gymnasium. Höchstens um einen Grad.
Am schwersten fiel mir die französische Sprache. Sächsisch gelehrt war sie wohl auch von einem Sachsen nicht zu lernen. „Scho nä ba, dü na ba, il na ba, nu nawong ba, wu nawä . . .“ Leider wusste ich mir für teures Geld ein für Schüler verbotenes und schwer zu erlangendes Buch zu verschaffen. Eine wörtliche Übersetzung des Lehrbuches von Plötz. Mit Hilfe dieses Schlüssels fertigte ich Hausübersetzungen an, die erstaunlich wenig Fehler aufwiesen. Musste ich aber unter Aufsicht des Lehrers nach Diktat übersetzen, so entstand etwas, was von Fehlern wimmelte. Dieser Lehrer, er hiess Rochlitz, war ein graumelierter Herr. So wie er aussah, stellte ich mir damals einen Marquis vor. Er zeigte jedoch weit mehr Interesse für mich als ich für ihn.
Ich hatte mir angewöhnt, allzeit an den Fingernägeln zu kauen. Wenn ich während des französischen Unterrichts mich so recht innig und fernsinnend diesem Sport hingab, beschlich mich Rochlitz und schlug mir unversehens mit dem Lineal gehörig auf die Hand. Das half aber nur für kurze Zeit. Später musste ich ihm vor Beginn jeder Stunde meine hässlich verstümmelten Fingerspitzen hinhalten, und er schmierte mir zum Gaudium der ganzen Klasse Ochsengalle darauf. Ochsengalle ist gelb und schmeckt bitter. Aber meine Leidenschaft nahm das mit in Kauf und gewöhnte sich rasch daran. Als man dieser üblen Angewohnheit von mir keine Aufmerksamkeit mehr schenkte, verlor sie sich von selber.
Rochlitz beschlich mich auch auf einem anderen Gebiete. Während der öden Schulstunden vertrieb ich mir die Zeit damit, mit Buntstift, ich glaube sogar mit Wasserfarben, Bilder zu malen. Feuersalamander, Reiter, rote Husaren oder sogar politische Bilder. Politisch deswegen, weil ich in ihnen irgend etwas Aufgeschnapptes oder dem Kladderadatsch Abgesehenes darzustellen versuchte. Etwa den grossen Russischen Bären neben der zierlichen Französischen Marianne. Rochlitz beobachtete mich dann heimlich, und auf einmal sprang er zu mir und entriss mir das Bild. Zufällig immer dann, wenn es fertig war. Er sah stets von einer Bestrafung ab, und es war mir gleichgültig, dass ich das Bild nicht zurückerhielt.
Wie sollte dabei Französisch in mich kommen. Auch als mein Vater sich persönlich meiner annahm und mir daheim Unterricht erteilte, ergab sich nichts anderes als Peinlichkeiten. Ich gestand nicht, dass ich die Anfangsgründe nicht begriff, schämte mich zu sagen, dass ich gar nichts, rein gar nichts wusste. Und der Privatunterricht endete damit, dass mein Vater wieder den Klemmer verlor, mich an seine rauhe Backe drückte, und wir beide weinten.
Englisch fiel mir leicht, aber ich war völlig uninteressiert. — Dem Religionsunterricht misstraute ich im Unterbewusstsein. — In Geographie war ich faul. — In Geschichte schwitzte ich Angst. — Naturbeschreibung hatte scheinbar nichts mit Natur zu tun. Naturlehre auch nicht. (Ich beschreibe diese Aufzählung nach einem Zensurenverzeichnis, das vor mir liegt. Den vorgedruckten Fächern sind handschriftlich Zensuren hinzugefügt.) — Zahlenrechnen fand ich entsetzlich. — Mathematik entsetzlich. — Für Freihandzeichnen zu unbegabt. — Geometrisches Zeichnen: Darüber spreche ich noch. — Schreiben ganz schlimm. — Gesang: Nur ein Strich. — Turnen: Lehrer und Schüler sich gegenseitig nicht im klaren. — Alle übrigen Fächer kamen, weil sie fakultativ waren, für mich nicht in Betracht.
Im Deutschen Aufsatz und in deutscher Grammatik unterrichtete der gestrenge Direktor selbst. — „Den besten Aufsatz haben geschrieben“, sagte er zu Beginn der Stunde und nannte dann die Namen der zwei oder drei Belobten. Da war ich häufig dabei. Und ich freute mich dann. Denn Vater hatte mir für die Zensur I eine Mark versprochen. Indessen bezog sich das „besten“ nur allgemein auf den Aufsatz als solchen. Bei der nun folgenden Verlesung der Zensuren stellte sich heraus, dass ich die schlechteste erhalten hatte. Weil mein Aufsatz unerhört unorthographisch und unschön geschrieben, das Schreibheft ausserdem durch Kleckse, einradierte Löcher sowie Fingerabdrücke total versaut war. Dabei entwarf ich manchmal heimlich Aufsätze für andere Schüler, wofür ich Bezahlung oder Geschenke annahm. Meine Glanzleistung hatte ich im ersten Tollerschen Schuljahr vollbracht, als ich aus meinem Heft ganz fliessend einen Hausaufsatz vorlas, der gar nicht darin stand. Ein jüdischer Mitschüler, der auch keinen Aufsatz geschrieben hatte, versuchte, meine Frechheit nachzuahmen, geriet aber gleich ins Stocken und wurde bestraft.
Herr Toller war sehr gefürchtet. Nur wenige Schüler, und zwar die, die bei ihm in Privatpension lebten, bewegten sich freier vor ihm. Darunter war zufällig der Primus. Kurze Zeit nach meiner Aufnahme in die Realschule starb ein alter Lehrer, ein herzensguter, treuer, leider sehr kranker Mann. Ich habe auch etwas dazu beigetragen, ihn zu Tode zu quälen. Denn wir nutzten die Hilflosigkeit des Greises dazu aus, in seinen Stunden grausamen Unfug zu treiben. Und ich war auch bei Toller sehr bald der Haupthanswurst geworden.
Da auf eine solche Presse Jungens geschickt wurden, die von besseren Schulen abgestossen waren, kann man sich denken, dass wir eine recht gemischte Rotte bildeten.
Unser weitaus genialster und intelligentester Schüler hiess Harich. Er hatte ein schön geschnittenes Gesicht und imponierte mir in allem. Besonders aber durch sein sicheres und unerschrockenes Verhalten bei einer fatalen Gelegenheit, da Rochlitz ihm eine obszöne Photographie abnahm. Rochlitz vertuschte diesen Vorfall.
Arthur Tausig war der Sohn eines Rabbiners. Er hatte als Jude viel unter unserem Spott zu leiden.
Als geistig unzurechnungsfähig wurde Bonz sehr bald zum Spott der ganzen Klasse. Mir erschien er nur ein bisschen verrückt. Und ich mochte ihn gerade darum leiden. Sein Vater war übrigens auch wie Harichs Vater ein hoher und geschätzter Beamter.
Der körperlich stärkste von uns hiess Lakorn, ein grosser frühreifer Junge, ungeschlacht, aber höchst gutmütig und ehrlich. Wie ein brauner, junger Jagdhund war er. Er half abends seinem Vater, einem Kneipenwirt in der Vorstadt, beim Bedienen der Gäste und war dadurch schon mit den Schatten- und Sonnenseiten des Arbeiterstandes vertraut. Deshalb wurde er von einigen bürgerlichen Lehrern als feindliches Element gehasst und sehr ungerecht behandelt. Als ich ihn einmal besuchte, war ich allerdings auch verblüfft darüber, wie vertraulich er mit seinem Vater stand, dass er ihm zum Beispiel lachend vor mir berichtete, ich hätte das harmlose. Haus vis-à-vis für einen Puff gehalten.
Da war ein ganz kleiner, winziger Knirps unter uns. Den warfen Lakorn und Harich sich manchmal hin und her wie einen Fangball zu.
Es gab auch zwei schwere Jungens in dem Institut. Der eine unternahm eines Tages einen regelrechten Einbruch und stahl Gurken. Andermal, als er mit mir und noch zwei Knaben durch einen Wald ging und wir darüber klagten, dass wir gar kein Geld hätten, sagte er: „Einen Moment! Das verschaffe ich.“ Lief uns voraus und trat nun — ärmlich gekleidet war er — mit gezogenem Hut an alle Passanten heran und bettelte sie an. Das Geld teilte er redlich mit uns.
Das andere mauvais sujet war ein sehr undurchsichtiger, wirklich übler Sohn eines sehr mysteriösen, wirklich üblen Besitzers einer Animierkneipe. Diese beiden Schüler spie die Schule im Laufe der Zeit aus, nach zwei für uns höchst sensationellen Ereignissen.
Am 28. März 1899 wurde ich in der Matthäikirche eingesegnet. In dem vorangegangenen Konfirmationsunterricht hatte ich mich auch schlecht betragen und besonders durch Juckpulver Ärgernis erregt.
Wieder verbrachten wir die grossen Ferien in Tautenburg und Umgebung. Man zeigte uns Weimar, erzählte uns von Goethe, und Vater führte uns vom „Elefanten“ auf den bunten Gemüsemarkt, um Sinn für künstlerisches Farbenverständnis und für volkstümliches Leben in uns zu wecken. In Jena assen wir Kalbsnierenbraten in der „Sonne“. Papa erzählte vom Kämmerer-Karl und der Himmelsziege und zeigte uns die sieben Wunder der Stadt. Einmal wehte an der Zeise eine lange schwarze Trauerfahne. Jemand sagte, Bismarck wäre gestorben. Vater sah die Studenten unter jener Fahne lustig beim Frühschoppen kneipen und wurde plötzlich sehr traurig.
Nach heissen Wanderungen setzte Vater manchmal eine köstliche Bowle an. Er war als sachverständiger Bowlenbrauer weit bekannt. Er war auch ein feiner Renner von Moselweinen. Bei einem Preisausschreiben des Trarbacher Kasinos gewann er mit einem Moselweinlied den ersten Preis von 500 Flaschen edelsten Mosel- und Saarweins. Das gab dann auserlesene Festlichkeiten bei uns, bei denen auch schon Gnadentröpfchen auf uns Kinder fielen. Schmeckte so gut auf den Tollerschen Schulstaub.
Von Schwester und Bruder war ich inzwischen naturgemäss mehr und mehr abgerückt. Ottilie war ein schöner, umschwärmter und koketter Backfisch geworden. Sie besuchte eine Tanzstunde mit Liebesflirt, der sich immer dramatischer gestaltete. Wolfgang widmete sich schon vorstudentlichen und wissenschaftlichen Interessen, besonders der Zoologie und der Steinkunde, sammelte Petrifakten und Briefmarken. Während meine Eltern ihre Anteilnahme mehr auf meine Geschwister und deren Bekannte verlegten, verbrachte ich meine Zeit frech und froh in meinem jüngeren, freieren und rauheren Freundeskreis. Das Erstrebenswerteste war mir damals etwa: Mit diesen Freunden einen Stammtisch zu pflegen, wo man viel Bier zuprostend trank, dicke Zigarren rauchte und von Zeit zu Zeit eine allgemeine erschütternde Lache ausstiess. Wie ich das an vollbärtigen Spiessern und Studenten so oft bewundert hatte. Unter den zirka fünfundzwanzig Schülern meiner Klasse fanden sich genügend zusammen, die diese meine Neigung nicht nur teilten, sondern von denen einige schon Überlegenheit mitbrachten. Sie konnten Billard und Skat spielen, verfügten über Kommentausdrücke und wussten sehr vorgeschrittene, schweinische Witze. Ein Stammtisch kam aber wegen Geldnot und Vorliebe zu Sahnenschnitten anfangs nur in kleinen Kakaostuben zustande, und auch nur vorübergehend. Er endigte meistens mit Schulkrach, Zank, Klatscherei.
An das heimliche Rauchen war ich längst gewöhnt. Es galt für männlich, durch die Lunge zu rauchen. Es galt auch für männlich, keine Schulmappe zu benutzen, sondern die Bücher unterm Arm zu tragen.
Meine Eltern waren nach dem Vorort Gohlis verzogen. Auf dem weiten Schulweg. dahin steckte ich mir dreist eine Zigarre an. Ein fremder Herr trat auf mich zu, zog mir ein Buch unterm Arm weg, schlug es auf, las meinen Namen, gab es mir schweigend zurück und entfernte sich. Das war zweifellos ein Lehrer einer anderen Schule. Die mit mir gehenden Freunde meinten, ich würde nun wohl in der Nachmittagsstunde vom Direktor etwas zu hören kriegen. Ich war sehr bedruckst. Jedoch nicht lange. „Ihr werdet sehen, dass mir gar nichts passiert“, sagte ich. Denn schon hatte ich einen Plan gefasst. Über Mittag kaufte ich mir in einem Laden für Scherzartikel eine Feuerwerkszigarre. Die rauchte ich in einem Keller ganz eilig so weit, bis sie explodierte. Den Rest löschte ich und verwahrte ihn in der Firmatüte. Das wollte ich vorzeigen. „Ich habe nur eine Scherzzigarre geraucht“, wollte ich sagen. Ich war stolz auf meinen Einfall.
Als ich nachmittags nach Schluss der Geographie zum Direktor gerufen wurde, lachte ich meinen Freunden siegesgewiss zu.
„Du hast geraucht!“ brüllte mich Herr Toller an.
„Nein, Herr Direktor, ich habe nur eine Feuer — —“
Weiter liess mich der Direktor nicht reden. „Du Lausejunge! Zwei Stunden Arrest!“ Dabei gab er mir links und rechts gewaltige Ohrfeigen und stiess mich zuletzt so heftig aus der Tür, dass ich durchaus nicht in Siegerstellung auf meine draussen wartenden Kameraden prallte.