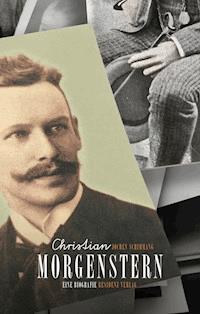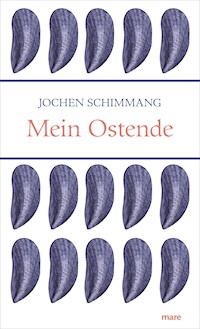
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als im Februar 1997 die letzte Fähre von Ostende nach Dover ablegte, endete in der belgischen Küstenstadt erneut eine Ära. Einst mondänes Seebad, war Ostendes äußerer Glanz nach dem Zweiten Weltkrieg dahin. Auch für Jochen Schimmang war die Stadt nur Transitstation auf der Reise nach England, bis er eines kalten Novemberabends als letzter Gast in einem Ostender Lokal so warm empfangen wurde, dass er fortan den Ort und seine bewegte Geschichte für sich entdeckte. So kann er von Friedrich Engels erzählen, der das Ostender Leben "sehr schluffig" fand, und von Georges Simenon, der hier zum ersten Mal das Meer erblickte. Schimmang kehrt im Café Leeshus und im Mu.ZEE ein, er beobachtet die Besonderheiten der Ostender Möwen und des belgischen Sands – und erlebt am Ostender Strand einen Moment der Erleuchtung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jochen Schimmang
MEIN OSTENDE
© 2020 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann, mareverlag
Coverabbildung akg-images / David Parker / Science Photo Library
Typografie (Hardcover) mareverlag, Hamburg
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-383-5
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-298-2
www.mare.de
Come in, she said, I’ll give youshelter from the storm.
BOB DYLAN
INHALT
OUVERTÜRE: TRANSIT
PLÖTZLICHES GEBORGENSEIN
EIN BEWEGLICHER ORT
KLEINE WAPPENKUNDE
PHANTASIEN IM GLÄSERNEN BUNKER (1)
»DIE ANZAHL DER BADEGÄSTE NIMMT MIT JEDEM JAHR ZU«
HERZ DER FINSTERNIS
PHANTASIEN IM GLÄSERNEN BUNKER (2)
DIE KÖNIGIN DER SEEBÄDER
DIE OASE DER MINDEREN BRÜDER
WAS FRANÇOISE ERZÄHLT
PHANTASIEN IM GLÄSERNEN BUNKER (3)
VOM SAND
PARADIES / SATORI
EMMA UND KASSANDRA
PHANTASIEN IM GLÄSERNEN BUNKER (4)
DER MANN AUS LÜTTICH UND DAS MEER
UNTER FEUER
»… DIE KAHLEN LINIEN DES ENTSEELTEN STRANDES«
ETHNOGRAFIE DES INLANDS: HOMMAGE AN HENRI STORCK
RAVERSIJDE
LICHTGESTALT IM SCHATTEN
SIC TRANSIT
PHANTASIEN IM GLÄSERNEN BUNKER (5)
HISTORISCHER EXKURS: DIE TOTE AM STRAND
PHANTASIEN IM GLÄSERNEN BUNKER (6)
VOR SONNENUNTERGANG
PHANTASIEN IM GLÄSERNEN BUNKER (7 UND SCHLUSS)
»… BEI DEN ANDEREN BIN ICH MIR NICHT SO SICHER, OB SIE EXISTIEREN.«
DAS REICH DER LICHTER
JOYCE UND DAS MÄDCHEN MIT DEN MUSCHELN
BLEU DE MER
DAS KÜRZESTE KAPITEL
DIE DASEINSFREUDE
DIE ENGLÄNDER
DAS ANTHROPOLOGISCHE FOSSIL
CODA: REFUGIUM
DANK
QUELLEN
OUVERTÜRE: TRANSIT
Lange Zeit hatten die Belgischen Eisenbahnen im Kölner Hauptbahnhof eine eigene Niederlassung. Solange es diese Geschäftsstelle gab, habe ich sie niemals aufgesucht, weil ich mir meine Fahrkarten ins westliche Nachbarland immer im sogenannten Reisezentrum oder gar vorher in einem Reisebüro gekauft habe. Man sieht, ich spreche hier von einer Zeit, in der ich noch keine Online-Existenz besaß, sondern mich ganz analog durch meinen damaligen Wohnort Köln und den Rest der Welt bewegte. Eine Welt, in der Bücher noch so anfangen konnten:
Stell dir jetzt vor: du gehst einfach zum Bahnhof. Vorher machst du ein paar Türen auf und wieder zu. Es gibt einen Menschen, der dich sofort begreift; das ist der Mann hinter der Scheibe des Fahrkartenschalters. Leer läuft der Zug auf dem Bahnsteig ein, und es vergeht Zeit bis zur Abfahrt. Nun kannst du durch den Zug gehen und dir das beste Abteil aussuchen. Du weißt, dass ungefähr drei Stunden Fahrt vor dir liegen, Richtung westliche Küste, nach Ostende.
So beginnt Jürgen Beckers Buch Erzählen bis Ostende, erschienen 1981. Heute würde man es einen Roman nennen. Es ist aber eher eine Abfolge kurzer Skizzen und Erzählungen, die durch die Klammer eben dieser Zugfahrt nach Ostende zusammengehalten werden. Auf der letzten Seite sitzt der Erzähler hinter den großen nassen Scheiben seines Ostender Hotels und schaut »ins näherkommende Meer«.
Inzwischen würde sich dieser Erzähler seine Fahrkarte von Köln nach Ostende vermutlich online buchen. Allerhöchstens würde er sie im Kölner Hauptbahnhof aus dem Automaten ziehen. »Das beste Abteil aussuchen«, auch damit ist es heutzutage so eine Sache. Doch selbst wenn er es gefunden hat – dort bis zum Ziel sitzen bleiben und träumen und all die Geschichten und Bilder an sich vorüberziehen lassen wie Beckers Erzähler, also Erzählen bis Ostende, das könnte der heutige Reisende nicht mehr. Denn mindestens in Brüssel Nord oder in Brüssel Midi, je nach Verbindung, müsste er umsteigen, im ungünstigsten Fall auch noch ein zweites Mal in Brügge. Die Direktverbindung von Köln nach Ostende existiert nicht mehr. Dabei wurde sie vor dem Zweiten Weltkrieg sogar zehn Jahre lang durch den Ostende-Köln-Pullman-Express bedient, Teil der schnellsten Verbindung zwischen Köln und London. Die Fahrpläne waren so ausgelegt, dass man innerhalb von knapp zwölf Stunden von Köln nach London kam, unter Einschluss der Fähre Ostende–Dover, und am nächsten Tag in der gleichen Zeit zurück. Dieser Express, betrieben von der Compagnie Internationale des Wagon-Lits (CIWL), war der einzige je in Deutschland betriebene seiner Art. Sein Hauptziel war die Beschleunigung des Verkehrs zwischen Großbritannien und dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet, sein Ziel nicht Ostende, sondern der Transit.
Auch für mich ist Ostende über viele Jahre nicht mehr gewesen als ein Fährhafen, ein klassischer transitorischer Ort. Beim ersten Mal sah ich davon praktisch nichts. Das war im Juli 1966, ich war achtzehn, und mit vielen anderen Jungmenschen befand ich mich auf dem Weg nach Swinging London, angeblich, um dort einen vierzehntägigen Feriensprachkurs zu absolvieren, den ich dann aber nur zweimal aufsuchte, ehe ich ihn auf die Straße oder ins Pub verlegte. Ein Zug hatte uns in der beginnenden Dunkelheit bis nach Ostende gebracht, und als wir dort ankamen, herrschte tiefe Nacht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir den kurzen Weg von Ostendes schönem Belle-Époque-Bahnhof zum Fähranleger zu Fuß gegangen sind oder ob es einen Shuttle gab. Von der Stadt jedenfalls sahen wir nichts als ein paar dunkle Umrisse, bis wir es uns auf der Fähre gemütlich machten und etwa vier Stunden später in einer milchigen Morgendämmerung die Kreidefelsen von Dover erblickten.
So ist es viele Jahre geblieben: Ostende selbst war weiter nicht von Interesse. Später nutzte ich meistens das Auto, um nach England zu kommen, und die Anfahrt zum Fähranleger verschaffte mir zwar einen schemenhaften Eindruck von der Stadt, aber sie blieb in meinen Augen Transitstation: als sei das hier womöglich so etwas Ähnliches wie Helmstedt/Marienborn.
PLÖTZLICHES GEBORGENSEIN
Das änderte sich an einem Novemberabend, irgendwann Anfang der Achtzigerjahre. Auf einer Rückreise aus dem englischen Südwesten erwischte ich in Dover nicht mehr die Fähre, die ich eigentlich hatte nehmen wollen, sondern erst die folgende, und kam damit schon am sehr fortgeschrittenen Abend in Ostende an. Dort plagte mich der Hunger, und da ich wusste, dass ich ohnehin erst mitten in der Nacht nach Hause kommen und um diese Zeit selbst in Köln wohl kaum noch etwas zu essen finden würde, fuhr ich mit dem Auto erstmals in meinem Leben die endlos lange Promenade mit ihren zahllosen Restaurants ab. Unglücklicherweise handelte es sich gerade um die Wochen im Jahr, in denen die meisten von ihnen geschlossen hatten, bevor sie rechtzeitig vor Weihnachten zur Wintersaison wieder öffneten. Nur sehr wenige waren erleuchtet, und als ich zögernd das einladendste von ihnen betrat, den Old Fisher, wäre ich am liebsten gleich wieder gegangen, denn es saß dort kein einziger Gast. Am Meer isst man bekanntlich zeitig, weil der Appetit schon am frühen Abend kommt: eines der unabdingbaren Kapitel in der großen Erzählung von der Heilkraft des Meeres und der Seeluft. Es ging auf halb elf zu, ich war ersichtlich zu spät. Doch eine Frau in den Dreißigern, mit rötlichen Locken, wasserblauen Augen und einem leichten Rosenteint, als sei sie einem Gemälde von François Boucher entsprungen, kam auf mich zu und bedeutete mir freundlich, Platz zu nehmen. Ich wählte einen Tisch direkt am Fenster und ahnte hinter der menschenleeren Promenade im Dunkel das Meer. Ich meine mich zu erinnern, dass ich ein Seezungenfilet aß. Es war nicht die ganz große Küche, aber ausgezeichnet zubereitet und präsentiert, wie in Belgien nicht anders zu erwarten, zu einer Zeit, als man in (West-)Deutschland das Essen als kulturellen Akt gerade erst zu entdecken begann. Niemand schien ungeduldig darauf zu warten, dass ich fertig wurde; auch meinen Kaffee konnte ich in aller Ruhe trinken und mich von einem sehr anstrengenden Tag erholen, der frühmorgens noch in Dorset begonnen hatte. Fast schien es mir, als sei dieses Restaurant an diesem Novemberabend nur für mich geöffnet gewesen und habe den ganzen Tag auf mich gewartet. Deshalb bleibt es für mich bis heute eines der besten der Welt. Dann fuhr ich zwei Stunden lang über die bekannten hell erleuchteten belgischen Autobahnen, verfuhr mich auch nicht im verknoteten Wirrwarr des Brüsseler Autobahnnetzes, fiel an der Grenze bei Aachen in die Dunkelheit zurück und war eine weitere Stunde später zu Hause.
Noch zwei Mal habe ich im Old Fisher gegessen, beide Male an einem frühen Sommerabend mit Blick auf eine um diese Zeit sehr betriebsame Promenade. Ebenso betriebsam war es im Lokal selbst, weil viele der Besucher der Stadt ihren Promenadenbummel oder den Gang über den Strand schon hinter sich hatten und nun redlich hungrig waren. Ich wurde von derselben Frau an meinen Tisch geführt und bildete mir ein, dass sie mich wiedererkannte, eine Vorstellung, die eher meiner Eitelkeit schmeichelte, als dass irgendwelche Wahrscheinlichkeit dafürsprach. Dann hatte das Restaurant eines Tages seine Pforten geschlossen. Vielleicht war das zum selben Zeitpunkt geschehen, als der Fährverkehr nach England eingestellt wurde. Die Wärme, die selbstverständliche Gastfreundschaft, mit der ich bei meinem ersten Besuch dort empfangen wurde, das Gefühl des plötzlichen Geborgenseins an diesem unwirtlichen Novemberabend hinterließen jedoch einen so starken Eindruck, dass ich schon auf der damaligen Rückfahrt unter der Schirmherrschaft der gelben Lichter erstmals die Möglichkeit erwog, die ganze Stadt Ostende könne ein ähnlich freundlicher Zufluchtsort sein wie dieses Restaurant.
EIN BEWEGLICHER ORT
Damit begannen meine kleinen Fluchten. Als Kölner stand ich mit ihnen keineswegs allein. Zumindest zu Karnevalszeiten war die belgische Küste für viele Rheinländer, die den jecken Tagen entfliehen wollten, ein beliebtes Ziel, und die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen waren auf diese Woche in der Vorsaison durchaus eingerichtet. Daran hat sich nach meiner Kenntnis bis heute nichts geändert.
Ich selbst gehörte jedoch eher selten zu diesen Karnevalsflüchtlingen. Meine kleinen Fluchten hatten andere Anlässe und verteilten sich über alle Jahreszeiten. Zuweilen war es einfach nur der Überdruss an der eigenen Stadt, und Ostende lag gerade weit genug weg, um einerseits den nötigen Abstand zu schaffen – Lüttich hätte nicht gereicht, denn es war, zumal am Wochenende, voller Kölner – und andererseits nicht einen halben Tag Anreise zu brauchen. Einmal war der Anlass eine noch nicht weit zurückliegende Trennung, ein anderes Mal eine Ausstellung, die im nahen Gent stattfand. In den meisten Fällen war es die Sehnsucht nach dem offenen Meer, und von Köln aus gab es keinen näher gelegenen Punkt, um diese Sehnsucht zu befriedigen. Und manchmal, zumal in den Sommermonaten, trieb mich einfach nur der Wunsch, in den gleichsam demokratischen Trubel eines Seebads einzutauchen, das schon lange nicht mehr chic war.
Doch das waren eben nur Anlässe. Nachdem ich die Stadt einmal entdeckt hatte, muss es etwas Tieferes gegeben haben, das mich immer wieder dorthin zog. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, um was es sich handelt: Ostende ist ein ideales Versteck. Wer Petri Tamminens großartiges Buch Verstecke gelesen hat, weiß, dass man sich keineswegs vollkommen den Blicken der anderen entziehen muss, um sich zu verstecken. Auch das Mittendrin, die Straße, ja, eine ganze Stadt können ein idealer Unterschlupf sein. Ostende ist für diese zuweilen überlebenswichtige Technik besonders geeignet, weil es per se schon an der Grenze des Untertauchens liegt: an der Grenze zwischen Land und Meer, einer Grenze, die die beiden Elemente ebenso sehr trennt wie verbindet und äußerst beweglich ist.
Ein Blick auf die Frühgeschichte der Stadt zeigt, dass das auf Ostende ganz besonders zutrifft. Ursprünglich lag der Ort nämlich am östlichen Ende der Insel Testerep, womit die alte Preisfrage, warum ein Badeort am westlichen Ende Europas Ostende heißt, beantwortet wäre. Auf Testerep wurde bereits im neunten und zehnten Jahrhundert vor allem Schafzucht betrieben, in geringerem Maße wohl auch Fischerei. Die Insel lag unmittelbar vor dem damaligen Küstenstreifen und war von ihm nur durch einen natürlichen Kanal getrennt, den Testerepvliet. Schon bald wurde das Gebiet eingedeicht und durch Schleusen und Siele entwässert, wobei auch die größeren Orte auf dieser Insel entstanden: Ostende, Middelkerke und Westende, alles Ortschaften, die man heute bequem mit der berühmten Küstenstraßenbahn erreichen kann, von der später noch zu reden sein wird. Im Lauf der Zeit verlandete der Testerepvliet vollständig; Ostende fand sich auf dem Festland wieder und erhielt 1267 die Stadtrechte.
Es mag sein, dass der Mensch, gewissermaßen von Hause aus, »ein Landtreter« ist, wie ihn Carl Schmitt in seinem Essay Land und Meer nennt. Aber gleich anschließend stimmt es schon nicht mehr so ganz: »Er steht und geht und bewegt sich auf der festgegründeten Erde. Das ist sein Standpunkt und sein Boden; dadurch erhält er seinen Blickpunkt; das bestimmt seine Eindrücke und seine Art, die Welt zu sehen.« So mag das vom Festland betrachtet aussehen, zumal von den Hügeln des Sauerlandes aus. Nur, dass man die Welt von diesem Standpunkt aus nicht immer ganz richtig sieht, was schon mit der Mär von der »festgegründeten Erde« beginnt. Küstenbewohner wissen das und wussten es schon immer, weil sie Teile des Landes, auf dem sie wohnten, dem Meer abgewonnen hatten, und sie wissen auch, zumal heutzutage, dass sie es ebenso gut wieder ans Meer verlieren können. Man erinnert sich an dieser Stelle zum Beispiel an den schönen Satz eines französischen Reisenden aus dem siebzehnten Jahrhundert: »Der liebe Gott hat die ganze Welt erschaffen, ausgenommen die Niederlande, die haben die Holländer gemacht.«
Im Gegensatz zu der heutigen Tendenz, die Grenzen an Land überall wieder zu befestigen und zu schließen und neue zu errichten, ist die Grenze zwischen Land und Meer, allen Deichen zum Trotz, immer eine offene. Selten so offen wie an der belgischen Küste: Hier fehlen nämlich jene Deiche, die wir aus Deutschland oder den Niederlanden kennen und hinter denen sich irgendwo das Meer versteckt. In Belgien steigen die Ufer entlang der gesamten Küstenlinie so schnell an, dass man auf die vielfache Eindeichung vorerst verzichten kann und dem Meer lediglich ein System von Dünen und Dämmen entgegenstellt, das nie den Blick aufs Wasser versperrt. Auch der seit 2012 neu gestaltete Zeeheldenplein mit der orange leuchtenden Skulpturenkunst von Arne Quinze dient in seiner wellenbrechenden Konstruktion dem Schutz Ostendes. Die große Sturmflut 1953, die hauptsächlich die Niederlande und Großbritannien traf, ließ jedoch auch Ostende nicht völlig ungeschoren. Die Innenstadt wurde bis zu einer Höhe von zwei Metern überflutet.
Alle bisherigen Maßnahmen könnten sich allerdings mit dem Klimawandel als unzureichend herausstellen, denn bis zum Ende dieses Jahrhunderts dürfte der Meeresspiegel um etwa einen Meter gestiegen sein. Die flämische Regierung denkt deshalb über extreme Maßnahmen nach. Die radikalste wäre die Teilung des Küstenstreifens in einen Ost- und einen Westteil. Der Ostteil, der sich von Ostende bis zum immer noch um Mondänität bemühten Knokke und an die niederländische Grenze erstreckt, würde besonders geschützt und in ein großes Stadtgebiet verwandelt, also »urbanisiert« werden, während die andere Hälfte, die bis zur französischen Grenze reicht, zum Überflutungsgebiet gemacht würde. Dabei sollen die dicht gedrängten Ortschaften in diesem Teil, die ohnehin etwas höher liegen und zu denen eine Reihe beliebter Badeorte wie Nieuwpoort und De Panne gehören, natürlich nicht geflutet, sondern ihr Hinterland in ein entsprechendes Biotop umgeformt werden, das zudem, so hofft die flämische Regierung, eine neue Gruppe Touristen anziehen würde. Ob diese radikalen Pläne aber jemals Wirklichkeit werden, ist bei der bekannten Neigung der Belgier zum Kompromiss und zu weniger schmerzhaften Lösungen (oder, wenn man es so überheblich ausdrücken will, zum Durchwursteln) durchaus fraglich.
KLEINE WAPPENKUNDE
Das Wappen der Stadt Ostende zeigt einen goldenen Schild mit drei Schlüsseln, bekränzt von einer fünfzackigen Krone in Gold. Die Schildhalter sind rechts ein Wassermann, der in der rechten Hand ein silbernes Schwert mit goldenem Griff trägt, auf der linken Seite eine Meerjungfrau, die in der linken Hand einen goldenen Spiegel hält. Das Ganze auf blauem Wellengang, darunter das Belgische Kriegskreuz mit Palme aus dem Zweiten Weltkrieg über einem Netz, unter dem sich ein Dreizack und eine Fischschaufel kreuzen, darunter ein goldener Anker mit silbernen Ketten. Ich bin kein Experte der Heraldik, aber summarisch lässt sich sagen, dass dieses Wappen, wie so viele andere, zunächst einmal von Wehrhaftigkeit zeugt. Darüber hinaus spricht es von der Verankerung des Ortes im Meer und auch von den Erträgen, die das Meer der Stadt bringt. Die Stadt selbst jedoch, die festgegründete Erde, die Carl Schmitt sich ausmalt, ist überraschenderweise nirgends sichtbar. Das Wappen kehrt dem Land den Rücken zu.
Mein persönliches Wappen von Ostende hätte dagegen die Form einer Muschel. Ein Blick auf die Karte kann das erklären. Von Osten her über die A10 kommend, kann man die allmähliche Verbreiterung der Stadt verfolgen, je weiter man sich in ihr aufs Meer zubewegt, sodass sie kartografisch etwa die Form einer Herzmuschel bildet.
Unter der Muschelschale dieser Stadt, so erfuhr ich bald bei meinen Besuchen, kann man sich durchaus geborgen fühlen: geschützt besonders vor allem, was hinter einem liegt. Denn um das, was hinter ihr liegt, scheint sich die Stadt Ostende nicht zu scheren. Als Küstenstadt ist sie kein Ort mit Hinterland, keine Regionalmetropole, auf die die Wege des Umlands zulaufen, kein Marktort für Landprodukte. Die nächste Regionalmetropole liegt weiter im Landesinnern und heißt Brügge. In Ostende angekommen, verspürt man keinerlei Bedürfnis, einen Ausflug nach Zandvoorde oder Oudenburg zu machen, so heißen die beiden nächstgelegenen Örtchen. Aber das Landesinnere interessiert die Stadt, ihre Bewohner und ihre Besucher nicht, es ist zu überwindende Wegstrecke bei der Anfahrt. Hat man sie bewältigt, liegt das ganze Land hinter einem, und man dreht sich nicht nach ihm um, solange man sich in Ostende aufhält.
Muscheln sind an das Leben im Wasser gebunden, vorwiegend in geringer Tiefe. Sie gehören jenem Bereich an, in dem die Grenzen zwischen den Elementen Wasser und Erde unscharf werden, in dem beide sich berühren. Dieser Bereich schärft das Bewusstsein für die Unbeständigkeit der Dinge. Man weiß, dass die Gestalt der Küste sich ständig ändert, dass sie Übergangsbereich par excellence ist, jederzeit vom Untergang bedroht. Natürlich gilt diese amphibische Existenzform mehr oder weniger für alle Küstenorte, für Ostende aber ganz besonders. Einst auf einer Insel gelegen, also gleichsam aus dem Meer geboren, richtet die Stadt ihren Blick nach wie vor entschlossen dorthin und tut alles, um auch ihren Bewohnern und speziell ihren Besuchern diesen Blick zu ermöglichen und zu empfehlen, aus gutem Grund: Bekanntlich ist der unmittelbare Blick vom Strand zurück auf die Stadt nicht sehr erfreulich. Das gilt nicht nur für Ostende, sondern beinahe für den gesamten belgischen Küstenstreifen.
PHANTASIEN IM GLÄSERNEN BUNKER (1)
Als ich vor Kurzem, auf einer Rückreise aus Südengland, zum ersten Mal mit meiner Frau in Ostende war, sagte sie: »Sei mir nicht böse, aber für mich sieht das hier aus wie Wilhelmshaven.« Überflüssig zu erwähnen – und bei allen Wilhelmshavenern vorauseilend Abbitte leistend –, dass das nicht als Kompliment gemeint war.
Zweifellos hat meine Frau irgendwie recht, obwohl sie an diesem Abend gar nicht viel von der Stadt gesehen hat, weil kurz nach unserer Ankunft ein sehr unangenehmer, kalter Dauerregen einsetzte. Niemand, der bei ästhetischem Verstand ist, könnte das heutige Ostende als eine rundum schöne Stadt bezeichnen. Vor dem Ersten Weltkrieg war die Strandpromenade von prachtvollen Bauwerken gesäumt, die von damaligen Reisebroschüren als unvergleichlich gepriesen wurden. Auch in der Zwischenkriegszeit verlor Ostende nichts von seinem Glanz. Es mag sogar sein, dass nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs noch eine Zeit lang die Chance bestanden hat, die Eleganz der Stadt zu erhalten und zu transformieren, sie gewissermaßen in die Moderne zu retten. Doch schon in den Sechzigerjahren haben sich fast alle Städte an der belgischen Küste dafür entschieden, nicht mit sich selbst zu wuchern, sondern Kapital aus dem freien Blick aufs Meer zu schlagen – möglichst für alle. Zora del Buono, die 2009 die 68 Kilometer mit der Küstenstraßenbahn von Knokke bis De Panne abgefahren ist und zu Beginn ihrer Reportage über diese Fahrt ihr Entsetzen über die dort aufgetürmten architektonischen Verbrechen nicht verbirgt, kommt am Ende zu dem Schluss: »Ein jeder hat seinen Blick aufs Meer verdient, egalitäre Architektur thront vor den Gründerzeitvillen: Besser, es können tausend Menschen neben- und übereinander gestapelt das Meer genießen als nur ein Villenbesitzer mit seiner Apanage. Glückliches Belgien.«
In der Tat kann man die gläserne Skyline, die den belgischen Küstenstreifen säumt, mit viel gutem Willen als den Sieg des demokratischen Gedankens in der Architektur ansehen, was beweist, dass das demokratische Prinzip, wenn es architektonische Gestalt annimmt, durchaus brutale Ergebnisse zeitigen kann: Égalité – Fraternité – Brutalité. Ist andernorts die exzellente Aussicht das Privileg der Reichen und Schönen, etwa am Zürichsee oder am Starnberger See, so muss der Käufer oder temporäre Mieter eines Glasbunkers in einem der sechs- bis zehnstöckigen Hochhäuser an der Ostender Promenade noch keine Phantasiepreise zahlen, um jeden Morgen nach dem Aufwachen den Blick aufs offene Meer zu genießen.
Ich selbst träume seit vielen Jahren davon, für ein paar Wochen ein Appartement in einem dieser Glaskästen als Ferienwohnung zu mieten. Bisher war das nur einem Helden meiner literarischen Phantasie namens Gregor Korff vorbehalten, weil ich selbst nie länger als drei oder vier Tage hintereinander in Ostende zugebracht habe, wogegen mein Protagonist sich mehrfach über Monate im gemieteten Ferienappartement versteckte und niemand wusste, wo er war.