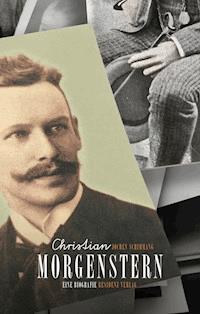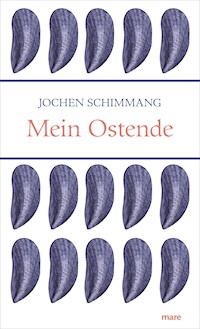Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rainer Roloff führt ein zurückgezogenes Leben. Fragte man ihn nach seiner »Erwerbsbiografie«, so würde er sich als »Privatgelehrter« bezeichnen. Struktur bekommt sein Leben dank einer Langzeitstudie zum Einfluss des Schlafs auf das Gedächtnis, an der er als Proband teilnimmt. Dafür reist er regelmäßig von Köln nach Düsseldorf, selbst in Zeiten der Pandemie, um im Labor seine an das Aufwachen anschließenden Gedanken zu Protokoll zu geben. Roloff, ein Jahr älter als die Bundesrepublik, ist ein idealer und ergiebiger Proband, mit einem Elefantengedächtnis und Aufmerksamkeit für den Zusammenhang zwischen dem kollektivem Unbewussten und der individuellen Erinnerung. Dr. Meissner, der die Studie leitet, findet überwiegend »sehr gelungen«, was sein Proband ihm in einer Mischung aus zeitgeschichtlicher und persönlicher Erinnerung und spielerisch-absurder Noch-Traum-Logik erzählt. Doch dann gerät das Gedächtnis des Schlafforschers selbst aus dem Gleichgewicht… Einmal mehr erweist sich Jochen Schimmang als Meister einer nonchalanten Melancholie, als hintersinniger Chronist der Geschichte, deren teilnehmender Beobachter er ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49 a
D - 22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten
© Edition Nautilus 2020
Erstausgabe März 2022
Umschlaggestaltung:
Maja Bechert
www.majabechert.de
1. Auflage
E-Book-ISBN 978-3-96054-279-7
In memoriam Hermann Kinder (1944 – 2021)
Please don’t spoil my day
I’m miles away
And after all
I’m only sleeping
The Beatles: Revolver (1966)
Everything is very quiet
Everyone has gone to sleep
I’m wide awake on memories
These memories can’t wait
Talking Heads: Fear of Music (1979)
… alles ein Gestern, das nicht aufhört
zu sprechen und keiner mehr hören will? Warte mal ab.
Jürgen Becker: Graugänse über Toronto (2017)
Inhalt
ERSTER TEILTULIPAN ODER DIE LIEBE ZUR SOZIOLOGIE
ZWEITER TEILERINNERUNGEN AN DEN TOAST MOZART
DRITTER TEILDIE VERLASSENE ZÜNDAPP
VIERTER TEILDAS GRÜNE BUCH
FÜNFTER TEILTRÄNENSÄCKE UND FREIER FALL
STELLENKOMMENTAR
Danksagung
ERSTER TEILTULIPAN ODER DIE LIEBE ZUR SOZIOLOGIE
1Alles löschen. Löschen, bis es nicht mehr wiederkommt. Mit Dateien bekomme ich das hin, mit den gesammelten Papieren, Dokumenten und Briefen auch, mit den persönlichen Aufzeichnungen, die man bei ansteigender Schamröte nach zwölf Jahren wiederliest, sowieso. Doch Erinnerungen gleichen Ratten oder Kakerlaken, man kann alle möglichen Mittel gegen sie einsetzen, sie kehren irgendwann wieder. Tabula rasa ist eine Schimäre, denke ich, selbst nach einem Unfall mit Hirnschaden bleibt noch immer etwas zurück. Mein Gedächtnis scheint ein unzerstörbarer Bunker zu sein, in dem fast der ganze Unrat meines Lebens gelagert wird.
»Da täuschen Sie sich«, sagte Dr. Meissner, als wir uns das erste Mal trafen. »Sie würden staunen, wenn Sie wüssten, was Sie alles vergessen haben. Sie wären nämlich schon lange tot, wenn Sie nie etwas vergessen würden. Kein Mensch hält das aus. Aber so, wie Sie sich selbst beschreiben, sind Sie auf jeden Fall unser Mann.« Das war vor knapp neunzehn Monaten, genau genommen am siebenundzwanzigsten August 2018, einem Montag. Diesen ganzen Datenmüll, zum Teil Jahrzehnte zurückliegend, kriege ich auch nicht aus meinem Gedächtnisbunker getilgt. Allerdings wäre das in diesem Fall auch schwierig, denn es war nach dem Tag, als in Chemnitz die Übungen zur Menschenjagd begonnen wurden, und auf dem Weg nach Düsseldorf, damals noch mit dem Auto, war das Radio voll davon. Alle hatten es gesehen, nur ein Mann mit sehr kleinen runden Brillengläsern fand keine belastbaren Beweise dafür, weil er über die Maaßen kurzsichtig war.
Wir saßen im fünften Stock eines Düsseldorfer Hochhauses in Dr. Meissners Büro einander gegenüber, getrennt durch eine überdimensionale Schreibtischfläche, die kaum von irgendwelchen Papieren oder Büchern oder Schreibwerkzeug bedeckt war und vor allem Leere, Klarheit, Aufgeräumtheit und Chef signalisierte. Noli me tangere. Ganz entfernt konnte ich auf die in der Straßenschlucht vorbeiziehenden Autos blicken, die von hier oben alle lautlos und seltsam verlangsamt voranzukriechen schienen, obwohl offensichtlich kein Stau herrschte.
Auch eine meiner ersten deutlichen Erinnerungen aus der Kindheit ist übrigens mit einem historischen Datum verbunden, das damals noch nicht historisch war, aber sehr schnell das Zeug dazu hatte, ein Gedenktag zu werden: der siebzehnte Juni 1953. Ich war fünf Jahre alt und saß in der Küche meiner Großmutter am Tisch, während sie Kartoffeln schälte, und das Radio lief auch hier. Vom Hinterhof schien die Sonne in die Küche, und wenn ich auch wenig verstand von dem, was erzählt wurde, begriff ich doch, dass etwas in Unordnung geraten war und meine Großmutter Angst hatte. Dass es der Sozialismus war, der in Unordnung geraten war, verstand ich erst später, als die Ereignisse schon zum Gedenktag geronnen waren. Meine Großmutter war auch alles andere als eine Sozialistin, wie ich später erfuhr, sie hatte nur vor jeder Art von Unordnung Angst. Es interessierte sie nicht, dass der Sozialismus in Unordnung geriet, sie hatte nur die Angst: die Russen kommen. Auch das erzählte ich Dr. Meissner bei unserer ersten Begegnung, und er wiederholte: »Sie sind auf jeden Fall unser Mann.«
So wurde ich der achte von insgesamt sechzehn Probanden.
Vorgestern, IC 2453 Ankunft Düsseldorf Hbf 17:05, Zeit des vorabendlichen Berufsverkehrs, Anfang März. Mein Arbeitsbeginn rückt näher. Entspannte Fahrt, die Augen halb geschlossen, während draußen »Leverkusen« vorbeizieht. Gibt es »Leverkusen«, frage ich mich jedes Mal auf dieser Strecke. Nach dem Aussteigen vorbei an nervösen kleinen Menschenpulks, freudig oder angespannt. Rückwärtiger Ausgang, Taxi nach Flingern. Der Fahrer ist schweigsam. Ich frage ihn, ob er bald Feierabend hat. Eine meiner Standardfragen, um das Schweigen nicht zu sehr aufzuladen, obwohl ich jeden, der gern schweigt, bestens verstehe. »Habe gerade angefangen«, sagt der Fahrer, »fahre durch bis morgen früh um sechs.« Warum überrascht mich immer noch das zwar nicht akzentfreie, aber grammatikalisch einwandfreie Deutsch, warum muss ich mir die Frage woherkommSie verkneifen. Ich tippe auf Afghanistan. Du lebst seit Jahrzehnten in einem Multikultiland, weißer alter Mann, und es gefällt dir doch. Warum dann diese Fragen noch immer im Hinterkopf. »Ich setze Sie direkt hier vorm Haupteingang ab«, sagt der Fahrer jetzt und fragt, ob ich eine Quittung brauche.
Oben angekommen der übliche Satz: Da bin ich mal wieder. Und die Antwort: Sie sind es. Willkommen, Herr Roloff. Möchten Sie etwas trinken. Solche Begrüßungsrituale gehören zu meiner Arbeit.
Manche sammeln Leergut; ich schlafe. Vom Ertrag her ist meine Tätigkeit deutlich lohnender, und im Ansehen rangiert sie weit über der erstgenannten. Während andere Papierkörbe und Parks durchstöbern, immer mit der lauernden Befürchtung, es könnten fremde Blicke auf ihnen ruhen, liege ich, als klinisches Objekt, in ebenso klinisch sauberer Bettwäsche und gleite hinüber, vielfach kabelfrei verstöpselt zwar, aber das stört mich schon lange nicht mehr. Es handelt sich in mehrfacher Bedeutung des Wortes um einen Traumberuf.
Zwar werde ich über die gesamte Schlafzeit beobachtet und gemessen, aber gerade im Schlaf spüre ich den Blick des Anderen nicht. Davon habe ich mein Leben lang geträumt. Und der erste Blick nach dem Aufwachen ist immer freundlich: dankbar, dass ich mich – wieder einmal – zur Verfügung gestellt habe.
Dann beginnt der Tag, auf Wunsch bekomme ich noch Frühstück, und danach trete ich auf die Straße, in Lübeck, Göttingen, Düsseldorf, auch zu Hause in Köln. Berühmter Schläfer, der ich bin. Jedenfalls in der Szene; die Ewigwachen wissen nichts von mir. Die 24/7-Zombies mit ihren weit aufgerissenen Augen.
Im Labor kommt Dr. Meissner auf mich zu, lächelnd, warmherzig, beides nicht in professioneller Manier, sondern mit der aufrichtigen Wiedersehensfreude, die man guten Freunden entgegenbringt. »Schlafmediziner sind Tiefseeforscher«, hat er einmal gesagt, nachdem ich zum fünften oder sechsten Mal bei ihm aufgewacht war. »Wer den wachen Menschen erforscht, hat es mit einer ganz anderen Wirklichkeit zu tun als wir. Ein Mensch, der wacht, ist eine völlig andere Person als ein Mensch, der schläft. Klingt banal, aber kaum jemand denkt das konsequent zu Ende. Ich bewerte das nicht. Unser Forschungsgebiet steht in der Hierarchie nicht höher als, sagen wir mal: die Ernährungsforschung. Aber auch nicht darunter, obwohl wenigstens die Öffentlichkeit das so zu sehen scheint. Alle Magazine sind voll mit Ernährungstipps, und was die Förderung mit öffentlichen und privaten Mitteln angeht – ein Unterschied wie Tag und Nacht, buchstäblich. De facto ist der Tag offenbar doch unendlich viel wichtiger. Richtig essen, fit sein für die anstehenden Aufgaben. Dagegen die Nacht: Manchmal glaube ich, unsere Gesellschaft findet es schade, dass man überhaupt schlafen muss. Deshalb wurde an uns Schlafforscher allen Ernstes schon die Frage gestellt: Ließe sich eventuell der Schlaf ganz abschaffen? Pervers, absolut pervers, finden Sie nicht?«
Ich habe zugestimmt, das ist klar. Nicht aus Opportunismus, sondern von ganzem Herzen. Schlaf abschaffen ist wirklich pervers, ich fand den Ausdruck nicht zu stark. Au contraire: Ich wäre sehr interessiert daran, ob man den Schlafzustand – der ja das blühende Leben ist – mehr oder weniger ins wache Leben hinüberretten kann. Ins Tagesleben. Das habe ich Dr. Meissner damals auch gesagt, das ist nun schon fast anderthalb Jahre her. Seitdem sind wir Freunde auf Distanz. Vielleicht auch nur Kollegen, die an derselben Aufgabe arbeiten: Tiefseeforschung. Jedenfalls verkehren wir auf Augenhöhe. Deshalb ist seine Wiedersehensfreude echt.
Der Schlaf und seine blühenden Landschaften
Dann muss Dr. Meissner sich anderen Schläfern und Schläferinnen zuwenden, die gerade eingetroffen sind; ich weiß nicht, ob Probanden oder Patienten. Wir Schläfer sprechen eigentlich selten miteinander; meistens bekommen wir die anderen gar nicht zu Gesicht. Aber vorgestern herrschte wohl eine gewisse Terminenge. Ich suchte dann mein Zimmer auf – es ist immer das gleiche Zimmer – und nahm es in Besitz.
Ich bin oft im Düsseldorfer Labor, es ist das mir vertrauteste, auch wenn ich in Lübeck angefangen habe. Das Labor in Düsseldorf ist nicht etwa mein zweites Zuhause, sondern inzwischen doch eher das erste. In Köln bewohne ich nur ein Zweizimmerloch mit Kochnische und Nasszelle in der Nähe des Hansarings. Da halte ich mich so selten wie möglich auf und schlafe nachts mit Ohrstöpseln aus Silikon, weil die Züge zum und vom Hauptbahnhof so nah an der Wohnung vorbeifahren. Manchmal bleiben sie auf Höhe meiner Fenster stehen und warten auf Einfahrt. Die Ohrstöpsel heißen witzigerweise WellNoise. Das nenne ich mir Dialektik.
In Düsseldorf handelt es sich um eine Langzeitstudie. Also ist es wie Nachhausekommen, wenn ich mein Zimmer im Labor betrete. Gespannt bin ich jedes Mal auf die Bettwäsche: graubeige, sandgelb, staubgrau, zeltgrau, einfarbig ohne Muster, das Schrillste bisher war zitronengelb. Auf keinen Fall weiß, weiß ist Klinik, und nie schwarz, schwarz ist dann doch beinahe Grab, und die ganze Geschichte mit Schlafes Bruder ist totaler Quatsch, versteht sich.
Im Zimmer, das wird manchen überraschen, gibt es auch einen Fernseher mit einem 42er-Bildschirm, obwohl alle Schlafforscher wissen, dass Fernsehen der Einschlafkiller par excellence ist. Das Zimmer soll jedoch so alltäglich sein wie möglich, und in vielen Schlafzimmern, das ist bekannt, steht nun einmal am Fußende des Bettes ein Fernseher. Ich selbst nutze ihn so gut wie nie, höchstens die Textnachrichten, sehe auch schon mal die Tagesschau. Ansonsten habe ich immer ein oder zwei Bücher dabei, die mir beim Einschlafen helfen, was nichts über ihre Qualität aussagt. Ich bin seit Jahren schon vor allem ein Wiederleser. Die Anzahl der Bücher, die sich zwei, drei oder vier Mal zu lesen lohnt, ist zum Glück gegenüber denjenigen, die sich überhaupt nicht zu lesen lohnen, überschaubar, aber doch ausreichend für lange Zeit. Insofern bin ich als Wiederleser in einer glücklichen Lage.
Das Zimmer also, die Rückkehr nach Hause. Dafür habe ich im Normalfall eine halbe Stunde Zeit. Nach dieser halben Stunde kommt eine Mitarbeiterin und übernimmt. Eine davon kenne ich seit meinem ersten Auftritt in diesem Labor. Es handelt sich um Frau Wobser, die, glaube ich, schon seit der Gründung dieser Praxis dabei ist. Vorgestern war Frau Wobser nicht da, Frau Wobser hatte Urlaub, stattdessen erster Auftritt, jedenfalls was mich betrifft, von Frau Dr. Hoss, das sagte das Namensschild auf ihrer linken Brust, und kaum war sie im Zimmer, rief Dr. Meissner, Barbara, kommen Sie noch mal eben, und schon wusste ich auch ihren Vornamen.
Ich muss erklären, warum ich von Auftritt spreche. Wenn man erstmals in eine neue Umgebung, einen neuen Kreis, an einen neuen Arbeitsplatz kommt, das ist doch ein Auftritt. Der Blick der Anderen mag indifferent, freundlich, abweisend, interessiert oder wie auch immer wirken: Immer steht der Neuankömmling auf der Bühne. Jedenfalls empfinde ich das so. Und das wiederholt sich in vielen Situationen, etwa, wenn ich das erste Mal an einem Tag auf die Straße gehe, nur, dass ich mich im unmittelbaren Nahbereich erst einmal geschützt fühle. Geschützt heißt unbeobachtet. Oder zunächst von Nachbarn gesehen werden, die man schon Jahre kennt, auch wenn man in manchen Fällen noch immer ihren Namen nicht weiß. Aber schon wenn ich in den Hansaring einbiege, ändert sich die Situation.
Als Frau Hoss ins Zimmer kommt, ist das nicht ihr erster Auftritt im Labor, sie arbeitet schon acht Wochen dort, wie ich dann erfahre. Aber ich selbst habe sie noch nie hier gesehen. Ich bin schließlich nicht jede Woche in Düsseldorf, trotz Langzeitstudie.
Die Langzeitstudie gilt der Gedächtnisbildung während des Schlafs und vermöge des Schlafs, obwohl das in der Forschung schon fast ein alter Hut ist. Dass guter Schlaf fürs Gedächtnis eine herausragende Rolle spielt, ist Konsens. Gedächtnisbildung ist auch nur offiziell der Fokus der Langzeitstudie. Dr. Meissner möchte mehr herausbekommen und erfasst bei sechzehn Probanden und Probandinnen unterschiedlichen Alters, welche Erinnerungen aus ihrer Lebenszeit, persönlicher oder zeitgeschichtlicher, also kollektiver Art, ihnen in den ersten zwanzig Minuten nach dem Aufwachen zuerst kommen. Also in der Zeit des Übergangs, wenn man in beiden Wirklichkeiten zugleich ist. This time of sweet and thoughtful doziness. L’espace transitoire. Es geht um die Assoziationskette, die da abläuft. Nicht die Traumreste, vergessen Sie mal vorübergehend Freud. Eher das kollektive Unbewusste, das die individuelle Erinnerung mitbestimmt und das auch bei jedem anders arbeitet, je nach seinen Verhältnissen. Und seinem Alter. Bei meinem ersten Auftritt im Labor sagte Dr. Meissner zu mir, ich sei ein idealer Proband, weil ich ein Jahr älter sei als die Bundesrepublik, und er sei sehr gespannt.
Inzwischen weiß ich, dass an der Studie acht Frauen und acht Männer teilnehmen; ich habe aber noch niemanden davon kennengelernt, auch nicht per Zufall.
Ich war kein Neuling mehr in der Welt der Schlaflabore. Der Lübecker Kollege von Dr. Meissner hat mir den Tipp gegeben beziehungsweise mir einen Link zugeschickt, mit einem regelrechten Inserat. Das wäre was für Sie, hat er geschrieben. Das Inserat war so formuliert, ich kann es auswendig: Wir suchen Probanden von 20 bis 80 Jahren mit ungestörtem Schlaf. In einer Langzeitstudie soll der Zusammenhang zwischen Schlaf und Gedächtnis weitergehend untersucht werden. Eine Aufwandsentschädigung ist vorgesehen.
Das ist in der Tat was für mich, habe ich gedacht. Zwischen zwanzig und achtzig kommt hin, ungestörter Schlaf kommt weitgehend hin, die Thematik interessiert mich, und Aufwandsentschädigung ist selbstverständlich, schließlich geht es entscheidend auch um die Aufbesserung meiner Rente.
Nach meinem ersten Aufwachen in Düsseldorf dachte ich an Barschel. Uwe Barschel. Der Fall Barschel, Herbst 1987. Von Kiel nach Genf, Hotel Beau-Rivage, Zimmer 317. »Erzählen Sie mal etwas genauer«, sagte Dr. Meissner, »ich bin zwanzig Jahre jünger als Sie: Ich war damals neunzehn oder zwanzig. Ich weiß noch, dass da was war, aber ich befand mich gerade am Anfang meines Studiums. Eigentlich weiß ich nur noch: Toter Mann in der Badewanne.«
Darauf lief es damals in der Tat hinaus.
In der alten Bundesrepublik, wie man heute gern zu sagen pflegt, in dem Land Schleswig-Holstein – das es selbstverständlich auch noch in der neuen Bundesrepublik gibt – standen im September 1987 Landtagswahlen an. Der amtierende Ministerpräsident, ein christdemokratischer Youngster von gerade 43 Jahren, der schon seit fünf Jahren das Land regierte, dieser Uwe Barschel eben, musste den Prognosen nach um seinen Wahlsieg bangen und setzte über seinen Medienreferenten,* einen Herrn Pfeiffer, alle möglichen schmutzigen Tricks ein, um den Oppositionsführer zu diskreditieren. So berichtete es kurz vor der Wahl ein bekanntes Nachrichtenmagazin, dem der Medienreferent das persönlich erzählt hatte. Seine Aussagen hatte er außerdem eidesstattlich bei einem Notar hinterlegt. Wie immer sich diese Nachrichten auf die Wahl ausgewirkt haben mögen, jedenfalls verteilten die Wähler dieses Bundeslandes ihre Stimmen am Wahltag so, dass der Ministerpräsident selbst mit Hilfe der Freien Demokratischen Partei, die gern mit ihm kopuliert hätte, keine Mehrheit erreichte, andererseits aber von der Opposition, auf deren Seite auch der Abgeordnete der dänischen Minderheit im Lande stand, ein Mann namens Karl Otto Meyer, nicht abgewählt werden konnte. Der Däne schlug deshalb vor, die Sozialdemokraten als stimmenstärkste Partei sollten mit den Liberalen eine Regierung bilden, aber der Chef der Liberalen, dessen zumindest wirtschaftspolitisches Leitbild die englische Premierministerin Maggie Thatcher war, mochte sich nun mit den Sozis wirklich nicht gemein machen. Allerdings mochte er sich auch mit Uwe Barschel, mit dem er über eine Koalition verhandelte, nach dem Verhandlungstermin nicht zusammen fotografieren lassen. On ne sait jamais.
Der Ministerpräsident wies die Vorwürfe seines ehemaligen Medienreferenten entschieden zurück. Diesen Herrn konnte man übrigens noch am Wahlabend in einem Fernsehinterview sehen, und er machte einen bedrückten, auch unsicheren Eindruck, ein wenig, als befände er sich in einer Alkoholdepression. Der Kronzeuge gegen den Ministerpräsidenten erschien also zunächst nicht besonders glaubwürdig, und das mag Uwe Barschel seinerseits zu dem Glauben bewegt haben, er könne am Freitag nach der Wahl die Sache damit ad acta legen, dass er auf einer Pressekonferenz sein persönliches Ehrenwort gab, von all den Machenschaften seines Medienreferenten nichts gewusst zu haben. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort – ich wiederhole: mein Ehrenwort, ein Satz, der unvergessen in die politische Folklore der alten Bundesrepublik eingegangen ist. Doppelt hält besser, mochte er gedacht haben. Wie beim Indianerspielen: Ehrenwort, ich habe nichts gesehen. Eine Woche später gab der Ministerpräsident dann seinen Rücktritt bekannt, und danach ist es nicht mehr beim Indianerspielen geblieben.
Der ehemalige Ministerpräsident ist dann erst einmal in den Urlaub gefahren, wobei seine Partei zunächst nicht gewusst hat, wohin. Später hat man erfahren, dass er sich im Haus eines Waffenhändlers auf Gran Canaria aufgehalten hat. In seiner Abwesenheit hat der Finanzminister vor dem inzwischen eingesetzten Untersuchungsausschuss einen Hinweis darauf gegeben, dass zumindest ein Teil des Ehrenworts wohl unzutreffend sei, denn der ehemalige Ministerpräsident habe schon sehr früh etwas gewusst. Seine Partei hat ihn dann aufgefordert, sein Landtagsmandat niederzulegen, und zugleich dem Finanzminister ihr Vertrauen ausgesprochen, obwohl dieser ja recht lange mit seinem Wissen hinterm Berg gehalten hatte. Man kann jedoch nicht alle auf einmal abschießen, dann bleibt nichts mehr übrig von einer funktionsfähigen Partei.
Inzwischen hatten auch die Sozialdemokraten zugeben müssen, schon viel früher mehr gewusst zu haben, als sie bis dahin zu Protokoll gegeben hatten, denn Barschels Medienreferent Pfeiffer hatte dem Pressesprecher der SPD vertraulich erzählt, was er so alles im Schilde führte, worauf dieser ihm gleich noch ein paar Tipps gab, wie man das am besten anfängt. Die anderen Parteien haben deshalb den Oppositionsführer zum Rücktritt aufgefordert, was der aber ablehnte, weil er rein gar nichts davon gewusst habe. Eine Versicherung, die klugerweise ohne Ehrenwort erfolgte.
Dieser Stand der Dinge war dann nicht mehr relevant, als einen Monat nach der Wahl der ehemalige Ministerpräsident in einem Genfer Luxushotel tot aufgefunden wurde. Nun war es tatsächlich kein Indianerspielen mehr, sondern eher ein Roman von Eric Ambler. Der Reporter einer Hamburger Illustrierten, die noch immer unter den Nachwehen des vier Jahre zurückliegenden Komplexes Hitler-Tagebücher litt, war mit Barschel zu einem Interview verabredet, und nachdem er und der ihn begleitende Fotograf mehrmals vergeblich an die Tür des Zimmers 317 geklopft hatten, öffneten sie diese und fanden den potentiellen Gesprächspartner bekleidet und mausetot in einer gefüllten Badewanne liegen. Das daraufhin gemachte Foto hat zwar viel Empörung hervorgerufen, ist aber brav von vielen Zeitungen abgedruckt und auch vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt worden. Überhaupt ist der Journalismus bei der Verfolgung seiner vornehmsten Aufgabe, der Aufklärung und kritischen Information der Öffentlichkeit, sehr konsequent vorgegangen, also gnadenlos.
Genützt hat es aber nichts, denn man hat nichts mehr aufklären können, was auch an einer gewissen Schlampigkeit der ermittelnden Schweizer Behörden lag. In der Folge blühten die Erzählungen. Es war unter anderem von Waffenhandel die Rede, ein Herr namens Roloff wurde erwähnt, ein Taxifahrer auch, schließlich eine verschwundene Rotweinflasche. Die Familie des Toten glaubte und glaubt bis heute an Mord; die Genfer Polizei hat zunächst an einen natürlichen Tod geglaubt (voll bekleidete Tote in einer gefüllten Badewanne waren für sie offenbar nichts Neues), später dann doch eher an einen Suizid, ohne sich aber festlegen zu wollen. Von einem natürlichen Tod lässt sich wohl kaum sprechen, wenn der Tote einen Medikamentenmix aus insgesamt acht Mitteln intus hat, davon sechs hochwirksame Sedativa. Auch wenn schnell bekannt wurde, dass Uwe Barschel schon seit Jahren ein Psychopharmaka-Junkie gewesen war, war diese Mischung doch auffällig.
Nicht so recht glauben mochte die Genfer Polizei an den Herrn namens Roloff, der den ehemaligen Ministerpräsidenten entlasten sollte und über den im Hotelzimmer Aufzeichnungen gefunden wurden, die wohl auch gefunden werden sollten. Der Fall interessierte mich und viele meiner Freunde schon um seiner selbst willen, aber für mich hatte er eine besondere Note, weil ich auch Roloff heiße und von meinen Freunden damals gehänselt wurde, auf einem Niveau immerhin, das man als sophisticated bezeichnen kann. Mich gibt’s aber wirklich, während nicht nur die Genfer Polizei, sondern auch andere eher geglaubt haben, dieser Mann und das Treffen mit ihm seien eine Phantasie des ehemaligen Ministerpräsidenten gewesen. Und so liest sich die Geschichte auch am plausibelsten, so habe ich sie zumindest damals gelesen.
Der Ministerpräsident, so müsste sie beginnen, hat zum Zweck der Erhaltung seiner gefährdeten Macht versucht, seinen Kontrahenten, dem man gute Chancen einräumte, als Politiker und als Mensch zu vernichten. Das ist ihm nicht nur misslungen, es ist auch ruchbar geworden. Von diesem Augenblick an hat der – bald ehemalige – Ministerpräsident sich an seine Handlungen zwar noch erinnern, aber er hat nicht mehr an sie glauben können. Er war überzeugt, so sein Bruder, dass gegen ihn eine Verschwörung lief. Nicht neu ist, dass Menschen, die die Welt nicht mehr verstehen, weil sie plötzlich das Glück verlassen hat, gern auf Verschwörungsmythen zurückgreifen. Uwe Barschel hat seinem Bruder am Telefon noch angekündigt, bald werde man Zusammenhänge erfahren, von denen keiner geträumt hat. Dazu ist es dann aber nicht mehr gekommen, vermutlich deshalb nicht, weil es diese Zusammenhänge nicht gegeben hat, weil allein Uwe Barschel von ihnen geträumt hat.
Später hat sich jedoch herausgestellt, dass die Geschichte auf diese Weise nicht auserzählt ist und vermutlich auch nicht mehr zu Ende erzählt werden kann. »Sie wissen sicher«, sagte ich zu Dr. Meissner, »dass die Suizidversion inzwischen stark in Zweifel gezogen worden ist, weil zum Beispiel die Flasche Rotwein, die der Kellner auf Barschels Zimmer gebracht hatte, nicht mehr da war. Und es ist wohl kaum anzunehmen, dass die Herren vom Stern sie ausgetrunken und dann entsorgt haben.«
Also wurde die Mordthese, die die Familie früh ins Spiel gebracht hatte, wieder plausibler. Barschels Frau Freya kam ja aus dem Geschlecht derer von Bismarck, da ist die heroischere Version schon passender als ein Suizid. Schließlich kam dann auch die – nicht unwahrscheinliche – Version auf, Barschel habe einen Sterbehelfer gehabt, der ihn dabei unterstützte, das Ganze als Mord zu inszenieren, indem er die Flasche entsorgte und die Aufzeichnungen über Herrn Roloff gut sichtbar placierte. Kann ich mir vorstellen, wird man aber auch nicht mehr aufklären können. Man wird überhaupt nichts mehr aufklären.
Es ist aber nicht so sehr das Unaufgeklärte, das mich fasziniert, und auch nicht die besonders mysteriöse Rolle, die mein Familienname darin spielt, der schließlich alles andere als selten ist. Aber je länger die so genannte Barschel-Affäre dauerte, vor allem dann auch mit diesem Ende, desto stolzer wurde ich. Endlich, habe ich damals gedacht, endlich kommen wir auch mal ans Weltniveau ran. Eine richtig düstere Politaffäre, zwar kein Watergate und kein Mord an Olof Palme, sondern nur der Ministerpräsident einer bundesrepublikanischen Provinz, aber immerhin. Und dann noch diese Stasi-Spekulationen und der Waffenhandel und so weiter.
I shouted out Who killed the Kennedys?
Well, after all, it was you and me.*
2Als ich von Barschels Tod erfuhr, saß ich auf einem weißen Metallhocker von etwa ein Meter zwanzig Sitzhöhe, dessen Sitzfläche die Form eines durchschnittlichen Hinterns getreu nachbildete und den ich in einem Geschäft auf der Luxemburger Straße erworben hatte, vor einem in der Wand befestigten Brett, auf dem mein kleines Frühstück stand, vielleicht ein Milchkaffee, Croissants und Marmelade, obwohl die Szenerie mit dem Hocker und dem Brett eher amerikanisch war als französisch, American Diner eben. Pancakes wären vielleicht angemessener gewesen. Ich wohnte damals mit meiner Freundin zusammen im Agnesviertel, und die Freundin war schon zur Arbeit gefahren, während ich damals nicht arbeitete. Ich faltete die Zeitung auseinander und las die Schlagzeile Uwe Barschel tot aufgefunden. Es war ein Montag; am Tag davor, einem schönen Herbstsonntag, hatten wir noch eine Wanderung im Ahrtal gemacht und waren dabei unter anderem am Ausweichsitz der Verfassungsorgane des Bundes im Krisen- und Verteidigungsfall vorbeigekommen, landläufig bekannt als Atombunker oder Regierungsbunker, ein typisches Produkt des Kalten Krieges seligen Angedenkens, damals noch in voll funktionsfähiger Wartestellung. Dann hatten wir in einem Restaurant, nein, sagen wir eher, einem Wirtshaus, einen leichten Abendimbiss genommen und waren zurück nach Hause gefahren, nach Köln. Inzwischen war in Genf ein Krisenfall ganz anderer Art eingetreten, wie ich dann aus der Zeitung erfuhr.
Auch ich war im ersten Moment schockiert, als ich die Schlagzeile las. Doch je mehr man Näheres erfuhr, inklusive der Spekulationen, die sich darum rankten, desto mehr dachte ich: Jetzt haben wir auch endlich einen Politskandal von veritablem Ausmaß. Die Amis hatten Watergate, die Briten zehn Jahre vorher die so genannte Profumo-Affäre mit der faszinierenden Christine Keeler, in Frankreich gab es die Marković-Affäre und in Italien schon in den Fünfzigern die Affäre Wilma Montesi. So etwas hatten wir bis zu Barschel nicht, trotz Franz Josef Strauß und anderen Figuren. Sicher gab es vorher schon die Nitribitt, aber das war kein Politskandal, sondern einer aus der Wirtschaftswunderwelt, in der ich noch ein Kind war, gerade erst neun; immerhin lernte ich aber aus der yellow press damals das Wort Lebedame, weil das Wort Edelhure oder gar Luxusnutte zu dieser Zeit selbst in diesen Blättern noch nicht druckbar war. Aufgewacht bin ich aber nie mit der Nitribitt, nur ein- oder zweimal eingeschlafen, aber das war nicht im Labor. Vielleicht kam sie auch mal in einem Traum vor, vielleicht hat sie damals die Roros abgelöst, obwohl die schwarzlockig waren, während die Nitribitt wohl blond war, zumindest im Kino, in den Filmen mit Nadja Tiller, mit Belinda Lee und mit Nina Hoss.*
Die Roros waren der standardisierte Albtraum meiner Kindheit. Jetzt sind wir doch kurz bei den Träumen. Dr. Meissner hat das auch nicht ausdrücklich untersagt; nur liegt das Hauptgewicht seiner Untersuchung auf dem Übergangsraum zwischen Schlaf und Wachen. Wir führen alle täglich ein Schlaftagebuch, nicht nur, wenn wir hier übernachten, auch zu Hause oder anderswo unterwegs. Dr. Meissner möchte gern wissen, ob unsere Assoziationen durch die Laborsituation mitbeeinflusst werden. Das alte Dilemma, man kennt die Frage: Verändert die Beobachtungssituation das zu Beobachtende? Normalerweise würde ich sagen: Natürlich, der Blick des Anderen, aber wenn ich schlafe, spüre ich ihn nicht mehr.
Also die Roros. Eine heikle Angelegenheit. Wie gesagt, mein Kindheitsalbtraum, der Ablauf variierte kaum. Zuerst brachte meine Mutter mich für einige Stunden zu ihnen, weil sie etwas vorhatte; ich habe nie herausgefunden, was es war. Vielleicht ging sie fremd? Ich wurde gewissermaßen in Verwahrung gegeben. Die Frauen, zu denen sie mich brachte, waren mir aus meinem wachen Leben mehrheitlich durchaus bekannt. Es waren die Freundinnen meiner Mutter, teils Nachbarinnen sogar, die in der Tat überwiegend dunkles Haar hatten, viele mit Dauerwellen oder Naturlocken, alle Ende zwanzig, Anfang dreißig, wie meine Mutter auch. Seidenstrümpfe von Opal. Meine Mutter verschwand dann sehr schnell, meistens waren, wenn sie mich abgab, nur wenige Frauen da, danach füllte sich der Raum schnell. Zuerst wurde ich nicht weiter beachtet, saß oder lag in irgendeiner Ecke, die Frauen, die Roros eben – ich weiß nicht, warum ich auf den Namen kam, er war jedoch sofort da, als ich diesen Traum das erste Mal geträumt hatte –, die Roros unterhielten sich untereinander, eine sehr lebhafte Szenerie war das immer, die mir zunehmend Angst einjagte, je länger das dauerte, im Traum erschien es mir wie Stunden. Erstens Angst, dass meine Mutter nie mehr wiederkam, worauf auch manche Bemerkungen der Roros hindeuteten, die ihre Aufmerksamkeit nun mehr und mehr mir zuwandten, und das war die zweite Angst, denn sie kamen dann immer näher in ihrer massiven Schwarzlockigkeit und begannen mich zu bedrängen, zu betatschen, sich über mich zu beugen, als wollten sie mich verschlingen. Überrollen auch, vielleicht daher der Name Roros. Ich wachte dann entweder an dieser Stelle auf oder erst, wenn kurz vor dem Verschlungenwerden meine Mutter zurückkam, um mich abzuholen, und fragte, ob ich mich anständig benommen hätte. Alles in Ordnung, Marieche, sagten die Roros dann, braver Junge, mach dir keine Sorgen. Sie lachten immer, wenn sie das sagten. Dann nahm meine Mutter mich mit, ein paar Schritte draußen gehörten noch zum Traum, ich ging neben meiner Mutter, die kein Wort mit mir sprach, dann erwachte ich bei dieser Variante. Der Traum variierte wirklich nur im Zeitpunkt des Aufwachens, davor lief immer alles unerbittlich gleich ab. Irgendwann träumte ich ihn nicht mehr, da war ich vielleicht acht oder neun.
Dr. Meissner hat dieser Traum übrigens nicht besonders interessiert. »Das sollen andere analysieren«, hat er gesagt, »das ist nicht mein Metier.«
»Das muss keiner analysieren«, habe ich geantwortet, »das ist meine Privatsache. Das analysiere ich selbst, dazu brauche ich gerade mal fünf Minuten.«
Mein Gedächtnis dagegen, so viel habe ich in den letzten anderthalb Jahren gelernt, ist keineswegs meine Privatsache, so wenig wie die leergefegten Straßen, als ich heute Morgen einkaufen ging. Hinterm Küchenfenster sind die Gleise vom und zum Hauptbahnhof leerer als sonst, und die Erschütterungen der ein- und ausfahrenden Züge sind deutlich weniger geworden. Das Haus zittert nicht mehr. Wer weiß, wann der endgültige Stillstand kommt.
Mein Gedächtnis, so habe ich weiter gelernt,* meine Fähigkeit, mich zu erinnern, funktioniert nur, weil ich meine Erinnerungen mit vielen anderen teile, die damals in einem ähnlichen Milieu, einer ähnlichen sozialen Gruppe, womöglich am selben Ort oder in derselben Arbeitswelt gelebt haben wie ich. Meine Träume sagen nur mir etwas, und meistens ist nicht einmal das der Fall. Aber dass ich auf diesem Hocker saß und von Barschels Tod erfuhr, dass ich im Agnesviertel wohnte, einem schönen Altbauviertel im Norden der Kölner Innenstadt, dass ich nicht arbeitete –
Warum arbeitete ich damals nicht? Ich erinnere mich, ich hatte gerade mal wieder aufgehört. Eher unterbrochen, würde ich sagen. Auf Honorarbasis und auch immer wieder fest angestellt unterrichtete ich über viele Jahre, aber eben mit Unterbrechungen, an einer Sprachschule für Deutsch als Fremdsprache, mit ganz unterschiedlichen Klientelen und mit Gruppen, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen hatten. Bevor das anfing, hatte ich eine Weile in einer Kneipe namens Oblomow im Kölner Univiertel gearbeitet, die sich nicht lange gehalten hat und keineswegs so erfolgreich war wie ihr Bochumer Namensvetter. Ich könnte nicht mal mehr genau sagen, wo die war, nicht weit vom Luxor jedenfalls. Ich habe auch im Supermarkt Regale aufgefüllt, als Auslieferungsfahrer für eine Feinkostfirma gearbeitet und war eine Weile Hilfskraft in einer Großgärtnerei, das Letzte war aber nichts für mich. Taxifahrer bin ich leider nie geworden, das wäre die Krönung gewesen. Das fehlt mir in meiner Erwerbsbiografie, die zweifellos gebrochen ist. Erwerbsbiografie ist einer meiner Lieblingsbegriffe, das Wort begeistert mich immer wieder, auch wenn meine eigene dazu geführt hat, dass die Rente nicht reicht.
Damals also – auf dem Hocker vor unserer kleinen Küchenbar – hatte ich Pause. Gerade war ein Kurs zu Ende gegangen mit Sprachanfängern aus Osteuropa, die ich sehr gern unterrichtet hatte, auch wenn es Knochenarbeit war. Den Kurs teilte ich mir halbehalbe mit einem Kollegen, etwa so alt wie ich. Kurz vor Ablauf der sechs Monate begrüßte mich der Kollege im Lehrerzimmer: »Hallo Tulipan!« Verstand ich nicht. »So nennen dich unsere Freunde aus der II a. Ich habe sie gefragt, warum. Grażyna hat gesagt – wörtlich – Das liegt doch auf der Hand. Hätte sie vor sechs Monaten so noch nicht sagen können, wir haben also was erreicht. Es war aber nicht ihre Erfindung, der ganze Kurs sieht dich offenbar als Tulpe.«
Niemand wird verstehen, dass dies einer der glücklichsten Momente meines Lebens war, oder man wird das zumindest für eine horrende Übertreibung halten. Ich kenne mich in der Botanik und in der Flora nicht besonders gut aus. Als Kind hatte ich beinahe Angst vor allem, was Natur hieß. Aufgewachsen bin ich zwischen Trümmern in der Nähe des Barbarossaplatzes, aber das ist fast egal, von der Stadt war ja ohnehin nichts mehr übrig. Zweihundertzweiundsechzig Bombardierungen, eins Komma fünf Millionen Bomben, deutscher Rekord. Das sei nur mal eben in Richtung Dresden erwähnt, bevor im nächsten Februar wieder die große Opfershow gestartet wird.
Natur kam nur als Wildwuchs zwischen den Schutthaufen vor; manchmal blühte auch etwas, von dem ich nicht wusste, was es war. Aber als ich das erste Mal einen Strauß Tulpen sah, war ich entflammt. Es waren einfache Tulpen, leuchtend rot, Darwin-Tulpen oder vielleicht auch Duc van Thol, wie ich später gelernt habe, und sie waren, als ich sie sah, noch fast ganz geschlossen. Die einfachen Frühen oder einfachen Späten sind mir nach wie vor die liebsten, ungefüllt, je schlichter, zugleich aber künstlicher, umso besser. Lange Zeit dachte ich, die Tulpe sei eine holländische Erfindung; dass sie wild in vielen Variationen vor allem in Zentralasien wächst, dass sie ursprünglich aus dem Orient kommt, wusste ich damals nicht, und es interessiert mich auch heute nicht.
O Wildnis, o Schutz vor ihr*
Was mich dagegen faszinierte, als ich vor dreißig Jahren erstmals etwas darüber las, war die Tatsache, dass die Tulpe in den Vereinigten Provinzen der Niederlande Mitte der Dreißigerjahre des siebzehnten Jahrhunderts mehr und mehr ihrer konkreten Form entkleidet und zum Wertpapier, ja sogar zum Derivat wurde, wie man heute sagen würde. Dass am Ende des Tulpenwahns nicht einmal mehr eine einzelne Tulpenzwiebel gegen Wahnsinnssummen und gegen Haus und Hof eingetauscht wurde, in der Hoffnung auf die unendliche Wertsteigerung, sondern am Ende nur noch der Zwiebelname. Welch ein kühner Vorgriff auf die Finanzmoderne! Die unendliche Wertsteigerung fand nicht statt, so wie sie nie stattfindet, denn schon ab 1635 begannen die Kurse zu stagnieren, und im Winter 1637 kam der große Crash. Da die Tulpenmanie klassenübergreifend alle besessen gemacht hatte, wurden Reiche und Arme gleichermaßen ruiniert. Zum Goldenen Zeitalter, dem Gouden Eeuw, gehörte wohl zwangsläufig auch die Phantasie an der Macht, also der Irrsinn.
Dr. Meissner war amüsiert, als ich ihm eines Tages von meiner Liebe zur Tulpe erzählte und dann sagte: »Wenn ich einschlafe, schließe ich mich wie eine Tulpe, die man nachts nach draußen stellt, ins Kühle.«
»Sie schlafen also gewissermaßen einen Tulpenschlaf«, sagte er und brachte es auf den Punkt.
3Es blieb nicht bei Barschel und beim siebzehnten Juni, es folgte auch bald der Bonner Hofgarten. Nicht der von 1981, da war ich noch nicht dabei, sondern der von 1983. Da war ich eigentlich auch nicht richtig dabei, nicht mit meiner ganzen Person. Heute würde ich sagen, ich wohnte zu nah dran, um zu schwänzen, eine halbe Stunde Zugfahrt ist einfach keine gute Ausrede. Ich hatte ein bisschen in einer Friedensgruppe mitgearbeitet, die von Dekapisten dominiert wurde, und den Dekapisten habe ich eigentlich immer misstraut. Falsches Wort. Ich habe ihnen nicht misstraut, es ging nicht um ideologische Fragen, ich kam mit ihrem Ernst nicht zurecht und ihrer Biederkeit. Es gab ein, zwei Ausnahmen, aber die waren nicht in dieser Gruppe, die kannte ich aus dem Chlodwig-Eck von der Theke. Also, dachte ich damals, ich gehe jetzt noch auf diese Demo, und das war es dann aber mit der Friedensarbeit, dann steige ich aus.
Goldener Oktober, ohne Einschränkungen. Auf dem Weg vom Bonner Hauptbahnhof zum Hofgarten vorbei an einem McDonald’s, gleich kam aus der Menge der Zweizeiler Neuer Job für Ronald / Kellner bei McDonald’s!, der schon inhaltlich verunglückt war, weil es bei McDoof keine Kellner gibt. Von der Kundgebung selbst erinnere ich mich noch an den Satz Heinrich Bölls, dass es im Laufe der Geschichte in Deutschland einige höchst zwielichtige Gestalten in die höchsten Ämter geschafft hatten; das war eine Antwort auf den Vorwurf gegen die Friedensbewegung, sie werde teils von zwielichtigen Elementen gesteuert. Böll sprach ziemlich leise und wirkte irgendwie erschöpft, zwei Jahre später ist er gestorben, aber alle konnten ihn verstehen, weil die Menge während seiner Rede ziemlich still war, beachtlich bei einer geschätzten halben Million Menschen. Ich weiß nicht, ob es so viele waren, für eine halbe Million Menschen habe ich überhaupt kein Gefühl. An die anderen prominenten Redner erinnere ich mich nicht, sondern nur noch an den jungen Mann, der uns darauf hinwies, dass Deutschland immer noch ein besetztes Land sei, und an das zustimmende Gemurmel in meinem Umfeld. Überhaupt schien der Satz auch anderswo im Auditorium gut anzukommen, ein kleines Raunen ging durch die Reihen, eine Welle des Opferbewusstseins. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob ich mitgeraunt habe, oder ob mich schon damals etwas störte; ich weiß nur, dass das Nazi-Onale mich schon immer abstieß, in jeglicher Form, auch in der des so genannten gesunden Patriotismus. Ich möchte auch nicht angegrinst und in kalifornischem Schwäbisch angebrüllt werden: Du bist Deutschland! Vielen Dank.*
(Und »Nationaler Kitsch« ist weißer Schimmel: national ist immer Kitsch!)*
Einzige Ausnahme: die Marseillaise. Da stehe ich auf, da singe ich sogar die ersten beiden Zeilen mit. Da bin ich absolut inkonsequent. Aber vermutlich hat das mit Rick und mit Victor Laszlo zu tun: Spielen Sie die Marseillaise! Spielen Sie! Die einzige Filmszene, in der mir zuverlässig die Tränen kommen.
Als sich im Hofgarten langsam alles auflöste, traf ich auf einer Brücke einen Bonner Freund und konnte mich endlich von meiner Gruppe entfernen. Ich bin nie mehr hingegangen, habe noch ein paar Telefongespräche mit Einzelnen geführt, aber freundlicherweise hat man mich dann in Ruhe gelassen.
»Ihre Erinnerung an den Tag«, sagte Dr. Meissner an jenem Morgen zu mir, »besteht also nur aus ein paar Komponenten: dem schönen Herbstwetter, dem McDonald’s-Augenblick, den zwielichtigen Gestalten aus der Rede von Heinrich Böll und den nationalen Tönen des jungen Mannes, dessen Namen Sie nicht wissen, und dem Raunen, das durch die Menge ging.«
»Ganz recht. Das ist nicht sehr viel, zugegeben.«
»Doch, schon«, sagte Dr. Meissner, »vor allem diese kleine Unsicherheit, dass Sie nicht mehr wissen, ob sie bei den plötzlichen nationalen Tönen mitgeraunt haben oder schon damals leicht angewidert waren. Im Nachhinein sind Sie es ja bestimmt.«
Das wüsste ich auch gern, wie das damals war. Ich würde übrigens nicht angewidert sagen, sondern eher mulmig: Mir war damals, glaube ich, mulmig zumute, als ich diese Spitze gegen die Besatzungsmächte hörte, die an jenem Tag besonders gegen die Amerikaner gerichtet war. Obwohl es bei uns ja die Briten waren, und zum Teil auch die Belgier.
»Wir waren damals auf der Schule auch gegen die Amis, das weiß ich noch«, sagte Dr. Meissner.
»Nanu?!«, rief ich! »Ich will Ihnen was sagen, Herr Bauer: hoffentlich bleibt die Besatzung fünfzig Jahre!« – Erzählen Sie mir doch nicht, dass Hitlers stets 98%ige Wahlerfolge gefälscht gewesen wären: das hatte er gar nicht nötig!*
Aber es ist wohl an der Zeit, ein paar Worte zu Dr. Meissner zu sagen.
4Als ich heute Morgen um halb elf aus dem Fenster sah, war in meinem Sichtfeld nur die Alte unterwegs, die um diese Zeit zum zweiten Mal am Tag ihren Zwergpudel ausführt. Vom Hansaring aus hatte das Verkehrsrauschen noch beinahe Normalstärke. Sonniges Wetter, zehn Grad.
Alles, was ich über Dr. Meissner weiß, habe ich entweder von ihm selbst erfahren, oder ich habe es aus dem Netz. Ein paar Details hat mir auch Frau Wobser erzählt, zum Beispiel, wie es in Dr. Meissners Haus in Oberkassel aussieht, und dass er eine sehr hübsche und viel jüngere Frau hat, ein richtiges Model! Frau Wobsers Mann ist Fußbodenverleger* – mit eigener Firma – und hat vor drei Jahren bei Dr. Meissner in vier Räumen eigenhändig neues Parkett verlegt, vom Feinsten, und einmal hat Frau Wobser ihn abends von der Arbeit abgeholt und die Frau Meissner gesehen. Das ist ja schön, dass ich die Mitarbeiterin meines Mannes mal kennenlerne, hat Frau Meissner gesagt und dabei nett gelächelt.
Ich wartete noch auf den Anschlusssatz Nett ist die kleine Schwester von scheiße, aber er kam nicht. Das gehört entweder nicht zu Frau Wobsers Repertoire, oder sie konnte sich zurückhalten.
Dr. Meissner kommt direkt von der Zonengrenze, aus der Eisenbahnerstadt Bebra; auch sein Vater war selbstverständlich bei der Bahn, in gehobener Position, »aber ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, weil ich auch nie gefragt habe. Meine Eltern hatten Verwandte auf der anderen Seite, in Thüringen, die sie ein paar Male drüben besuchten, aber ich wollte zu Hause bleiben. Ich habe gar nicht begriffen, dass das auch meine Verwandten waren. Mir gefiel es in Bebra nicht schlecht, ich kannte ja viele Jahre wenig anderes, auch wenn ich durch meinen Vater billig mit der Bahn fahren konnte. Aber in meinem Abijahr – sechsundachtzig – habe ich Sommerferien in Frankreich gemacht, vier Wochen Feriensprachkurs im Lande, in Tours. Französisch war ein Wahlfach von mir, und in Tours wird ja angeblich das reinste Französisch gesprochen, aber vor allem war es schön warm, und dann die Loire! Ich hatte noch nie an so einem großen Fluss gestanden. Und einmal haben wir in Amboise direkt am Ufer fast einen ganzen Nachmittag in der Sonne gelegen.«
Ich fragte mich, wer wir ist, aber Dr. Meissner redete nach einem kurzen Stocken, das ihn offensichtlich weit in seine Jugend zurückgeführt und vielleicht an eine schöne kleine schmutzige Geschichte erinnert hatte, Dr. Meissner also redete schon weiter.
»Danach wollte ich nur noch weg aus Bebra. Wenn möglich nach Frankreich. Ich glaube, es hatte damit zu tun, dass es mir weit genug weg von Drüben erschien. Drüben ist mir in meiner ganzen Kindheit und Jugend zu nah auf die Pelle gerückt, gleich auf der anderen Seite lag ja die GÜSt Gerstungen, und ich hatte das Gefühl, das Armselige, dieses klapprige Grau von drüben schwappte rüber zu uns, und so ist es ja auch irgendwie gewesen, auch wenn es Bebra selbst damals nicht schlecht ging. Als Interzonenbahnhof hatte die Stadt eine unbestreitbare Existenzberechtigung. Ich mochte auch die ganzen Eisenbahngerüche von damals sehr gern und vermisse sie heute manchmal, aber gleichzeitig hörte die Welt eben bei uns auch auf.«
Manchmal, bisher ist das drei Mal vorgekommen, lädt mich Dr. Meissner nach der Probandennacht in sein großes Büro zum Frühstück ein, während ich es sonst im dafür vorgesehenen Raum der Praxis oder irgendwo in der Stadt einnehme. Bei einer dieser Gelegenheiten hat er mir das erzählt. Laut Frau Wobser bin ich der Erste und bisher Einzige, der dieses Frühstücksprivileg hat. »Womit haben Sie das verdient«, fragt oder sagt Frau Wobser, »na, wahrscheinlich, weil Sie älter sind als der Doktor, von Ihnen kann er noch was lernen. Dabei haben Sie nicht mal Altersflecken an den Händen, da staune ich immer wieder drüber.«
1989 im November war Dr. Meissner schon weiter ins Landesinnere gerückt, studierte Medizin in Marburg an der Lahn und stand kurz vorm Physikum. Er fuhr nicht nach Bebra, um zu sehen, wie die Grenze fiel; er wusste, dass das mittelfristig für Bebra nicht gut sein konnte. Er besuchte erst zwei Jahre später wieder seine Eltern, als er sich schon mitten im klinischen Teil seines Studiums befand, mit starker Neigung zur Inneren, und als sein Vater starb, sehr früh mit siebenundfünfzig Jahren, war er bereits Arzt in Weiterbildung in Bonn und fuhr nicht selten hinter Autos her, auf deren Heckscheibe der Aufkleber mit dem Slogan Kein Umzug nach Berlin leuchtete, die Schrift groß und deutlich, leider aber oft genug auch in Schwarzrotgold, dieser überaus geschmacklosen Farbkombination.
»Hat nichts genützt«, sagte Dr. Meissner, »aber mich betraf es ja nicht. Ich hatte gerade die Gegenbewegung gemacht und bin dann auch im Rheinland geblieben.«
Das Hervorstechendste an ihm sind unruhige Augen, graugrün. Ich kann mich nicht erinnern, dass seine Augen jemals länger etwas fixiert hätten als den buchstäblichen Augenblick lang. Dieser Blick springt ständig hin und her, und ihm zu folgen ist unmöglich. Allerdings weiß ich nicht, wie es sich verhält, wenn er allein in seinem Büro sitzt.
Das stimmt nicht ganz. Beim ersten Mal, als er mich zum Frühstück eingeladen hatte und ich sein Büro betrat, habe ich ihn vielleicht bei etwas erwischt. Er trug seine Lesebrille mit den sehr kleinen runden Gläsern, ohne die er nichts entziffern kann – für die Fernsicht reicht dagegen sein Augenlicht –, beugte sich über eine geöffnete Kladde, unliniert, wie ich noch feststellen konnte, und schrieb. Schwer atmend zog der linkshändige Mann mit einem klassischen Füllfederhalter aus dem Hause Pelikan feine Linien auf dem Papier, bevor er die grüne Kladde zuklappte, in der Schublade verschwinden ließ und mich etwas verlegen anlächelte, wobei sein Blick wie gewohnt unruhig durch den Raum huschte.
Für mich ist klar, dass es sich nicht um wissenschaftliche Aufzeichnungen oder die Auswertung von Schlafprotokollen handelte. Die Kladde war eher von der Art, in der man Tagebuch führt. Oder mit der in früheren Zeiten Menschen, die ein Buch schreiben, ja, die Schriftsteller werden wollten, ihren Bemühungen die nötige Ernsthaftigkeit verliehen, indem sie eben gleich in ein schon gebundenes Buch mit Blankoseiten hineinschrieben. Später sah ich in Cafés oft Männer, manchmal auch Frauen, die in ihr kleines Moleskine ihre Notizen machten und ab und zu aufsahen, ob die Menschen an den anderen Tischen ihre Arbeit auch gebührend wahrnahmen. Heute, wo es selbstverständlich ist, dass alle auf ein Smartphone starren, ist diese Distinktionsgeste weitgehend untergegangen.
Kurzum, ich gehe davon aus, dass Dr. Meissner ein Buch schreibt, keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern einen Roman, eine Novelle, vielleicht auch einen Essai im ursprünglichen Sinn des Wortes. Oder seine Autobiografie vielleicht, oder wenigstens Autofiktion, die derzeit so hoch im Kurs steht. Darauf deutet auch das Schreibinstrument hin. Wenn er in den Räumen von Bon Sommeil unterwegs ist – das ist der offizielle Name des Schlaflabors und geht auf Dr. Meissners Frankophilie zurück –, macht er sich seine Notizen mit ganz normalen Kugelschreibern.
Er schreibt also ein Buch, redet aber nicht darüber: ein guter Ansatz. Und ich bin davon überzeugt, dass er seit der Szene im Büro genau weiß, dass ich davon weiß. Aber wir reden nicht darüber.
Gerade lese ich, dass die Schweden auf ihre Art weitermachen. Das Leben geht seinen Gang, nur die Infizierten sollen in Notlazaretten isoliert werden. Die meisten Infizierten sind zwischen vierzig und sechzig und haben sich beim Skifahren in Italien und Österreich angesteckt. Wären sie doch im Land geblieben – der Skibetrieb geht dort weiter. In den Osterferien ist der Skiurlaub in den schwedischen Bergen sehr beliebt, erfahre ich.
Hierzulande dagegen Kontaktsperre. Das Wort habe ich zum ersten Mal 1977 gehört. Ein paar Wochen danach gab es zur nachträglichen Legalisierung ein Kontaktsperregesetz. Hatte mit irgendeinem Virus aber nichts zu tun.
Dr. Meissner hat angerufen. »Wir machen weiter. Die Forschung darf nicht stillstehen. Sie kommen mit dem Taxi.«
5Das Taxi ist wahrhaftig mit einer Trennscheibe aus Plexiglas hochgerüstet worden, und ich sitze hinten. Das erspart mir die Konversation. Der Fahrer ist ein Mann Ende dreißig. Von der Musik, die er hört – nicht aus dem Radio, sondern eigene Playlist –, kommt bei mir noch so viel an, dass ich Massive Attack identifizieren kann, später dann Air mit Premiers Symptômes. Jetzt hätte ich doch plötzlich Lust, mit ihm zu sprechen.
Le soleil est près de moi … J’ai dormi sous l’eau
Wir gleiten ohne die üblichen Staus über eine ziemlich leere A57 nach Norden und dann über die A46 nach Düsseldorf. Als ich in Flingern aussteige, bedanke ich mich beim Fahrer für die Musik und sage zum ersten Mal selbst den klassischen Satz dieser Wochen: »Bleiben Sie gesund!« Der Satz funktioniert einwandfrei.