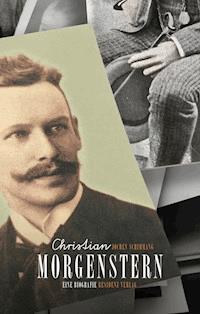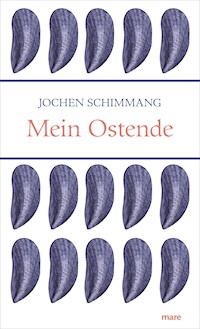Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jochen Schimmang schreibt vom Glück, das an den Rändern verborgen liegen kann. Entlang seiner Autobiografie erzählt er davon, was es heißt, ein Kind der britischen Besatzungszone (und nicht eines deutschen Staates) zu sein. Er berichtet von frühen Grenzerfahrungen im "Zonenrandgebiet" und an der höllandischen Grenze, vom verträumten dänischen Fährhafen Rodbyhavn, vom räumlichen und zeitlichen Ende der Welt, vom Transit BRD-Westberlin und vom Transitorischen im Allgemeinen. Er schreibt eine persönliche Kulturgeschichte des Verschwindens, des Verstecks, des Unsichtbarwerdens und prägender Lektüren. Diese literarischen Geländegänge führen sowohl in den englischen Klassenkampf wie zu Peter Handke in Chaville. Der Leser darf dem Autor in entlegenste Winkel folgen, auf Dachböden und in kindsgroße Löcher unterm Bahndamm. Festes Schuhwerk ist dazu nicht nötig. Es reichen Neugier und Entdeckerfreude. Eine persönliche transitorische Kulturgeschichte des Verschwindens, des Verstecks und der Poetik des Reisens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jochen Schimmang
GrenzenRänderNiemandsländer
51 Geländegänge
Für Lutz Schulenburg
(1953–2013)
Edition NautilusVerlag Lutz SchulenburgSchützenstraße 49 aD-22761 Hamburgwww.edition-nautilus.deAlle Rechte vorbehalten© Edition Nautilus 2014OriginalveröffentlichungErstausgabe August 2014Umschlaggestaltung:Maja Bechert, Hamburgwww.majabechert.de1. AuflagePrint ISBN:978-3-89401-798-9E-Book ePub ISBN:978-3-86438-164-5
The Germany can me furchtbar leckn.Arno Schmidt
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Zum Nach- und Weiterlesen
Fotonachweis
1
Noch immer bin ich heilfroh, dass wir rechtzeitig weggezogen sind. Natürlich wäre ich ohnehin mit 18, 19 aus dem Haus gewesen und damit auch aus der Stadt. Aber vielleicht hätte ich ab und zu Besuche machen müssen, und plötzlich wäre ich in der neuen Mitte gelandet – dort, wo ich niemals hin wollte.
Jetzt ist Schluss mit dem Geschichtsunterricht für Nachgeborene. Kurz und gut, ich wuchs zumindest in einer grenznahen Region auf, wenn es sich auch nicht um eine Grenze zum Ausland handelte, eine Region jedoch, die seit 1990 plötzlich ziemlich in der Mitte unseres schönen Landes liegt. So wie Kassel, das nicht zu weit weg ist und ebenfalls zur Neuen Mitte gehört. Nicht, dass das diesen Städten und Regionen allzu sehr nützt. Im Gegenteil, die Zonenrandförderung fällt flach, und als das pulsierende kulturelle Zentrum unseres Gemeinwesens gelten Städte wie Kassel, Northeim oder Duderstadt auch nicht.
Wenn auch kulturell nicht unbedingt dabei, sind sie doch geografisch ziemlich mittendrin. Grenzerfahrungen lassen sich da nicht mehr machen, und was ein Randgebiet ist, muss man sich heute anhand anderer Regionen erklären. Insgesamt wird das immer schwieriger, und ich erwarte den Tag, an dem alle Grenzen und alle Ränder verschwunden sind und das Leben ganz und gar öde wird. Denn dann sitzen wir alle in ihr fest, in der Neuen Mitte, und schmoren darin wie in der Hölle.
2
Als wir durch den Stellenwechsel meines Vaters umzogen, kam ich erstmals in die Nähe einer richtigen Grenze, das heißt, einer Grenze zum Ausland. So toll gesichert wie die zur Ostzone war sie allerdings nicht und daher beim ersten Anblick für mich etwas enttäuschend. Es gab einen Schlagbaum, und man musste selbstverständlich seinen Personalausweis vorzeigen. Aber an so etwas wie Selbstschussanlagen, Wachtürme oder scharfe Munition dachte man nicht, wenn man den deutsch-holländischen Grenzübergang Neuschanz (damals traute sich noch kein Deutscher, den Namen Nieuwe Schans auszusprechen) passierte. Was doch häufiger geschah, damals, weil es in Neuschanz / Nieuwe Schans im Laden direkt an der Grenze Kaffee, Butter und andere Lebens- und Genussmittel billiger einzukaufen gab als auf deutschem Boden. Der Ort selbst interessierte eigentlich nicht. Entscheidend war die Grenze: der Unterschied: der Preis.
Auf diesen Expeditionen war ich damals immer in Begleitung meiner Eltern bzw. meines älteren Bruders. Mein erster Grenzübertritt ohne diese Begleitung scheiterte. Ich war mit einem Schulfreund bis an die Grenze getrampt. Der Fahrer des Wagens, der uns mitgenommen hatte, blieb aber auf der deutschen Seite (weil er dort wohnte), und wir mussten zu Fuß auf die andere Seite wechseln.
Zumindest versuchten wir es. Wir waren 13 oder 14, es war ein Werktag, und wir hatten dennoch schulfrei. Der Werktag war der 31. Oktober, in protestantischen Gebieten Deutschlands auch unter dem Namen Reformationstag bekannt (»Ein feste Burg ist unser Gott«) und damals in eben diesen Gebieten noch ein Feiertag. Das Wetter war schon im November angekommen. Die Deutschen ließen uns durch, aber an der wirklichen Grenze: am Schlagbaum: am Häuschen pflanzte sich ein ziemlich langer Holländer in einem fast ebenso langen schwarzen Uniformmantel und mit einer schwarzen Schirmmütze vor uns auf und fragte: »Warum seid ihr von zu Hause weggelaufen?«
Schulfrei, sagten wir. Reformationstag, sagten wir. Diese Holländer, vor allem hier oben im Norden, waren doch selbst evangelisch, die mussten das doch kennen. (Ich lernte erst später, dass der Katholizismus numerisch die stärkste Konfession in den Niederlanden ist.) Aber die kannten das nicht, jedenfalls nicht der lange Grenzer in dem fast genauso langen Mantel. Vielleicht lag es daran, habe ich später gedacht, dass die evangelischen Holländer überwiegend nicht von der lutherischen Fraktion sind, sondern von der Soll-und-Haben-Fraktion, den Calvinisten. Jedenfalls wiederholte der gute Mann bei all unseren Erklärungsversuchen immer wieder die Frage: »Warum seid ihr von zu Hause weggelaufen?« Wir hatten alles dabei, Personalausweise, ein bisschen Geld, wir wollten keineswegs illegal einreisen, und Drogen spielten damals im kleinen Grenzverkehr noch keine Rolle. Und wir konnten uns nicht vorstellen, dass dies zufällig der einzige deutsche Satz war, den er konnte. Diese Grenzholländer sprachen alle Deutsch, im Gegensatz zu den Grenzdeutschen, die kaum oder kein Wort Holländisch konnten.
Schließlich brachte er uns zu den deutschen Kollegen zurück und wies sie darauf hin, dass wir von zu Hause weggelaufen seien. Bei uns ist heute schulfrei, klärten ihn die deutschen Kollegen auf. Reformationstag. Ich erinnere mich an die Enttäuschung auf seinem Gesicht, aber ich weiß nicht mehr, ob wir dann doch über die Grenze durften oder nicht, oder ob wir über die Grenze zwar gedurft hätten, nun aber nicht mehr wollten, weil wir die Nase voll hatten. Das wäre ja verständlich gewesen.
3
Misslungener Grenzübertritt hin oder her: Jedenfalls war ich durch diesen Umzug wirklich schön nah an der Grenze gelandet, am Rand. Der Rand ist schließlich nicht nur der Rand des fremden, des angrenzenden Landes, es ist auch schon der Rand des eigenen. Man stand plötzlich ein bisschen mit dem Rücken zum Rest der Republik, und gewisse Orte jenseits der Grenze waren jetzt interessanter als das, was in meinem Rücken lag. Groningen zum Beispiel war irgendwie interessanter als Oldenburg, und Amsterdam ist sowieso interessanter als Hannover, das versteht sich von selbst.
Rheiderland/Reiderland
Anfangs aber war das eigene neue Territorium noch merkwürdiger als der Blick über die Grenze. Dieses Gefühl, auf einem ganz besonderen Streifen Land zu wohnen. Seine Jugend in einer ostfriesischen Kleinstadt zu verbringen, ist schon per se eine recht extreme Angelegenheit. Wenn ich aber diese Stadt verließ, um Schulfreunde zu besuchen, die noch näher an der holländischen Grenze wohnten, im Rheiderland nämlich, dann wurde es für mich beinahe außerirdisch. Das Rheiderland ist der Teil Ostfrieslands links der Ems; durchs Rheiderland sind mein Freund und ich damals getrampt, als wir den Versuch gemacht hatten, die Grenze zu Fuß zu passieren. Die Landschaft setzt sich jenseits der Grenze unter gleichem Namen fort, nur dass die Holländer auf das stumme h verzichten und Reiderland schreiben. Übers Rheiderland kann man manches erfahren, wenn man die späten Bücher von Christian Geissler liest oder den Roman Feuerfreund von Sabine Peters. Es ist ein Land, das unter den Meeresspiegel gesunken scheint und nicht nur an der deutsch-niederländischen Grenze, sondern auch an der zwischen Land und Wasser liegt. Heute, wo die Ems mehr und mehr zu einem Kanal wird, der der Überführung von Luxuskreuzern dient, kann man dort manchmal erleben, wie sich hinter dem Deich langsam ein riesiges Schiff an der Horizontlinie vorwärts zu schieben scheint, als würde es an einem Seil gezogen. Überhaupt handelt es sich um eine Landschaft, in der man leicht Sinnestäuschungen erliegen kann. Das rührt nicht zuletzt daher, dass der Blick in dieser leeren grünen Ebene kaum einen Halt findet, ausgenommen die schwarzweißen Kühe, die auf den Weiden herumstehen und versonnen wiederkäuen. Für mich, der ich aus einer hübschen kleinen Mittelgebirgslandschaft dorthin verschlagen wurde, war das so ähnlich wie für all diese Schweizer Schriftsteller, die so gern nach Berlin gehen und sich dort am Anfang immer verlaufen, weil ihnen die Berge als Orientierungspunkte fehlen.
4
In diesem Randgebiet (was für ein träumerisches, heimeliges Wort, zu dem ich merkwürdigerweise immer gleich den Begriff Nahverkehr assoziiere) war ich als Jugendlicher gleichwohl mit dem Rest der Welt bestens verbunden, über die damals vorherrschenden Medien Fernsehen, Radio, Buch, Zeitung. Als Hinterwäldler konnten wir schon deshalb nicht durchgehen, weil es in dieser Gegend so gut wie keine Wälder gibt. Stattdessen herrschte aufgrund der reichlich vorhandenen freien Fläche Durchzug, Durchreise, weiter Blick. Es ist ja bekannt, dass es an der Küste immer etwas weltläufiger zugeht als hinterm Berg und im tiefen Tal.
Erstaunlich, was damals in einer Kleinstadtbuchhandlung alles präsent war, verglichen mit den erweiterten Papierboutiquen der heutigen Provinz, die sich vollmundig als Buchläden deklarieren. 1968 erwarb ich dort ein Buch mit dem Titel Ränder, geschrieben von einem Kölner Schriftsteller namens Jürgen Becker. Englische Broschur (ein Begriff, den ich damals natürlich noch nicht kannte), ein schwarzer Einband mit dem dunkelviolett geschriebenen Autorennamen und dem hellvioletten Titel gleich darunter, gleiche Schrift und Schriftgröße, alles in Majuskeln und einer serifenlosen Schrift. 112 Seiten, von denen zwei in der Mitte des Bandes komplett leer und weiß waren, das war das Kapitel 6 von insgesamt 11: die leere Mitte, das Verstummen, das leere Zentrum. Das Buch bewegte sich gleichsam von beiden Seiten, von den Rändern auf diese Mitte zu: Kapitel 7 war formal ein Spiegel von Kapitel 5, Kapitel 8 von Kapitel 4 und so weiter. Vielleicht stimmt das aber gar nicht: Vielleicht entfernte sich das Buch in beide Richtungen von der Mitte, und man musste die leeren Seiten zuerst lesen. Wie schon bei einigen anderen Büchern aus demselben Verlag sah ich hier, was man typografisch mit einem Buch alles anstellen kann, welche Sprache der Zeilenbruch, das Weiß, das Ausgesparte, der Rand sprechen konnten. Fast überflüssig zu erwähnen, dass es sich bei dem Verlag um Suhrkamp handelte, damals Frankfurt, Mitte der Republik, heute Berlin bei Polen. Das Buch ist in dieser Ausgabe noch immer lieferbar.
5
Im selben Jahr 1968, als ich dieses Buch erwarb, trampte ich im Sommer mit einem Freund nach Kopenhagen. Ich war 20 und hätte natürlich eigentlich in Dahlem oder in Bockenheim die Klassenkämpfe vorantreiben müssen, war daran aber leider das ganze Jahr 1968 verhindert, weil ich in einer Garnisonsstadt nahe Wilhelmshaven als Gefreiter der Bundeswehr das Geschäftszimmer einer Kompanie besetzte und Urlaubsanträge oder Schadensfälle bearbeitete. Damals dauerte das Soldatspielen noch 18 Monate, und als Abiturient hätte ich auch eine Offizierskarriere einschlagen können. Dass ich darauf gleich am Anfang verzichtete, hatte weniger ideologische Gründe, sondern lag daran, dass es mir viel zu anstrengend war, auf Kommando durch den Dreck zu robben und sportliche Leistungen der abstrusesten Art zu erbringen. Nach dem Ende meiner Schulzeit wollte ich möglichst keine Bundesjugendspiele mehr mitmachen. Dabei habe ich nichts gegen Sport, solange es sich um Fußball handelt.
Der Freund, mit dem ich nach Kopenhagen trampte, teilte für den Rest des Jahres das Geschäftszimmer der Kompanie mit mir und hatte ebenfalls freiwillig auf eine Offizierskarriere verzichtet. In Wonderful Copenhagen wollten wir unseren Jahresurlaub verbringen. Natürlich hätten wir uns auch Amsterdam aussuchen können, aber dort war ich drei Jahre vorher schon mit einem anderen Freund gewesen. Auch wäre uns eine sehr eindrucksvolle Grenzerfahrung entgangen. Um nach Dänemark einzudringen, kann man bekanntlich mit der Fähre von Puttgarden auf Fehmarn nach Rødbyhavn auf der Insel Lolland übersetzen. Wir haben damals diesen Weg gewählt und kamen aus irgendwelchen Gründen in den frühen Morgenstunden eines schönen Sommertages in Rødbyhavn an.
Urbild aller transitorischen Orte
Ich habe keine Ahnung, wie dieser Ort heute aussieht. Angeblich hat er jetzt beinahe 2000 Einwohner. Damals hatte er etwa 20, meinem Eindruck nach. Ich gestehe, dass meine Erinnerung sehr schwach ist, aber vor mir steht das Bild einer schönen, sommerlichen Morgendämmerung in einer Hafenanlage, die verteufelt einem Grenzübergang in die DDR ähnelte. Es gab eine Tankstelle und einen Laden, in dem man sich mit Reiseproviant eindecken konnte: Der Kapitalismus machte schon damals vor den entlegensten Gegenden nicht Halt. Rødbyhavn ist für mich bis heute das Urbild allen Niemandslands, aller transitorischen Orte geblieben, aller Nicht-Orte, lange bevor ich diesen Begriff bei Marc Augé kennenlernte. Seither verbindet mich eine tiefe Liebe zu diesen Orten und vor allem zu ihren Bewohnern, die nicht wie alle anderen einfach weiterziehen können und die ich darum gleichzeitig bedauere und beneide. Die wenigen, ausnahmslos funktionalen Häuser oder eher Schuppen von Rødbyhavn in der rosigen Frühe eines Sommermorgens sind der tiefste Eindruck dieser Reise geblieben. Von Kopenhagen dagegen ist eigentlich nur zu erzählen, dass wir zum ersten Mal in unserem Leben einen Pornoshop betraten – das waren noch Zeiten! – und dass wir in einem Museum den Schreibtisch von Søren Kierkegaard gesehen haben. Schließlich noch, dass uns nach einer Woche das Geld ausging. Teures Pflaster schon damals, dieser europäische Norden.
6
Gewissermaßen die Negativfolie der Morgenröte von Rødbyhavn habe ich drei oder vier Jahre später im Kino gesehen. Da lag der Ort indes nicht am Meer, sondern in der tiefen texanischen Provinz und hieß Anarene. Der Titel des Films war The Last Picture Show, und der Film, vermutlich der traurigste, der je gedreht wurde, erzählt vom Erwachsenwerden zweier Jungen in diesem Kaff um 1950. Es geht – übrigens in Schwarzweiß – um die Ödnis der Provinz, um missratenen Sex und das Ende des Kinos im Ort, das vom Fernsehen überholt wird. Wer von den gelangweilten Jugendlichen abhauen will, wird von den ebenso gelangweilten Eltern wieder zurückgeholt. Aus diesem Kaff kommt keiner raus, höchstens als Soldat nach Korea.
Anarene, so verrät mir Wikipedia, ist übrigens der tatsächliche Name einer Stadt in Texas, die 1908 gegründet wurde und in den fünfziger Jahren langsam verschied. Im Jahr ihrer Gründung wurde im nahen Newcastle ein Kohlenbergwerk eröffnet. Anarene lag an der Wichita Falls and Southern Railroad, und der Haupterwerbszweig war der Kohletransport. 1921 wurde in der Nähe noch ein Ölfeld entdeckt. 1929 hatte Anarene 100 Einwohner, eine Schule, eine Post, einen Laden, eine Tankstelle und eine Schmiede. 1933 waren es nur noch 20 Einwohner, ab 1942 wurde in Newcastle keine Kohle mehr gefördert, 1951 wurde der Bahnhof stillgelegt und 1955 schloss die Post.
Der Film, gedreht im acht Meilen entfernten Archer City, beginnt mit einer Szene, in der der Wind durch die leeren Straßen fegt und Sand und Staub aufwirbelt. Anarene hat nichts von der zivilisatorischen Funktionalität von Rødbyhavn, sondern ist von Anfang an ein Urbild von Stagnation und Verfall, ein Ort, in dem auch die Beziehungen unter den Menschen nur schiefgehen können. Von diesen Städten wird bleiben: der durch sie hindurchging: der Wind! oder, weniger poetisch gesagt: Der Letzte macht das Licht aus.
7
Das gilt auch für größere Untergänge. Manchmal bleibt allerdings kaum noch Zeit, das Licht auszumachen; es verglüht dann einfach mit der Zeit oder bleibt als immer schwächer werdende Funzel zurück, die hilflos ans Untergegangene mahnt. So geschah es nach 1989 mit der Deutschen Demokratischen Republik, die 40 Jahre lang, wie der gesamte politische Block, in den sie als Grenzbastion eingefügt war, als etwas völlig Unverrückbares galt. Noch mindestens hundert Jahre, so Honecker in den Achtzigern, werde die Mauer stehen. Das erschien vielleicht auch mir etwas übertrieben, aber selbstverständlich ging ich davon aus, dass ich selbst, der bis 1989 seine gesamte Lebenszeit mit dieser unverrückbaren Teilung gelebt hatte, nichts Anderes mehr erleben würde. »Die Grenzen sind sicher«, dachte ich, in Abwandlung eines bekannteren, aber ebenso unzuverlässigen Politikercredos. Heute werden meine Erinnerungen an meine eigenen Grenzübertritte – und das waren nicht wenige – im Zug und im Auto zwischen 1969 und 1974 (Transit BRD–Westberlin und vice versa) immer blasser. Sie sind im Großen und Ganzen zum Andenken an typische Situationen und Sätze geronnen, von denen der häufigste das unvermeidliche Machen Se ma ’s linke Ohr frei war, der prägnanteste aber die im Wortsinn entwaffnende Frage: Hamse Waffen, Munizjon, Funggeräde dabei? Ja, das ist doch wohl klar, dass man an der Grenze offen und ehrlich seine massenhaft mitgeführten Waffen, seine Munition, seine Funkgeräte deklariert. Sonst kommt man ja in Teufels Küche. Wir waren doch bloß froh, wenn wir schon mal die Brücke mit der Aufschrift Plaste und Elaste aus Schkopau erreicht hatten, denn dann hatten wir ein gutes Stück DDR geschafft. Wir waren froh, wenn wir wieder drüben waren, also entweder jenseits Dreilinden im Bezirk Zehlendorf, auf breiten, zum Teil baumgesäumten Straßen, oder aber auf dem Parkplatz des Rasthofs Helmstedt, Fahrtrichtung Braunschweig. Wenn im Zug Griebnitzsee hinter uns lag oder aber Marienborn, oder wenn wir weiter nördlich Staaken erreicht hatten oder Büchen.
Wir waren doch nur froh, wenn wir Marienborn hinter uns hatten
Doch an die Angst kann man sich nicht mehr so recht erinnern, wenn man von den Volksarmisten gemustert wurde, Blick in den Pass, Blick ins Gesicht, Blick in den Pass, Blick ins Gesicht und so weiter, bis sie den Pass zurückreichten und durchwinkten, diese Kerle, die wir einerseits bedauerten und andererseits im stillen einfach als Arschgesichter ansahen, die uns unnötig aufhielten. Irgendwie haben sie geschichtlich ja »verloren«, und jetzt, wo man weiß, dass man keine Angst mehr vor ihnen haben muss, kann man diejenige von früher auch nicht mehr zurückrufen.
Heute gibt’s das alles nur noch als Museum: Gedenkstätte Marienborn, Grenzlandmuseum Eichsfeld, deutschdeutsches Museum Mödlareuth und Ähnliches. Und damit man sich an die Farben dieses in sich zusammengesunkenen Staatswesens erinnern kann, irgend etwas zwischen graugrün-braun, wurde der Film Das Leben der Andern gedreht. Der schildert zwar das Leben in diesem Staat gewiss nicht so, wie es war, aber farblich stimmt er. Wahrscheinlich hätte er auch die Gerüche bestens hingekriegt, wenn es eine olfaktorische Spur gegeben hätte.
8
Man darf sich an dieser Stelle ruhig noch einmal die Frage stellen, warum damals so viele Leute so häufig den Transit Westberlin–BRD (»Westdeutschand«) und zurück auf sich genommen haben, was so anziehend war an diesem Biotop Westberlin und vor allem: für wen. Für die eingeborenen Berliner vermutlich am wenigsten, von diffusen Heimatgefühlen mal abgesehen. Viele von denen, die es sich leisten konnten, waren doch längst gegangen und hatten im günstigen Falle sogar die Firmen, die sie besaßen, mitgenommen. Für den zugewanderten Arbeitnehmer war Westberlin vielleicht durch die Berlinzulage interessant, einen achtprozentigen, steuerfreien Zuschuss zum Bruttolohn, den jeder erhielt, der in Westberlin für Lohn oder Gehalt arbeitete – selbst ich, als ich in den Semesterferien einmal beim Finanzamt Kreuzberg jobbte. Für den zugewanderten westdeutschen Schulabschließer war Westberlin als Ort attraktiv, der ihn vor der Wehrpflicht rettete. Für mich spielte das damals keine Rolle. Mein schon abgeleisteter Wehrdienst half mir im Gegenteil, sowohl Westberlin wie auch die DDR besser zu verstehen. Ich war gewissermaßen mit Mauern, Grenzen, Stacheldraht, Vorschriften und Beschränkungen bereits vertraut, und das Leben auf dem Kasernengelände lehrte mich zudem, Gebilde besser zu begreifen, bei denen im Großen und Ganzen über Jahrzehnte alles beim alten bleibt, wie in Westberlin der Fall. Solche Zustände, das darf man nicht geringschätzen, schaffen natürlich auch eine gewisse Übersichtlichkeit, ja Berechenbarkeit. Sie schaffen vertrautes Gelände, auf das man sich verlassen kann. Die von uns Kickerkneipe genannte Kaschemme in der Kreuzberger Moritzstraße (weil wir dort immer am Kicker standen und Lola von den Kinks oder das unsägliche El condor pasa von Simon & Garfunkel hörten) wäre ohne die heftige Nähe zur Mauer nur die Hälfte wert gewesen. Es erhöht das Lebensgefühl ungemein, wenn man weiß, dass ein paar hundert Meter weiter die bekannte Welt zu Ende ist. Denn in die DDR fahren, das war etwas für die Generation unserer Eltern, die dort Verwandte hatten. Für den gewohnheitsmäßigen Transitler galt dagegen nach Ideal und Annette Humpe: Bahnhof Zoo, mein Zug fährt ein / ich steig aus, gut wieder da zu sein.
War es natürlich oft gar nicht, weil Biotope dieser Art – aller Art? – irgendwann auf den Gemütszustand durchschlagen und krank, traurig oder verwirrt machen können. Der Transitler war deshalb oft jemand, der traurig war, Westberlin zu verlassen, und manchmal regelrecht psychotisch wurde, wenn er zurückkam. In der Zwischenzeit, in Westdeutschland, war es ihm meistens auch nicht besser ergangen.
9
Ich habe mir reichlich Mühe gegeben, inzwischen 25 Jahre lang, mich darüber zu freuen, dass all das eines Tages ein Ende hatte, nicht, weil ich ohnehin schon lange wieder in Westdeutschland lebte, sondern weil das Ende der Teilunggekommen war, die Wiedervereinigung, die deutsche Einheit oder auch Deutschland einig Vaterland, weil also zusammenwächst, was zusammengehört. Die Freude ist mir nicht gelungen, sie wird mir nicht mehr gelingen, obwohl ich mir keinen Augenblick den vorherigen Stand der Dinge zurückwünsche. Jene 40 Jahre waren die Strafe gewesen für das, was Deutschland einig Vaterland zuvor getan hatte, und diese Strafe hätte schließlich noch viel drastischer ausfallen können, wenn man an den Morgenthau-Plan denkt. Der Gedanke der Versöhnung, dass es irgendwann gut sein muss, ist mir nicht fremd, hier aber will er nicht greifen. Ich traue meinem Volk so wenig wie mir selber. Daran ändert alle deutsche Weltoffenheit und Friedfertigkeit nichts, und schon gar nicht irgendein albernes Sommermärchen, bei dem die Welt zu Gast bei Freunden ist (wie schon 1936). Dazu liebe ich den Fußball viel zu sehr.