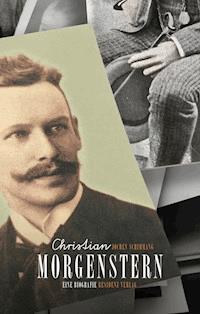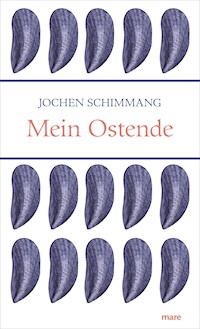Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was geschieht, wenn man in der Mitte des Lebens von den politischen Ereignissen überholt wird und alles, was man bis dahin für selbstverständlich angesehen hat, ins Strudeln gerät? Jochen Schimmang erzählt die Geschichte von Leo Münks, Verfassungsschützer, und Gregor Korff, Ministerberater. Ihre Köln-Bonner BRD-Welt gerät mit der Wende ins Wanken: Gregor erfährt, dass seine große Liebe, die ihn Mitte der Achtzigerjahre plötzlich verlassen hat, ein Stasi-Spitzel war; und Leo Münks wird ein Freund aus Berliner Studententagen, der ein Germania-Denkmal in die Luft sprengen will, beinahe zum Verhängnis. Schimmang, der Archivar der verschwindenden Dinge, hat einen klugen und sehr spannenden Roman über die letzten Jahrzehnte der Bonner Republik geschrieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jochen Schimmang, geb. 1948, studierte Politische Wissenschaften und Philosophie an der FU Berlin und lehrte an Universitäten und in der Erwachsenenbildung. Von 1978 bis 1998 lebte er in Köln, seit 1993 als freier Schriftsteller und Übersetzer. Jochen Schimmang lebt heute in Oldenburg. Seine schriftstellerische Arbeit wurde mit Preisen und Stipendien gefördert. Zu seinen wichtigsten Romanen zählen Der schöne Vogel Phönix (1979), Die Geistesgegenwart (1990) und Ein kurzes Buch über die Liebe (1997) sowie Die Murnausche Lücke (2002). Zuletzt erschienen die Erzählungenbände Vier Jahreszeiten (2002) und Auf Wiedersehen, Dr. Winter (2005).
www.jochen-schimmang.de
Jochen Schimmang
DAS BESTE,WAS WIR HATTEN
Roman
Der Dank des Autors für Unterstützung in verschiedenster Form bei der Arbeit an dem vorliegenden Roman gilt Monika Eden, Ralph Gätke, Benedikt Geulen, Michael Heitz, Susanne Heitz, Bettina Hesse, Eduard Hoffmann, Casjen Klosterhuis, Michael Kohtes, Rolf Laube, Christian Linder, Gert Loschütz, Klaus Modick, Hans-Ulrich Müller-Schwefe, Christian Rolfs, Thomas Schaefer, Robert Suermann und Thorsten Themann.
Die Arbeit an dem vorliegenden Text wurde durch den Deutschen Literaturfonds e. V. gefördert. Der Autor dankt außerdem dem Künstlerhaus Edenkoben für fünfmonatige Gastfreundschaft und Unterstützung.
Edition Nautilus Verlag Lutz Schulenburg
Schützenstraße 49 a · D - 22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten · © Edition Nautilus 2008
Originalveröffentlichung · Erstausgabe Juni 2009
Umschlaggestaltung: Maja Bechert, Hamburg
www.majabechert.de
Titelmotiv: © Daniel Hauri
Autorenfoto: © Teja Sauer
5. Auflage April 2010
ISBN 978-3-89401-598-5
e-ISBN 978-3-89401-826-9
Für Sabine
Inhalt
ERSTER TEIL
1 Der Schuppen
2 Innerstaatliche Feinderklärung
3 »Vorwärts möchte ich gerade nicht«
4 Am Rhein so schön
5 Arbeitersport vom Feinsten
6 Jetzt bitte keine anderen Trauergäste
7 Guten Morgen in großer Zeit
8 Kölsche Mädcher
9 »Die Sonne wärmt trotz allem unsere Knochen«
10 Vom Ausnahmezustand
11 Die Macht, das Auto, das Kasino, die Frau
12 Kurz vor Ostende
13 Flamingos im Zoo
14 Elegie
15 Nie sollst du mich befragen
16 Der Siebzehnjährige aus Leimen schlägt das letzte Ass
17 Hartings Kaffee ist der beste
18 Armer Gregor, sagt Anita
19 Ein neuer Archivar ist in der Stadt
20 Ein Abendessen bei Carl Schelling
21 Im Amt
22 Im Stadtwald
23 Frau Mohr-Hagen greift ein
24 Bungalow. Abschied von den Eltern
25 Rheinhotel Schulz. Die serbische Hochstaplerin
26 Ein Geständnis
27 Erinnerungen an einen Hochzeitstag
ZWEITER TEIL
28 Tischgespräche in Lindenthal
29 res publica. eine zeitschrift für freie geister
30 Am Rhein so schön (2)
31 »Endlich hat mal was geklappt«
32 Besuche
33 Vor dem Urteil: Shelter from the Storm
34 Kriegsrat in der Landgrafenstraße
DRITTER TEIL
35 Kampagne. Das Normale und das Andere
36 Interviews
37 Eine Art Heiliger
38 Seinesgleichen geschieht: Gregor und die Propaganda der Tat
39 Eine kurze Geschichte des Farbeis
40 Himmelsrichtungen
41 Erinnerungen an den Frieden
42 Der Schuppen (2)
Bey dem freundlichen Bonn fängt die eigentlich schöneRheingegend an …Friedrich Schlegel, Köln und Rheinfahrt
»Nein«, sagte er, »wir haben ein großes und ein kleines Gedächtnis. Das kleine, um uns der kleinen Dinge zu erinnern, und das große, um die großen Sachen zu vergessen.«John Le Carré, Eine kleine Stadt in Deutschland
ERSTER TEIL
Akteure Agenten
1 Der Schuppen
Der Regen hatte aufgehört, und sie fuhren auf ihren Rädern am Fluss entlang. Bisher war der Mai kühl und nass gewesen. In diesem Jahr hatten sie noch kein einziges Mal am Ufer im Gras gelegen. Nach dem Schauer kam die Sonne durch, und es schien erstmals richtig warm zu werden. Nott hielt an und ließ sein Fahrrad ins Gras fallen. Durch das Schilf sahen sie den Fluss vorbeiziehen: schnell und geschäftig, als müsse er heute noch irgendwo ankommen.
Nott wollte sich hinsetzen, aber Gregor war das Gras zu feucht. »Ich würde mir lieber mal den Schuppen da drüben ansehen«, sagte er.
Der Schuppen stand sechzig Meter vom Ufer entfernt, ein verwitterter Holzbau mit einer winzigen Veranda davor. Das Holz war einmal rostrot gewesen; inzwischen war es blass und hell. Gregor fühlte sich an die Laube erinnert, die früher in ihrem Schrebergarten in Thalheim gestanden hatte. Es war das einzige Gebäude hier weit und breit; der Rand der Stadt lag schon gut zwei Kilometer hinter ihnen.
Sie untersuchten die Tür, die nicht abgeschlossen war. Gregor rief ein paarmal leise Hallo, aber es kam keine Antwort. Nott zog die unverschlossene Tür langsam auf, ohne dass etwas Schreckliches geschah. Sie waren auf Gestank gefasst, auf Ungeziefer, einen Tierkadaver vielleicht, irgendetwas Ekliges. Der Bau war jedoch ganz leer; nur eine lange Sitzbank stand an der gegenüberliegenden Wand. Es roch muffig, aber nicht widerlich. Der Schuppen war solide gebaut und überraschend warm. Die drei Fenster, zwei nach vorn und eins nach hinten, starrten fast blind.
Sie waren keine Kinder mehr; dies hier sollte kein Unterschlupf für Tom Sawyer und Huckleberry Finn werden. Sie waren fünfzehn Jahre alt und sehnten sich nach Ruhm und nach Mädchen, mit denen man etwas anfangen konnte. Aber der Bau konnte ein Ort werden für sie. Er stand im Niemandsland, und kaum jemand kam hier vorbei. Wer immer diese Hütte einmal errichtet hatte, er war vielleicht gestorben oder hatte einfach keine Verwendung mehr dafür, und sie würden sie übernehmen: Nur sie beide, niemand sonst würde davon erfahren, das versprachen sie sich.
»Ich besorge ein Schloss«, sagte Nott.
»Ein Schloss?«
»Wir müssen die Tür absperren können, wenn wir hier drin sind.«
»Stimmt, ja. Kannst du das, ein Schloss einbauen?«
»Kann ich, ja. Morgen Nachmittag. Danach putzen wir die Fenster.«
Am nächsten Tag fuhren sie gleich nach dem Mittagessen dorthin und achteten darauf, dass ihnen niemand folgte. Es war noch wärmer geworden. Nott hatte einen Eimer voller Putzmittel mitgebracht und das Schloss mit zwei Schlüsseln. Nach zwei Stunden Arbeit unter Notts Anleitung hatten sie den leeren Schuppen gesäubert, und durch die Fenster fiel Licht, auch wenn innen noch immer ein angenehmer Halbdämmer herrschte.
In der folgenden Woche brachten sie zwei Stühle mit und einen kleinen Tisch, alt und wacklig, den Nott aber neu verleimte. Nott war der Praktische. Alles konnte er reparieren; er wusste, wo es was gab, möglichst umsonst; er wusste auch, wie man den Schuppen noch etwas besser isolierte: »Schließlich wollen wir es im Winter hier ja auch noch aushalten.« Nott war der Handwerker, sah sich selbst aber eher als Künstler, und wirklich gab es keinen besseren Zeichner als ihn. Wie er zu seinem Namen gekommen war, wusste keiner mehr, aber alle riefen ihn so, denn sein richtiger Vorname (und der Familienname dazu) war eines dieser kühnen ostfriesischen Gebilde, die kaum jemand aussprechen konnte – schon gar nicht ein Zugewanderter wie Gregor Korff.
Später baute Nott aus Polsterelementen noch ein Sofa zusammen und schleppte einen alten Sessel an, der an einer Stelle eine tiefe Kuhle hatte. Er brachte auch Decken mit, ein paar Gläser, Tassen, Löffel. Langsam wuchs der leere Raum zu und wurde zur Höhle. Da hatten sie schon angefangen zu spielen.
Am liebsten spielten sie Beckett. Fin de partie. Ende, es ist zu Ende, es geht zu Ende, es geht vielleicht zu Ende. Genau der richtige Weltschmerz für sie. Er war ganz echt, aber sie lachten viel dabei. Ein paar Szenen spielten sie immer wieder, über Monate. Natürlich nicht Nagg und Nell: Eltern waren ganz uninteressant, Begleitpersonal, hier in diesem Stück und im Leben auch. Bei Nott gab es ab und zu Krach mit seinem Vater, aber Gregor hatte mit seinen Eltern gar keine Probleme. Sie waren irgendwie da, im Hintergrund, das war alles. Er kam gern nach Hause abends. Es machte ihm keine Schwierigkeiten, Geschichten zu erfinden, wo er nachmittags gewesen war. Selbstverständlich hatten auch seine Eltern keine Ahnung von dem Schuppen.
Nott und er spielten Hamm und Clov. Nott saß im Sessel und spielte den Hamm, Gregor warf als Clov einen vorsichtigen Blick in die Außenwelt, wo das Leben leider immer noch nicht ganz erstorben war. Sie freuten sich mehr als an allem anderen an der Ausweglosigkeit, dem geschlossenen Raum: An der rechten und linken Wand je ein hoch angebrachtes Fensterchen mit geschlossenen Vorhängen. Eigentlich hatten sie den Schuppen entdeckt, um darin Beckett spielen zu können, den ganzen verregneten Sommer 1963 hindurch. Ohne Beckett hätten sie gar keine Augen für den Schuppen gehabt. Beckett war etwas ganz Besonderes. Existenzialist konnte jeder sein, ein paar schwarze Klamotten, eine Schachtel Gauloises und fertig. Den Existenzialismus hatten sie schon hinter sich. Über die Exis lächelten sie milde, wenn sie ihnen auch allemal lieber waren als die Spießer. Beckett dagegen war für die Auserwählten. Zum Schreien komisch. Tieftraurig. Wie geht es deinen Beinen, wie geht es deinen Augen. Und dein Pipi? Wird gemacht.
Gregors Lieblingsstelle war Clovs träumerisches Bekenntnis zur Ordnung. Ich liebe die Ordnung, sagt Clov. Sie ist mein Traum. Eine Welt, in der alles still und starr wäre und jedes Ding seinen letzten Platz hätte, unterm letzten Staub. Keine Stelle spielte Gregor mit solcher Inbrunst wie diese.
Natürlich hatten sie immer Angst, dass man ihren schönen Schuppen entdeckte. Wiederholt liefen draußen am Ufer Liebespaare entlang. Einmal hielt ein alter Mann auf seinem Fahrrad an und sah lange zu ihrem Bau hinüber. Was würden sie tun, wenn er herkäme? Wenn er durchs Fenster lugte oder an der Tür rüttelte? Aber schließlich fuhr er weiter, ohne den Schuppen näher inspiziert zu haben.
Am gefährlichsten waren eigentlich die Kinder, die nachmittags manchmal am Ufer spielten. Kinder sind unberechenbar und neugierig. Einmal schlichen zwei kleine Jungen auf ihr Haus zu, aber dann trauten sie sich nicht. Vielleicht und dem Himmel sei Dank hatte der Bau etwas Unheimliches, Düsteres für Kinder. Vielleicht erinnerten sie sich an die Ermahnungen ihrer Mütter, nicht in solche leeren Häuser zu gehen, nicht an den Bahngleisen zu spielen, nicht auf den Hof der alten Fabrik zu gehen und sich überhaupt in Acht zu nehmen vor allem und jedem, das und den sie nicht kannten.
Es mochte auch das Wetter sein, das Gregor und Nott vor der Entdeckung schützte. Das war in diesem Jahr meist nicht so, dass es die Paare verlockte, sich hier ins Gras zu legen oder gar ein Versteck zu suchen in ihrem Häuschen. Es blieb ihnen schließlich selbst überlassen, das Geheimnis des Schuppens zu lüften, im Herbst des nächsten Jahres.
Aber noch spielten sie Beckett, oder Nott zeichnete Gregor, das Innere des Schuppens, die Flusslandschaft draußen. Sie rauchten und träumten von später und langweilten sich köstlich. Sie genossen diese Stunden sehr, in denen nichts geschah, sondern einfach nur Zeit verging. Manchmal sprachen sie auch über Mädchen, besonders über die Schwestern Fuchs, fünfzehn, vierzehn und dreizehn Jahre alt, genannt die Füchsinnen. Nicht Lyzeum, sondern Realschule, das war ohnehin besser. Gregor erzählte von einem französischen Film, den er gesehen hatte, Adieu Philippine, in dem es auch um Mädchen ging, und jeden Monat kauften sie das neue Heft von twen, wegen der Fotos vor allem. Ein bisschen warteten sie darauf, dass das Leben anfing, aber nicht ungeduldig. Sie hatten es nicht so eilig wie der Fluss, der da vorn an ihnen vorbeizog.
Später im Jahr, als es nach dem verregneten Sommer in einen versöhnlichen, milden September überging, mit einer blaugrau zitternden Luft, in der an einzelnen Tagen schon rauchig der Herbst zu riechen war, brachte Nott ein Transistorradio mit. Sie hatten Mühe, einen vernünftigen Sender zu finden, aber manchmal gelang es ihnen, die Musik zu erwischen von der anderen Seite der Nordsee. Listen, do you want to know a secret … But I’ll get you, I’ll get you in the end …
Aber vorher passierte noch die Geschichte mit diesem Mädchen in London, mit dieser jungen Frau, und die nahm ihnen fast den Atem.
Die Affäre bekam ihren Namen nicht nach der jungen Frau, die Christine Keeler hieß, sondern nach dem englischen Kriegsminister, John Profumo. Der hatte kurz etwas gehabt mit der jungen Frau, die er im Haus von Lord und Lady Astor eines Abends nackt im Swimmingpool entdeckt hatte. Das ist gewiss aufregend, wenn man da als Kriegsminister auf einer privaten Party so ganz ahnungslos am Rand eines Swimmingpools steht, und plötzlich steigt ein nacktes Mädchen heraus, neunzehn Jahre alt und wunderschön. Das war nun schon beinahe zwei Jahre her und hatte auch nicht sehr lange gedauert. Aber jetzt erst kam es heraus, und das Dumme war, dass Christine Keeler es zur gleichen Zeit mit einem sowjetischen Marineattaché getrieben hatte, der Iwanow hieß. Also zuerst Profumo im Bett (der hatte italienische Vorfahren), dann am nächsten Tag dieser Iwanow. Von dem sagte die Keeler später, er sei »ein herrlicher Bär von einem Mann«. Das war ein erstklassiges Muster für Spionage, und im Juni, Gregor und Nott hatten sich gerade fertig eingerichtet in ihrem Schuppen, musste Profumo von seinem Amt als Minister zurücktreten.
Sie verfolgten die Berichte. Was sie am Anfang vielleicht am meisten überraschte, war die Tatsache, dass auch Politiker vögeln: Darüber hatten sie noch nie so richtig nachgedacht. Die Spionagegeschichte selbst interessierte sie nur mäßig. Vielleicht war da auch gar nichts; vielleicht hatte Profumo im Bett keine Dienstgeheimnisse verraten.
»Da hat er bestimmt was anderes zu tun gehabt«, sagte Nott, und sie grinsten beide.
Es war natürlich das Mädchen, das sie interessierte. Nicht das Mädchen, die junge Frau. Die Fuchs-Schwestern waren Mädchen, aber diese Christine Keeler war sechs Jahre älter als Gregor und Nott. Bald konnte man eine ganze Reihe Fotos von ihr sehen, eins zum Beispiel, wie sie in einer leeren Badewanne lag und nur mit einem knappen Handtuch bekleidet war. Dann kam eins dazu, das weltberühmt wurde: Da saß sie nackt und verkehrt herum auf einem Designerstuhl, die Arme auf der Rücklehne und vor der Brust verschränkt, die langen Beine kamen links und rechts hinter der Lehne vor, hinter der man das geöffnete Geschlecht ahnte. Das war es, was ihnen fast den Atem nahm. Das war sensationell für Gregor und Nott, dieses Nackte. In England! Good old England! Den Namen Swinging London kannten sie noch nicht, der wurde erst später erfunden.
Sie mochten Christine Keeler wirklich, vom ersten Moment an. Es interessierte sie nicht, dass sie aus ihrer Geschichte – dem Skandal, wie er genannt wurde – Geld machte, ziemlich viel, und dass sie sogar einen Rolls Royce bekam. Sie sah einfach gut aus, sehr gut, sie war richtig klasse, und dabei wirkte sie auf den Fotos nicht einmal abgebrüht. Eher so, als müsse man sie beschützen, fand Gregor.
Sie konnten lesen, dass sie mit ihrem Stiefvater und ihrer Mutter in einem ausrangierten Eisenbahnwagen in der Provinz aufgewachsen war. Mit siebzehn ging sie von zu Hause weg nach London. Sie beide waren auch schon fünfzehn, aber sie hätten sicher nicht den Mut gehabt, einfach wegzugehen. Sie hatten ja nichts gegen ihre Eltern, und Gregor liebte es, zu Hause in dem kleinen Garten unter dem Apfelbaum zu sitzen und zu lesen. Es war zwar eine manchmal etwas zu stille Welt, aber noch mochte er sie nicht eintauschen gegen das richtige Leben.
Christine Keeler war dann Verkäuferin, Friseuse, Kellnerin, Tänzerin in einem Nachtclub, und schließlich tauchte dieser Dr. Ward auf, ein Arzt der High Society, und nahm sich ihrer an. An manchen Stellen der Geschichte gab es auch etwas zu lachen. Die Ehefrau von Profumo etwa war eine ehemalige Schauspielerin, und der bekannteste Film, in dem sie mitgespielt hatte, hieß Adel verpflichtet. Es gab auch richtige Tragik: Dr. Ward wurde verhaftet, wegen Zuhälterei angeklagt, verurteilt und beging Selbstmord.
Aber das waren alles Nebenfiguren. Wirklich interessierte sie nur Christine Keeler. Gregor und Nott standen ganz und gar auf ihrer Seite, egal, was die anderen in der Geschichte über sie sagten. Sie hatte etwas von einer Straßenkatze an sich, die es geschafft hat, sich in ein sehr gutes Haus einzuschmeicheln. Natürlich hätten sie es gern mit ihr getrieben, auch wenn sie noch gar keine Erfahrung hatten, wie das ging (die Knutschereien mit Hanna zählten nicht). Aber Gregor stellte sich vor allem vor, wie sie ganz nah beieinander sein würden, Christine Keeler und er, für immer, und wie sie sich wehren würden gegen den Rest der Welt. Er mochte sie wirklich sehr. Das sagte er Nott nicht. Christine Keeler war die erste Frau, in die er wirklich verliebt war.
Bald fehlte der Liebe die Nahrung, weil die Nachrichten aus England über den Fall spärlicher und im August schließlich durch die über den Postraub abgelöst wurden, bei dem der Postzug Glasgow–London fünfzig Kilometer vor dem Ziel von einer Gruppe maskierter Männer angehalten wurde, die fast dreißig Millionen Mark erbeuteten. Das war auch ganz interessant für Gregor, gab aber für seine Sehnsucht nichts her.
An den wenigen schönen Sommertagen des Jahres gingen sie nicht in den Schuppen, sondern in den kleinen Park in der Stadt oder liefen durch die Hauptstraße, um Mädchen anzusehen. Manchmal saßen sie auch in der Unterführung unter der Bahnlinie und tranken abwechselnd aus einer Flasche Martini. Im September brachte Nott ein Schachspiel mit in den Schuppen, und sie führten verbissene Kämpfe, die Gregor in der Mehrzahl verlor, ohne die Lust am Spiel zu verlieren. Vor ein paar Monaten hatte er den Satz eines berühmten Schachspielers gelesen: Schach ist ein blutiges Spiel, und nach den Partien gegen Nott konnte er ihn verstehen.
Später verlegten sie das Spiel zu Gregor nach Hause, weil es im Winter im Schuppen zu kalt war. Nott kam am Sonntagnachmittag. Anfangs spielten sie zwei Partien am Nachmittag, später nur noch eine, weil Gregor sich zu einem Defensivkünstler ausgebildet hatte, was die Partien fast endlos in die Länge zog. Gewinnen konnte er noch immer nur selten, aber auch Nott marschierte nicht mehr auf den Sieg zu wie am Anfang. Die meisten Partien endeten inzwischen remis.
Danach liefen sie manchmal in die Stadt, die leer und öde war an den Sonntagen, oft kalt und neblig dazu, oder freuten sich im Kino am Anblick des nackten Rückens und des nackten Hinterns von Brigitte Bardot in einem Film von Jean-Luc Godard, veredelt durch rote und blaue Farbfilter. Das Leben, das ohnehin nicht gern in ihre kleine Stadt zu kommen schien, war an den Sonntagen ganz daraus verschwunden, und Nott und Gregor gestanden sich auf einem ihrer kleinen Gänge gegenseitig, dass sie den Montag und die Schule herbeisehnten.
Als er vor vier Jahren mit seinen Eltern in die Stadt gekommen war, war Gregor anfangs sehr unglücklich gewesen in dieser Schule. Man lachte in der Klasse, wenn er den Mund aufmachte und von »Kürschen« sprach und in die »Kürche« ging, anstatt glockenhell und piepsig von den »Kierschen« und der »Kierche« zu erzählen, wie es diese ostfriesischen Blondköpfchen taten. Sie hatten nichts gegen ihn, sie lachten ihn nur aus, und das wärmte sie und bescherte ihnen wohlige Schauer, jedem von ihnen, weil zum Glück nicht er selber es war, der ausgelacht wurde. Dabei sagten diese piepsigen blonden Tölpel selber Sätze wie ich bin schlecht oder ich bin kalt statt mir ist schlecht und mir ist kalt, und man hätte ihnen nicht mal erklären können, was daran falsch war. In diesem ersten Schuljahr am neuen Ort erfuhr Gregor zum ersten Mal, was ein Fremder ist, und sehnte sich in sein Städtchen am Vorharz zurück.
Aber die ganz normale Grausamkeit von Kindern stirbt irgendwann, und vier Jahre später war Gregor von fast allen in der Schule heftig umworben, konnte sich seine Freunde aussuchen und hatte doch eigentlich nichts dafür getan. Ein Fremder war er noch immer, aber ausgelacht wurde er nicht mehr, und jeder versuchte, hinter sein Geheimnis zu kommen, das er gar nicht hatte. Nicht mehr als jeder von ihnen in diesem Alter. Sie hatten alle diese kleine Heimlichkeit, von der in Wahrheit jeder wusste, dass sie sich nämlich abends vor dem Einschlafen oder morgens nach dem Aufwachen einen runterholten, und außerdem das andere kleine Mysterium, dass sie sich fragten, was wohl der Sinn des Lebens sei: das gehörte irgendwie zusammen. Das erste wirkliche Geheimnis, das Gregor Korff an seinem neuen Wohnort hatte, war sehr konkret, und er teilte es von Anfang an mit einem Anderen: den Schuppen draußen am Fluss.
Im Oktober 1964 enthüllten sie das Geheimnis, und das Geheimnis enthüllte sich ihnen.
In den Sommerferien waren sie eine Woche in Westberlin gewesen. Die Eltern hatten die Busfahrt bezahlt, Taschengeld gegeben und sie ermahnt, nicht unter die Räder zu kommen. Sie wohnten sehr weit im Norden, in Frohnau, einem eher kleinstädtischen Teil Berlins nah an der Grenze zu Brandenburg, denn dort war die Jugendherberge. Von da fuhren sie jeden Tag mit dem Bus bis zur U-Bahn Tegel, und von Tegel aus weiter ins Herz der großen Stadt: zum Bahnhof Zoo, zum Kurfürstendamm, in die Tauentzienstraße. Als sie zum ersten Mal mit der U-Bahn fuhren und aussteigen wollten, wussten sie nicht, wie die Türen zu öffnen waren, bis ein anderer Fahrgast das für sie erledigte. Gregor hörte das leise Gelächter in ihrem Rücken und die Frage eines jungen Mannes: »Wo die wohl herkommen?« Auf dem Bahnsteig begann er zu rennen, als wollte er die Scham so schnell wie möglich hinter sich lassen.
Einmal fuhren sie zur Friedrichstraße und bewegten sich durch das komplizierte System der Gänge, Sperren und Kontrollen in den Osten der Stadt. Zum ersten Mal roch Gregor das Lysol, das ihm später so vertraut werden sollte. Noch in der Friedrichstraße wurden sie von zwei Jungen in ihrem Alter angesprochen, die sie baten, in den Intershop zu gehen und Westzigaretten für sie zu kaufen: HB, Ernte 23, Peter Stuyvesant. Sie führten den Auftrag aus, und als sie am frühen Abend wieder zur Friedrichstraße gingen, war Gregor sehr nervös. Vielleicht waren sie beobachtet worden, und das dicke Ende kam nach. Es passierte aber gar nichts. Ostberlin war sehr still gewesen, doch der Westen der Stadt kam Gregor in der Erinnerung auch nicht viel lebendiger vor, als sie nach einer Woche wieder zu Hause waren. Keine Stadt, die für ihn in Frage kam, wenn er von seinen Eltern fortging.
Sowieso wollten sie alle eigentlich nur nach London, oder noch lieber vielleicht nach Liverpool. Noch in Westberlin hatten sie sich jeder ihre erste Langspielplatte gekauft, A Hard Day’s Night, die gerade erschienen war. Nach einer Woche konnten sie fast alle Songs auswendig mitsingen, aber was ihnen am meisten Bewunderung abrang, war der Anfangsakkord des Titelsongs. Es war, als ob sich zu Beginn eines Films ein riesiges Fabriktor öffnete und die Arbeiter herausströmten, endlich frei für einen Abend, eine Nacht. And I’ve been working like a dog. I should be sleeping like a log. Hunderte, nein Tausende von Männern und Frauen, die aus dem Fabriktor kamen. Das war Wärme, das Ende des Alleinseins.
Nott und Gregor blieben vorerst allein in ihrem Schuppen. Nott hatte ein Fanmagazin besorgt, The Beatles Monthly, das hauptsächlich aus Schwarzweißfotos bestand und in dem außerdem ein paar Texte abgedruckt und neueste Nachrichten über die Gruppe zu lesen waren. Notts Lieblingsbeatle war überraschenderweise Ringo, Gregor liebte natürlich John. Im Herbst sahen sie den Film, mit der schönen Stelle, wo die süßen Mädchen durch die Gittermaschen des Gepäckwagens versuchen, den Beatles ins Haar zu greifen, während diese I should have known better singen, und in den Herbstferien gingen sie beide in einer Fabrik arbeiten, um sich danach Klamotten kaufen zu können. Die Zeit, da ihre Eltern sie einkleideten, war vorbei.
Die Fabrik stellte Verpackungsmaterial her. Sie wurden in der Packerei eingesetzt, wo die Produkte für den Versand fertiggemacht wurden, ein großer lichter Raum, in dem der Staub in der Oktobersonne tanzte. Nott war schneller als Gregor, aber sie wurden ohnehin per Stunde bezahlt. Sonst arbeiteten dort nur Frauen, die schon verheiratet waren, und junge Mädchen, die darauf warteten, geheiratet zu werden und während ihrer Wartezeit mit unglaublichem Geschick und in rasendem Tempo die Tüten, Taschen und Säcke einpackten und verschnürten, weil sie Stücklohn bekamen. Nebenan lärmten die Maschinen, und ab und zu fuhr ein Gabelstapler durch die Gänge. Um halb vier öffnete sich das Fabriktor, und in dem Moment, da Nott und er nach draußen kamen, hörten sie in ihrem Kopf den Anfangsakkord von A Hard Day’s Night.
Nach zwei Wochen war der Job vorbei und die Ferien beinahe auch. Für Gregor reichte es zu einer Jeans mit leichtem Schlag und einem Paar erstklassiger schwarzer Beatles-Stiefel. Er musste nach Hamburg fahren, um sie zu bekommen. Eine schwarze Jacke, deren Kragen er immer hochgestellt trug, hatte er schon seit einem Jahr. Nott holte sich Jeans und einen grünen Parka. Das war nicht Gregors Fall, aber sie gingen trotzdem zusammen auf den großen Herbstrummel und standen stundenlang an der Raupe. Da kämpften Little Richard, Fats Domino, die Beatles und die Stones um die kulturelle Hegemonie, während die Wagen immer schneller über Berg und Tal donnerten und sich schließlich das Verdeck schloss. Am letzten Tag lotsten sie die beiden ältesten Füchsinnen langsam vom Gelände runter und schafften es tatsächlich, dass sie die ganze Strecke mitgingen bis zu ihrem Schuppen am Fluss. Gregor ging neben Angela, der ältesten, und Nott neben Irene, der mittleren, genannt Reni. Die war nach allem Gerede und Geflüster, das durch die Schule und die Straßen ging, die Schärfste von allen.
Es dämmerte schon, als sie am Schuppen ankamen, aber sie hatten zwei Baustellenlampen und dazu Kerzen genug. Nott holte eine Flasche Martini und vier Gläser aus dem kleinen Schränkchen, das er eines Tages angeschleppt hatte. Die Mädchen waren entzückt vom Schuppen, auch von der Ordnung, die darin herrschte. Sie gingen davon aus, dass Nott und Gregor sie von Anfang an als Liebeslaube genutzt hatten, und die beiden ließen sie in dem Glauben.
Später konnte sich keiner mehr erinnern, warum plötzlich Reni bei Gregor auf dem Schoß saß und Nott mit Angela knutschte, obwohl es am Anfang umgekehrt ausgesehen hatte. Sie hatten schon die zweite Flasche Martini aufgemacht. Gregor hatte plötzlich zum ersten Mal eine weibliche Brust in der Hand. Die kleine Reni hatte sie dorthin führen müssen, denn Gregor hätte sich allein nicht getraut, obwohl ihre Küsse – ganz andere als damals die von Hanna – schon Aufforderung genug waren. Die beiden Paare hatten sich jetzt in verschiedene Ecken des Raumes zurückgezogen und hörten einander schnaufen und keuchen. Sie hatten längst alle Lichter ausgemacht. Gregor hörte von drüben das Kichern der älteren Schwester, während die jüngere sich an ihm zu schaffen machte. Schließlich hatte sie sein Geschlecht in der Hand und rieb es, während es in der anderen Ecke jetzt ganz still war, und plötzlich beugte sie sich darüber. Ein paar Minuten später schrie Gregor laut und juchzend auf, und ihm schwindelte, und Reni Fuchs ließ von ihm ab und fragte: »Schön, oder?«
Den ganzen Herbst und Winter flanierten sie zu zweit oder zu viert durch die Stadt. Der Schuppen wurde bald zu kalt, und man sah sie in den beiden angesagten Cafés der Stadt sitzen, für sich oder mitten im Pulk der anderen Schüler: Nott im Parka, den er fast nie auszog, und Gregor in seiner schwarzen Jacke mit dem hochgestellten Kragen, in Jeans und mit den Beatles-Stiefeln, die er täglich pflegte. An ihren Schultern lagen Angela und Reni Fuchs mit ihren schwarzen Fransenponys und den darunter gerade noch sichtbaren Mandelaugen. Über den Tischen stand der Zigarettenrauch wie eine Nebelwand. Gregor hatte Fotos aus dem Cavern Club in Liverpool gesehen; so musste es dort sein.
Im Frühjahr hörte es auf. Zuerst ließ Angela Nott sitzen und ging mit einem Achtzehnjährigen. Dann sagte Reni zu Gregor an seinem siebzehnten Geburtstag, dass sie keine Lust mehr habe. Gregor wollte es genauer wissen, aber sie weigerte sich, mehr zu sagen. »Ich hab dich schon gern«, sagte sie, »aber ich habe keine Lust mehr.« Irgendwann später erfuhr er von einem Freund, dass Reni Fuchs ihn wirklich süß gefunden hatte, aber auch irgendwie langweilig, weil er so wenig von sich erzählte und so selten lachte. »Das geht eben auf die Dauer nicht gut, einer vom Gymnasium und ein Mädchen, das mit Ach und Krach die Realschule schafft«, sagte der Freund.
Mitte April räumten sie den Schuppen aus. Sie hatten sich seit dem Herbst kaum noch darum gekümmert, aber es war nicht eingebrochen und nichts beschädigt worden. In der Nähe hatte man an drei Stellen zugleich angefangen zu bauen, der Stadtrand verschob sich weiter nach draußen.
»In einem Jahr müssten wir sowieso abhauen«, sagte Nott, »wenn sie den Schuppen nicht schon vorher plattmachen.«
Er lag ziemlich richtig mit seiner Prognose. Im Mai des folgenden Jahres, als sie sich aufs Abitur vorbereiteten, wurde der Schuppen abgerissen.
Achtzehn Jahre nach diesem Abitur liefen sie sich in einem Frankfurter Hotel über den Weg, wo sie an zwei verschiedenen Tagungen teilnahmen. Nott war seit über zehn Jahren Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Hamburg und vertrat Mandanten aus dem sogenannten linken Spektrum. Gregor Korff hatte sein Berliner Irresein längst hinter sich. Er liebte und lebte wieder die Ordnung, wie Clov, und verteidigte die Republik, indem er einem ihrer Politiker zuarbeitete. Seit zwei Jahren wohnte er in Bonn. Sie standen sich im Fahrstuhl gegenüber, und Nott rief: »Gregor Korff!« Gregor erkannte seinen Freund von früher erst nach einem kurzen Stutzen. Von den beiden Tagungen, an denen sie teilnahmen, drehte sich im weiteren Sinn die erste um den Staat als Feind, die zweite um den Staat als Schutzmacht. Abends aßen sie zusammen außerhalb des Hotels, in einem indischen Restaurant im Bahnhofsviertel. Beide nahmen das Tandoori-Hühnchen und tranken Unmengen Kingfisher-Bier. Sie verstanden sich prächtig nach all den Jahren und wussten beide, dass sie sich wieder aus den Augen verlieren würden. Am Ende des Abends, als sie draußen im Nieselregen auf das Taxi warteten, leicht schwankend, aber doch nicht wirklich betrunken, dachten sie noch einmal an die gemeinsamen Tage im Schuppen: wie sie Hamm und Clov gewesen waren, wie sie die Berichte über Christine Keeler gelesen hatten, wie völlig versunken sie Schach gegeneinander gespielt hatten und wie sie schließlich mit Angela und Reni Fuchs im Schuppen gelandet waren. Oh ja, sie waren sehr glücklich damals, daran erinnerten sie sich jetzt, und als das Taxi endlich kam, sagte Nott: »Das war doch das Beste, was wir je gehabt haben!«
2 Innerstaatliche Feinderklärung
Ja, vielleicht war das wirklich das Beste, was wir gehabt haben, dachte Gregor jetzt, am letzten Abend der achtziger Jahre, als er in seiner Wochenendhütte weit oberhalb von Königswinter saß. Die Hütte war ein ausgewachsenes kleines Haus in massiver Bauweise, das er vor zwei Jahren einem Regierungsdirektor abgekauft hatte. Wenn er anderen davon erzählte, sprach er jedoch nur von seiner Hütte, und im Stillen nannte er das Häuschen für sich manchmal auch den Schuppen.
Vielleicht war es wirklich das Beste, was sie je gehabt hatten: diese windstillen frühen und mittleren sechziger Jahre, ihre Jugendjahre. Davon zehrte er noch. Vor drei Jahren etwa hatte Sonja, die letzte und heftigste seiner Affären (ach, es hätte mehr werden sollen!), plötzlich die Beatles entdeckt. Sie wollte wirklich alles von ihnen haben und war sogar hinter alten Fanzines her. Gregor stand kurz davor, ihr seine alten Beatles Monthly zu schenken, horchte dann aber in sich hinein und entdeckte, dass seine Liebe so weit nicht ging. Sonja begann, ihm Vorträge zu halten über die herausragende Rolle der fab four in der Geschichte der Popmusik, bis Gregor sie kühl unterbrach und ihr klarmachte, dass er die Gruppe nicht hatte entdecken müssen, sondern sie gleichsam im Original erlebt hatte, in Echtzeit, mit einem Wort, dass er mit ihr aufgewachsen war und John, Paul, George und Ringo damals seine engsten Freunde waren. Es machte ihm Spaß, Sonja das zu sagen und ihr deutlich zu machen, dass sie ihn in diesem Punkt niemals mehr würde einholen können. Noch nie war es ihm so sehr eine Freude gewesen, elf Jahre älter zu sein als sie, wie in diesem Augenblick.
Und Beckett im Schuppen! Ja, es war wohl das Beste, was sie gehabt hatten. Später das Schachspiel, erst im Schuppen, dann bei ihm zu Hause, so etwa im November. Er erinnerte sich an den Morgen, als er kurz vor Schulbeginn beim Frühstück saß – allein, sein Vater war schon aus dem Haus – und seine Mutter die Zeitung hereinholte und plötzlich einen Schrei ausstieß. Einen schlimmen Schrei, voller Angst und Erschrecken. Die Zeitung war ein überregionales Blatt, großes Format, nicht das kleine Faltblatt namens Lokalzeitung. Sie hielt ihm die fette, fast unseriös überdimensionierte Schlagzeile entgegen: Kennedy ermordet.
Mein Gott, dachte Gregor jetzt, während im Nachbarhaus bei Frings offenbar Silvestergäste ankamen, dass wir das nicht schon am Abend zuvor erfahren haben! Heutzutage wäre es ganz ausgeschlossen, dass etwas passiert, und man weiß es nicht spätestens zwei Stunden später. Man müsste schon auf einer Insel sein, die von den Medien noch nicht erreicht wird. Aber wir hatten eben damals noch keinen Fernseher, und unsere Nachrichtenquellen waren die Zeitung und das Radio. Radio scheinen wir am Abend davor nicht gehört zu haben.
Der Schock war heftig und tief, hielt aber nicht lange an. Vielleicht erreichte er seine Eltern stärker als ihn und Nott. Er war irgendwie wichtig, dieser Mord, spielte aber letzten Endes in der Welt, in der sie lebten, keine Rolle. Nicht in dieser Welt aus Büchern, Filmen, Liedern. Was Amerika anging: wichtiger als Kennedy war Hemingway, lost generation, und dann die Südstaaten: Capote, McCullers, Faulkner. Das war für sie eine Sehnsuchtslandschaft wie sonst nur Frankreich und die Merseyside.
Nebenan waren jetzt offenbar alle Gäste eingetroffen und die Begrüßungsrituale vorüber. Über der Haustür brannte wieder einsam und still die Lampe, und wenn ihr jemand zu nahe kam, flammte zusätzlich ein Bewegungsmelder auf. Nachbar Frings gehörte weder im engeren noch im weiteren Sinne zur Bonner Ministerialbürokratie und war insofern in dieser Umgebung fast ein Exot. Er war einfach nur ein hoher Beamter in der Stadtverwaltung von Königswinter, knapp zehn Jahre älter als Gregor, mit einer netten Frau und zwei Kindern, von denen die Tochter schon seit zwei Jahren fort war und der Sohn im Frühjahr nun auch zu studieren begonnen hatte: nicht in Bonn, das ihm zu nahe lag, sondern in Berlin an der Freien Universität. Das alles hatte Gregor in Gesprächen von Tür zu Tür herausgefunden, gewissermaßen am Gartenzaun oder genauer an der Hecke, und einmal hatte er sich von Frau Frings tatsächlich etwas Butter ausgeliehen, als er an einem Freitagabend aus Bonn herübergekommen war und seinen Kühlschrank inspiziert hatte. Sein köstliches Alleinsein, seine königliche Einsamkeit machten ihn nicht ungelenk. Sie machten ihn umgänglich und geschmeidig. Es gab in ganz Bonn und im ganzen Siebengebirge keinen Umgänglicheren als Gregor Korff.
Der Frings-Sohn studierte jetzt Jura in Berlin und dazu tatsächlich Politische Wissenschaften, am selben Otto-Suhr-Institut wie seinerzeit Gregor. Ein gutes Jahr nach dem ersten Besuch damals in Westberlin mit Nott fuhr er mit der Klasse noch einmal dorthin, das war Klassenfahrtspflicht kurz vor dem Abitur, der Gipfel der politischen Bildung. Diesmal kam ihm die Stadt viel voller vor, kompakter, lärmender, lebendiger und wirklicher. Er wusste nicht, dass es an der Oktoberluft und dem Oktoberlicht lag, am Rauch, am Dunst und am Grau, die über der Stadt lagen. Er war berauscht. Du, vielstädtiges Berlin, über und unter dem Asphalt geschäftig …
Unter dem Asphalt: Die U-Bahn konnte er benutzen ohne Zögern, ohne Stocken, hatte allen anderen etwas voraus damit. Als sie nach einer Woche die Stadt wieder verließen, war er fest entschlossen, nach dem Abitur dorthin zu gehen. Den Plan des U-Bahn-Netzes trug er in sich; vorsichtshalber hatte er aber auch einen auf Papier mitgenommen und heftete ihn zu Hause in seinem Zimmer an die Wand. Voller Ungeduld erwartete er den Wechsel seiner Lebensumstände, von dem ihn nur noch das Abitur trennte. Homo homini lupus – Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Erläutern Sie diesen Satz von Thomas Hobbes und nehmen Sie Stellung! Das hatte er getan und musste doch noch anderthalb Jahre warten, bis er in die Stadt seiner Träume gehen konnte, denn vorher wollte ihn das Vaterland. Die abwehrbereite Republik.
In einigen Gärten der Nachbarschaft wurden die ersten Knaller und Raketen probegezündet, obwohl es noch mehr als drei Stunden dauern würde, bis die achtziger Jahre endgültig zu Ende gingen. Ein kleines Strohfeuer nur, dann wurden die Kinder und die Jungen wieder hereingerufen. Vielleicht gab es jetzt Karpfen oder einfach Bockwurst mit Kartoffelsalat. Es war ein feuchter und milder Silvesterabend, hier oben auch verhangen, ein typisch rheinischer Dezembertag. Nasse Gärten, Berge im Nebel, Dunstschwaden über dem Fluss und etwa zehn Grad über null, das war das Rheinland im Winter, und Gregor liebte es, weil es so vernünftig war, so wenig extrem, so gemäßigt. Ganz anders, als er etwa den letzten Tag der sechziger Jahre erlebt hatte, damals in Westberlin, bei zwanzig Grad unter null. In der Wohnung Nähe Innsbrucker Platz, die er mit zwei Germanisten und einer Theaterwissenschaftlerin teilte, mühten sie sich nach Kräften, die großen Kachelöfen auf Höchstleistung zu bringen, aber die Wohnung wollte sich nicht wirklich erwärmen.
Wie hieß bloß die Straße, in der er damals wohnte? Gregor konnte sich an den Namen nicht mehr erinnern. Der Berliner Frost von damals ließ ihn noch jetzt in der rheinischen Wintermilde schaudern. Er konnte sich auch noch an die Namen seiner Mitbewohner erinnern, obwohl er sie alle schon wenige Monate danach aus den Augen verlor. Das Mädchen hieß Magda, eine Kleine, Zarte, Dunkelhaarige aus Aachen, die ihre Tage wirklich an der Uni verbrachte und zu Hause fast sofort in ihrem Zimmer verschwand, um weiterzuarbeiten. Sie glaubte sehr ans Theater, ans epische vor allem, und kannte alle theoretischen Schriften von Brecht und seinen Epigonen. Sie wollte Dramaturgin werden, aber Gregor hörte später nie mehr etwas von ihr. Die beiden Germanisten waren Brüder, hießen Manfred und Wolfgang Voigt und kamen aus Braunschweig. Er hatte sie eines Abends im Natubs am Olivaer Platz kennengelernt.
Das Natubs! Das Frösteln, das Gregor eben noch in der Erinnerung an den Silvestertag 1969 gepackt hatte, wich jetzt einem Wärmestrom, als er an diese wunderbare Kaschemme aus einem anderen Zeitalter dachte. Das Natubs war selbst schon ein Zitat, es war voller Sperrmüll und Gips; voller Rauchschwaden war es, voll süßer Gerüche und guter Musik. Lieder aus Abbey Road hörte er dort zuerst, dann Strange Brew und White Room, dann das beschwörende, peitschende, klagende, wimmernde Intro von Gimme Shelter. Einer der Sessel war so tief, dass ein zartes Etwas wie Gregor Korff darin praktisch verschwand, zusätzlich verschluckt vom Dunkel, das in der weitläufigen Kneipe herrschte. An dem Oktoberabend, an dem er die Brüder Voigt kennenlernte, saß er aber gut sichtbar auf einem Stuhl vor einem Bier und einem Schmalzbrot, in einer anderen, dickeren schwarzen Jacke jetzt, aber noch immer mit denselben Beatles-Stiefeln, deren Leder hier und da schon etwas brüchig geworden war. Draußen schickte der Berliner Herbst sich an, in den Berliner Winter überzugehen, in diese langen Monate aus Kälte und Dunkelheit und dem ewigen Geruch von Kohle über der Stadt. Das Natubs war die Wärme und die Höhle, fast wie der Schuppen, den er mit Nott geteilt hatte. Die Voigt-Brüder setzten sich an seinen Tisch, weil dort Platz war, und während Gregor noch ein Bier trank und an seinem Schmalzbrot herumkaute, hörte er ihr Gespräch mit. Da war offenbar jemand ausgezogen aus dieser Wohnung in der Straße, auf deren Namen er jetzt nicht kam, und sie suchten einen neuen Mitbewohner, und an dieser Stelle schaltete Gregor sich ein, unter Überwindung und unter Mühen: Denn er war schüchtern geworden in dem einen Jahr in der großen Stadt, schüchtern und arrogant bis zur Unerträglichkeit und immer auf der Suche nach Schutz.
Eine Woche später zog er in Schöneberg ein, Nähe Innsbrucker Platz. Bis dahin hatte er zur Untermiete gewohnt, bei alten Leuten in Steglitz, an den Namen dieser Straße konnte er sich jetzt mühelos erinnern: Brentanostraße. Ein Zimmer mit einem kleinen Balkon davor, die Wohnung lag im ersten Stock, vor dem Balkon stand ein alter Baum mit einer riesigen Krone, der im Sommer wie im Winter sein Zimmer verdunkelte: sein möbliertes Zimmer mit einem wunderbaren alten Schreibtisch darin, einem tiefen Sessel, einem nicht mehr ganz intakten Stuhl und einer Couch zum Schlafen, deren Sprungfedern knarrten. Zehn Jahre später versuchte er dem Sohn eines Freundes zu erklären, was das damals war: Untermiete. Ein paarmal hatte er Besuch von Mädchen, vor allem von Bärbel Tarnowski, die aus Hamborn kam und gern sagte: »In Hamborn kenne ich jeden Baum, der da nicht wächst.« Mit Bärbel Tarnowski war es dann nicht richtig was geworden, nicht wirklich. Um zehn jedenfalls klopfte jedesmal seine Vermieterin an die Tür seines Zimmers und sagte freundlich, dass es jetzt Zeit sei.
»Das gibt’s doch gar nicht«, sagte Markus, der Sohn des Freundes, als Gregor ihm das erzählte. »Ich meine, das war doch in Berlin!«
»Das war in Berlin«, bestätigte Gregor, »Berlin 1968. Das war das ganz normale Berlin von 1968. Meine Vermieterin war eigentlich eine ziemlich nette alte Dame, und ihr Ehemann war ebenso nett. Ich sollte dir vielleicht mal erklären, was der Kuppeleiparagraf war.«
Aus der Brentanostraße zog er dann also aus in die Wohngemeinschaft in Schöneberg. Damals habe ich mich irgendwie geadelt gefühlt, dachte Gregor jetzt, dass ich aus dem Untermieterverhältnis ins Abenteuer der Wohngemeinschaft eingetreten war. Das war dann völlig unspektakulär. Keineswegs machten sich die drei jungen Männer nacheinander oder zugleich über das Mädchen Magda her. In dieser Wohnung wurden keine Konspirationen ausgeheckt und keine Bomben gebastelt. Natürlich wurden Diskussionen geführt. Natürlich hatte inzwischen jeder von ihnen seine Raubdrucke von Wilhelm Reich oder von Freud oder der Dialektik der Aufklärung gelesen. Die Voigt-Brüder kannten auch Geschichte und Klassenbewußtsein, und Magda konnte das proletarische Theater von oben bis unten und vorn bis hinten erklären. Aber sie saßen nur selten zusammen beim Frühstück und noch seltener bei einem gemeinsamen Abendessen. Nur Magda und Gregor konnten leidlich kochen, die Voigt-Brüder hatten gerade mal gelernt, wie man ein Spiegelei brät.
Und nun war am Silvestertag die stille Wohnung ganz oben im vierten Stock nicht wirklich warm zu bekommen, obwohl jeder eifrig seinen Kachelofen fütterte. Der kleinere Kohleofen in der Küche heizte noch am besten, und so hockten sie am Nachmittag dort beieinander. Magda hatte eigentlich über Weihnachten und den Jahreswechsel nach Hause zu ihren Eltern fahren wollen, sich aber kurz zuvor mit ihnen am Telefon so heftig zerstritten, dass sie in Berlin blieb und tagelang leicht bebend durch die Wohnung lief. Zitternd vor Wut, nicht vor Kälte. Die Voigt-Brüder hatten den grundsätzlichen Krach mit ihren Eltern schon im Jahr davor über die Bühne gebracht. Gregor war einfach nur zu träge, um nach Hause zu fahren, ganz ans westliche Ende des Landes. Seine Eltern waren etwas enttäuscht, aber da in ihrer Familie nie irgendein Konflikt ausgetragen wurde, verlief sich ihre Enttäuschung ins Leere.
Wie hieß die Straße bloß, in der wir wohnten?, fragte sich Gregor wieder, während nebenan bei Frings plötzlich ein Streit ausbrach, ein Streit zwischen Vater und Sohn, der aus Berlin nach Hause gekommen war. Das geht immer weiter, dachte Gregor, durch die Jahrzehnte und die Generationen. Man hörte dann das amüsierte Lachen der Frings’schen Tochter, die aus Wuppertal gekommen war, wo sie bei Bazon Brock Ästhetik, Kunstvermittlung, Kommunikationsdesign und andere Dinge studierte, unter denen sich ihre Eltern nichts vorstellen konnten. Ihr Lachen war nicht nur amüsiert, sondern auch begütigend und galt offenbar ihrem Bruder, dem es bedeuten sollte, dass sie die pubertäre Phase der Aufmüpfigkeit gegen die Alten, Kennzeichen aller jungen Leute, die gerade das Elternhaus verlassen haben, schon hinter sich gelassen hatte. Gelassenheit mahnte ihr Lachen an, aber der Sohn wütete weiter, der Vater wütete dagegen, und dann wurde ein Fenster geschlossen und Gregor hörte nichts mehr.
Damals 1969 in der … Gutzkowstraße! Sie hieß Gutzkowstraße! Plötzlich wusste er es wieder: eine kurze, für Berliner Verhältnisse auch recht enge Straße zwischen der Kärntner und der nach Gustav Freytag benannten, eine Steinschlucht mit vierstöckigen grauen Mietshäusern, die teilweise immerhin Relieffassaden hatten. Im Treppenhaus, das bei jedem Wetter im Halbdämmer lag, roch es muffig, manchmal auch säuerlich. Gab es ein Hinterhaus? Er wusste es nicht mehr. Aus der Küche jedenfalls sah man auf einen engen steinernen Hof, und nach vorn ging der Blick auf die steinerne Straßenschlucht. »In der Gutzkowstraße«, hätte er zu Bärbel Tarnowski sagen können, »kenne ich jeden Strauch, der da nicht wächst.«
Damals 1969 in der Gutzkowstraße mussten sie ohne Eltern auskommen, mit denen sie sich streiten konnten. Sie saßen um den wurmstichigen alten Tisch herum und wärmten sich zuerst mit Tee, später mit allem, was sie an Alkohol im Hause hatten. Magda war so geistesgegenwärtig gewesen, am Vortag noch einzukaufen, und sie und Gregor kochten, während Manfred Voigt seinem älteren Bruder den Unterschied zwischen dem Signifikanten und dem Signifikat erklärte, den er gerade bei den Linguisten gelernt hatte. Er war groß und schmal und sah nicht nur wegen seiner Frisur Prinz Eisenherz sehr ähnlich, während sein älterer Bruder viel kleiner und ausgesprochen bullig war. Draußen hörte man die ersten Knaller und Raketen, einige Straßen weiter. Nach dem Essen erzählte Magda von einer großen Silvesterparty bei einer Kommilitonin in Charlottenburg, zu der sie eingeladen war.
»Man kann Leute mitbringen«, sagte sie.
Die Brüder Voigt schüttelten den Kopf. Sie wollten den Jahrzehntwechsel ganz zurückgezogen und heroisch in dieser Wohnung erleben. Gregor hätte sich am liebsten ins Bett gelegt und alles verschlafen, aber er bezweifelte, dass ihm das gelingen würde. Sicher war es auf der Party in Charlottenburg auch wärmer als hier; vermutlich gab es dort Zentralheizung, und die vielen Gäste heizten den Raum zusätzlich auf.
»Ich komme mit«, sagte er.
Auf dem Weg nach Charlottenburg fragte er Magda, wie sie eigentlich in Berlin zurechtkomme, und Magda fing an zu weinen und blieb stehen. Dann entschuldigte sie sich und fasste sich wieder. Es war die Dunkelheit und die Kälte, die ihr zu schaffen machten, sagte sie.
»Im Rheinland ist es einfach viel wärmer, weißt du. Und die Leute sind freundlicher. Am Anfang fand ich es ganz gut, dass sie hier in den Geschäften nicht so nett sind und einen mit ihren singenden Stimmen nicht dauernd anflöten wie bei uns. Ich wollte endlich den Ernst des Lebens. Strenge, verstehst du. Aber inzwischen bringt mich das hier um. Sie sind alle so furchtbar nüchtern und sachlich, wenn sie nicht gerade laut sind und sich über irgendeinen Mist aufregen. Es ist, als ob sie …« Sie wusste nicht mehr, was sie sagen wollte.
»Als ob sie vom Leben nichts mehr erwarten«, sagte Gregor.
»Genau! Genau das meine ich! Und als ob sie noch nie was davon erwartet haben.« Sie lachte, gar nicht zart und sparsam abgemessen wie sonst, sondern etwas atemlos und wütend. »Dann sollen sie doch alle in den Grunewald fahren und sich da aufhängen. Jeder an seinem Baum.« Jetzt verlor ihr Lachen das Atemlose, wurde aber nicht zart, sondern voll und befreit, als freute sie sich, auf einen so exquisiten Gedanken gekommen zu sein. »Da drüben ist es«, sagte sie dann in einem anderen Ton, als sie in die Mommsenstraße eingebogen waren.
Sie mussten an der Wohnungstür im ersten Stock lange Sturm klingeln, weil die Musik alles übertönte. Irgendeiner von den Gästen machte ihnen schließlich auf, und Magda und Gregor verschwanden in dem Gewirr der achtzig oder hundert Gäste und verloren sich fast sofort aus den Augen. Drei Stunden später winkten sie sich einmal kurz zu. Da saß Gregor schon neben Lea auf einem Sofa mit ausgemergeltem Polster und ließ sich die Worte des Großen Vorsitzenden erklären, kurz vor dem Ende des Jahrzehnts.
Erklären? Er hatte sie sich eher vorsingen lassen und Lea dabei angesehen, dachte er jetzt. Wenn er sich nicht auf dieser Klassenfahrt in das herbstliche Berlin verguckt hätte, hätte er vermutlich in Frankfurt studiert. Wenn er an jenem Abend in der Gutzkowstraße geblieben wäre, hätte er Lea nicht kennengelernt. Wenn er nicht irgendwann um drei mit Lea nach Hause gefahren wäre nach Wilmersdorf, wo sie ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft in der Holsteinischen Straße hatte, hätte er nicht zwei Monate später ein sogenanntes Kontaktgespräch mit einem leitenden Kader geführt. Wenn er sich nicht bald wieder von Lea losgerissen hätte, wäre er vielleicht eines Tages in einen Schusswechsel geraten. Es ist so gekommen, wie es dann kam, dachte Gregor, als er die aus Bonn mitgebrachte Entenbrust aus dem Kühlschrank holte, weil die Umstände sich damals so und nicht anders miteinander verkettet haben. Es hätte aber durchaus anders kommen können.
Er erinnerte sich jetzt, wie er vor wenigen Jahren auf einem kleinen Fest eine spirituell bewegte und durch die Räume schwebende Frau die abgegriffenen Sätze hatte sagen hören: »Ich glaube nicht an Zufälle. Es gibt keine Zufälle.« Gregor war in einem ihn selbst überraschenden Maß laut und grob geworden, vielleicht auch, weil er die Frau ohnehin nicht leiden konnte mit ihrer raunenden Begeisterung für die Geheimnisse des Lebens. Also hatte er laut und grob gerufen: »Quatsch! Es gibt überhaupt nur Zufälle! Kontingenz! Haben Sie davon schon mal was gehört?« Die Frau hatte den Kopf geschüttelt, reichlich eingeschüchtert wegen Gregors Ausbruch, und Gregor hatte gesagt, immer noch ziemlich laut: »Kontingenz, also Zufall, ist zum Beispiel, dass Sie in Europa geboren sind als Tochter begüterter Eltern und nicht in einem Slum in Kinshasa oder Bangkok! Oder halten Sie das etwa für Vorsehung? Für Prädestination? Für Sie war von vornherein nur das Beste vorgesehen? Was?« Er hatte die Antwort der Frau gar nicht mehr abgewartet und war ins Nebenzimmer gestürmt, und später, als die Frau gegangen war, hatte der Gastgeber ihn beiseite genommen und gefragt: «Was war denn los, Gregor, warum hast du dich denn so aufgeregt?« Gregor hätte ihm sagen können, dass die Sache mit der Kontingenz ihm sehr wichtig sei, aber er winkte nur ab und sagte: »Entschuldigung, ich kann diese Schnepfe einfach nicht leiden. Tut mir leid, dass es ein bisschen laut war. Ich weiß, dass du sie einladen musstest, aber deshalb muss ich nicht nett zu ihr sein.«
Während er sich mit dem Verschluss der Champagnerflasche abmühte, der keinen Millimeter nachgeben wollte, begriff er, warum ihm das jetzt wieder einfiel. Diese Silvesterfete war tatsächlich der Wendepunkt gewesen, aber er war ihm nicht vorherbestimmt. Gregor hätte nur zu Hause bleiben müssen. Lea hätte nur auf eine andere Fete gehen müssen. Gregor hätte nur eine andere Frau interessanter finden müssen. Lea hätte ihn nur fragen müssen: »Was willst du denn, Kleiner?«
Dann hätte Gregor sich weiter mit den Bauformen des Erzählens beschäftigt. Vielleicht wäre er irgendwann zur strukturalen Analyse von Texten vorgedrungen und hätte sich dabei als besonders brillant erwiesen. Vielleicht hätte er sogar eine Art neue Schule begründet. Der Aufsatz, der seinen Ruhm begründete, hätte nicht Der Tod des Autors geheißen, sondern etwa Der Tod des Interpreten oder Das Ende der Auslegung. Vielleicht hätte er in den siebziger Jahren eine Professur an irgendeiner Reformuni ergattert, säße jetzt aber schon seit mehreren Jahren auf einem Lehrstuhl in Bonn oder Münster und bereiste die Kongresse der Welt. Statt dessen saß er damals plötzlich neben Lea auf dem Sofa und hörte den grundstürzenden Erkenntnissen des Großen Vorsitzenden zu, wie etwa dieser: Die Dinge in der Welt sind kompliziert, und man muss sie von allen Seiten betrachten. Einfach großartig. Er hörte natürlich nicht dem Großen Vorsitzenden zu, sondern Lea, die eine fliederfarbene Cordhose trug und einen schwarzen Pullover und irgendwann mit ihrer sehr warmen Hand seine rechte umschloss, die – ebenso wie seine linke – kalt und fischig war wie immer. So fing das an. Sehen Sie, gute Frau, das ist Kontingenz. Falls Sie verstehen wollen, was ich meine.
Zufall, nichts als Zufall. Natürlich fällt einem nur zu, was in Reichweite und im Raum des Möglichen liegt, klar, aber im Raum des Möglichen hätte ja eingangs der Party durchaus auch eine andere Blickrichtung gelegen. Eine Frau mit einem Fransenpony wie der von Irene Fuchs, eine Frau, die sich als Vertreterin des Strukturalismus entpuppt. Dann wäre es wohl anders gekommen, denn man weiß ja: Die Strukturen gehen nicht demonstrieren. Oder, dachte Gregor, während sich der Champagnerkorken erstmals leise rührte, ich hätte mich in irgendeiner Ecke der Küche, oder eben auf einem anderen Sofa als dem nämlichen, einfach nur still besaufen können und wäre irgendwann traurig und betrunken und fröstelnd in tiefer Neujahrsnacht in die Gutzkowstraße zurückgekehrt. Dann hätte es gewiss einen Kater gegeben am nächsten Tag, ja. Alkoholdepression, ja. Kurzfristig auch die Sinnfrage, ja, bis es mir wieder besser gegangen wäre. Aber nicht den revolutionären Kampf. Nicht den Aufbau der Partei. Aber, sang Gregor jetzt nach der Melodie von Gehn’se mit der Konjunktur, aber, sang er, ins Berlinerische von damals zurückfallend: Sehn’se det is Kontingenz …
Die Gruppe, der Kreis, der Zirkel, in den Gregor über Lea hineingeriet, war eine von vielen Gruppen, Kreisen und Zirkeln zwischen der Mauer und den Kontrollpunkten Dreilinden beziehungsweise Staaken, die sich damals daran machten, die Kommunistische Partei aufzubauen. Baut auf, baut auf. Wenn du rundum eingesperrt bist und den Knast nur dann und wann in Richtung Griechenland, Italien oder Eltern verlässt, wirst du leicht irre. Plötzlich ging es nicht mehr um die Bauformen des Erzählens. Um das Signifikat und den Signifikanten. Es ging auch nicht mehr allein um die Analyse der Mucken des Kapitals, das hatte Gregor ja schon kapiert, das las man damals. Es ging um kryptische Schriften aus dem Jahr 1905 oder 1949, um den historischen und dialektischen Materialismus und um die kurze Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, auch Bolschewiki genannt. Da war Gregor plötzlich gelandet, beim Großen Vorsitzenden, beim Genossen Lenin und bei Väterchen Stalin, obwohl sich Väterchen Frost nach einem langen Winter endlich verzogen hatte und ab der zweiten Aprilhälfte ein schönes Berliner Frühjahr heraufzog.
Lea war schon im innersten Kreis angekommen, sie leitete die Organisationsabteilung. Sie führten jeder eine Abteilung, die paar Leute, die sich Mitglieder des Zentralen Gremiums nennen durften: Den Namen Zentralkomitee hatten sie sich für später vorbehalten, wenn die Partei stand und blühte und die Massen führte. Jeder eine Abteilung: Organisation. Agitprop. Theorie. Interne Schulung. Innere Blutung: versprach sich Gregor später einmal morgens nach dem Erwachen, da leitete er die Abteilung schon selber und fragte sich, was er eigentlich tat. Zum Glück war’s ein Selbstgespräch, und keiner hörte zu.