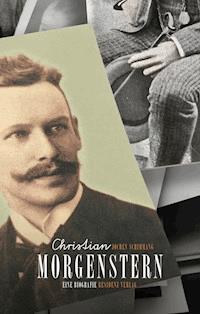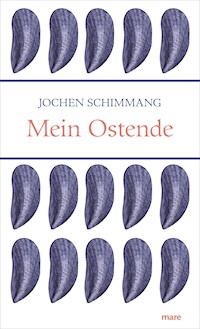Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Winter 2029/30. Deutschland hat nach neun Jahren Juntaherrschaft vier Jahre Übergangsregierung unter englischer Führung hinter sich. Das ehemalige Regierungsgelände in Berlin ist Niemandsland. Doch hat sich dort inzwischen ein bunter Haufen von Menschen angesiedelt, die ihr Utopia leben - intelligent, gebildet, die meisten vernetzt durch den Widerstand während der Juntazeit: ein Gärtner, ein Geigenbauer, ein anarchistischer Lektürezirkel, das Restaurant "Le plaisir du texte". Nun soll dort auch eine Bibliothek eingerichtet werden - für deren Aufbau ist Ulrich Anders nach Berlin gekommen, der Erzähler des Romans. Doch der Zustand glückseliger Freiheit ist bald bedroht: Aus den verlassenen U-Bahn-Schächten heraus unternimmt die Junta einen neuen Putschversuch. Eine Drahtzieherin scheint die schöne Witwe des Juristen der Junta zu sein, dessen Bibliothek Ulrich gekauft hatte. Und an welchem geheimnisvollen Programm arbeitet Ulrichs Freundin, die Softwareentwicklerin Eleanor Rigby? Jochen Schimmang gibt dem Möglichkeitssinn Zunder und entwirft ein Deutschland der Zukunft, in schönster postmoderner Tradition: pure Lust am Text! Aber Neue Mitte ist auch ein spannender Politthriller, der das eigene Genre aufs Korn nimmt und ganz nebenbei Roland Barthes' Frage "Wie zusammen leben?" zu beantworten sucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jochen Schimmang
NEUE MITTE
Roman
Edition Nautilus
Der Autor dankt Kurt Bracharz für die
Lizenzüberlassung von White Peace
Edition Nautilus Verlag Lutz Schulenburg
Schützenstraße 49 a · D-22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten · © Edition Nautilus 2011
Originalveröffentlichung · Erstausgabe August 2011
Umschlaggestaltung:
Maja Bechert, Hamburg, www.majabechert.de
Druck und Bindung: CPI Moravia Books
1. Auflage
Print · ISBN 978-3-89401-741-5
eBook · ISBN 978-3-86438-045-7 (ePub)
ISBN 978-3-86438-046-4 (PDF)
»It’s a poor sort of memory that onlyworks backwards«, the Queen remarked.Lewis Carroll
Ich wünschte, dass sich die Schlechtennicht zu schlecht, die Guten ihrerseitsnicht zu gut vorkämen.Robert Walser
1
Sander erwartete mich eingangs der ersten Ruine. Hinter den riesigen Fensterbögen im Erdgeschoss war das übliche Kraut hochgeschossen, das sich über kurz oder lang aller verlassenen Gebäude bemächtigt und dabei auch vor einem ehemaligen Regierungssitz nicht haltmacht. Sander stand im Torbogen und lächelte mir freundlich entgegen. Wir hatten uns zwölf oder dreizehn Jahre nicht gesehen, und ich war überrascht, wie wenig er gealtert schien. Er war jetzt siebenundvierzig und trug einen hellen Trenchcoat, den er geschlossen und dessen Kragen er hochgeschlagen hatte, obwohl wir erst Mitte September hatten. Ich sollte bald merken, wogegen er sich schützte. Manchmal war man hier plötzlich heftigen Windstößen ausgesetzt, die ein paar Schritte weiter wieder von einer fast reglosen Luft abgelöst wurden.
Sander gab mir die Hand und zog mich ins Haus, genauer: zwischen die Mauern, die stehen geblieben waren. Wir brauchten fast eine Viertelstunde, um am anderen Ende der Ruine anzukommen. In manchen Räumen war ein Teil des Mobiliars zurückgelassen worden: Stühle, Sessel, Schreibtische, die nun teilweise völlig verwittert und verschimmelt waren. Andere Stücke hatten die neuen Bewohner an sich genommen und aufgearbeitet, erzählte Sander.
»Bei uns ist praktisch jedes Handwerk vertreten«, sagte er, »sonst könnten wir gar nicht existieren. Das Gerümpel, das hier noch herumsteht, wird bald entsorgt werden.«
Katzen huschten durch die Zimmer, in denen früher die Bittsteller darauf gewartet hatten, vorgelassen zu werden. Die Katzen wurden von den jetzigen Bewohnern gut behandelt, erzählte Sander, weil man sie gegen die Ratten brauchte. Sie waren fast so etwas wie die geheimen Göttinnen des Geländes.
An einer der Wände hing noch immer das offizielle Bild des Generals. Jedes Mal, wenn er daran vorbeikam, wollte Sander es abnehmen und auf den Müll werfen, winkte dann aber ab und ging weiter. Das Foto war stark nachgedunkelt und ganz leicht gewellt, aber es zeigte den General, wie ihn die ganze Welt gekannt hatte: im Halbprofil, das kurze Haar streng gescheitelt und mit einem Blick, der zugleich Entschlossenheit und Güte ausdrücken sollte. Sein Leibfotograf war bei der Flucht der Regierung nicht mehr mitgekommen, sondern gefasst worden. Man hatte ihn jedoch nicht an die Wand gestellt, sondern sich sein Können und seine Dienste für die neuen offiziellen Legenden gesichert.
Am anderen Ende der Ruine weitete sich der Blick auf die zahllosen flachen Bauten, in denen die einzelnen Ämter und Kommissariate untergebracht gewesen waren. Nur die zwei Hochhäuser, in denen ein Großteil des Wissens der Machthaber in Akten und elektronischen Speichermedien lagerte, hatten die Fliehenden kurz vor ihrem Verschwinden noch sprengen lassen. Deshalb erhoben sich nun links von uns zwei riesige Trümmerhaufen, die man inzwischen mit Erde aufgeschüttet und teilweise begrünt hatte.
Zwischen den einzelnen Gebäudekomplexen gab es noch immer Schutt und Lücken. Ein Jahr nach der Flucht der alten Regierung hatte man begonnen, das entleerte Machtzentrum in mehreren Schritten zu sprengen, dann aber damit aufgehört, als klar wurde, dass der geplante Gewerbepark eine Fehlinvestition sein würde. Seitdem wurde über die künftige Nutzung des ehemaligen Zentrums der Macht diskutiert; Gutachten wurden erstellt und Kommissionen eingesetzt; Historiker, Denkmalspfleger und Professoren für Ethik wurden befragt, und in der Zwischenzeit rottete die abgebrochene und verfaulte Geschichte weiter vor sich hin.
Die ersten wilden Siedler waren schon gekommen, als diese endlose Debatte noch geführt worden war, und hatten sich nach und nach der Flachbauten angenommen. Die Stromleitungen waren repariert und die wichtigsten Verbindungen zur Außenwelt aufgebaut worden. In der Folge hatten sich Handwerker, zwei kleine IT-Firmen, eine Historikerin von der Freien Universität, eine anarchistische Gruppe, deren Leitbild Kropotkins Prinzip der gegenseitigen Hilfe war, und viele andere hier niedergelassen. Vor einem Jahr war Sander geholt worden, damit er eine zentrale Bibliothek aufbaute.
»Seitdem bin ich nicht mehr draußen gewesen«, sagte er. »Wir sagen draußen, wenn wir meinen, dass jemand durch den Torbogen der ersten Ruine geht, in dem ich auf dich gewartet habe.«
»Aber du musst doch Lebensmittel einkaufen?«
»Das machen einmal in der Woche die Anarchisten für mich«, erzählte Sander. »Sie machen auch für die meisten anderen Besorgungen und Erledigungen, schwirren aus in die Welt. Dafür werden sie von uns allen versorgt.«
»Also praktizierter Kropotkin.«
»Kann man so sagen. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass hier vorher der Staatsterror geherrscht hat. Das Haus dort drüben« – er zeigte auf einen langgestreckten Bau auf der linken Seite unseres Weges –, »in dem jetzt eine Gärtnerei untergebracht ist, war früher das Verhörzentrum für Staatsfeinde. Im Gegensatz zu anderen Regimes haben diese Verbrecher ihre Vernichtungsmaschinen ja nicht ausgelagert, sondern wollten sie so nah wie möglich bei sich haben.«
Ein kleiner Mann in den frühen Achtzigern kam aus dem Gebäude, in einem blaugrauen Kittel und mit einer uralten Ballonmütze auf dem Kopf.
»Das ist der Gärtner«, sagte ich spontan. »Der Obergärtner.«
»Ganz recht«, bestätigte Sander. »Allerdings erst seit gut einem Jahr. Sein Name ist Ritz. Das sagt dir etwas?«
»Nur als Name eines Hotels in Paris und eines anderen in Wolfsburg«, sagte ich.
»Ritz hat früher viele Jahrzehnte als Berater gearbeitet. Ich weiß nicht warum, aber alle großen Firmen und viele Verbände und Politiker haben sich seiner Dienste versichert. Er ist dabei sehr reich geworden; er ist gewiss der Reichste hier auf dem Gelände.«
»Ihr habt also auch Reiche und weniger Reiche hier?«
»Selbstverständlich. Den egalitären Kram wollen nicht einmal die Anarchisten. Die wollen nur ohne Reglementierung von außen leben können und ihr Auskommen haben, und das haben sie bei uns. Ritz ist zwei Jahre vor mir hierher gekommen. Dann tauchte irgendwann das Thema der Begrünung des Geländes auf, angefangen mit den beiden Hochhaustrümmern. Da fungierte Ritz noch als Berater. Aber er ist Systematiker, weißt du, er hat sich gründlich eingearbeitet in die Gartenbaukunst und Landschaftsarchitektur, und dabei hat er spät im Leben seine eigentliche Bestimmung entdeckt. Wir hoffen, er bleibt uns noch lange erhalten. Am anderen Ende des Geländes hat er schon einen englischen Park angelegt und zwischen manchen der Flachbauten japanische Gärten. Seine größte Aufgabe besteht jetzt darin, die erste Ruine zu begrünen. Du hast ja gesehen, dass da noch das Chaos herrscht. Wir wollen aber in den Fluchten und Räumen kleine Gärten verschiedenen Stils anlegen, und die vordere Fassade soll eines Tages ganz hinter Grün verschwinden.«
Ritz war uns langsam entgegengekommen, mit einem Bleistift und einem kleinen Notizbuch im Brusttaschenformat in der Hand, eingebunden in schwarzes Leder. Im ersten Moment war ich etwas irritiert, als er im schleppenden rheinischen Tonfall zu sprechen begann, nachdem Sander mich vorgestellt hatte, und ich bekam einen ersten Anfall von Heimweh nach der Stadt, die ich gerade verlassen hatte.
»Es ist ein großer Irrtum«, sagte er, während wir weitergingen in Richtung von Sanders noch provisorischer Bibliothek, die in der Villa untergebracht war, welche dem General als Wohnhaus gedient hatte, »es ist ein großer Irrtum, die Trümmerlandschaft und die Ruine einerseits und die Harmonie und die Schönheit andererseits in einen Gegensatz zu stellen. Bedenken Sie, wie dieses Gelände in den Zeiten des Terrors ausgesehen hat: ein auch architektonisch geschlossenes System, das rein der Machterhaltung diente und der Abwehr von allem, was die Macht hätte gefährden können. Ein System ohne Lücke, könnte man sagen, auf Ewigkeit angelegt, und uns erschien es ja auch ewig. Dabei hat es sich nur neun Jahre gehalten. Der Terror geht auf lange Dauer immer an sich selbst zugrunde. Er erstickt gewissermaßen, gerade weil er keine Lücke hat und nicht Atem holen kann. Nun, da das Gelände noch immer halb verfallen, also offen ist« – in diesem Augenblick erfasste uns aus einem Seitenweg einer der plötzlichen Windstöße, von denen ich schon gesprochen habe, und Ritz erhob die Stimme –, »entfaltet es seine Möglichkeiten. Erst der Verfall macht es wirklich reich und treibt die Blüte hervor. Allein rein gärtnerisch gesehen, werde ich noch mindestens fünf Jahre beschäftigt sein.«
Ein größerer Lieferwagen zuckelte an uns vorbei, dem äußeren Anschein nach mindestens vierzig Jahre alt. Im Fahrerhaus saßen zwei jüngere Männer, und der Beifahrer winkte uns kurz zu.
»Das sind zwei der Anarchisten«, erklärte Sander, »sie haben eingekauft und beginnen jetzt mit der Auslieferung.«
Der Weg machte eine Biegung. Hinter einem weiteren Komplex von Flachbauten wurde das ehemalige Wohnhaus des Generals sichtbar, und dahinter sah man den Anfang des Parks. Ein paar Minuten später hatten wir die Bibliothek erreicht, und unsere Wege trennten sich, denn Ritz wollte in seinem Park nach dem Rechten sehen, wo eine andere Gruppe von Anarchisten mit Aufräumarbeiten beschäftigt war.
Sander und ich stiegen die Treppe in den ersten Stock hinauf und sahen von der rückwärtigen Fensterfront nach draußen. Unter uns lag ein erhöhtes Stück Land, ein fast runder Hügel, bepflanzt mit einer Gruppe verschiedener Laubbäume. Da wir uns im Flachland befanden, fragte ich Sander nach der Herkunft des Hügels.
»Er bedeckt den alten Bunker«, sagte er. »Der Bunker schloss natürlich unmittelbar an das Privathaus des Generals an, wegen der kurzen Wege. Ritz hat ihn mit dem Hügel überkront, und er hat diese Form des Hügels gewählt, um an ein Hünengrab zu erinnern. Der General ist zwar verschollen, aber die Grabform ist wie ein Bann gedacht: als läge er tatsächlich dort unten.«
Ein heftiges Klopfen war an der Haustür zu hören, und Sander lief nach unten, um zu öffnen. Ich folgte ihm. Die beiden Anarchisten standen vor der Tür und zeigten stumm auf mehrere Stapel Kartons. Sander rieb sich die Hände, drehte sich zu mir um und sagte: »Bücher, kartonweise Bücher. An die Arbeit!«
Ich hatte mir Unordnung in der Bibliothek vorgestellt, wenn nicht Chaos. Tatsächlich waren in manchen Ecken noch nicht eingearbeitete Bücher gestapelt, doch in den Regalen, die bis unter die Decke reichten, allein von hohen Fenstern unterbrochen, herrschte Ordnung. Alles war beschriftet und in Sachgebiete eingeteilt. Manche Räume sahen schon endgültig eingeräumt aus. Von Sander erfuhr ich, dass die Bibliothek in einem halben Jahr eröffnet werden sollte, während ich davon ausgegangen war, dass alles noch in den Anfängen stand.
Sander kannte ich aus meiner kurzen Studentenzeit. Er hatte sein eigenes Studium schon abgeschlossen und arbeitete an der Universitätsbibliothek. Er war zwölf Jahre älter als ich, und ich lernte ihn an einem Nachmittag im Sommer 2012 kennen, als er erschöpft auf dem Rasen vor dem Institut für Germanistik lagerte. Gerade war die Polizei, die das Institut geräumt hatte, wieder abgezogen. Die Augen der Älteren, ja vor allem der Ältesten, leuchteten in diesen Tagen. Die Kämpfe waren wieder aufgeflackert! Lotta continua! Unter dem Pflaster liegt der Strand! L’imagination au pouvoir! Für mich alles Sprüche aus einer Zeit, in der ich noch nicht einmal geplant war. Geplant war ich überhaupt nicht, aber dazu später.
Es war ein sonniger Nachmittag im späten Juni, fünfundzwanzig Grad vielleicht. Ich hatte die Kämpfe aufmerksam, aber auch vorsichtig vom Rande aus verfolgt. Nach dem Abzug der Polizei lagerten überall auf dem Rasen kleine Gruppen und diskutierten, aber da ich erst seit zweieinhalb Monaten an der Universität war, fühlte ich mich nicht befugt, mich einzumischen. Ich war achtzehn Jahre alt und verstand sehr wenig von dem, was seit Wochen hier vor sich ging. Sander war der Einzige, der ganz für sich allein auf einer Decke saß, unter einer Linde, den Kopf auf den angezogenen Knien, vielleicht dösend. Ich konnte also in Ruhe den Titel des Buches entziffern, das neben ihm lag. Ein dicker Wälzer, und der Titel klang nach einem Kriminalroman: Der Tod des Jorge von Burgos von Adam Melk. Das sagte mir nichts. In diesem Moment hob Sander den Kopf und sah zu mir hoch, etwas überrascht zuerst, dann aber lächelte er und sagte: »Setz dich doch. Kennst du das Buch?«
»Nein, nie gehört. Aber ich bin nicht sehr belesen.«
Das war nicht ganz richtig. Es war sogar gelogen. In meinen späten Schuljahren war ich beinahe der Einzige in der Klasse, der noch Bücher las, ohne Anleitung, völlig wildwüchsig, aber nächtelang und mit roten Ohren. Das war sogar der Grund, warum ich etwas so Altmodisches wie Germanistik und Philosophie studieren wollte. Davon mochte ich aber jetzt nichts erzählen.
»Ich lese es«, sagte Sander, »um etwas über das Jahr meiner Geburt zu erfahren. Da war es nämlich ein Bestseller. Und in den Jahren danach auch. Setz dich doch endlich.«
Das tat ich, und als die Dämmerung kam und es sich abgekühlt hatte, zogen wir in eine Kneipe um, aus der wir erst gegen Mitternacht wieder herauskamen.
Als vier Jahre danach der Putsch kam, dauerte es nicht lange, bis Sander gefeuert wurde. Er arbeitete dann in einem kleinen Verlag am äußersten westlichen Ende der Stadt, und als das Regime – gestürzt wurde? an sich selbst zugrunde ging? – und man ihn an die Universität zurückrufen wollte, lehnte er ab und blieb dort, bis er vor einem Jahr gebeten wurde, auf dem Trümmergelände die zentrale Bibliothek aufzubauen. Vor zwei Wochen hatte Sander mich endlich ausfindig gemacht und gefragt, ob ich ihm nicht helfen wolle, und obwohl ich mich im alten Westen sehr wohlfühlte, versprach ich, ihn wenigstens zu besuchen und es mir dann zu überlegen.
Von Überlegen war jetzt aber nicht mehr die Rede.
»Über deine Aufgaben sprechen wir später«, sagte er, »erst einmal packen wir aus!«
Die Bücher, die wir nach und nach aus den insgesamt zwölf großen Kartons holten, waren Beutestücke aus einer Bibliotheksauflösung. Ein Gelehrter war mit fast zweiundachtzig Jahren gestorben, ein emeritierter Philosophieprofessor, und über seine Bibliothek hatte er keine testamentarischen Verfügungen getroffen. Seine Kinder und Enkel (seine Frau war schon seit fünfzehn Jahren tot) nahmen sich vielleicht das eine oder andere Stück daraus, hielten das meiste aber für uninteressant, verpackten es in insgesamt einhundertvierundzwanzig gleich große Kartons, wie es gerade hineinpasste, also durchaus alles durcheinander, und luden dann zur Versteigerung ein. Die Anarchisten, die Sander geschickt hatte, waren nur mit so viel Geld ausgestattet worden, dass es für zwölf Kartons gereicht hatte. Die Bietenden durften den Inhalt der Kartons keineswegs vorher ansehen: man ersteigerte blind und kaufte die Katze im Sack. Diese Beute begutachteten wir jetzt also Stück für Stück.
Würde ich sie hier allerdings Stück für Stück aufzählen, würde das hundert Seiten oder mehr füllen. Sehr viele waren dabei, von denen ich noch nie etwas gehört hatte, aber einige, die mir beim Auspacken am meisten Eindruck gemacht haben, will ich doch nennen.
Das Erste, was ich bestaunte, war die Anleitung zur Registraturwissenschaft und von Registratoribus nebst einer Erläuterung einiger hierin befindlicher Stellen von Philipp Wilhelm Ludwig Fladt, Churpfälzischen Kirchen- und Ober-Apellations-Gerichts-Rath wie auch Mitglied der Churbayerisch- und Pfälzischen Academie der Wissenschaften, erschienen in Franckfurt und Leipzig, in der Eßlingerischen Buchhandlung, 1765. Das ist gewissermaßen der Kurztitel, der vollständige würde zu viel Platz in Anspruch nehmen. Allerdings handelte es sich hier um einen unveränderten fotomechanischen Nachdruck der Ausgabe 1765, erschienen 1975 in Pullach. Dieser Nachdruck war erstklassig erhalten, nachgerade unberührt. Der Gelehrte hatte sich offenkundig nie näher damit beschäftigt, und es konnte gut sein, dass er das Buch eines Tages geschenkt bekommen hatte, von einem Kollegen etwa, der zum Essen eingeladen worden war und nicht die übliche Flasche Wein mitbringen wollte, grand cru hin oder her. Das hier war ja auch irgendwie grand cru und deshalb noch nicht geöffnet worden.
Ganz unten im zweiten Karton lag ein englischer Kriminalroman in deutscher Übersetzung, eine Taschenbuchausgabe, reichlich zerlesen und beinahe zerfleddert, mehr als jedes andere Buch in diesem Karton. Sein Titel lautete Der Mord von Bleston, und sein Autor war ein gewisser J. C. Hamilton. Die Übersetzung stammte aus dem Jahr 1960 – ich rechnete schnell nach: da musste dieser verstorbene Professor gerade zwölf Jahre alt gewesen sein –, und der Name des Übersetzers entlockte mir ein kurzes Lachen, denn der Mann hieß tatsächlich Michael Rüpel.
Das Prunkstück des dritten Kartons war ein mir wohlbekanntes Buch, ein Bestseller aus meiner Schulzeit, den ich auch selbst sehr gern gelesen hatte, Margarete Mühlenbecks Das Haus an der Elbe, hier in einer prachtvoll gebundenen Sonderausgabe mit Fadenheftung und Lesebändchen. Rainer Harms, ein Schulfreund aus der Parallelklasse und außer mir einer der wenigen manischen Leser in dieser Zeit, hatte damals im Internet zwei Interviews mit der Autorin gefunden, und diese Videos sahen wir uns immer wieder an. Wir waren ganz gewiss verliebt in sie. Wir waren fünfzehn.
In den beiden nächsten Kartons hatte man Werkausgaben beieinandergelassen, nichts Prunkvolles diesmal, hier und da gab es blasse Anstreichungen. Wir hatten drei Franzosen erwischt: Marcel Bergotte, Edmond Teste, Antoine Roquentin, dazu einen Italiener, Zeno Cosini. Von ihnen allen hatte ich noch nie gehört, aber Sander wusste natürlich Bescheid. Es waren keine kritischen Gesamtausgaben, nicht einmal Sämtliche Werke, sondern bei jedem eine Auswahl, die anlässlich eines runden Geburts- oder Todestages erschienen war.
Der sechste Karton war im Gegensatz zu den beiden vorhergehenden ein großer Mischmasch, und am besten gefiel uns beiden hier der kleine Band Barthes Foucault Toyota: Nach dem Strukturalismus von Karl Furrer, erschienen 1988 in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt.
Im siebten hatten die Erben offenbar einen Teil der portugiesischen Abteilung unversehrt und beisammengelassen, denn dort fanden sich, natürlich in deutscher Übersetzung, die Werke von Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Àlvaro de Campos und Bernardo Soares.
Der achte Karton enthielt nun wahre Schätze. Unter anderem entdeckten wir von Silas Haslam A General History of Labyrinths und in einer sehr alten Ausgabe Johann Valentinus Andreäs Lesebare und lesenswerthe Bemerkungen über das Land Ukkbar in Klein-Asien, dann Der heimliche Heiland von Nils Runeberg, die von Emil Schering besorgte deutsche Übersetzung von Kristus och Judas aus dem Jahr 1912, von Herbert Quain das Romanfragment April March und schließlich Pierre Menards Sonette für die Baronesse de Bacourt aus dem Jahr 1934.
Im neunten Karton steckten beinahe alle Bücher noch in der Verschweißung, aber oben drauf hatten die emsigen Erben noch die Taschenbuchausgabe eines Romans gepresst, an den ich mich aus meinen Schülerlesenächten noch gut erinnern konnte. Auch der tote Professor hatte ihn wohl mit Vergnügen und vielleicht auch wiederholt gelesen, denn das Büchlein war ähnlich zerrupft wie der Kriminalroman aus dem zweiten Karton und zudem an den leider zu schmal geratenen Rändern mit unzähligen Bleistiftanmerkungen in einer an Robert Walser gemahnenden Mikroschrift versehen. Johann Andermatt war es, sein herrliches Buch Kinder Kinder, eine grandiose kinderhassende Groteske oder groteske kinderhassende Grandiosität. Ich erinnerte mich, dass ich mich damals, als ich es las, in meinem sechzehnjährigen Entschluss bestärkt fühlte, nie Kinder in die Welt zu setzen, wozu ich bis dato allerdings auch noch nicht eine einzige Gelegenheit gehabt hatte.
Im zehnten Karton fanden wir, und lächelten uns natürlich sofort an – dieses sanfte, fast verliebte Weißtdunochlächeln –, im zehnten Karton also fanden wir das Buch, über das wir uns kennengelernt hatten, Adam Melks Der Tod des Jorge von Burgos in einer sogenannten Erfolgsausgabe. Dazu eine bibliophile Edition des kleinen Essays Kafka als Hausgenosse von Franz Odradek, ein Faksimile der Erstausgabe von 1928, erschienen 1993 bei Bittner & Klein.
Im elften steckte neben drei oder vier Kochbüchern – von denen schienen die Erben also schon genug zu haben – viel Philosophie, primär, sekundär und tertiär. Manches kannte ich, da ich ja vier Semester Philosophie studiert hatte, vieles kannte ich nicht. Als wir die Bücher in Stapeln geschichtet hatten, wollte ich schon den zwölften Karton öffnen, als Sander eins der Bücher hochhielt und sagte: »Das ist er übrigens.«
»Das ist wer?«
»Der Erblasser«, sagte Sander.
Es handelte sich um ein klassisches suhrkamp taschenbuch wissenschaft aus dem Jahr 2008, goldgelbe Schrift auf schwarzem Grund, etwa hundertsechzig Seiten mit dem Titel Ironie. Eine philosophische Summe. Sein Verfasser war ein gewisser Ulrich Goergen, damals noch ausgewiesen als Ordinarius für Philosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, und im Buch lag vorn noch ein Kärtchen mit dem handschriftlichen Vermerk: »Lieber Herr Goergen, hier schon einmal ein Vorausexemplar der Taschenbuchausgabe. Ihr Raimund Fellinger.«
Mit dem letzten Karton hatten die Anarchisten auf den ersten Blick eine Niete gezogen, weil er nichts anderes zu enthalten schien als einen Stapel alter Zeitungen. Ganz unten fanden wir dann aber doch noch drei Stücke. Erstens einen Sonderdruck von Walter Benjamins Aufsatz Ich packe meine Bibliothek aus, erschienen 2012 bei Ulrich Keicher in Warmbronn und versehen mit einem Nachwort von Lukas Domnik. Zweitens einen abgegriffenen Reiseführer von Polyglott für Bad Münstereifel und Umgebung, etwa dreißig Jahre alt. Auf dem Boden des Kartons lag schließlich ein Achthundertseitenklotz aus der Gattung Polit-Thriller mit dem Titel Das Sonja-Komplott. Es handelte sich um die sechzehnte Auflage der Taschenbuchausgabe, erschienen 2005. Die gebundene Ausgabe war zuerst 1999 erschienen. Der Verfasser war ein gewisser Gregor Korff.
»Das würde ich mir gern erst einmal für die einsamen Abende ausleihen, bevor wir es einarbeiten«, sagte ich zu Sander.
»Kein Problem«, sagte der. »Das wird ohnehin nicht das Prunkstück unserer Bibliothek.«
2
Als damals der Putsch kam, im Frühjahr 2016, hatte ich mich in meinem Studium schon reichlich verlaufen und wusste nicht mehr, wie ich aus dem Labyrinth herausfinden sollte. Mein größtes Problem bestand darin, dass ich mich für beinahe alles interessierte, was auf dem Weg lag, und deshalb nicht den geraden Weg beschreiten konnte, den das Studium verlangte, sondern ständig abzweigte. Insbesondere die Philosophen führten mich immer noch einen entlegenen Pfad weiter, auch fort von ihrer eigenen Disziplin, und dann war ich manchmal plötzlich bei den Ethnologen, den Linguisten, den Soziologen, den Kommunikationswissenschaftlern, den Kulturwissenschaftlern, den Cineasten und den Psychoanalytikern, bei den Kunstgeschichtlern, Semiotikern und Medizinhistorikern gelandet und hatte jedes Mal Schwierigkeiten, zurückzufinden. Mit den Freunden, mit den Frauen ging es mir ebenso: immer noch ein Abzweig, noch ein Seitenpfad. Während der vier Jahre meines Studiums war Sander die einzige Konstante in meinem Leben, doch als man ihn dann entlassen hatte und er in seinen Kleinverlag verschwunden war, schlief unser Kontakt ein.
Auch deshalb, weil ich die Hauptstadt verließ und in den alten Westen zurückging. Die Hauptstadt war ohnehin in den vorangegangenen Jahrzehnten schon in einem architektonischen Stil herausgeputzt und aufgebläht worden, der mir nicht gefiel. Die neuen Machthaber aber gaben sich nicht mit der vorhandenen Herrschaftsarchitektur rund um den Reichstag zufrieden, sondern ließen alles abreißen, erweiterten das Gelände noch durch die Zerstörung angrenzender Viertel und bauten neu in einer Stilmischung aus italienischem Futurismus und Neuer Sachlichkeit. Das betraf nicht nur das Regierungsviertel, sondern darüber hinaus viele öffentliche Gebäude, und das Tempo, das dabei angeschlagen wurde, auch aufgrund der sich ständig weiter entwickelnden technischen Möglichkeiten und des enthusiastischen persönlichen Einsatzes des internationalen Stararchitekten, der den Wettbewerb gewonnen hatte, hielt die Welt in Atem: Das neue Regierungszentrum war nach zehn Monaten fix und fertig, und das war auch der Zeitpunkt, als ich in den alten Westen zurückging. Das neue Regime war mir architektonisch einfach zu nah auf die Pelle gerückt. Ich war nie ein Widerstandskämpfer, aber wenigstens wollte ich mich so weit entziehen, wie es mir möglich war.
Zwei Monate lebte ich bei meiner Mutter in Frankfurt, dann trat ich in Aachen in das Handelshaus Del’Haye & Münzenberg ein. Ein Bekannter meiner Mutter hatte das vermittelt, und so begann ich mit zweiundzwanzig Jahren eine klassische kaufmännische Ausbildung und ließ alle geisteswissenschaftlichen Wirren hinter mir. Del’Haye & Münzenberg war eine Groß- und Einzelhandlung für Genussmittel am Rande des Aachener Zentrums, die seit über zweihundert Jahren existierte. Einen Del’Haye gab es in der Firma schon lange nicht mehr, die Familie Münzenberg war aber noch immer Eigentümer des Geschäfts, das überaus erfolgreich war und dessen Geschäftspraktiken sich durchaus auf dem neuesten Stand befanden, in dem mich aber, sobald ich es morgens betrat, aus allen Ecken die Tradition eines Familienunternehmens anwehte.
Die Münzenbergs importierten, verschickten und verkauften Kaffee, Tee, Kakao, Zigarren, Weine, Spirituosen, Schokoladen, Gewürze, Konfitüren und Honig, natürlich nur in allerbester Qualität. Die Geschäftsräume waren zwar mehrfach erweitert worden, immer aber im Stil des ursprünglichen Geschäfts, Ladentheken und Regale aus massivem dunklen Holz, und wenn man eines der Büros betrat, war man versucht, unwillkürlich von einem Kontor zu sprechen, obwohl dieses Wort schon damals aus der deutschen Sprache fast verschwunden war. Selbst das Lager, in dem nach den modernsten logistischen Methoden verfahren wurde, atmete den Geruch des Alten und Gediegenen.
Bei den etwas hilflosen Bemühungen des Regimes, neue Symbole zu etablieren, oder aber alte Symbole neu zu etablieren, machten die Münzenbergs von Beginn an nicht mit. Man sah also nirgends den stilisierten Doppelblitz, der die Kraft, die Entschlossenheit, die Modernität und vielleicht auch den Vernichtungswillen der neuen Herren symbolisieren sollte und der selbstverständlich an jedem öffentlichen Gebäude, auf jeder Uniform, auf jedem offiziellen Briefkopf und sogar weit verbreitet in der Mode zu finden war. Nicht einmal das obligatorische Foto des Generals hing in der Firma, wie das Regime überhaupt hier am westlichen Rand des Landes einen schwereren Stand hatte als in großen Teilen der Mitte und des Ostens. Der alte Münzenberg, der bei meinem Eintritt in die Firma noch lebte, sagte bei Gelegenheit: »Wenn man uns hier Schwierigkeiten macht, können wir sehr schnell umziehen. Zur belgischen Grenze sind es zwanzig Minuten, und man wird uns dort sicher willkommen heißen, denn von Genussmitteln verstehen die Belgier etwas. Dann ist eben Schluss mit der Aachener Münzenberg-Tradition.« Man machte aber keine Schwierigkeiten, denn einige der Emporkömmlinge und Funktionsträger des neuen Regimes gehörten jetzt, da sie es sich leisten konnten, zu den eifrigsten Kunden der Münzenbergs.
In dieser traditionsreichen Firma durchlief ich während meiner zweieinhalb Ausbildungsjahre alle Abteilungen, vom Lager über die Buchhaltung, die Bestellung, den Versand bis zum Verkauf und schließlich dem Einkauf. Im Einkauf wurde ich danach auch eingesetzt, reiste oft nach Belgien, Frankreich und Italien, nach Brüssel und Montélimar, ins Piemont und in die Emilia Romagna. Natürlich war ich auch innerdeutsch unterwegs, und so könnte man sagen, dass ich die Jahre der Diktatur sowohl in der inneren wie in der temporären äußeren Emigration überwinterte.
Direkt nach ihrem Ende stieg ich in den Schwarzmarkt ein, wobei ich zugleich in der Firma weiterarbeitete. Immerhin waren die Beziehungen, die ich dort aufgebaut hatte, meine Basis. Ich bin davon überzeugt, dass einer der Juniorchefs, Anton Münzenberg, der Enkel des alten Münzenberg, der 2018 gestorben war, ziemlich genau wusste, dass ich neben dem Geschäft noch meine eigenen Geschäfte betrieb. Darauf angesprochen hat er mich nie. Anton war vier Jahre jünger als ich, und wir verstanden uns vom ersten Moment an gut. Er hatte eine Geliebte in Lüttich, von der seine Familie nichts wissen durfte, da es sich nach ihren Regeln um eine Mesalliance gehandelt hätte, und begleitete mich oft auf meinen Ausflügen nach Belgien. Ich hielt dicht, und ich denke, er hat mir das vergolten, indem er über meine Nebengeschäfte ebenfalls eisern schwieg.
Auf dem Schwarzmarkt war ich vor allem im Kaffee und in den Tabakwaren tätig und verdiente in den ersten zwei Jahren gutes Geld. Die Übergangsregierung bekam aber gerade hier im Westen die Versorgungslage schneller in den Griff, als man erwarten konnte, und die Geschäfte ließen stark nach. Man konnte sich noch hier und da etwas hinzuverdienen, aber Reichtümer waren auf diesem Sektor der Wirtschaft nicht mehr zu machen. Im Übrigen musste ich trotz allem immer damit rechnen, in der Firma aufzufliegen, und die Scham hätte ich vielleicht nicht überlebt. Die Münzenbergs haben mich immer beinahe wie ein Mitglied der Familie behandelt. Familie im traditionellen Sinn hatte ich nie gehabt. Ich war das einzige Kind meiner Mutter, und meinen Vater habe ich nie gekannt. Auch meine Mutter hat ihn eigentlich nicht gekannt. »Dein Vater war ein Durchreisender, Ulrich«, sagte sie, »und das wusste ich schon in der betreffenden Nacht. Ich weiß nicht einmal seinen Familiennamen.«
Also ließ ich den Schwarzmarkt sein und arbeitete noch knapp drei Jahre weiter als seriöser Kaufmann bei Del’Haye & Münzenberg. Dann kam Sanders Anruf. Ich wusste sofort, wer da am anderen Ende der Leitung war, und wir sprachen miteinander, als hätten wir uns gerade vorgestern zum letzten Mal gesehen. Ich sagte nicht sofort ja, ich hatte keinen Grund, den alten Westen zu verlassen. Ich wohnte in einer sehr schönen Wohnung direkt am Markt. Das Haus gehörte den Münzenbergs, und meine Miete hatte eher symbolischen Charakter. Ich war nah an den Grenzen, Westeuropa in Sichtweite. Ich hatte außer Anton Münzenberg noch weitere Freunde, ich hatte ein paar Liebschaften. Ich hatte einen sehr sicheren Arbeitsplatz in der Firma, und meine Tätigkeit machte mir Freude. Ich liebte die Gerüche und das dämmrige Licht in den alten Räumen.
»Sieh es dir wenigstens mal an«, sagte Sander am Telefon, »eine so prächtige Ruinenlandschaft wie hier hast du noch nie gesehen.«
Dokument 1
Gespräch mit Anton Münzenberg, Mitinhaber der Fa. Del’Haye & Münzenberg, Aachen, im Zuge inoffizieller Ermittlungen
Münzenberg empfängt die beiden Ermittler der Gruppe »Wirtschaftskriminalität in der Übergangszeit«, Teichert und Preen, in seinem Büro: holzgetäfelte Wände, ein Schreibtisch von Anfang des 20. Jahrhunderts, eine Sitzgruppe mit drei Ledersesseln. Er bietet Zigarren an, die Herren lehnen jedoch ab. Kaffee steht bereit. Entgegen der Aussage des Ermittlers Teichert (siehe unten) wurde das Gespräch doch heimlich aufgezeichnet und anschließend transkribiert und fand sich unter der Inventarnummer S/14/3/48 im Aachener Stadtarchiv.
Teichert Das ist keine offizielle Ermittlung. Wir haben lediglich ein paar Fragen. Es wird nichts notiert, nichts aufgenommen.
Münzenberg Ganz wie Sie wollen. Ich habe nichts zu verbergen. Bin gern auch zu offiziellen Auskünften bereit. Es geht um Herrn Anders, wie ich höre.
Teichert Richtig. Der Ihre Firma verlassen hat.
Münzenberg Auf eigenen Wunsch, ja. Er ist in die Hauptstadt gegangen, um dort beim Aufbau einer Bibliothek zu helfen.
Preen Ein etwas überraschender Berufswechsel, finden Sie nicht auch? Vom Kaufmann zum Bibliothekar?
Münzenberg Auf den ersten Blick sicher. Aber Ulrich – wir waren befreundet, wissen Sie –, Ulrich hatte vorher Geisteswissenschaften studiert, bevor er bei uns seine kaufmännische Ausbildung gemacht hat. Germanistik und angrenzende Fächer, so genau weiß ich das gar nicht. Er war auch sehr belesen, jedenfalls, wenn ich mich selbst als Maßstab nehme.
Teichert Aber er war auch ein guter Kaufmann?
Münzenberg Ein sehr tüchtiger, ja.
Teichert Zuständig in der Firma wofür?
Münzenberg (leicht ungehalten) Aber das wissen Sie doch schon alles. Er war im Einkauf tätig. Eigentlich war er der Chefeinkäufer, auch wenn ich offiziell die Abteilung leitete. Aber Ulrich hatte ein sehr gutes Gespür, und ich habe ihm weitgehend freie Hand gelassen.
Teichert Könnte er das vielleicht ausgenutzt haben?
Münzenberg Wofür?
Preen (nachdrücklich) Nebengeschäfte, Herr Münzenberg. Sie können sich doch wohl vorstellen, was wir meinen.
Münzenberg Davon ist mir nichts bekannt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was Sie meinen. Die Abläufe in unserer Firma sind so, dass niemand in die eigene Tasche wirtschaften kann.
Preen Wer kontrolliert?
Münzenberg Die Buchhaltung. Der Abteilungsleiter, in dem Fall also ich. Wir hatten zweimal eine Wirtschaftsprüfungsfirma im Haus, während Ulrich hier arbeitete. Schließlich kontrolliert der Chef, das war damals, als Ulrich kam, noch mein Großvater, dann ab 2018 mein Vater. Wir sind ja ein Familienunternehmen, immer noch.
Teichert Das ist erstaunlich, ja. Und anerkennenswert. Um auf Herrn Anders zurückzukommen: Wir sprachen vom Schwarzmarkt.
Münzenberg Bisher noch nicht. Sie sprechen jetzt zum ersten Mal davon.
Teichert Gut, zugegeben. Wir nennen das Kind jetzt erst beim Namen.
Münzenberg Dazu kann ich Ihnen wirklich nichts sagen.
Preen Nie Unregelmäßigkeiten?
Münzenberg Nie. Es gab nie Fehlbestände, und die Bücher waren immer in Ordnung. Tut mir leid. Oder vielmehr, tut mir nicht leid, denn so etwas hätte ich Ulrich auch nie zugetraut.
Teichert Sie beide waren freundschaftlich verbunden, haben Sie vorhin selbst gesagt.
Münzenberg Richtig. Aber das gehört sicher nicht in den Rahmen Ihrer Ermittlungen. Die Sie ja offiziell auch gar nicht führen.
Preen Sie haben Herrn Anders auf seinen Reisen manchmal begleitet?
Münzenberg Nur auf denen nach Belgien. Aus privaten Gründen, die Sie nichts angehen. Woher wissen Sie das eigentlich? Dürfen Sie das wissen?
Preen Wir wissen es auch nicht. Unsere Vorgänger im Amt haben es gewusst. Es gibt Unterlagen. Aus der Juntazeit.
Münzenberg Die nach meiner Kenntnis längst vernichtet sein müssten.
Teichert (verlegen) Es ist sehr schwer, Daten zu löschen, wenn sie erst einmal da sind. Wir wissen ja auch, dass wir sie eigentlich nicht verwenden dürfen. Wir haben uns nur noch einmal ein genaueres Bild machen wollen. Wir haben zu danken.
Münzenberg Gern geschehen.
3
Eine so prächtige Ruinenlandschaft hatte ich in der Tat noch nie gesehen. Ich hatte bisher überhaupt keine Ruinenlandschaften gesehen, weil der Westen von den Kämpfen praktisch nicht berührt gewesen war. Die Chargen des Juntaregimes in der Aachener Region, darunter auch manche Stammkunden der Firma Del’Haye & Münzenberg, waren beim Näherkommen der Internationalen Befriedungstruppe schnell und diskret untergetaucht, vermutlich jenseits der Grenze und eher in Flandern als in der Wallonie. Abgesehen von ein paar Scharmützeln in der Gegend um Brand und Kornelimünster, bei denen es nur Gefangene gegeben hatte, schien die Armee in diesem Gebiet nicht sehr kampflustig zu sein. In der Stadt selbst gab es ein paar zivile Heckenschützen, meist jugendliche Anhänger des Regimes, die schnell gefasst wurden. Ein paar Einschusslöcher in einigen Häusern der Kleinkölnstraße, das war der ganze Schaden, den die Stadt genommen hatte. Auch von den temporären Stromsperren, die es in den ersten Monaten weiter landeinwärts und vor allem in der Hauptstadt gegeben hatte, waren wir hier verschont geblieben.
Dagegen nun dieses immer noch wüste Terrain! Bei manchen Gebäuden war kaum zu entscheiden, ob sie sich schon im Wiederaufbau befanden oder ob sie im Gegenteil morgen vielleicht ganz abgerissen werden sollten. Zwischen den Ruinen herrschte reger Verkehr; fast entstand für mich der Eindruck, als spiele sich auf diesem Gelände das Leben vorwiegend draußen ab. Zugleich wurden die meisten der Ruinen schon genutzt. Als in der beginnenden Dämmerung die ersten Lichter eingeschaltet wurden, sah ich das Leben in den Büros, den Betrieben und Wohnungen, und plötzlich wusste ich, dass ich hier bleiben würde. Sander hatte mich erst halb überzeugen können, aber dieses Reich der Lichter in der nun schnell fallenden Dämmerung, die Selbstverständlichkeit in den Bewegungen der Menschen, die ich hinter den Fenstern sah, verführten mich ganz, und ich wünschte mir nichts mehr, als in Zukunft zu ihnen zu gehören und wie Sander wir zu sagen, wenn ich von diesem Gelände sprach.
Sander führte mich in meine Wohnung. Während er in der Bibliothek wohnte, wurde ich in einem schon ausgebauten ehemaligen Geräteschuppen zweihundert Meter weiter nördlich untergebracht. Ich bekam ein großes, spärlich möbliertes Zimmer zum Wohnen und Schlafen, ein kleines Bad und eine Küche. »Vielleicht gibt es mal etwas Größeres für dich«, sagte Sander, aber ich wehrte gleich ab. Mir reichte das völlig. Sander stand etwas unentschlossen in der Tür, und ich nickte ihm zu, als Zeichen, dass er gehen könne. Ich wollte jetzt allein sein. Ich zog die japanischen Rollos aus Reispapier zu, sechs Bahnen, die man gegeneinander verschieben konnte, und saß dann eine Weile in einem schwarz bezogenen Sessel. Dann schob ich eine der Rollobahnen leicht zur Seite und spähte nach draußen. Ich beobachtete, wie hier Lichter verloschen und anderswo welche angingen, ich sah Umrisse von Gestalten in der Dunkelheit, die in verschiedene Richtungen verschwanden. Wartet nur, dachte ich, bald bin ich auch bei euch.
An diesem Abend meines ersten Tages begann ich, den Wälzer von Gregor Korff zu lesen, Das Sonja-Komplott. Es handelte sich um eine Polit- und Geheimdienststory aus den Jahren vor meiner Geburt, als das neue Deutschland noch etwas unübersichtlich gewesen war. Im Klappentext hieß es, dass der Autor, ein »ehemaliger einflussreicher Berater in der Bonner Szene«, in dem Roman »zum Teil eigene Erfahrungen verarbeitet« habe. Das Ganze war flott geschrieben und erzählte im Kern davon, wie der Held und Ich-Erzähler Norbert Sethe, ein Mitarbeiter des Kanzleramts, sich in den achtziger Jahren in eine junge Frau namens Sonja verliebt, die in der Bundestagsverwaltung arbeitet. Für einen geübten Leser wird natürlich ziemlich schnell klar, dass es sich bei der Kleinen um eine Stasi-Agentin handelt. Ich blätterte schon einmal vor und sah, dass später noch andere Geheimdienste mitmischen würden, vom MI6 über die CIA bis zum Mossad, und dass alles da war, was dazugehört: Ministerstürze, fiese Morde und alle Arten von Verrat. Anders kriegt man auch keine achthundert Seiten zusammen. Auf der Umschlagrückseite waren lobende Pressestimmen und dazu ein anerkennendes Statement von John le Carré abgedruckt. Schmöker aus diesem Milieu habe ich immer gern gelesen. Unter anderen Umständen hätte ich mir sogar vorstellen können, selbst bei einem Dienst anzuheuern, aber ich habe es eben nur bis zum Schwarzmarkt gebracht.
Am nächsten Morgen gab Sander mir eine erste Einführung in die Systematik der Bibliothek, damit ich ihm künftig beim Katalogisieren helfen konnte. Bei aller Liebe zu Büchern war ich schließlich ein Quereinsteiger, ein abgebrochener Student, der später in einem ganz anderen Bereich, nämlich als Kaufmann, erfolgreich gewesen war. Bei Sander dagegen hätte ich mir nie etwas anderes vorstellen können, als dass er mit Büchern zu tun hatte, von früh an.
Nicht lange, nachdem wir uns kennengelernt hatten, hatte er mir die Geschichte erzählt. Eines Tages hatte er im Kindergarten einen harten Gummiball gefunden und ihn in die Hosentasche gesteckt. Bei den Spielen saß er oft am Rande. Die Erzieherin hatte ihn schon drei Mal gefragt, warum er so still sei und was ihn unglücklich mache, und jedes Mal antwortete Sander mit den Worten: »Ich bin gern still, und unglücklich bin ich gar nicht. Es ist alles in Ordnung.« Da war er vier Jahre alt, und als er diese Sätze zum dritten Mal gesagt hatte, lachte die Erzieherin und schien irgendwie erleichtert, weil sie ihn jetzt sich selbst überlassen konnte, ohne damit etwas Schlimmes zu tun. An diesem Tag stand Sander in einer Ecke und lächelte, bis er den Gummiball aus der Tasche zog und ihn einem Mädchen gezielt und aus nächster Nähe mit voller Wucht ins Gesicht warf. Riesengeschrei natürlich, das Auge des Mädchens schwoll schnell an, ein Arzt wurde gerufen, und die Erzieherin – ganz allein an diesem Tag, weil die Kollegin krank war – rief Sanders Mutter an mit der Bitte, sie möge ihren Sohn abholen. Dann wusste sie sich nicht anders zu helfen, als Sander, der ganz ruhig den Tumult beobachtete, den er ausgelöst hatte, in ihr winziges Büro einzusperren, bis die Mutter kam. Er weigerte sich, sich bei dem Mädchen zu entschuldigen. Die Erzieherin, die ihn sehr mochte, sah ihn verzweifelt an, als sie an der Tür stand, und er tröstete sie und sagte: »Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist alles in Ordnung.« Sie schüttelte erstaunt den Kopf, tauchte wieder in den Kinderstrudel draußen ein und schloss von außen ab. Vielleicht dachte sie damals: Ich mache alles falsch. Es ist alles ganz anders, als ich es gelernt habe. Wir werden es nicht mehr wissen können. Heute ist sie eine alte Frau oder vielleicht schon tot. Sander erinnert sich, dass sie Ingrid hieß und dass auch er sie mochte.
In ihrem Büro stand ein Wasserkocher und ein Glas mit löslichem Kaffee, und in der Spüle lag eine schmutzige Tasse im schon halb kalten Spülwasser. Auf dem winzigen Schreibtisch entdeckte er ein graues Ablagefach, das bis auf zwei oder drei Blätter fast leer war, und daneben lag ein schon etwas abgegriffenes Taschenbuch.
»Ich erinnere mich«, sagte Sander, »dass ich etwas erstaunt war, weil ich Ingrid bisher nicht mit einem Buch gesehen hatte.«
Sander nahm das Buch und schlug es auf, und wenn er auch erstaunt war, dass Ingrid hier in ihrem Büro, verborgen vor den Augen der Kinder, ein Buch beherbergte, schien es ihn nicht zu erstaunen, dass er, als seine Augen sich auf die schwarze Textur auf weißem Grund richteten, diese Textur mühelos entziffern konnte. Und warum auch sollte er darüber erstaunt sein, hatte ihm doch noch nie jemand erzählt, dass Kinder im Alter von vier Jahren im Regelfall nicht lesen können? Mrs. Dalloway sagte, las er also, sie wolle selber gehen und die Blumen kaufen.
»Natürlich«, sagte Sander, als er mir diese Geschichte erzählte, »konnte ich damals weder erstaunt sein noch es ganz natürlich finden, dass eine Erzieherin Virginia Woolf las, weil ich nicht wusste, wer Virginia Woolf war und welche Art Leserinnen sie lasen. Vermutlich war es auch gar nicht so erstaunlich, dass sie Virginia Woolf las, denn damals galt Virginia Woolf irgendwie als eine literarische Speerspitze des Feminismus, und dass sie überhaupt solche Literatur las, die Erzieherin Ingrid, die jetzt da draußen vielleicht besorgt mit dem Arzt sprach, war vielleicht auch nicht so erstaunlich, denn ich wusste ja nicht, über welchen Weg oder welche Umwege sie Erzieherin geworden war und ob sie nicht früher etwas ganz anderes hatte werden wollen und das vielleicht noch immer werden wollte.«
Sanders Mutter kam also, um ihn abzuholen, und Ingrid schloss wieder die Tür auf, und die beiden Frauen sahen den kleinen Kai Sander dort in einer Ecke sitzen, was für sie beide kein ungewohnter Anblick war, jedoch mit einem Buch in der Hand, was sie in der Tat etwas ungewöhnlich und irgendwie auch amüsant fanden, sodass die besorgten Mienen, mit denen sie das Büro betraten, sich zu einem angedeuteten Lächeln veränderten, in dem erwachsene Überheblichkeit sich vielleicht mit der Erleichterung darüber mischte, dass der kleine Kai keinen weiteren Schaden angerichtet und inzwischen das Büro zu Kleinholz gemacht hatte. Das Lächeln war bei Ingrid entspannter als bei Sanders Mutter, die vermutlich noch über das Aggressionspotenzial ihres Sohnes nachgrübelte, und Ingrid war es auch, die etwas scherzhaft sagte: »Schau an, du hast ja mein Buch gefunden. Was steht denn da drin?«
Sander blätterte zum Anfang zurück und sagte: Mrs. Dalloway sagte, sie wolle selber gehen und die Blumen kaufen, und dann sah er, wie die Gesichter der beiden Frauen, seiner Mutter und seiner Kindergartenmutter also, sich zu ungläubigem Erschrecken veränderten.
»Ich habe sie später nie gefragt«, sagte Sander, »aber manchmal glaube ich, meine Mutter hat in jenem Moment gedacht, sie habe ein Monster geboren. Das Erschrecken jedenfalls, darauf schwöre ich, auch wenn ich erst vier Jahre alt war, das Erschrecken auf ihrem Gesicht war nicht freudig.«
Warum hatten seine Eltern es noch nicht gemerkt? Der Sandersche Haushalt war schließlich keiner ohne Bücher, auch wenn man nicht von einer Bibliothek sprechen konnte. Sein Vater arbeitete in der Geschäftsführung der Stahlwerke, und selbstverständlich hatte man Bücher in der Wohnung stehen, manche lagen sogar auf dem Tisch. In den stillen Nachmittagsstunden, wenn seine depressive Mutter im abgedunkelten Schlafzimmer lag, nahm der kleine Kai Sander das eine oder andere Buch an sich und blätterte darin, las hier ein paar Sätze und dort ein paar, bis er sich an seine erste vollständige Lektüre machte, Andersens Schneekönigin. Das war wenige Wochen vor dem Vorfall im Kindergarten, an einem sehr heißen Augusttag im gefilterten Licht der geschlossenen Jalousien. Das Märchen beeindruckte ihn außerordentlich – vielleicht nur, weil er zum ersten Mal in seinem Leben als Lesender selbst einen Text erschaffen hatte –, und er erzählte davon seiner Mutter. Ihn faszinierte die Geschichte von den Spiegelscherben, von denen eine dem kleinen Kay ins Auge flog, und natürlich zog ihn die Geschichte umso mehr an, als der Held der Geschichte fast so hieß wie er selber, nur eben mit einem y statt einem i am Ende. Er bewunderte die kleine Gerda, die sich allen Widerständen und den minimalen Erfolgsaussichten zum Trotz auf die Suche nach Kay macht. Er mochte vor allem die beiden Krähen, die Gerda schließlich ins Schloss bringen und die am Ende eine feste Anstellung als Hofkrähen erhalten. Mit dem kleinen Räubermädchen wäre er gern unterwegs gewesen, »und nur der Schluss des Märchens gefiel mir schon damals nicht so richtig«, erzählte mir Sander. »Ich ahnte irgendwie, dass er ziemlich kitschig war, und ich bedauerte die beiden, dass sie nun, als Erwachsene, wieder zu Hause waren und dort wohl auch für immer bleiben würden.«
Seine Mutter fragte sich damals nicht, woher er das Märchen kannte, sondern ging davon aus, er habe es im Kindergarten vorgelesen bekommen. Nun war es aber raus. Der Gummiball hatte es an den Tag gebracht. Seine Eltern waren in heller Aufregung und fuhren mit ihm zu einem Kinderpsychologen nach Hannover. Am Ende war dieses Kind noch hochbegabt, und sie hatten bisher nichts davon bemerkt.
»Ihr Junge ist völlig in Ordnung«, sagte der Psychologe, ein freundlicher älterer Herr mit dem Gesicht eines Gnoms, das zur Hälfte durch einen grauen Bart verdeckt war, »er kann nur einfach lesen. Andere Kinder in diesem Alter können Klavier spielen. Oder Schach.« Das beruhigte seine Eltern etwas, auch wenn es ihnen nicht wirklich half.