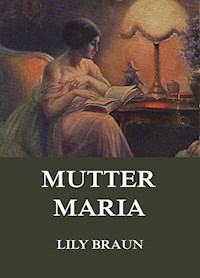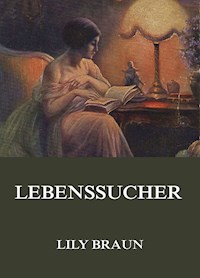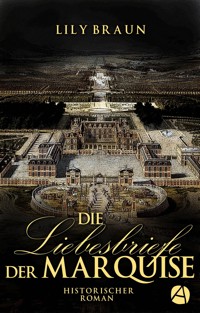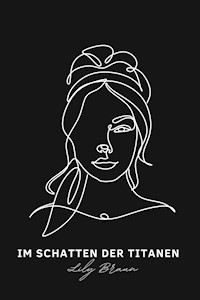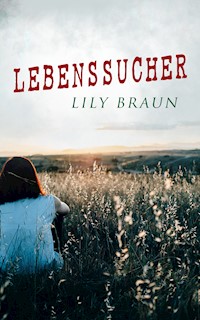Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält beide Teile, "Lehrjahre" und "Kampfjahre" der deutsche Frauenrechtlerin und Sozialdemokratin. Lily Braun, geboren als Amelia Jenny Emilie Klothilde Johanna von Kretschmann, war ebenso Schriftstellerin und Journalistin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1527
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Memoiren einer Sozialistin
Lily Braun
Inhalt:
Lily Braun – Biografie und Bibliografie
Memoiren einer Sozialistin
Lehrjahre
An meinen Sohn
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Kampfjahre
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Memoiren einer Sozialistin, L. Braun
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849606480
www.jazzybee-verlag.de
Lily Braun – Biografie und Bibliografie
Lily Braun, geb. von Kretschmann, (verwitwete von Gizycki) Berlin W., Friedrich-Wilhelmstrasse 13, wurde zu Halberstadt den 2. Juli 1865 geboren. Sie lebte mit ihren Eltern – ihr Vater war Offizier – in verschiedenen Städten des deutschen Reichs und genoss ausschließlich Privatunterricht. Nach dem Tode ihrer Großmutter, der Freundin Goethes, gab sie im Jahre 1891 unter dem Titel »Aus Goethes-Freundeskreise, Erinnerungen der Baronin Jenny von Gustedt, geb. von Pappenheim«, deren Memoiren heraus. Sie begann damit ihre literarische Tätigkeit und wurde Mitarbeiterin des Goethe-Jahrbuchs, der Westermannschen Monatshefte, der Deutschen Rundschau u.m. Die Frucht ihrer Studien in den Weimarer Archiven ist das Buch: »Deutsche Fürstinnen«. In Berlin, wo sie vom Jahre 1890 ab lebte, machte sie die Bekanntschaft des Professors Georg von Gizycki, dessen Schülerin sie wurde und der sie zuerst in die Ideen der ethischen Bewegung, der Frauenbewegung und des Sozialismus einführte. Sie wurde im Herbst 1892 in Gemeinschaft mit ihm eine der Mitgründer der deutschen Gesellschaft für ethische Kultur und leitete mit Professor von Gizycki vom Januar 1893 ab die Wochenschrift »Ethische Kultur«. Im Juni desselben Jahres vermählte sie sich mit ihrem Lehrer. In Wort und Schrift trat sie für die radikale Richtung der Frauenbewegung ein und gründete mit Frau Minna Cauer die Zeitschrift »Die Frauenbewegung«, gab auch eine Zeitungs-Korrespondenz für die Frauenfrage heraus. Im März 1895 starb ihr Gatte infolge eines langen schweren Leidens, das ihn während der letzten Jahre seines Lebens ganz an den Rollstuhl gefesselt hatte. Unter seiner Leitung war sie nach und nach ganz zur Sozialistin geworden. Sie konnte die Redaktion bürgerlicher Zeitschriften nicht mehr mit ihrer politischen Überzeugung vereinigen und legte daher ihre Stellung als Mitherausgeberin der »Ethischen Kultur« und der »Frauenbewegung« Ende des Jahres 1895 nieder, sich von da ab offen zur sozialdemokratischen Partei bekennend. Im August 1896 vermählte sie sich mit Dr. Heinrich Braun, dem Herausgeber des Archivs für soziale Gesetzgebung und Statistik, dessen Mitredakteurin sie wurde. Sie war außerdem ständige Mitarbeiterin der von Frau Klara Zetkin geleiteten sozialdemokratischen Frauenzeitschrift »Die Gleichheit«. Lily Braun verstarb am 9. August 1916 in Berlin.
‒ Aus Goethes Freundeskreise. Erinnerungen der Baronin Jenny von Gustedt
‒ Clifford, Wahrhaftigkeit. 1893
‒ Deutsche Fürstinnen. 1893
‒ Die Bürgerpflicht der Frau. 1895
‒ Die neue Frau in der Dichtung. 1896
‒ Die Stellung der Frau in der Gegenwart. 1895
‒ Frauenfrage u. Sozialdemokratie. Reden anlässlich d. internationalen Frauenkongresses zu Berlin. 1896
‒ Zur Beurteilung der Frauenbewegung in England u. Deutschland. 1896
Memoiren einer Sozialistin
Lehrjahre
An meinen Sohn
Die Rosen blühen und die Linden duften. Über dunkle Wälder und saftgrüne Matten ragen die Berge meiner Heimat zum Himmel empor, an dem die Sterne funkeln und strahlen, ungetrübt von den Dünsten der Städte und den Nebeln der Niederung. Die grauen Felsriesen schimmern silbern im Mondlicht, und in ihren tausend Furchen und Spalten glänzt noch der Schnee.
Das ist die schönste Nacht des Jahres, die Nacht, in der's in Wald und Feld von alten Märchen raunt und flüstert, die Nacht, mein Sohn, die dich mir geschenkt: ein Sonnwendskind, ein Sonntagskind. Elf Jahre sind es heute. Ist es mir doch, als wäre es erst gestern gewesen, daß du an meiner Brust gelegen, daß du die ersten Worte lalltest, zum erstenmal die Füßchen setztest. Und nun bist du ein großer Junge! Die Kindheit bereitet sich aufs Abschiednehmen vor.
Fast am gleichen Tage war es, und mehr als drei Jahrzehnte sind es her, daß auch ich zu Füßen dieser Berge meinen elften Geburtstag feierte. Die Tafel bog sich damals unter der Fülle der Geschenke, – auf deinem Tisch, mein Sohn, lagen heute neben dem duftenden Kuchen unsrer alten Marie nur ein paar Bücher! –, und Eltern, Verwandte und Freunde umgaben mich, mit schäumendem Sekt und schmeichelnden Reden das Geburtstagskind feiernd, – wir dagegen waren heute allein und hatten nur tiroler Landwein in den Gläsern. Das Geburtstagskind von damals war ein blasses, langaufgeschossenes Mädchen mit einem alten, hochmütig-sarkastischen Zug um den Mund, dessen Lächeln der Dankbarkeit nur die Frucht guter Erziehung war; du aber bist ein blühender Knabe, der im Überschwang seiner Freude seine Mutter und die alte Marie abwechselnd in tollem Tanz auf der Wiese umherwirbelte. Nur zweierlei ist sich gleich geblieben – damals und heute –: auf deinem Tisch wie auf dem meinen lag das erste, langersehnte Tagebuch, dessen weiße Blätter so verlockend sind für ein elfjähriges Herz wie der Eingang ins Zauberreich des Lebens selbst, und vor dir wie vor mir ragten dieselben Bergesriesen, und derselbe Wald umrauschte unsre Kinderträume.
Mich hat mein Tagebuch durchs ganze Leben begleitet, und der Gewohnheit, mir allabendlich vor ihm Rechenschaft abzulegen über des Tages Soll und Haben, bin ich immer treu geblieben. Am Schlusse jeden Jahres habe ich an seiner Hand den verflossenen Lebensabschnitt überlegt und sein Fazit gezogen. Seine lakonischen Bemerkungen – ein bloßes trockenes Tatsachenmaterial – bildeten den festen Rahmen, den die Erinnerung mit den bunten Bildern des Lebens füllte, und unverzerrt durch jene schlechtesten Porträtisten der Welt – Haß oder Bewunderung – blickte mein Ich mir daraus entgegen.
Als ich diesmal aus der Tretmühle und der Fabrikatmosphäre meines Berliner Arbeitslebens in unsre stille Bergeinsamkeit floh, nahm ich die zweiunddreißig Jahreshefte meines Tagebuches mit mir. Generalabrechnung muß ich halten.
Auf steilem Felsenpfad bin ich bis hierher gestiegen, meinem wegkundigen Blick, meiner Kraft vertrauend, weit entfernt von den Lebenssphären, die Tradition und Sitte mit Wegweisern versah, damit auch der Gedankenlose nicht irre gehe. Jetzt aber muß ich stille stehen, muß Atem schöpfen, denn die große Einsamkeit um mich her läßt mich schaudern. Wohin nun? Hinab zu Tal, zu den Wegweisern? Oder weiter auf selbstgewähltem Steige?
Die Menschen zürnen mir, und alle nennen mich fahnenflüchtig, die irgendwann auf der Lebensreise ein Stück Weges mit mir gingen; mir aber erscheinen sie als die Ungetreuen. Wer hat recht von uns: sie oder ich? Um die Antwort zu finden, will ich den letzten Wurzeln meines Daseins nachspüren, wie seinen äußersten Verästelungen; und an dich, mein Sohn, will ich denken dabei, auf daß du, zum Manne gereift, deine Mutter verstehen mögest.
In der Sonnwendnacht, die dich mir geschenkt, in der Sonnwendnacht, in der ringsum auf den Höhen die Feuer glühen, in der Sonnwendnacht, wo aufersteht was ewigen Lebens würdig war, seien die Geister der Vergangenheit zuerst heraufbeschworen.
Obergrainau, den 24. Juni 1908.
Erstes Kapitel
Wo die kurische Nehrung beginnt ihre Dünen in die Ostsee hinauszustrecken, und das Meer auf der einen, das Haff auf der andern Seite das Land bespült, steht das Haus meiner Großeltern, in dem ich geboren bin. Vor Jahrhunderten haben deutsche Ordensritter es als festes Bollwerk gegen das heidnische Volk des Samlands erbaut; der breite, viereckige Turm, die dicken Mauern und der Graben ringsum erinnern noch an seinen Ursprung. Ein Ordensbruder soll es gewesen sein, der als einer der ersten im Samland zur Lehre Luthers übertrat, – nicht aus Gewissenszwang, denn das hätte dem blonden derben Junker aus dem thüringischen Geschlecht der Golzows wenig ähnlich gesehen, sondern aus Liebe zu einem schönen Fräulein, die ihn das Keuschheitsgelübde brechen hieß. Er wurde auf dem Schloß von Pirgallen der Stammvater des preußischen Zweigs der Familie und der Vorfahr meines Großvaters. Mit dem Besitz schien sich aber auch die lebenbestimmende Liebesleidenschaft des Ahnherrn von Generation zu Generation zu vererben. Nur selten fügte sich ein Golzow dem Rate der Familiensippe, wenn es galt, sich die Eheliebste zu wählen, und so wurden viele fremde Blumen in den nordischen Garten verpflanzt. Manch eine mag dabei im Frost erstarrt, vom Meersturm zerzaust worden sein, andere aber blühten, trugen Frucht und streuten den Samen ihrer Heimaterde in das Land, wo er üppig aufging, so daß es zwischen den gelben Dünen, den weißen Birkenstämmen und knorrigen Eichen gar seltsam anzuschauen war.
Auch meine Großmutter war solch eine fremde Blume gewesen: ein Kind der Liebe, dem heimlichen Bund eines Königs mit einem kleinen elsässischen Komteßschen entsprossen. Und sie war wohl nie recht heimisch geworden da oben. Sie fror immer, saß auch im Sommer gern am Kaminfeuer der Halle, und schwere schleppende Samtkleider, mit Pelz verbrämt, trug sie am liebsten. Sie blieb auch einsam trotz der großen Kinderschar, die sie umgab. Das Blut der Golzows war lebenskräftiger als das ihre, denn all die Buben und Mädel, die sie gebar, waren nicht eigentlich ihre Kinder: mit hellen blauen Augen aus rosigweißen Gesichtern blickten sie in die Welt, und Jagd und Tanz, Spiel und Liebe blieb ihnen Lebensinhalt.
An meine Mutter, ihr jüngstes Kind, die goldblonde Ilse, hatte sie sich mit aller Kraft ihrer Sehnsucht geklammert. Lange hoffte sie, sich selbst in ihr wiederzufinden, und verdeckte mit den bunten Gewändern ihrer Phantasie in zärtlicher Selbsttäuschung alles, was ihr fremd war an ihrer Tochter. Sie half ihr auch den Starrsinn des Vaters brechen, der sich ihrer Verbindung mit einem armen Infanterieleutnant widersetzte. Die Ehe mit dem ernsten, strebsamen Manne würde, so meinte sie, ihr eigentliches Wesen erst zur Entfaltung bringen – das Wesen, das sich schon deutlich genug dadurch auszudrücken schien, daß ihre Wahl unter allen ihren glänzenden Bewerbern grade auf diesen gefallen war. Sie wußte nicht, daß nur der Rausch Golzowscher Liebesleidenschaft – heiß und kurz, wie die Sommer Pirgallens – Ilse beherrschte. Ihr Gatte kannte die Tochter besser als sie, darum gab er die Hoffnung nicht auf, statt des »heimatlosen Landsknechts«, wie er ihren Erwählten, den Leutnant Hans von Kleve, spöttisch nannte, einen der Standesherrn des Landes als Schwiegersohn zu begrüßen.
Kleve besaß nichts als seinen guten Namen und seinen Ehrgeiz. Nachdem sein Vater, ein leichtsinniger Gardeleutnant, mit dem spärlichen Rest seines rasch verjubelten Vermögens und einer lustigen kleinen Frau, deren bürgerliche Herkunft ihn den schönen bunten Rock auszuziehen zwang, ein Gütchen in der Nähe Berlins erworben hatte, um dort nichts zu tun, als zu sterben, war seiner Mutter kaum das notwendigste übrig geblieben, um ihn und seine vier Geschwister zu erziehen. Wie gut, daß sie an Arbeit gewöhnt gewesen war ihr Leben lang! Zu stolz, die reichen Verwandten ihres Mannes, die sie ihrer Herkunft wegen nie hatten anerkennen wollen, in Anspruch zu nehmen, zog sie sich in eine kleine märkische Stadt zurück, wo sie ihre Kinder mit eiserner Strenge und in spartanischer Einfachheit erzog. Hans war zwölf Jahre alt, als er in diese harte Schule genommen wurde. Er empfand die Beschränktheit des Lebens am tiefsten und litt ständig unter den Anforderungen, die seine Mutter an seine geistige und moralische Leistungskraft stellte. Sein Liebesbedürfnis fand wenig Verständnis bei ihr, die unter dem dauernden Druck quälender Sorgen die Zärtlichkeit glücklicher Mütter eingebüßt hatte. Eine Schwester, die ihm im Alter am nächsten stand, und der er sein ganzes Herz zuwandte, wurde ihm früh durch väterliche Verwandte, die sich plötzlich der armen Witwe und ihrer Kinder erinnert hatten, entrissen; so blieb er ganz auf sich allein angewiesen und konzentrierte all seine Energie auf das eine Ziel: sich selbst das Leben zu erobern.
Mit sechzehn Jahren machte er das Abiturientenexamen und trat in ein Königsberger Infanterieregiment ein. Kavallerist zu werden, was er sich gewünscht hatte, – denn die Reiterleidenschaft saß ihm tief im Blute –, erlaubten seine Mittel ihm nicht, und die Schwester, die von ihrem reichen Onkel wie ein eignes Kind gehalten wurde, hatte dem Bruder – um ihre persönliche Stellung besorgt – rundweg abgeschlagen, eine Zulage für ihn zu erbitten. Von selbst reichte des Onkels Generosität über das Geburtstags-und Weihnachtsgoldstück und gelegentliche Urlaubsreisen nach dem Familiengut in Oberfranken nicht hinaus, und so bestand des jungen Mannes Dasein in unaufhörlichen Verzichtleistungen. Er lebte nur seinem Beruf; sein Empfindungsleben schien durch die Arbeit völlig erstickt zu sein.
Um diese Zeit lernte er Ilse Golzow kennen, und alles was an Liebessehnsucht in seiner Seele gelebt hatte von klein auf, brach ungestüm hervor. Das Weib war ihm unbekannt geblieben bis dahin; die Arbeit hatte ihn taub und blind gemacht, und eine angeborene Reinheit der Gesinnung hatte ihn das Gemeine stets als gemein empfinden lassen. So vereinte sich in der ersten Liebe des Achtundzwanzigjährigen die volle phantastische Schwärmerei des Jünglings mit der tiefen Neigung des reifen Mannes. Die Erfüllung alles dessen, was er in seinen stillsten Stunden für sich an Glück erträumt hatte, erwartete er von dem Besitz dieses holden blonden Mädchens. Daß ihm dies Glück nicht kampflos in den Schoß fiel, erhöhte nur seinen Wert für ihn.
Um ihretwillen vertauschte er seine Studierstube mit dem Ballsaal; er entwickelte gesellige Talente, die bisher niemand in ihm vermutet hatte, er wurde das belebende Element aller großen und kleinen Feste. Auf dem Wege zwischen Königsberg und Pirgallen ritt er sein Pferd fast zuschanden, das er sich endlich als Regimentsadjutant halten konnte, und auf den Schnitzeljagden stellte er durch seine Reiterkunst sämtliche Kürassierleutnants in den Schatten. Ein instinktives Verständnis für die weibliche Natur lehrte ihn, daß Mädchen, wie die schöne Ilse, durch die Bewunderung, die man ihnen abnötigt, am sichersten zu gewinnen sind. Von dem Vater der Geliebten aber mußte er sich eine zweimalige Ablehnung gefallen lassen; erst als er zum drittenmal wiederkam und die Tränen Ilsens sich mit seinen Bitten vereinigten, während ihre Mutter alle Gründe der Liebe und der Vernunft zu seinen Gunsten zur Geltung brachte, hieß er ihn – mit aller Reserviertheit des Bezwungenen, nicht des Überzeugten – als Schwiegersohn willkommen.
An einem Maiensonntag des Jahres 1863 fand die Trauung des jungen Paares in der alten Pirgallener Dorfkirche statt. Als »Burg des Christengottes«, so erzählt die Sage, galt sie einst dem heidnischen Volk, und an eine Burg mehr als an eine Kirche erinnern noch heut die aus ungefügen Steinblöcken zusammengesetzten Mauern und der viereckige Turm mit den kleinen Fenstern, den dichter Efeu fast ganz überwuchert. Die dämmerige Halle verstärkte diesen Eindruck: vor dem Zeichen des Speeres, dem Wappenbilde der Golzows, verschwand fast das des Kreuzes, und statt der Bilder des Heilands und der Apostel reihte sich ein Grabstein neben dem andern an den Wänden, mit Ritterhelmen und Schwertern geschmückt, oder mit steinernen Bildnissen, die alle denselben Typus ostdeutschen Adels aufwiesen, ob ihr Antlitz mit den regelmäßigen, etwas leblosen Zügen und den hochmütig geschürzten Lippen nun unter dem Stechhelm oder der Allongeperücke hervorsah. Auf den Grabsteinen der Frauen erzählten die Doppelwappen, wie selten nur die ritterbürtige Ahnenreihe unterbrochen worden war. Und daß sie alle zu einem Geschlechte gehörten: diese stummen Zeugen der Hochzeit Ilsens und die vielen derer von Golzow, die sich in der alten Kirche zusammenfanden, – das bewiesen diese schlanken Menschen mit den schmalen Handgelenken und den langen spitzen Fingern, die an harte Arbeit nie gewöhnt gewesen waren. Nur daß die Kraft der Ahnen sich in lässige Grazie verwandelt und ihre rassige Vornehmheit einen leisen Schein müder Dekadenz angenommen hatte.
Auch des Bräutigams Verwandte waren vollzählig erschienen. Sie hatten sich die Teilnahme an dem Familienfest um so weniger entgehen lassen, als Hans Kleves Heirat die Mesallianz seines Vaters verschmerzen ließ. Von anderm Schlag waren sie als die Golzows: das Blut fahrender Landsknechte und alt-nürnberger Patrizier mischte sich in ihren Adern, und breit, groß und stämmig waren ihre Gestalten. Die Kniehosen und Wadenstrümpfe ihres bayerischen Berglandes ließen ihnen besser, als Frack und Zylinder, und seltsam stach vor allem des Bräutigams üppige rotblonde Schwester Klothilde ab gegen die zarte Elfengestalt seiner Braut.
Als Menschen eigner Art jedoch, nicht als bloße Glieder einer Familie, traten zwei Erscheinungen aus dem großen Kreise hervor: die Mütter des jungen Paares waren es. Das Leben hatte sie beide auf seine Höhen geführt und in seine Abgründe hineingerissen, sie waren von ihm gezeichnet; die eine, – das Königskind, das Kind der Liebe –, um deren hohe Gestalt das Samtgewand wie ein Krönungsmantel niederfloß, deren schwermütig-dunkle Augen Geist und Güte strahlten, – die andere – ein Kind des Volkes und der Arbeit-, die sich nicht zu Hause fühlte in dem schwarzen Seidenkleid, deren harte Hände von zähem Fleiße, deren durchfurchte Züge von eiserner Willenskraft sprachen, und in deren braunen Augen doch der kecke Humor noch lachte, der über alles Ungemach hinweghilft.
Königsberg, die Garnison meines Vaters als er heiratete, war mit dem raschen Golzowschen Gespann von Pirgallen aus in drei Stunden zu erreichen. Es war daher für die Tochter kein Abschied von zu Hause, der den Schmerz langer Trennung in sich birgt. Ja, sie blieb im Grunde daheim, denn im alten Stadthaus ihrer Eltern wurde dem jungen Paare die Wohnung eingerichtet.
Während es auf der Hochzeitsreise war, schmückte die Großmutter das künftige Nest ihrer Kinder. All ihren Geschmack, allihre Träume und Gedanken über die Schönheit, Harmonie und Behaglichkeit einer Familienwohnung verwirklichte sie hier. Da war der grüne Salon mit den tiefen englischen Lehnstühlen, dem geräumigen Sofa am breiten Fensterpfeiler, mit dem runden, von einer Tuchdecke bedeckten großen Tische davor, dem mächtigen roten Marmorkamin an der Längswand ihm gegenüber; daneben, nur durch Portieren getrennt, das helle Boudoir mit seinen kretonneüberzogenen Wänden und Möbeln, dem Schreibtisch voller Familienbilder, überragt von Thorwaldsens segnendem Christus; und auf der andern Seite des Vaters Zimmer mit seinen schweren geschnitzten Eichenmöbeln, in deren Arabesken das Wappentier der Kleves, die gekrönte Eule, sich vielfach wiederholte. Für das Speisezimmer hatte die Großmutter die alten Empiremöbel ihrer Mutter hergegeben: Mahagoni mit Bronzebeschlägen und gelbseidnen Sesselbezügen. Hier prangte auch eine Reihe alter Familienbilder an den Wänden: Frauen im Reifrock mit märchenhaft dünner Taille und gepuderten Haaren, Männer in goldstrotzender Uniform und mächtiger Lockenperücke, und mitten unter ihnen ein rosiges, lächelndes, goldlockiges Frauenköpfchen, das die Mutter in spätern Jahren immer in den dunkelsten Winkel zu hängen pflegte: Alix, die Urgroßmutter, das Königsliebchen.
Ein großes, helles Schlafzimmer, eine Fremdenstube und ein sorgfältig abgeschlossner, von der Großmutter streng behüteter Raum – als hätte Blaubart seine Frauen darin – vollendeten die Wohnung. In Ost und West, in Süd und Nord – wohin immer das Soldatenschicksal uns getrieben hat –, dieser Rahmen des Lebens ist sich stets gleich geblieben. Ein Gesellschaftszimmer, ein Tanzsaal kamen später wohl hinzu, sie haben mich aber immer wie etwas Fremdes angemutet. »Ihr habt keine Heimat,« pflegte die Großmutter zu sagen, »da müßt ihr sie als Ersatz, wie die Schnecke ihr Haus, mit euch tragen.«
Als die Eltern nach der Hochzeitsreise diese Räume, die geschaffen schienen, Liebe und Freude in sich zu schließen, betraten, war auf ihr Eheglück schon ein Reif gefallen. Ahnungslos, wie alle wohlgehüteten Mädchen ihrer Zeit und ihrer Lebenskreise, war Ilse in die Ehe getreten. Keusch wie sie war der Mann, dem sie sich vermählt hatte, aber um so gewaltiger war die Glut seiner Liebe und seines Begehrens, während ihre Sinne noch schliefen und das große, tiefe Geheimnis des Geschlechts sich ihr wie eine gräßliche Untat offenbarte. Sie hat mir oft erzählt, daß sie in den ersten acht Tagen ihres Zusammenlebens mit ihrem Mann am liebsten davongelaufen wäre, wenn sie sich nicht vor ihren Eltern geschämt hätte. Erst ganz allmählich kam ihr die Erkenntnis, daß ihr Gatte kein Verbrecher, ihr Schicksal kein abnormes war. Zu den seelischen Leiden, mit denen sie ihn, der so liebevoll, so zartfühlend und weichherzig war, wohl noch mehr quälte als sich selbst, kamen körperliche Beschwerden hinzu, deren Ursachen sie ebenso verständnislos gegenüberstand. Sie suchte sie mit der ihr eignen Energie zu beherrschen, um so mehr, als sie sich unter den ihr fremden Kleveschen Verwandten befand; sie teilte auch ihrer Mutter nichts davon mit, um die Überängstliche nicht unnötig, wie sie meinte, aufzuregen. Tapfer beteiligte sie sich an allen Ausflügen, allen ländlichen Festen; tanzte und ritt, obwohl es ihr oft vor den Augen dunkelte und der Schwindel sie zu übermannen drohte. So kehrte die junge Frau bleich und müde zurück, die, ein Bild blühender Gesundheit, das Elternhaus verlassen hatte. Der Schatten dieser ersten Schmerzen und Enttäuschungen fiel über ihr ganzes Leben.
Der Großmutter blutete das Herz, als sie ihr Kind wiedersah. Bald aber war sie beruhigt und zärtlicher Freude voll in dem Gedanken an das junge Leben, das sich im Schoße der Tochter entwickelte. Nur allzu früh sollte die Hoffnung, die von Ilse selbst nur qualvoll empfunden wurde, zerstört werden; und statt einer Wöchnerin pflegte die Großmutter eine schwerkranke junge Frau. Erst die würzige Herbstluft von Pirgallen heilte sie, und der Königsberger Karneval sah sie als eine der schönsten der Schönen im fröhlichen Kreise der Jugend wieder. Sie tanzte gern, sie sah sich gern von Bewunderern umgeben, und ihr Mann war überglücklich, wenn er sie heiter wußte.
Im zweiten Jahre ihrer Ehe stellten sich wieder Hoffnungen ein; mit hellem Jubel begrüßte sie Hans Kleve, mit tiefer Rührung die Großmutter; nur die, unter deren Herzen das neue Leben erwachte, spürte nichts von alledem. Die Fassung, mit der sie sich in ihr Schicksal ergab, das Vorgefühl ernster kommender Pflichten war das einzige, was sie ihm gegenüber aufbringen konnte.
Indessen richtete die Großmutter des Enkelkindes erstes Stübchen ein: Alles darin war weiß und rot, einfach und freundlich, nur das Sofa war mit braunem Rips bezogen und der Tisch davor mit braunem Wachstuch. Du gutes altes Sofa! Auf dir hab' ich die Glieder im ersten Lebensgefühl gestreckt, auf dir bin ich umhergeklettert, als ich die Beinchen regen konnte; in deinen Winkeln hab' ich mein Lieblingsspielzeug geheimnisvoll verwahrt, habe, tief in deine Polster geschmiegt, meine Märchenbücher verschlungen und meine ersten Träume auf dir geträumt!
Mitten in den Vorbereitungen zum Empfange des kleinen Erdenbürgers warf eine Lungenentzündung den alten Golzow aufs Krankenlager. Bei einer der häufig wiederkehrenden Überschwemmungen, die durch die wilden, alle Dämme durchreißenden Wogen des kurischen Haffs entstanden und die Wiesen stets auf Jahre hinaus wertlos machten, hatte er stundenlang, bis an die Knie im Wasser, mit den Knechten um die Wette die Löcher der Dämme zu verstopfen gesucht und sich dabei eine Erkältung zugezogen. Auf die Nachricht seiner Erkrankung siedelte Ilse, die ihrem Vater besonders nahe stand, nach Pirgallen über. Noch wochenlang sah sie dem wilden Kampf des starken Mannes gegen den Allüberwinder zu, der ihn schließlich sanft in seine Arme nahm.
Ein Maiensonntag war es abermals, als der Gutsherr mit all dem Pomp, der die Sprossen eines der ältesten Geschlechter des Landes von jeher zu Grabe leitete, in die Gruft seiner Vorfahren gesenkt wurde. Vollzählig war wieder die Familie versammelt, vollzählig war auch das Offizierkorps des Königsberger Kürassierregiments zugegen, dem Walter, der älteste Sohn des Verstorbenen, angehörte, und seine Trompeter bliesen die Trauerchoräle. In langem Zuge folgten die Knechte und die Instleute dem Sarge, den der greise Förster, des Toten Lebensgefährte, mit seinen Jägern trug. Ehrliche Trauer blickte aus den Zügen aller der wettergebräunten Männer der Arbeit. Werner Golzow war ihnen ein guter Herr gewesen. Sie hatten nie seine Faust und nie seine Peitsche gespürt wie ihre Kollegen ringsum auf den Nachbargütern, und sie fürchteten sich vor dem Junker, seinem Erben. Sein junges hübsches Gesicht war hart und hochmütig, auf die unbeholfenen, teilnehmenden Worte der Diener seines Vaters antwortete er nur mit einem leichten Neigen des Kopfes, die Hand, die sie, der alten preußischen Sitte gemäß, küssen wollten, zog er ungeduldig zurück. Als die Gutsleute nach der Beisetzung in der großen Halle des Herrenhauses von der Großmutter empfangen wurden, spürten sie doppelt ihre Güte, die nichts Herablassendes hatte, die den Untergebenen niemals den Abstand zwischen Herrn und Diener fühlen ließ. Und einer nach dem andern richtete die angstvolle Frage an sie: Unsere Frau Baronin wird uns doch nicht verlassen? Sie schüttelte nur wehmütig lächelnd den Kopf dazu, und halb und halb beruhigt ging alles auseinander.
Sechs Wochen später wurde ich geboren. Es war ein glühheißer Junisonntag; in voller Pracht blühten die Rosen, und in der alten dunklen Gespensterallee, wo die »böse Frau von Pirgallen« nächtlicherweise mit dem Kopf unter dem Arme umging, dufteten berauschend die Linden. Das Geläut der Glocken begleitete gerade die heimkehrenden Kirchgänger, als ich zur Welt kam. Ich konnte das Leben nicht erwarten, denn den Weg hinein fand ich ohne Hilfe, – die weise Frau kam erst, als die Großmutter mich schon in den Armen hielt und dem Vater beim Anblick seines Kindes große Tränen der Rührung über die Wangen liefen.
In der alten Kirche, über der Gruft der Golzows und unter ihren Speeren, wurde ich getauft. Die Gutskinder hatten den düstern Raum in eine Laube von Jasmin verwandelt, – darum hab' ich wohl mein Lebtag keinen Blumenduft so geliebt wie den dieser weißen Sterne. Selbst im geweihten Wasser des Taufsteins schwammen ihre Blätter, und als der greise Pfarrer es mir auf die Stirn träufelte, blieb eins davon auf meinem dunkeln Köpfchen haften. »Und wenn ich mit Menschen- und Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, ich wäre ein tönend Erz und eine klingende Schelle« – lautete der Text der Taufpredigt und Alix der Name, der mir gegeben wurde. Beides hatte die Großmutter gewählt; den Namen hatte sie gegen den Widerstand der Tochter für ihr erstes Enkelkind durchgesetzt – den Namen ihrer Mutter, die sie um so inniger geliebt, je mehr die Welt sie verdammt hatte.
Ich blieb in Pirgallen. Vergebens hatte man versucht, mich an die Brust meiner Mutter zu legen. War es ihre innere Abneigung, die sie nur im Gefühl, eine Pflicht erfüllen zu müssen, überwinden wollte, war es mein früh erwachter Eigensinn – kurz, Mutter und Kind schienen nichts voneinander wissen zu wollen, und eine derbe Fischerfrau, die mich mit ihrem Söhnchen zusammen nährte, wurde meine Amme. Behütet von ihr und der Großmutter, der das schwarzhaarige, dunkeläugige Baby so ähnlich sah, verbrachte ich auch den Winter bei ihr; seufzend hatte es mein Vater zugegeben, da er sah, daß ich hier besser aufgehoben war als in Königsberg, wo die Freuden der Geselligkeit meiner Mutter ganze Zeit in Anspruch nahmen. Oft aber packte ihn die Sehnsucht so sehr, daß er Sturm und Wetter nicht scheute und, wie einst zu der Geliebten, zu der Braut, nun zu dem Töchterlein hinausritt, um es zu küssen, und in den Armen zu schaukeln. Die Großmutter hat immer dabei weinen müssen, erzählte mir die Amme später. Lange wußte ich nicht, warum.
Dann kam der Krieg, der böse deutsche Bruderkrieg. Mein Vater wurde Kompagnieführer in einem jener Regimenter, die durch die mörderischen Kämpfe in Böhmen fast völlig aufgerieben wurden. In den Wäldern um Königgrätz warf ihn eine Kugel zu Boden. Wären nicht ein paar seiner treuen Grenadiere, die ihn wie einen Vater liebten, der eignen Erschöpfung nicht achtend, noch spät des Nachts ausgezogen, um, wie sie meinten, die Leiche ihres Hauptmanns zu suchen, er wäre elend verblutet. Puckchens, unseres Affenpinschers, klägliches Winseln führte sie auf die Spur des Verwundeten. Sobald er transportfähig war, brachte man ihn nach Königsberg. Die Mutter, sonst eine so starke Frau, brach zusammen beim Anblick des entkräfteten, vollkommen entstellten Mannes. Er war es, der sie lächelnd trösten mußte.
Viele, viele Wochen lag er auf dem Krankenlager, das ihm in seinem Wohnzimmer errichtet worden war. Je mehr seine Genesung vorschritt, desto eifriger beschäftigte er sich mit mir. Ich habe nie einen Mann gesehen, der wie er mit kleinen Kindern spielen konnte.
Meine erste traumhafte Erinnerung – ich bin immer ausgelacht worden, wenn ich von ihr erzählte, da ich doch damals noch nicht zwei Jahre alt war – führt mich in einen dunkel verhängten Raum vor ein großes braunes Bett, aus dem mir ein blasser Mann die Arme entgegenstreckte. Ich weiß, daß ich laut aufschrie, daß der Mann den Kopf müde zurücklegte und ich mich aufatmend in meinem hellen Stübchen wiederfand. Und später sah ich ihn im Rollstuhl wieder und mich auf seinem Schoß mit seiner großen, dicken Uhr spielend, die, weil sie mit so zärtlichem, feinem Stimmchen alle Viertelstunden schlug, für mich immer etwas Lebendiges gewesen ist. Wende ich ein andres Blatt der Erinnerung um, so sehe ich große rote Blumenkerzen in mein Fenster hereinleuchten. Das war in Potsdam, wohin mein Vater nach dem Feldzug versetzt wurde, und wo wir in einem gartenumsäumten Haus, vor dem ein alter Kastanienbaum Wache hielt, das erste Stockwerk bezogen. Neben uns, nur durch den Gartenzaun getrennt, wohnte meiner Mutter zweiter Bruder Max, der bei den Gardehusaren Leutnant war und eine elsässische Cousine geheiratet hatte. Werner, ihr Sohn, war nur um wenige Monate jünger als ich. Unter uns aber, in die Parterrewohnung mit der großen Terrasse, auf deren Balustrade kleine Steinengelchen saßen, die in meinen Träumen immer lebendig wurden, zog, kaum ein Jahr nach unsrer Übersiedlung, die Großmutter ein.
Walter Golzow hatte nach dem Kriege den bunten Rock mit dem schönen himmelblauen Kragen ausgezogen und das Gut übernommen, dessen Geschäfte die Großmutter bis dahin mit Hilfe des erprobten Verwalters gewissenhaft und in der alten Weise geleitet hatte. Sie versuchte dann noch eine Zeitlang, neben dem Sohn zu wirken und zu arbeiten, wie sie es früher gewohnt gewesen war. Aber zu hart stießen die Gegensätze aneinander: in ihrer Milde sah Walter Schwäche, in ihrer Wohltätigkeit Verschwendung. Es kam auch tatsächlich zuweilen vor, daß ihre Güte mißbraucht wurde, daß man die allzeit Hilfsbereite, die an jedem Menschen etwas Gutes sah oder herauszulocken verstand, hinterging und betrog. Das nahm ihr Sohn zum Vorwand, ihrem barmherzigen Wirken mehr und mehr Hindernisse in den Weg zu legen. Doch dies alles hätte sie nicht so schwer getroffen, da sie als Herrin ihres Vermögens damit machen konnte, was ihr gut schien; unerträglich wurde ihr die Existenz vielmehr erst durch die fast fieberhafte Neuerungssucht Walters: nichts in der Wirtschaft und im Hause schien ihm mehr gut genug, und Umwandlungen und Neuanschaffungen, die ein vorsichtiger, auf alle Möglichkeiten schlechter Jahre vorbereiteter Gutsherr auf einen langen Zeitraum verteilt, sollten jetzt in wenigen Monden vor sich gehen. Die Großmutter sorgte, warnte, bat, – sie predigte tauben Ohren. Die Ställe füllten sich mit Luxuspferden, die Wirtschaftsräume mit neuen Maschinen aller Art, deren Handhabung selten einer verstand, das Herrenhaus mit modernen Möbeln, vor deren geschmacklosem Prunk der alte, solide Hausrat aus Urväter Tagen weichen mußte. Es kam zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen Mutter und Sohn, die ihren Höhepunkt erreichten, als sie sah, wie er auf die Wange eines ungeschickten Reitknechts die Peitsche niedersausen ließ, so daß der junge Mensch blutend zu Boden sank. Wenige Tage darauf entführte der alte breite Kutschwagen mit den wohlgenährten Braunen davor die Großmutter von der Stätte ihrer jahrzehntelangen Wirksamkeit, von dem erinnerungsreichen Boden ihrer zweiten Heimat. Sie sah sich nicht um, und sie weinte nicht; zu tief empfand sie das schwerste Geschick, das ein Weib treffen kann: fremde Kinder zu haben.
Ich war vier Jahre, als die Großmutter nach Potsdam kam. Ein Ölbild von Tochter und Enkelin, das damals für sie gemalt worden war, zeigt, daß auch ich meiner Mutter solch ein fremdes Kind gewesen bin: von ihrer lichten Erscheinung mit dem hellblonden Haar, der durchsichtigen Haut, den meerblauen Augen sticht das kleine Mädchen seltsam ab, um dessen schmales, gelbliches Antlitz dunkle schwere Locken sich ringeln, dessen schwarze Augen fragend und verträumt ins Weite sehen. Von klein an bewunderte ich neidvoll meiner Mutter nordische Schönheit, und wenn meine Freunde mir Tränen des Zorns entlocken wollten, brauchten sie mich nur »schwarze Alix« zu rufen; sie waren selbst alle blond, und schon bei den Unmündigen wirkt die Majorität überzeugend. Die Anführer bei solchen Späßen, die mir den Umgang mit meinesgleichen früh verleideten, waren meist mein Vetter Werner und Adda, das Töchterchen eines der Regimentskameraden meines Vaters. Mit jener Grausamkeit, die nur den kleinen Menschentieren eigen ist, rächten sie sich durch ihre Neckereien an meiner Besonderheit. Einig waren wir drei eigentlich nur, wenn es galt, unseren französischen Bonnen einen Schabernack zu spielen. Wir konnten sie alle nicht leiden und empfanden sie nur als notwendiges Übel, unter dem wir gemeinsam zu leiden hatten.
An jedem schönen Morgen führten sie uns in den Park von Sanssouci; kein Wort Deutsch durften wir sprechen, und artig mußten wir nebeneinander gehen. Wenn die drei Fräuleins aber erst häkelnd auf einer der Bänke saßen und die Lebhaftigkeit ihres Gesprächs einen gewissen Höhepunkt erreicht hatte, benutzten wir schleunigst die Gelegenheit, aus ihrem Gesichtskreis zu verschwinden, und dann war ich die Anführerin. Wo die Büsche am dichtesten waren, versteckten wir uns und spielten im grünen Dämmerlicht phantastische Märchen. Meine blühende Phantasie steckte die beiden andern an: unter halbverwitterten steinernen Göttern gruben sie eifrig nach den Schätzen, von denen ich ganz genau zu erzählen wußte, oder sie umschlichen geduldig immer wieder des alten Fritzen Schloß oben auf den Blumenterrassen, die Ritter und die Feen mit Herzklopfen erwartend, die ich schon »soo« oft gesehen hatte. Wenn freilich durchaus nichts von dem Erwarteten sich zeigen wollte, mußte ich's bitter büßen, und wenn wir unsrer schmutzigen Hände und zerdrückten Kleider wegen von unsern drei Gestrengen gescholten wurden, war allemal ich die Hauptschuldige. Allmählich gewöhnte sich mein robuster und prosaischer kleiner Vetter daran, den lebhaften Ausbrüchen meiner Einbildungskraft mit einem verächtlichen »zu dumm« zu begegnen, was mich bis zu Tränen kränkte und mehr und mehr verstummen ließ. Spielte ich dann artig mit Ball und Reifen, ohne in die Büsche zu kriechen, dann lobte mich Mademoiselle: »Comme elle devient raisonnable!« sagte sie.
Noch stand ich nicht fest auf dieser Staffel der guten Erziehung, als mir ein schwerer Kummer widerfuhr. In unserm Garten, in dem wir nachmittags zu spielen pflegten, lagen auf den Wegen viele bunte Kieselsteine. In einem Winkel, unter einem Jasminstrauch – zu den weißen Blüten trug ich immer meine tiefsten Geheimnisse – sammelte ich die schönsten, die ich finden konnte. Ich war fest überzeugt, daß sie in ihrem Innern goldne Wagen mit weißen Pferdchen davor, blitzende Königskronen und schimmernde Schlösser bargen, und versuchte, sie mit einem Hammer aufzuschlagen. Schließlich kamen Werner und Adda hinter mein Geheimnis; mein Vetter, den meine glühende Begeisterung für die zu erwartenden Herrlichkeiten anstecken mochte, bemühte sich auch seinerseits, die Kiesel zu öffnen, und es gelang. »Bist du dumm,« rief er ärgerlich, als er die grauen Splitter in der Hand hielt, »es sind ja nur ganz gewöhnliche Steine!«
Noch oft hab' ich später hinter dem Leblosen wundervolle Offenbarungen vermutet und im Schweiße meines Angesichts versucht, zu ihnen vorzudringen, aber die Enttäuschung hat mich kaum je so heftig geschmerzt und bis zu so wilder Verzweiflung getrieben, wie damals, wo ich, ein fünfjähriges Kind, weinend vor den zerschlagenen Kieseln saß.
Wenn die andern mich verhöhnten, wenn der Schmerz mich übermannte und sie nicht verstanden, warum, dann blieb mir ein Zufluchtsort und ein Mensch, der immer die rechten Worte des Trostes fand: Großmama. Wie oft flüchtete ich in ihr stilles Reich, wo sie zwischen blühenden Blumen und dunkeln Palmen lesend, schreibend oder still vor sich hinträumend in ihrem tiefen, grünen Lehnstuhl saß. Sie hatte immer Zeit für mich, sie lachte mich niemals aus und antwortete nie auf meine tausend Fragen mit jenem ein weiches Kindergemüt so verletzenden: »Das verstehst du nicht.« Und wenn sich mir Park und Garten, Wasser und Wald mit tausend Gestalten bevölkerten, wenn die allabendlich in buntem Reigen um mein Bettchen tanzten, so wußte ich: Großmama sah sie, wie ich; nur die andern hatten keine Augen dafür. War ich allein bei ihr, so erschienen mir ihre Zimmer wie ein einzig Märchenreich: zwischen den Palmen lächelte der schöne weiße Jünglingskopf ihres Vaters mir entgegen – halb ein Cäsar, halb ein Antinous –; –; von den Wänden sahen Männer und Frauen mich an, mir vertraut seit meinem ersten Augenaufschlag, wenn auch fremd nach Art und Gewandung, und unter einem von ihnen, auf kleinem Postament, stand Winter und Sommer ein frischer Blumenstrauß. Das war der Dichter, zu dessen Füßen die Großmutter gesessen hatte, als sie ein Kind, ein junges Mädchen gewesen war, der die Geschichte vom Heideröslein gedichtet hatte, die erste, die ich wiedererzählen konnte, und bei deren Schluß mir immer die Stimme brach: ... »Doch es half kein Weh und Ach, mußt es eben leiden!«
Auf dem Fußbänkchen neben Großmama, den Kopf vergraben in den weichen Falten ihres Sammetkleids, die Augen auf die tanzenden und zuckenden Flammen des Kaminfeuers gerichtet, während ihre leise Stimme über mir klang, von Schneewittchen und Dornröschen erzählend oder von der kleinen Seejungfrau, die dem Prinzen zuliebe unter tausend Schmerzen zum Menschen wurde und dann doch wieder hinabsteigen mußte in die Fluten, – das waren die schönsten Stunden meiner frühen Kinderjahre. Und das alles waren Erlebnisse für mich, viel bedeutungsvollere, als die Ereignisse des öffentlichen Lebens, deren Kunde an mein Ohr schlug. So weiß ich vom deutschfranzösischen Kriege, obwohl ich ihn als fast Sechsjährige erlebte, nicht allzuviel. Ich sehe mich zwar Scharpie zupfend am Fenster sitzen oder mein Frühstücksbrötchen mitleidig für die armen Soldaten in die Kiste legen, die die Mutter allwöchentlich zu packen pflegte; ich erinnere mich, daß ich mit Hurra schrie bei jeder Siegesnachricht und die Illuminationskerzen nach dem Fall von Sedan mit in die sandgefüllten Gläser steckte. Ich weiß auch, daß mir das bunte Schauspiel des Einzugs der Sieger in Berlin, dem ich in einem neuen blauseidnen Kleidchen mit meiner Mutter von irgendeinem Lindenhotel aus beiwohnte, sehr gefiel, und daß mein Lorbeerkranz statt auf die Lanze eines Kriegers auf den aufgespannten Schirm irgendeiner biedern Berliner Bürgerfrau niederfiel; aber von hochgeschwellter patriotischer Begeisterung weiß ich nichts. Vielleicht, daß die gedrückte Stimmung zu Haus mich beeinflußt hatte, denn hier kam eine reine Siegesfreude nicht auf. Nicht nur weil Söhne und Gatten allen Wechselfällen des Krieges ausgesetzt waren, sondern auch weil nahe, liebe Verwandte der Großmutter im französischen Heere dienten. Neffen von ihr kamen als Gefangene nach Potsdam; der alte Bruder ihrer Mutter, der sich als Jüngling unter Napoleon I. die Sporen verdient hatte, kämpfte jetzt mit derselben glühenden Vaterlandsliebe unter seinem Nachfolger. Von dem Franzosenhaß, der den deutschen Kindern späterer Zeit eingeprägt wurde, wußten wir infolgedessen nichts. Ich glaube, jener Hurrapatriotismus, der sich heute breit macht, gedeiht nur in Friedenszeiten. Wer dem Kriege Aug' in Auge sieht, dessen Vaterlandsliebe wird vielleicht nicht weniger tief, wohl aber ernster und stiller sein. Erst wenn die großen Kämpfe der Völker lange vorüber sind, werden sie zu Mitteln, die Begeisterung auch der Kinder anzufachen. So kam es wohl, daß meine Phantasie von dem, was vor sich ging, ebenso unberührt blieb wie mein Gemüt. Nur der Heimkehr meines Vaters sah ich voll jubelnder Freude entgegen.
Er brachte uns allen Geschenke aus Frankreich mit, die er mit Sorgfalt und in der freudigen Aussicht auf die glücklichen Gesichter der Empfänger ausgewählt und wofür er wohl auch viel Geld ausgegeben hatte. Über all das schöne Spielzeug, das ich erhielt, war mein Jubel ohne Grenzen, und ein zierliches goldnes Kettlein, das mich noch mehr entzückte, schlang ich mir grade vor dem Spiegel um den Kopf, so daß die Perle, die wie ein Tautropfen daran hing, just unter dem Scheitel auf die Stirne fiel, – meine schwarzen Locken erschienen mir plötzlich gar nicht mehr so häßlich –, als das Antlitz meiner Mutter hinter mir auftauchte. Angstvoll erstaunt wandte ich mich um; Seiden- und Samtstoffe lagen vor ihr ausgebreitet, mit zärtlich-fragenden Augen sah der Vater sie an, und sie – sie freute sich nicht! Worte des Vorwurfs über die »unnützen Ausgaben« war das erste, was ich sie sagen hörte, und mit ungewohnt heftiger Gebärde nahm sie mir die Kette aus den Haaren, die nun – ich wußte das nur zu gut – in der unergründlichen Tiefe des Silberschranks verschwinden würde, wie so manche der schönsten Dinge, bis »Alix groß sein wird«. Dann dankte sie dem Vater mit einer kühlen Phrase, aus der ich das Erzwungene mit dem feinen Gefühl des Kinderherzens herausempfand. Über unsre Festtagsfreude hatte sich ein dunkler Schatten gelegt. Papa ging verstimmt hinaus, ich spielte verschüchtert in einem möglichst versteckten Winkel. Freude ist eine der sensitivsten Pflanzen, die es gibt, das hab' ich damals unbewußt zum erstenmal empfunden: wenn sie in vollster Blüte steht, genügt ein kalter Lufthauch, sie zu töten. Sie will gehütet sein und gepflegt, und nur ihr natürliches Welken ist schmerzlos.
Verschleiert blieb von da an die Stimmung; um Liebe werbend, dankbar für jeden wärmeren Blick, bemühte sich mein Vater um seine schöne kühle Frau. Wie oft nahm er mich auf den Schoß, legte mein Bäckchen an seine Wange und herzte und streichelte mich, während seine Augen ihr folgten, die im Zimmer umherging, jedem Staubfäserchen nach, das etwa von einem Möbelstück nicht entfernt worden war.
Bald hieß es, die Mutter sei krank und brauche längere Zeit der Erholung. Große Koffer wurden gepackt, und wir reisten – Großmama, Mama und ich, meine Mademoiselle und die Jungfer – nach der Schweiz. Wie schnell war da der arme, einsame Papa vergessen! Wundervolle Bilder von weißleuchtenden Gletschern, blauen Seen, brausenden Wasserstürzen und schauerlichen Abgründen zogen an mir vorüber. Nirgends war mir meine Bonne mit ihrem ewigen: Tiens-toi droite – necours pas si vite – sois raisonnable! so widerwärtig vorgekommen wie hier. Ins Moos sich werfen mit ausgebreiteten Armen, laufen und springen, wie von Flügeln getragen, und über Stock und Stein aufwärts klettern, höher, immer höher, bis zu den silbernen Häuptern der Berge mitten in den Himmel hinein – ach, wer das könnte! Eines Tages hielt es mich nicht länger. Irgendwo am Vierwaldstätter See war's, wo ich davonlief, gedankenlos, ziellos, nur erfüllt von dem Wonnegefühl der ungebundenen Kraft. Erst als es anfing zu dunkeln, kam ich zum Bewußtsein meiner Verwegenheit. Da plötzlich geschah etwas so Wundersames, daß ich alles vergaß: die weißen Berge bekamen rotglühendes Leben. – Männergeschrei und ängstliches Rufen schreckten mich auf aus der Verzauberung; vom Hotel aus suchte man die Ausreißerin. Stumm kehrte ich heim, unempfindlich blieb ich für alle Vorwürfe, die mich sonst so bitter trafen; das Erlebte hatte jede andre Empfindung in mir ausgelöscht. Nur der Großmutter vertraute ich flüsternd das große Geheimnis an: wie die Bergriesen vor mir lebendig geworden waren.
Im Herbst desselben Jahres kehrte Großmama nach Potsdam zurück, Mama und ich aber reisten nach Augsburg zu meines Vaters Schwester Klothilde. Sie hatte sich mit Baron Artern, dem jüngeren Bruder ihrer Tante Kleve, bei der sie erzogen worden war, vermählt gehabt und war nach kurzem, strahlendem Glück Witwe geworden. Monatelang schien es, als ob ihr sehnsüchtiger Wunsch, dem Toten zu folgen, erfüllt werden würde, und es war mein Vater, der ihr in dieser Zeit mit der ganzen hingebungsvollen Liebe und zarten Rücksicht, deren er fähig war, zur Seite gestanden und sie dem Leben zurückgewonnen hatte. Er war es wohl auch gewesen, der ihr den Gedanken nahelegte, uns zu sich einzuladen. Es gibt kaum eine heilendere Kraft für alle Lebenswunden als die weichen Hände, die klaren Augen und das helle Lachen eines Kindes, – ihr war sie versagt geblieben; in mir, so hoffte mein Vater, sollte sie sie finden,
An einem trüben Oktoberabend kamen wir in Augsburg an. In Trauerlivree empfing uns der Diener am Bahnhof, dunkel war die Equipage, dunkel waren die engen winkligen Straßen, und grau, wie leblos, starrten die alten Häuser mir entgegen. In einen hallenden Torweg, den nur eine unruhig flackernde Lampe spärlich erhellte, bog der Wagen, und vor einer breiten, teppichbelegten Treppe mit kunstvollem, schmiedeeisernem Geländer stiegen wir aus. Eine alte Dienerin mit großem Schlüsselbund über der schwarzseidenen Schürze begrüßte uns zuerst; oben, wie eine Fürstin, wartete des Hauses Herrin auf uns. Der Kreppschleier verhüllte sie fast ganz, nur das weiße Gesicht und die roten Haare leuchteten daraus hervor. Weinend umarmte sie ihre Gäste, und erschüttert von dem Eindruck der neuen Umgebung weinte ich mit ihr. »Du gutes Kind,« sagte sie und küßte mich zärtlich; ich hatte ihr Herz gewonnen.
Ein seltsames Leben begann für mich in dem grauen Hause mit seinen langen, düstern Gängen, an deren Wänden ein dunkles Bild neben dem andern hing, mit seinen mächtigen schwarzbraunen Schränken und den tiefen, tiefen Teppichen, über die der Fuß unhörbar hinglitt. Die Türen waren mit Fries eingefaßt, um jedes Geräusch zu vermeiden, und die Klingeln hatten einen dunkeln Ton. Meine Tante vertrug nicht den geringsten Lärm. Man hatte mir das streng eingeschärft, aber ich wäre hier auch ohnedies ganz still gewesen. Nur im Stübchen bei der alten Kathrin, der Wirtschafterin, die mich schnell in ihr Herz schloß, durfte ich lachen und toben, und draußen bei allen den vielen Verwandten und Freunden fühlte ich mich aus dem Traumreich in die Welt zurückversetzt. Die erste Mädcheneitelkeit ist damals von ihnen in mir großgezogen worden. Sie umgaben mich förmlich mit der wohligen weichen Treibhausluft der Bewunderung; und wenn meine Mutter auch, sobald wir allein waren, Worte wie Hagelschauer und Gewitterregen abkühlend herniederbrausen ließ, so sah ich darin doch nichts weiter, als daß sie mir die Freude eben wieder einmal nicht gönnen wolle. Hatte ich mich früher, weil ich anders war, zurückgesetzt gefühlt, war ich mir im Vergleich zu meinen helläugigen Gespielen häßlich vorgekommen, so wurde ich allmählich meiner Besonderheit als eines Vorzugs bewußt.
In meinem Zimmer, das ich allein bewohnte – Mademoiselle war auf Urlaub bei ihren Eltern in der Schweiz geblieben –, stand ein verschlossener Schrank. Ich studierte durch die Glastüren die Titel auf den Rücken der Bücher, soweit das meine ziemlich unzureichende Kenntnis der deutschen Buchstaben zuließ; französisch war mir bisher allein geläufig geworden. Auf einer Reihe großer Quartbände wiederholten sich immer dieselben Worte: »Die Geschichten aus tausend und einer Nacht.« »Tausend und eine Nacht« – hieß nicht so das Buch mit den bunten Bildern, aus dem mir Großmama Aladins seltsame Abenteuer vorgelesen hatte? Niemand erzählte mir Märchen in Augsburg, die alte Kathrin wußte nur immer dieselben Gespenstergeschichten, – ach, wenn ich doch selber lesen könnte! Heimlich versuchte ich, mit allen Schlüsseln, die mir erreichbar waren, den Schrank zu öffnen, um zu den Schätzen zu gelangen, die er barg. Endlich, endlich sprang er auf. Wie gut, daß ich Halsweh hatte und Tante und Mama allein spazieren gefahren waren! Mit klopfendem Herzen nahm ich einen Band nach dem andern heraus – ich sehe noch ihr gebräuntes Leder vor mir und ihr gelbes, stockfleckiges Papier! – und betrachtete die vielen Bilder darin: Geister und Ungeheuer, Männer auf sich bäumenden Rossen mit krummen Säbeln und hohem Turban und wunder-, wunderschöne Frauen. Von nun an hatte ich häufig »Halsschmerzen« und ließ mir mit rührender Geduld Einreibungen und Umschläge gefallen, trug auch klaglos das rote Flanellläppchen, das ich sonst nicht rasch genug hatte abreißen können. Sobald ich allein war, vertiefte ich mich in die Bücher. Es waren unverkürzte Übersetzungen des herrlichen Märchenschatzes; ich lernte lesen darin; der ganze Farbenreichtum, die ganze Glut des Orients umgaben mich wie mit einem Zaubermantel. Wie oft, wenn ich mit glühenden Wangen und heißen Augen den Heimkehrenden entgegentrat, wurde mir das Fieberthermometer besorgt unter den Arm gesteckt. Aber ich hatte kein Fieber, – ich hatte ja auch nur mit den Ausschneidepuppen gespielt, die in buntem Durcheinander auf meinem Tische lagen!
Warum ich mein Geheimnis verschwieg? Nicht nur, weil die Mutter ganz gewiß die Bücher verschlossen hätte, sondern weit mehr noch, weil alles, was mich am tiefsten ergriff, auch am tiefsten verhüllt bleiben mußte. Es erschien mir entweiht, seines Wertes beraubt, wenn andre es sahen, besprachen, betasteten. Großmama allein hätte ich davon erzählen können. Niemand merkte das Geheimnis, in dem ich lebte, niemand ahnte, daß ich in den dunkeln Gängen und tiefen Nischen alle Spukgestalten meiner Bücher leibhaftig vor mir sah, daß sie mir aus den Bildern an den Wänden entgegentraten, daß ich eine seltsam schwüle, schwere Luft durstig einatmete.
Seit meiner ersten Kinderzeit hatte ich die Gewohnheit, mir abends im Bett Geschichten zu erzählen; das waren meine köstlichsten Stunden! Da störte mich nie die rauhe Hand der Wirklichkeit, da lachte mich keiner aus. Von nun an wurden meine Phantasien wilder, so daß ich mich oft vor ihnen fürchtete und zitternd unter die Bettdecke kroch. Häufig genug wartete ich mit fieberhafter Erregung auf den Schritt der Mutter im Nebenzimmer, aber zu rufen wagte ich nicht, nachdem sie mich einmal meiner »dummen Aufregung« wegen arg gescholten hatte.
Inzwischen war mein Vater nach Karlsruhe versetzt worden. Er und die Großmutter besorgten den Umzug, suchten die Wohnung und richteten sie ein. Beide erwarteten uns, als wir nach einer beinahe halbjährigen Abwesenheit endlich heimwärts reisten. Mir war der Abschied von Augsburg sehr schwer geworden, denn mochte ich mir noch so sehr den Kopf zerbrechen – meine lieben Bücher heimlich mitzunehmen, gelang mir nicht. Papa und Großmama erschraken, als sie mich wiedersahen. »So blaß ist mein Alixchen,« sagte sie. »So dunkle Ränder hat sie um die Augen«, fügte er hinzu. Als ich zuerst sein Zimmer betrat, einen langen Raum mit einem einzigen breiten Fenster, sah ich eine durchsichtige, weiße Gestalt mit gesenktem Haupt an mir vorüberschweben. Ich schrie auf und erzählte nach vielem Zureden, was mir begegnet war; schon wollte die Mutter auffahren, und der Vater murmelte etwas von »dem Unsinn, den man dem armen Kinde beigebracht hat«, als die Großmutter mich still beiseite nahm und lange und liebreich auf mich einsprach. Was sie sagte, weiß ich nicht mehr, aber es löste mir Herz und Zunge. »Ach, bleib doch bei mir, Großmama!« rief ich, während die Angst sich in Tränen löste. Andre jedoch bedurften ihrer noch mehr als ich; ihr jüngster Sohn, Max, zog sie an sein Krankenlager, und ich war wieder allein.
Es war tiefer Winter damals. Trübselig und neidvoll sah ich oft durch die geschlossenen Fenster auf den Platz, wo die Kinder tobten, Schneeball warfen und Schneemänner bauten. Ich durfte nur selten hinaus. Von klein an war ich Halsentzündungen ausgesetzt gewesen, und meine Mutter ließ mich, ebenso pflichttreu wie gedankenlos, bei kaltem Wetter nur ins Freie, wenn es völlig windstill war. Aber auch dann wurde ich dick verpackt und durfte nicht laufen wie die andern. Das ließ mich noch mehr vereinsamen. Mir ist, als hätte ich die Winter stets verschlafen, so wenig weiß ich von ihnen. Vom Frühling aber und vom Sommer weiß ich um so mehr. Wir hatten einen großen Garten hinter dem Hause mit alten Bäumen, blühenden Büschen und bunten Blumen. Hier war mein Reich. Hier durfte ich ungestört umherspringen, mir Höhlen bauen, die zu unterirdischen Schätzen führten, auf der Schaukel bis zu den Wolken fliegen, die im Grunde gar keine Wolken, sondern Drachen und Zaubervögel waren. Hier konnte ich mit meinen Bällen, die alle Märchennamen trugen, geheimnisvolle Zwiesprach halten, so daß die Nachbarn oft meinten, ich hätte Scharen von Gespielen im Garten. Puck, unser alter Pinscher, dem zwei Feldzüge schon die Haare gebleicht hatten, mußte sich hier zu jugendlichen Sprüngen bequemen, war er doch das Flügelpferd, das mich ins Zauberland tragen sollte.
Ich war den größten Teil des Tages mir selbst überlassen. Mademoiselle war froh, wenn sie den Mund nicht aufzutun brauchte und mit ihrer unendlichen Häkelei friedfertig auf dem Sofa sitzen konnte. Papa war den ganzen Vormittag auf dem Bureau des Generalkommandos tätig, nachmittags ritt er mit Mama spazieren und arbeitete dann allein bis zum Abend. Mama hatte immer schrecklich viele Besuche zu machen und zu empfangen; und was beiden an freier Zeit etwa noch übrig blieb, das verschlang die große, zu jeder Jahreszeit äußerst lebendige Geselligkeit. Nur vormittags zwischen ein und zwei Uhr pflegte meine Mutter mich bei schönem Wetter zum Spaziergang mitzunehmen. Mit dem Reifen, meinem unzertrennlichen Gefährten, lief ich voraus durch eine jener menschenleeren, langen, graden Straßen, die in Fächerform sämtlich am Schloßplatz münden, und trieb mein Spiel durch die stillen Laubengänge des Parks, bis es Zeit war, Papa vom Bureau abzuholen. Pünktlich, wenn wir vor dem Hause standen, schloß der Kommandierende, General von Werder, der Sieger von Wörth, die Vormittagsarbeit und kam mit Papa hinaus, um uns heimzubegleiten, denn er mochte alle schönen Frauen gern, meine Mutter insbesondere. Ich sehe ihn noch, den kleinen Mann, mit den Händen auf dem Rücken und den blitzenden Augen in dem scharf geschnittenen Gesicht, wie er neben uns herging, immer zu einem derben Scherz bereit und stets einen Leckerbissen für mich in der Tasche.
Mein Reifen ruhte auf dem Heimweg, denn dann hatte der Vater mich an der Hand, und des Fragens und Erzählens war kein Ende. Wenn er für meine Phantasien auch nur wenig Verständnis hatte und ich mich hütete, sie ihm anzuvertrauen, so wußte er doch wie kein anderer meine Wißbegierde zu stillen. Er hatte eine Art, mir die Dinge klarzumachen und selbst schwierige Probleme meinem kindlichen Verständnis nahezubringen, mir Naturerscheinungen, chemische oder physikalische Vorgänge zu erklären und mich das Leben der Pflanzen und Tiere beobachten zu lehren, die die kurzen Stunden des Zusammenseins mit ihm wertvoller für mich machten, als wenn ich den ganzen Vormittag in der Schule gesessen hätte. Kamen wir nach Haus, so gingen wir zusammen in den Stall, und ich brachte den Pferden meinen Frühstückszucker, den ich mir täglich vom Munde absparte, seitdem Mama mich wegen meiner Zuckerverschwendung gescholten hatte. August, unser Kutscher und Faktotum, der mir trotz seiner verdächtig roten Nase viel lieber war als alle Mademoiselles zusammengenommen, mußte den kleinen Braunen herausführen, und ich durfte auf Mamas Sattel im Hof umherreiten, während Puckchen steifbeinig nebenher trabte, die Augen ernsthaft auf mich gerichtet, als müßte er Sitz und Haltung ebenso beobachten und kritisieren wie Papa. Der war kein bequemer Lehrmeister, und ich fürchtete diese halbe Stunde vor Tisch mehr, als daß ich mich daran freute. Ja, reiten – das mußte herrlich sein! Frei, mit verhängtem Zügel über Felder und Wiesen – vor Wonne klopfte mein Herz, wenn ich daran dachte! Aber im engen Hof, immer im Schritt, bestenfalls im kurzen Trab in der Runde, jeden Moment gewärtig, vom Vater heftig angefahren zu werden, wenn ich krumm saß, die Zügel verkehrt hielt, die Ecken nicht ausritt oder die Peitsche verlor, – gräßlich war's! Laute, harte Worte zu hören, verwundete mich aufs tiefste, und die Liebesbeweise, mit denen mein Vater mich nach jedem Ausbruch seiner Heftigkeit in doppeltem Maße überschüttete, vermochten den Eindruck nicht auszulöschen. Ich bemühte mich, sie nicht hervorzurufen – man nannte das lobend »artig sein« –, aber mein Herz krampfte sich dabei zusammen, und ich zog mich mehr und mehr in das Gehäuse meines verborgenen Lebens zurück, was meine Mutter als ein erfreuliches Resultat ihrer Erziehungsmethode betrachten mochte, die nur ein Prinzip kannte: Selbstbeherrschung. »Ein gut erzogenes Mädchen zeigt seine Gefühle nicht,« pflegte sie zu sagen, und so vergrub ich mich in die Kissen meines Bettes, wenn ich weinen mußte, und lief in den Garten hinaus, um mich hoch in die Lüfte zu schaukeln, wenn ich mich freute.
Eigentliche Freunde und Spielkameraden hatte ich nicht, wohl aber geselligen Verkehr, der mich Sonntags fast immer, schön geputzt, aus dem Hause führte. Im Schloß bei Großherzogs war ich ein häufiger Gast: Prinzessin Viktoria und Prinz Ludwig, zwei blühende Kinder damals, waren lustige Gefährten, und beim Baumplündern zu Weihnachten, beim Eiersuchen zu Ostern hallte das Schloß wider von unserm Lachen und Lärmen, an dem das freundliche Elternpaar stets die meiste Freude hatte. Nur das Kochen in Vickis großer Küche, die das Ideal aller andern kleinen Mädchen war, langweilte mich entsetzlich – die Fee, die dem Wickelkind die Hausfrauentugenden in die Wiege legt, war offenbar zu meinem Tauffest nicht geladen worden! Da war's bei Max und Marie doch schöner, den Kindern des Prinzen Wilhelm, deren kaiserlicher Großvater ihnen aus Rußland das kostbarste Spielzeug zu schicken pflegte: Eisenbahnen mit richtigen Schienen, Puppen, die laufen und reden konnten, – lauter Dinge, die zu jener Zeit für gewöhnliche Sterbliche unerreichbar waren. Am allerbesten aber gefiel es mir in einem Hause, dessen Herrin, eine Tochter Bettinens auch dem Geiste nach, es verstand, Märchen zu Wirklichkeiten zu machen. Mit ihren beiden reizenden Töchtern, die um ein paar Jahre älter waren als ich, fertigte sie aus buntem Seidenpapier die köstlichsten Gewänder an, mit denen geschmückt wir lebende Bilder stellten, Scharaden aufführten und uns als Helden Grimmscher Märchen in unsre Rollen so einlebten, daß die Rückkehr in die prosaische Erdenwelt uns hart ankam. Unsre Feste wurden bald die große Attraktion der Gesellschaft; oft genug sah auch der Großherzog uns zu, und ich erinnere mich noch recht gut, wie ich einmal als kleiner Amor im rosa Hemdchen, mit goldenen Sandalen und blitzenden Flügeln aus einem Strauß lebendiger Blumen meinen Pfeil auf ihn zu richten hatte und auf seinen lachenden Zuruf: »Nun, schieß los!« das strenge Schweigegebot vergessend, antwortete: »Aber das tut weh!« Bald lernte ich besser, bei solchen Gelegenheiten die Fassung zu bewahren, denn lebende Bilder und Kostümfeste waren auch bei den »Großen« an der Tagesordnung, und fast überall wirkte ich mit. In Scheffels Dichtung vom Rockertweibchen, die unter seiner persönlichen Leitung dargestellt wurde, war ich ein kleines Schwarzwaldmädchen, das sich der besonderen Gunst des Dichters erfreute. Er hatte immer eine Tüte für mich in der Tasche, und das erste Glas Sekt, das mir warm und wohlig bis in die Fußspitzen niederrieselte, verdanke ich ihm. Auch ein Rokokodämchen war ich, mit hochaufgetürmtem, gepudertem Haar, und ein Elfenkind, und das Veilchen auf der Wiese, – was Wunder, daß ich immer unlustiger morgens vor meinem alten, pedantischen Lehrer saß, der mich Buchstaben malen, Gesangbuchverse und Bibelsprüche hersagen ließ. Im Strudel rauschender Freude untertauchen oder lesen und träumen für mich ganz allein, – was dazwischen lag: das Alltagsleben mit seinen Pflichten und Leiden, war wie eine staubige Straße, die ich am liebsten zu gehen vermied. »Pflichten« besonders waren mir verhaßt; ich definierte sie schon als sechsjähriges Kind auf eine Frage hin als das, »was immer unangenehm ist«. Alles, was Mama z. B. tat, wenn sie ein recht unzufriedenes Gesicht dazu machte, erklärte sie für Pflichterfüllung: die schmutzige Wäsche selber zählen, obwohl drei Dienstboten daneben standen, die Zutaten zum Kochen herausgeben, obwohl wir eine vortreffliche französische Köchin hatten, nachmittags mit mir spazieren fahren, obwohl wir uns beide schrecklich dabei langweilten, – ja selbst die Dämmerstunden bei Papa, wo er zu Frau und Kind gern zärtlich war, schienen mir, nach ihrem Ausdruck zu schließen, in dieses Gebiet zu gehören. Ganz gewiß, ich würde nie meine Pflicht erfüllen, schwor ich mir heimlich und suchte meine Theorie nur zu oft in die Praxis umzusetzen, indem ich tat, was mir zu tun gefiel, und Befehlen, deren Ursache und Zweck ich nicht einsah, hartnäckigen Widerstand entgegensetzte. Der meiner freien Bewegung gezogene Umkreis konnte daher für meine Bedürfnisse nicht weit genug sein; darum war der Sommer so schön, wo ich den Garten fast für mich allein hatte, wo ich auf dem Lande bei Verwandten und Freunden der weitgehendsten Ungebundenheit mich erfreute.
Eingebettet zwischen weiß- und rotblühenden Obstbäumen, überragt von grünen Hügeln, zu denen schmale, nußbaumbeschattete Wege emporführten, noch nicht erobert von dem Feinde aller verträumten Poesie, der fauchenden, qualmenden Maschine, lag Weinheim damals zu Füßen der Bergstraße. Dem Grafen Währing, dem Bruder meiner Urgroßmutter, hatte das Schloß gehört, das mit seinen Gärten und Weinbergen das Städtchen beherrschte. Jetzt hauste seine Witwe, eine achtzigjährige Greisin dort oben, der niemand ihr Alter ansah, und bei der wir oft wochenlang zu Gaste waren. Wie eine Marquise aus dem achtzehnten Jahrhundert war sie anzuschauen: klein, zierlich, sprudelnd von Geist und Leben, mit winzigen weißen, von Juwelen bedeckten Händen, allerhand seltenes Tierzeug – weiße Angorakatzen, schlanke Windspiele, lockige Zwergpinscher – um sich herum. Sie pflegte sich stets nur mit Jugend zu umgeben – es sei genug, daß der Spiegel sie an ihr Alter erinnerte, meinte sie. Je toller es um sie her zuging, je mehr Liebesgeschichten sie sich entspinnen sah, desto fröhlicher war sie. Immer hatte sie Schränke voll Pariser Toiletten bereit, um ihre weiblichen Gäste – die schönsten am häufigsten – damit zu beschenken, und Juwelen, Ringe und Armbänder aller Art, mit denen sie sie schmückte. Wer harmlos irgend etwas, was nicht niet- und nagelfest war, bei ihr bewunderte, dem wurde es als Geschenk aufgenötigt. Und was für merkwürdige Dinge gab es in ihren Salons mit den Louis XV. Möbeln, den hohen Spiegeln und vielen, vielen Bildern und Bilderchen: da waren Sessel, Fußbänke, Bücher, aus denen in tollem Durcheinander Mozartsche und Offenbachsche Melodien ertönten, sobald sie benutzt wurden; Gemälde, die plötzlich in der Wand verschwanden, um einem Schränkchen voll süßem Naschwerk Platz zu machen; Tischchen, die in den Boden sanken, wenn man sie anstieß, um mit Wein und Kuchen besetzt wieder zu erscheinen, kurz – ein Paradies für ein wundergieriges Kinderherz! Und dann der Garten mit seiner Fülle von Beeren und Blumen, mit seinen dichten Laubengängen und lustigen Wasserspielen – und die Freiheit vor allem, die ungebundene!