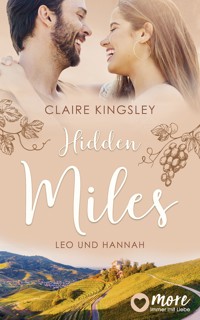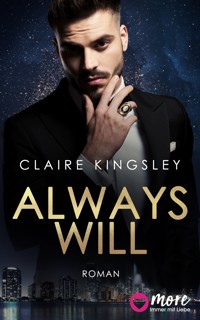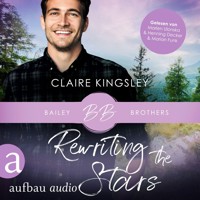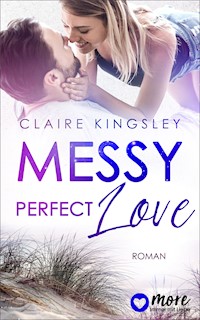
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jetty Beach
- Sprache: Deutsch
Wenn sich Gegensätze ausziehen…
Ich bin mir sicher, dass mich das Schicksal nach Jetty Beach geführt hat; aber bis ich Cody Jacobsen traf, wusste ich nicht warum. Arzt, gutaussehend, durchtrainiert und mit den hinreißendsten Grübchen der Welt, erobert er nicht nur seine Patientinnen, sondern auch mein Herz im Sturm. Aber auch wenn die Chemie zwischen uns der pure Wahnsinn ist, so passen wir einfach nicht zusammen. Cody, mit seinem geregelten Leben in Jetty Beach, seiner liebevollen Familie. Ich, die es nie lange irgendwo aushält und seit Jahren auf sich allein gestellt ist. Wir kommen nun mal aus verschiedenen Welten und es hat keinen Sinn. Denn Cody möchte alles. Und das werde ich ihm niemals geben können ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Wenn sich Gegensätze ausziehen…
Ich bin mir sicher, dass mich das Schicksal nach Jetty Beach geführt hat; aber bis ich Cody Jacobsen traf, wusste ich nicht warum. Arzt, gutaussehend, durchtrainiert und mit den hinreißendsten Grübchen der Welt, erobert er nicht nur seine Patientinnen, sondern auch mein Herz im Sturm.
Aber auch wenn die Chemie zwischen uns der pure Wahnsinn ist, so passen wir einfach nicht zusammen. Cody, mit seinem geregelten Leben in Jetty Beach, seiner liebevollen Familie. Ich, die es nie lange irgendwo aushält und seit Jahren auf sich allein gestellt ist.
Wir kommen nun mal aus verschiedenen Welten und es hat keinen Sinn. Denn Cody möchte alles. Und das werde ich ihm niemals geben können ...
Über Claire Kingsley
Claire Kingsley schreibt Liebesgeschichten mit starken, eigensinnigen Frauen, sexy Helden und großen Gefühlen.
Sie kann sich ein Leben ohne Kaffee, ihren Kindle und all den Geschichten, die ihrer Fantasie entspringen, nicht mehr vorstellen. Sie lebt im pazifischen Nordwesten der USA mit ihrem Mann und ihren drei Kindern.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Claire Kingsley
Messy perfect Love
Übersetzt von Cécile Lecaux aus dem amerikanischen Englisch
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1: Clover
Kapitel 2: Clover
Kapitel 3: Cody
Kapitel 4: Clover
Kapitel 5: Cody
Kapitel 6: Clover
Kapitel 7: Cody
Kapitel 8: Cody
Kapitel 9: Clover
Kapitel 10: Cody
Kapitel 11: Clover
Kapitel 12: Cody
Kapitel 13: Clover
Kapitel 14: Cody
Kapitel 15: Clover
Kapitel 16: Cody
Kapitel 17: Clover
Kapitel 18: Clover
Kapitel 19: Cody
Kapitel 20: Clover
Kapitel 21: Clover
Kapitel 22: Cody
Kapitel 23: Cody
Kapitel 24: Clover
Kapitel 25: Cody
Kapitel 26: Clover
Kapitel 27: Cody
Kapitel 28: Clover
Epilog: Clover
Nachwort
Impressum
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1: Clover
Kapitel 2: Clover
Kapitel 3: Cody
Kapitel 4: Clover
Kapitel 5: Cody
Kapitel 6: Clover
Kapitel 7: Cody
Kapitel 8: Cody
Kapitel 9: Clover
Kapitel 10: Cody
Kapitel 11: Clover
Kapitel 12: Cody
Kapitel 13: Clover
Kapitel 14: Cody
Kapitel 15: Clover
Kapitel 16: Cody
Kapitel 17: Clover
Kapitel 18: Clover
Kapitel 19: Cody
Kapitel 20: Clover
Kapitel 21: Clover
Kapitel 22: Cody
Kapitel 23: Cody
Kapitel 24: Clover
Kapitel 25: Cody
Kapitel 26: Clover
Kapitel 27: Cody
Kapitel 28: Clover
Epilog: Clover
Nachwort
Impressum
Kapitel 1 Clover
Die Warteschlange reicht bis draußen vor die Tür, und ich komme mit der Espressozubereitung kaum noch nach.
Aus meiner widerspenstigen blonden Lockenmähne lösen sich immer wieder Strähnen, die sich aus dem Haarband befreien und mir in die Stirn fallen, während ich im Akkord arbeite. Ich blase mir eine Locke aus dem Gesicht, während ich einen Becher Double Shot zubereite. Das war doch richtig, oder? Der Kunde hat die doppelte Menge Espresso bestellt. Oder war das der Kunde davor? Verflucht, ich kann mich nicht erinnern. Das Café ist seit einer Stunde rappelvoll, und ich kann schon nicht mehr klar denken.
Als der Kaffee fertig ist, verschließe ich den Becher mit einem Deckel. Es widerstrebt mir, in einem Laden beschäftigt zu sein, der Getränke in Pappbechern verkauft, aber was will man machen? Von irgendwas muss ich ja die Miete zahlen.
Ich lese den Namen von dem Becher ab. »Mark«, rufe ich laut, »ein kleiner Double Shot Vanilla Latte!«
Ein Mann mit Businesshemd und Krawatte tritt vor. Ich schenke ihm mein freundlichstes Lächeln, doch er guckt grimmig.
»Danke für deinen Besuch«, sage ich fröhlich.
Seine Züge werden weicher, als er sich den Becher nimmt, und seine Lippen verziehen sich zu einem angedeuteten Lächeln. Mein eigenes Lächeln wird noch eine Spur strahlender. Er musste lange auf seinen Kaffee warten, es ist mir allerdings gelungen, seine Laune zumindest etwas zu heben, was ich als kleinen Sieg verbuche.
Ich hole tief Luft und mache mich an die Zubereitung des nächsten Getränks. Ein Kollege schiebt sich an mir vorbei, und ich erstarre mitten in der Bewegung. Ich möchte nichts verschütten, denn mein Boss Dean ist ohnehin schon nicht gut auf mich zu sprechen. Wenn ich mir jetzt in der Stoßzeit noch einen Patzer erlaube, bin ich wahrscheinlich meinen Job los. Ich kann es mir nicht erlauben, gefeuert zu werden.
»Clover, kannst du kurz die Kasse übernehmen?«, sagt Dean im Vorbeigehen.
Mit dem Unterarm wische ich mir über die schweißnasse Stirn und nicke. »Klar.« Meine Füße tun höllisch weh, doch meine Schicht ist bald vorbei. Nur noch diese eine Schlange, dann kann ich endlich nach Hause gehen.
»Was darf es sein?«, frage ich den nächsten Kunden.
»Seid ihr unterbesetzt, oder was?«, brummt er.
»Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Aber unser Kaffee ist es wert.«
Er bestellt sein Getränk, und ich schreibe die Bestellung seitlich auf einen Pappbecher. Dann setze ich wieder ein Lächeln auf und wende mich dem nächsten Kunden zu. Die Bestellung der Frau ist so kompliziert, dass ich dreimal nachfragen muss, bevor ich alles richtig notiert habe. Mal im Ernst: Warum können Leute nicht einfach eine Tasse gewöhnlichen Kaffee bestellen? Wozu das Getue um einen vierfachen Espresso mit zwei Spritzern Mocha mit fettarmer Milch in einem extragroßen Becher mit Deckel und zwei Strohhalmen?
»Hey, Clover. Kannst du das an den Fenstertisch bringen?«, sagt Dean und drückt mir eine Keramiktasse mit schwarzem Filterkaffee in die Hand. Die meisten Kunden bestellen etwas zum Mitnehmen, hin und wieder setzt sich allerdings auch jemand an einen Tisch und bekommt sein Getränk in einer richtigen Tasse. »Ich übernehme die Kasse.«
Ich werfe einen Blick auf den Mann am Fenster und habe sofort Schmetterlinge im Bauch. Er sieht überdurchschnittlich gut aus. Und er sitzt allein am Tisch. Sein dunkelblondes Haar ist etwas zerzaust, und er trägt eine von diesen niedlichen Nerd-Brillen. Er hat Kopfhörer an seinen Laptop angeschlossen und starrt konzentriert auf den Bildschirm.
»Gerne«, entgegne ich mit etwas mehr Enthusiasmus als nötig. Ich nehme die Tasse und halte sie so vorsichtig wie nur möglich. Sie ist heiß, aber meine Finger sind mittlerweile relativ unempfindlich gegenüber Hitze. Ich habe schon in vielen Coffee Shops gearbeitet, und das ist eine normale Begleiterscheinung dieses Jobs.
Dann bahne ich mir einen Weg an der Endlosschlange vorbei zu seinem Tisch, darauf bedacht, dass das Getränk nicht überschwappt. Als ich seinen Tisch erreiche, sieht er auf, und ich schenke ihm mein strahlendstes Lächeln.
»Ihr Kaffee«, sage ich, stelle die Tasse auf den Tisch und atme erleichtert auf. Gott sei Dank, nicht gekleckert. Ohne die Kopfhörer abzusetzen, nickt er mir zu und richtet den Blick gleich wieder auf den Bildschirm.
Ich bin enttäuscht. Aber wenigstens habe ich den Kaffee nicht fallen lassen. Gestern habe ich einen Mixer kaputt gemacht, und letzte Woche ist mir ein ganzes Tablett voller Tassen hingefallen, von denen vier zu Bruch gegangen sind. Ich weiß auch nicht, warum mir so was immer wieder passiert. Ganz ehrlich: Manchmal glaube ich, dass das ganze Universum sich gegen mich verschworen hat.
Als ich mich abwende, um hinter den Tresen zurückzukehren, pralle ich mit einem Kunden zusammen. Ich schreie auf, als sein Iced Matcha Latte sich in meinen Ausschnitt ergießt.
»Oh mein Gott«, rufe ich atemlos aus, »das tut mir ja so leid!«
Die Tasse klemmt zwischen meinen Brüsten und seinem weißen Hemd fest, das ebenfalls grüne Flecken abbekommen hat. Er starrt mich mit offenem Mund an.
Ich winde mich innerlich. »Bitte lassen Sie mich das in Ordnung bringen.« Ich eile zum Tresen und hole eine Handvoll Papierservietten. Er rührt sich nicht von der Stelle, sondern steht nur da wie erstarrt. Das Eis in meinem BH brennt auf der Haut, und ich spüre die Blicke aller Anwesenden auf mir. Sogar der gut aussehende Typ mit den Kopfhörern verfolgt die Szene. Als ich anfange, an den Flecken auf dem Hemd des Gastes herumzutupfen, tritt dieser zurück und funkelt mich wütend an.
»Lassen Sie es gut sein«, sagt er unwirsch.
Dean kommt herüber, ein frisches Getränk in der Hand. »Bitte entschuldigen Sie das Malheur. Selbstverständlich kommen wir für die Reinigungskosten auf. Und Sie bekommen einen Gutschein.« Er reicht dem Kunden sein Getränk und den Gutschein und wirft mir dabei einen bitterbösen Blick zu.
Mir treten Tränen in die Augen, und ich weiche zurück. Am liebsten würde ich mich irgendwo verkriechen. Ein Typ in der Schlange legt eine Hand über den Mund und verkneift sich ein Lachen. Die Frau hinter ihm wirft mir einen mitleidigen Blick zu. Ich schniefe, würge den Kloß in meinem Hals herunter und gehe nach hinten, um mein Shirt auszuwaschen.
Ich nehme eine Handvoll Papiertücher und stopfe sie mir vorne unter das Shirt. Der Iced Matcha Latte ist überall. Es ist sinnlos. Den BH kann ich auch vergessen. Ich hoffe, dass Dean mich etwas früher gehen lässt. Mein T-Shirt ist völlig durchweicht und klebt an der Haut. Trotz der Schürze kann ich mich so nicht hinter den Tresen stellen.
»Clover«, sagt Dean, als ich aus der Toilette komme, »kann ich dich kurz in meinem Büro sprechen?«
Mir wird flau im Magen. Das klingt gar nicht gut.
»Natürlich«, entgegne ich und tupfe mit einem frischen Papiertuch überflüssigerweise an meinem T-Shirt herum.
Dean hat ein kleines Büro im hinteren Teil des Ladens, nicht viel größer als eine Besenkammer. Der Platz reicht gerade für einen kleinen Computertisch und einen Stuhl davor. Ich bin schon öfter hier drin gewesen – das erste Mal bei meinem Vorstellungsgespräch, und das war noch gut gelaufen. In Vorstellungsgesprächen kann ich überzeugen. In den meisten Fällen verliefen sie sehr locker und entspannt. Die anderen Unterredungen waren dann weniger lustig. Der Mixer. Die zerbrochenen Tassen. Da war noch ein anderes Missgeschick, an das ich mich aber gerade nicht erinnern kann. Ich arbeite erst seit etwa drei Monaten hier und habe in dieser überschaubaren Zeit mehr als genug Unter-vier-Augen-Gespräche mit meinem Boss geführt. Ich nehme vor ihm Platz und kaue auf der Unterlippe. Ich war so sicher gewesen, dass das Café genau der richtige Ort für mich wäre. Alles deutete darauf hin. Warum musste es dann so schieflaufen?
»Clover, du bist ein nettes Mädchen«, beginnt er.
Na toll, das war’s dann also.
»Aber du bist auch … ein Pechvogel«, fährt er fort. »Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass du nicht genug aufpasst, oder ob die Probleme motorischer Natur sind. Allerdings wir sind ein kleiner Laden, und hier geht es nun einmal beengt zu. Unsere Baristas müssen in der Lage sein, sich trotz der Enge sicher bewegen zu können, ohne ständig mit etwas – oder jemandem – zusammenzustoßen.«
Ich stoße auch nicht ständig mit etwas oder jemandem zusammen. Nur gelegentlich. »Das ist schon das zweite Mal, dass du einem Gast ein Getränk übergeschüttet hast.«
Das zweite Mal? Das kann nicht sein. Doch, halt. Es ist tatsächlich das zweite Mal. Verdammt. »Es tut mir furchtbar leid, Dean. Ich habe so aufgepasst mit dem Kaffee des Kunden am Fenstertisch. Aber als ich mich umgedreht habe, stand der Typ direkt hinter mir.«
»Mag sein, das ist allerdings nicht der erste Zwischenfall mit dir«, spricht Dean unbeirrt weiter. »Ich tue es nicht gerne, aber ich fürchte, wir müssen künftig auf dich verzichten.«
Ich lasse mich auf dem Stuhl zurücksinken und starre auf den Boden. Verfluchter Mist. Gefeuert. »Ist das dein letztes Wort? Ich werde mir mehr Mühe geben, versprochen. Ich brauche diesen Job, Dean.«
Dean seufzt. »Ich zahle dir noch einen Wochenlohn, mehr kann ich nicht für dich tun.«
Ich beiße mir auf die Unterlippe, um nicht loszuheulen. »Okay, also dann … danke, dass ich hier arbeiten durfte.«
Ich stehe auf und verlasse das Büro, ohne Dean noch einmal anzusehen. Ich will kein Mitleid. Ich suche meine Sachen zusammen und verlasse das Café durch den Hintereingang.
Kapitel 2 Clover
Auf dem Heimweg fühle ich mich schon deutlich besser. Ja, ich wurde gefeuert, aber der Job hat mir sowieso nicht gefallen. Ich werde mir etwas anderes suchen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mich in einer solchen Lage befinde. Beileibe nicht.
Ich ignoriere die Blicke der Passanten. Mein BH schimmert durch das nasse weiße T-Shirt mit dem hellgrünen Fleck, der sich bis hinunter zum Saum zieht. Ich kann eh nichts daran ändern, und da es warm ist, habe ich keine Jacke dabei, und die Schürze habe ich im Laden gelassen. Zu Hause werde ich erst einmal duschen und mich umziehen und dann in Ruhe überlegen, wie es weitergehen soll.
Die Sonne scheint, und Schweiß rinnt mir den Rücken hinunter. Als ich im vergangenen Jahr in den Bundesstaat Washington eingereist bin, habe ich eine regnerisch waldige Gegend erwartet. Tatsächlich hat sich aber herausgestellt, dass der Osten des Staates sehr trocken ist, nicht besonders grün und im Sommer höllisch heiß. Ich habe mich für den Ort Walla Walla entschieden, weil im Internet stand, er befände sich in der Weinregion. Und überhaupt: Wer kann bei einem solchen Namen widerstehen?
Die Weinregion war dann doch weniger malerisch als erwartet, trotzdem hat der Ort einiges für sich. Es gibt nette Geschäfte, und es ist nicht schwer, Arbeit zu finden. Eine Stelle zu behalten ist da schon schwieriger. Langsam frage ich mich, ob ich mich nicht beruflich verändern oder sogar noch mal die Schulbank drücken sollte.
Nach der Highschool erschien es mir wenig erstrebenswert, ein College zu besuchen. Meine Eltern haben auch nicht studiert und sind dennoch im Leben gut zurechtgekommen, auch wenn wir viel umgezogen sind und keiner von beiden Karriere gemacht hat. Einen Tag nach meinem achtzehnten Geburtstag haben sie mir dann eröffnet, dass sie nach Thailand auswandern wollen. Doch sie sind Freigeister. Als ich noch ein Kind war, hatten wir nicht viel. Wir haben die meiste Zeit in einem Wohnmobil gelebt und sind herumgereist. Das war zwar keine klassische Art aufzuwachsen, aber bei meinen Eltern war generell alles etwas anders.
Seit einigen Jahren habe ich sie nicht mehr gesehen, und manchmal vermisse ich sie.
Ich biege auf den Parkplatz des Apartmenthauses ein, in dem ich wohne. Es gibt Blumenkübel mit duftenden blühenden Pflanzen und in der Mitte einen kleinen Spielplatz. Es ist nicht übel. Die Nachbarn über mir sind Nachteulen, was etwas nervig ist, doch Mrs. Berryshire, die alte Dame nebenan, habe ich richtig ins Herz geschlossen. Wie immer sitzt sie in ihrem alten Schaukelstuhl draußen vor der Tür, in einen rosa Morgenmantel gehüllt und mit Lockenwicklern im weißen Haar.
»Hallo, Mrs. Berryshire.«
»Wie geht es meiner süßen Clover heute?«, fragt sie.
»Ich hatte heute keinen so guten Tag, aber das wird schon wieder. Ich lasse mich nicht unterkriegen, das wissen Sie doch.«
»Natürlich wird es das, Liebes. Magst du ein paar Kekse haben? Ich habe welche gebacken.«
»Nein, danke, Mrs. Berryshire«, entgegne ich. Ich habe bereits innerhalb weniger Stunden nach meinem Einzug gelernt, keine Kekse von Mrs. Berryshire anzunehmen. Sie sieht nicht mehr so gut und neigt dazu, Zutaten zu verwechseln, wie beispielsweise Salz und Zucker.
»Wie du meinst«, sagt sie. »Sag Bescheid, wenn du es dir doch noch anders überlegen solltest.«
»Klar, mache ich.«
Lächelnd sperre ich meine Wohnungstür auf. Es geht mir schon wieder besser. Ich werde jetzt warm duschen, meine schmerzenden Füße hochlegen und anschließend die Jobangebote online durchforsten. Ich bin optimistisch, dass ich bis nächste Woche etwas finde. Vielleicht probiere ich diesmal etwas anderes aus, vielleicht eine Tätigkeit, wo ich nicht mit zerbrechlichem Porzellan und Flüssigkeiten zu tun habe.
Ich stelle meine Tasche auf den Boden und betätige den Lichtschalter. Nichts passiert. Seltsam. Ich wiederhole den Versuch noch mehrmals, jedoch ohne Erfolg. Die Birne muss durchgebrannt sein.
Das Licht in der Küche geht auch nicht. Ich werfe einen Blick auf die Zeitanzeige an der Mikrowelle. Schwarz. Der Kühlschrank ist noch kalt, aber das Licht funktioniert ebenfalls nicht. Ich gehe durch die Wohnung und probiere diverse Apparate aus, doch alles ist tot.
Oh nein.
Ich stecke den Kopf zur Tür raus. »Mrs. Berryshire, haben Sie drüben in Ihrer Wohnung Strom?«
»Ich glaube schon«, erwidert sie.
»Darf ich mal nachsehen?«
»Natürlich, Liebes.«
Ich betrete ihre Wohnung, in der alle Lichter brennen. Sie hat definitiv Strom. Ich drehe eine kurze Runde durch die Wohnung und schalte die meisten Lichter aus. Sie neigt dazu, solche Kleinigkeiten zu vergessen.
»Bei Ihnen ist alles in Ordnung«, sage ich, als ich die Wohnung wieder verlasse. »Ich frage mich, was bei mir drüben los ist.«
»Ruf den Hausverwalter an«, rät sie mir.
»Ja«, entgegne ich mit einem Lächeln. »Vielleicht ist die Sicherung rausgesprungen.«
Dann gehe ich wieder zu mir und greife nach dem Telefon, um den Hausverwalter anzurufen. Mein Blick fällt auf den Korb mit der ungeöffneten Post. Ein ziemlich großer Stapel. Ich habe doch die Stromrechnung bezahlt, oder? Ich bin ganz sicher.
Ich lege das Telefon wieder weg und sehe die Post durch. Mir rutscht das Herz in die Hose, als ich auf einen Brief mit rotem MAHNUNG-Stempel auf der Vorderseite stoße. Wie konnte ich das übersehen? Ich öffne den Umschlag, der eine längst überfällige Rechnung und das Datum der angedrohten Stromabschaltung enthält. Ja, das ist heute. Offensichtlich war das keine leere Drohung gewesen.
Seufzend lege ich die Rechnung hin. Ich muss mich darum kümmern, aber eins nach dem anderen. Erst muss ich mir den klebrigen Latte abwaschen. Ich gehe ins Bad, drehe die Dusche auf und hoffe, dass noch etwas warmes Wasser übrig ist. Als es warm wird, wage ich einen Versuch. Das Wasser wird nicht richtig heiß, doch wenigstens ist es nicht ganz kalt. Ich wasche mich, trockne mich ab und ziehe saubere Sachen an.
Anschließend überprüfe ich meinen Kontostand, um sicherzugehen, dass ich noch genug Geld habe, um die Stromrechnung zu bezahlen, bevor ich die Bank beauftrage, den überfälligen Betrag zu überweisen. Der Stromversorger teilt mir mit, dass ich in ein paar Stunden wieder Strom haben müsste. Ich stöhne. Nicht eher? Aber natürlich bin ich selbst schuld.
Ohne Strom herumzusitzen ist deprimierend, also schnappe ich mir meinen Laptop und steuere das kleine griechische Restaurant ein Stück weiter die Straße runter an. Es ist ein nettes Lokal, und dort gibt es bestimmt freies WLAN. Ich werde an einen Tisch am vorderen Fenster geführt und bestelle eine Vorspeise. Ich werde mich mit Pitabrot und Tsatsiki zum Abendessen begnügen müssen, eine der preisgünstigsten Optionen auf der Karte. Bis ich eine neue Stelle habe, muss ich sparsam mit meinem Geld umgehen. Ich fahre meinen Laptop hoch, um mir die Jobangebote online anzusehen.
Erst logge ich mich in meine sozialen Netzwerke ein, warum auch nicht? Ich hatte einen langen Tag und habe ein Anrecht auf etwas Entspannung. Als Nächstes checke ich mein Horoskop.
Heute liegt Veränderung in der Luft. Sie müssen wichtige Entscheidung treffen, die langfristige Auswirkungen auf Ihr Leben haben werden, insbesondere auf Ihr Liebesleben. Wagen Sie eine Veränderung, brechen Sie auf zu neuen Ufern. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie das zu einem unerwarteten Ort oder Erlebnis führt. Ihre optimistische Grundeinstellung kommt Ihnen heute sehr zugute.
Ich starre auf den Bildschirm. Das ist ein Zeichen. Ich erkenne sie immer sofort. Manchmal stehen sie in meinem Horoskop, manchmal in den Wolken, in den Sternen, in einer Artikelüberschrift in einem Magazin. Plötzlich erfüllt mich ein Gefühl von Entschlossenheit, und ich weiß es einfach. Ich spüre, dass ein bestimmter Hinweis eine besondere Bedeutung hat. Schon seit Jahren folge ich diesen Zeichen. Ich weiß zwar nicht, wohin sie mich führen werden, glaube aber fest daran, dass am Ende sich alles zum Guten wenden wird.
Na ja, bisher haben die Zeichen mich oft im Kreis geführt, und in den vergangenen zehn Jahren bin ich kreuz und quer durch die Staaten gereist, immer wieder umgezogen. Doch ich habe dabei die Bekanntschaft vieler großartiger Leute gemacht, so dass ich meinen unsteten Lebenswandel nicht bereue.
Wie die von Mrs. Berryshire zum Beispiel, die ich nie kennengelernt hätte, wenn ich nicht nach Washington gekommen wäre. Und noch viele andere. Ich bin so vielen interessanten Persönlichkeiten begegnet.
Aber so nett dieser Ort auch sein mag, deutet alles ganz klar darauf hin, dass es an der Zeit ist, weiterzuziehen. Dass ich gefeuert wurde, dass man mir den Strom abgestellt hat, das Horoskop … Es liegt etwas in der Luft. Langfristige Auswirkungen. Neue Ufer. Unerwarteter Ort.
Neue Ufer. Ufer. Das muss etwas bedeuten, ich weiß es. Ich wiederhole die Worte in Gedanken und spüre ein Kribbeln. Das heißt immer, dass ich kurz vor dem Durchbruch stehe, dass das Schicksal zu mir spricht. Ich schließe die Augen und atme tief durch. Was hat das zu bedeuten? Was versucht das Universum, mir mitzuteilen?
Als ich die Augen wieder öffne, fällt mein Blick als Erstes auf ein Bild an der Wand. Meer und Sonne. Der Strand. Vermutlich handelt es sich um das Mittelmeer, doch ich werde nun nicht meine Sachen packen und mich aufmachen nach Griechenland, ganz egal, wie sehr ich die mediterrane Küche auch mag. Aber das Meer. Der Ozean.
Ich bin quer durch die Staaten gereist, war allerdings noch nie an der Pazifikküste. Ich rufe eine Karte auf dem Laptop auf und fahre mit dem Finger an der Küste entlang. Das dürften nur sechs oder sieben Stunden mit dem Auto sein, und ich hatte sowieso vor, früher oder später ans Meer zu fahren.
Ist jetzt der richtige Zeitpunkt?
Ich schaue mir verschiedene Orte an der Küste an und klicke auf das zweite Suchergebnis. Auf das erste klicke ich nie. Die Eins gehört nicht zu meinen Glückszahlen. Aber die Zwei … zwei steht für ein Paar, ein Paar wiederum für eine Zukunft, und eine Zukunft ist genau das, wonach ich suche.
Jetty Beach. Sieht wie ein idyllisches kleines Touristennest aus. Es gibt Cafés, Geschäfte und lange Sandstrände. Es werden keine warmen Strände sein, trotzdem klingt es vielversprechend. Dort wohnen bestimmt viele schrullige Leute. Ich mag schrullige Leute, die passen gut zu mir.
Die Sorgen wegen meines Jobs und der Wohnung … das alles fällt schlagartig von mir ab, und ein breites Lächeln stiehlt sich auf mein Gesicht. Ich weiß es. Dort soll ich hin. Vielleicht hat das Schicksal mich ja all die Jahre immer näher ans andere Ende des Landes geführt, und ich habe es nur nicht erkannt. Aber wenn ich erst die Küste erreicht habe, geht es nicht weiter. Bestimmt ist das das Ziel meiner langen Reise.
Ich klappe meinen Laptop zu, beende meine bescheidene Mahlzeit und gehe heim, um zu packen. Das Mobiliar lasse ich da. Das meiste war bei meinem Einzug sowieso schon vorhanden. Ich bin ganz aufgeregt. Ein Neuanfang. Neue Möglichkeiten. Neue Leute. Ich werde meine Freunde hier vermissen, aber es ist Zeit, loszulassen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das Horoskop mir den Weg gewiesen hat.
Veränderung liegt in der Luft, und ich werde aufbrechen zu neuen Ufern.
Kapitel 3 Cody
»Dr. J., können Sie sich noch eine Patientin anschauen, auch wenn sie keinen Termin hat? Eigentlich ist die Sprechstunde ja schon vorbei.«
Ich sehe von meinem Schreibtisch auf. Darcy, meine Sprechstundenhilfe, steht in der Tür zu meinem Büro. Sie hat die Stirn gerunzelt und sieht gestresst aus.
Es ist kurz vor sechs, und ich müsste bereits längst weg sein. »Worum geht es denn?«
»Ein fünfjähriges Mädchen«, entgegnet Darcy. »Die Mutter hat sie hergebracht, weil die Kleine ihren rechten Arm nicht bewegen kann. Offenbar hat sie starke Schmerzen. Wenn ich die beiden in die Notaufnahme schicke, werden sie ewig warten müssen.«
Ich komme zu spät zu meiner Verabredung, aber ich bringe es nicht übers Herz, die kleine Patientin abzuweisen. »Ja, natürlich.«
»Untersuchungsraum fünf«, sagt Darcy.
Als ich die Tür öffne, sehe ich gleich, dass die Mutter sich große Sorgen macht. Sie hält ihre Tochter auf dem Schoß, die einen Arm an den Körper gedrückt hält. Die Augen des Mädchens sind gerötet, die Wangen fleckig.
»Guten Tag«, sage ich und setze mich auf den Rollhocker, um sie nicht zu überragen und allein durch meine Größe einzuschüchtern, »ich bin Dr. J. Wie heißt du?«
Die Mutter lächelt angespannt, und das Mädchen mustert mich verstohlen aus den Augenwinkeln.
»Das ist Lily«, sagt die Mutter. »Und ich bin Christie.«
»Was ist passiert?«, frage ich.
»Mein Arm tut weh«, sagt die Kleine schüchtern.
Ich lege den Kopf auf die Seite und sehe mir an, wie sie den Arm hält. »Dein Arm tut weh? Das ist nicht gut. Bist du hingefallen?«
»Nein«, entgegnet Lily.
Ich schaue Christie in die Augen.
»Meines Wissens ist sie nicht gestürzt«, bestätigt die Mutter. »Aber ich muss es auch nicht zwingend mitbekommen haben. Sie hat mit ihrem Bruder im Wohnzimmer gespielt, während ich das Abendessen zubereitet habe, ich kann also nicht genau sagen, was passiert ist.«
»Okay. Sag mal, Lily, wie alt ist denn dein Bruder?«
»Elf.«
»Schon elf? Dann ist er ja bereits richtig groß. Spielst du gerne mit ihm?«
»Ja«, sagt sie.
»Und wie alt bist du?«, frage ich. »Siebzehn?«
Sie lächelt scheu. »Nein, ich bin fünf.«
»Fünf? Dann habe ich ja ziemlich weit danebengelegen. Sag mal, Lily, kannst du mir bei etwas helfen?«
Sie nickt.
»Ich muss mir deinen Arm ansehen. Ich möchte schauen, ob ich dir helfen kann, damit es nicht mehr so wehtut. Würdest du mir deinen Arm zeigen?«
Sie vergräbt das Gesicht an der Brust ihrer Mutter.
»Sie hat Angst, dass sie eine Spritze bekommt«, erklärt Christie.
Ich nicke. »Hör zu, Lily, ich verspreche dir was. Keine Spritze, okay? Ich verspreche dir, dass du heute keine Spritze bekommst.«
Sie wendet sich mir wieder zu, klammert sich aber weiter an ihre Mom. »Versprochen?«
»Versprochen«, sage ich feierlich.
Das scheint sie zu beruhigen.
»Gut«, sage ich. »Jetzt muss ich deinen Arm berühren, okay? Ich werde mir alle Mühe geben, dir nicht wehzutun.«
Sie sitzt nun ganz still, während ich bei der Hand beginnend vorsichtig ihren Arm abtaste. »Du bist also nicht hingefallen. Deine Mom hat gesagt, du hast mit deinem Bruder gespielt. Hat es beim Spielen angefangen wehzutun?«
»Ja«, bestätigt sie.
Ich umfasse ihren Ellbogen und versuche, ihren Arm zu bewegen, höre jedoch sofort auf, als sie zurückzuckt.
»Was habt ihr denn gespielt?«
»Wir haben Ninja gespielt. Ich hatte ein Schwert, und er hat versucht, es mir wegzunehmen.«
»Aha. Spielst du gerne Ninja?« Ich bin mir ziemlich sicher, zu wissen, was passiert ist, und lenke sie ab, während ich vorsichtig wieder nach ihrem Ellbogen greife. Kein Zweifel, er ist ausgekugelt.
»Wir spielen immer Ninja. Aber er wollte mir das Schwert nicht lassen.«
»Hat er es dir aus der Hand gerissen?«, frage ich.
»Ja. Er hat meinen Arm gepackt und ganz fest daran gezogen.«
Ich sehe Christie an. »Lily hat sich den Ellbogen ausgekugelt. Das ist nicht dramatisch, tut allerdings sehr weh. Ich kann das jetzt gleich in Ordnung bringen.«
Lily macht große Augen. »Nein, Sie dürfen ihn nicht anfassen. Der Arm tut weh.«
»Das weiß ich, Kleine. Aber sobald das Gelenk wieder eingerenkt ist, tut es nicht mehr weh.«
Ihre Unterlippe zittert.
»Ich sage dir was.« Ich hole nun einen Korb mit Lutschern aus dem Schrank. Die sind genau für solche Situationen bestimmt. »Du nimmst dir einen, steckst ihn in den Mund und sagst mir, welche Geschmacksrichtung es ist, einverstanden?«
Sie schaut immer noch misstrauisch, nickt aber und nimmt sich einen Lutscher. Ich wickle ihn für sie aus dem Papier, und Lily steckt sich die Süßigkeit in den Mund.
Blitzschnell packe ich Handgelenk und Ellbogen und renke das Gelenk mit einem kräftigen Ruck wieder ein. Es knackt laut, und sie reißt die Augen auf. »Au!«
Im ersten Moment sieht Lily mich an, als hätte ich sie verraten, doch dann bewegt sie vorsichtig den Arm vor und zurück und beugt ihn.
»Besser?«, frage ich.
Sie nickt. »Es tut immer noch weh, aber ich kann den Arm wieder bewegen!«
»Das ist normal. Morgen wird es schon viel besser sein.« Ich wende mich erneut an Christie. »So etwas passiert häufiger beim Spielen. Dass sie den Arm bereits wieder bewegen kann, ist ein sehr gutes Zeichen. Geben Sie ihr vor dem Zubettgehen noch etwas Tylenol, wenn die Schmerzen noch zu stark sind. Der Arm wird noch ein paar Tage wehtun, aber ansonsten müsste es damit getan sein.«
Christie entspannt sich sichtlich und atmet auf. »Vielen lieben Dank, Dr. J. Ich hatte schon befürchtet, der Arm wäre gebrochen, konnte mir allerdings nicht erklären, wie das passiert sein sollte.«
»Kein Problem«, sage ich und dann an Lily gewandt. »Du hast mir noch gar nicht gesagt, wonach dein Lutscher schmeckt.«
Lily lächelt. »Nach Kaugummi.«
Ich lächle zurück. »Das ist mein Lieblingsgeschmack. Geh nach vorne zu Darcy, sie gibt dir noch einen Aufkleber, okay?«
»Danke«, sagt sie.
»Ja, tausend Dank.« Christie lächelt.
»Gern geschehen. Ich wünsche den Damen noch einen schönen Abend.«
Ich gehe zurück in mein Büro. Ich bin bereits spät dran, habe jedoch noch etwas Papierkram zu erledigen. Im Medizinstudium hat niemand den Papierkram erwähnt, mit dem man sich in der Praxis herumschlagen muss. Ich bin Arzt geworden, um Menschen zu helfen, sie zu heilen – und zugegebenermaßen hatte auch der Doktortitel seinen Reiz. Der Schreibkram, ob manuell oder am Computer, ist unglaublich lästig und ganz klar die Schattenseite meines Berufs.
Ich beschließe, am nächsten Tag früher anzufangen, denn ich bin mit Jennifer zum Abendessen verabredet. Offiziell ist sie meine Freundin, auch wenn wir kürzlich mal wieder Schluss gemacht haben. In letzter Zeit weiß ich eigentlich nie genau, ob wir noch zusammen sind oder nicht. Die meiste Zeit ist sie sauer auf mich wegen der vielen Überstunden, und sie droht regelmäßig, mich endgültig zu verlassen.
Obwohl sie einen eigenen Laden hat, scheint sie nie Überstunden zu machen und erwartet von mir, verfügbar zu sein, wann immer sie meine Gesellschaft wünscht. Sie bezeichnet mich als Workaholic und wirft mir vor, sie zu vernachlässigen. Ich entschuldige mich, dann haben wir Versöhnungssex, und in der darauffolgenden Woche fängt das Theater dann von vorne an.
Ziemlich nervig, wenn ich so darüber nachdenke. Das Problem ist nur, dass ich eben nicht darüber nachdenke. Ich stehe früh auf, gehe zur Arbeit, behandle den lieben langen Tag einen endlosen Strom von Patienten, erledige den Papierkram und was sonst noch so anliegt, und komme erst spät nach Hause. Diese chaotische Beziehung hat für mich einfach keine Priorität mehr – und genau das macht Jennifer derart wütend.
Sie hat recht. Ich bin ein Workaholic.
Ich fahre den Computer herunter und seufze tief. Workaholic oder nicht, mir ist bewusst, dass das mit Jen und mir einfach nicht mehr geht. Ich muss endlich reinen Tisch machen. Seit Langem drängen mich meine Brüder dazu, die Beziehung endlich ein für alle Mal zu beenden. Sie haben recht. Ich schiebe das schon viel zu lange vor mir her.
Ich mache mir nicht die Mühe, erst nach Hause zu fahren, um mich umzuziehen, sondern fahre in dem cremefarbenen Hemd und der blauen Krawatte, die ich bereits den ganzen Tag trage, zum Restaurant. Jen sitzt an der Bar und trommelt mit den manikürten Fingernägeln an ihr Rotweinglas.
»Ist das dein Ernst, Cody?« Das lange dunkle Haar fällt ihr glatt über die Schultern, und sie trägt ein schwarzes Etuikleid und hochhackige Schuhe.
»Tut mir leid, ich wurde in der Praxis aufgehalten. Ein kleines Mädchen mit einem ausgekugelten Ellbogen.«
»Natürlich«, sagt sie kopfschüttelnd. »Ich habe mich noch nicht an den Tisch gesetzt, weil ich wusste, dass du zu spät kommen würdest.«
Ich runzle die Stirn. Ist das ihr Ernst? Kein Funken Mitgefühl für das kleine Mädchen? »Hör zu, Jen. Wir müssen reden.«
»In Ordnung. Lass uns nur erst an den Tisch gehen und bestellen. Ich habe nicht zu Mittag gegessen und sterbe vor Hunger.«
Die Bedienung erscheint, ehe ich etwas darauf erwidern kann. »Hier entlang, bitte.«
Ich folge Jen an den Tisch. Heute ist nicht viel los, und es sind bloß wenige Gäste in dem kleinen Restaurant. Wir setzen uns, und die Bedienung reicht uns die Speisekarte. Ich lege meine auf den Tisch und warte, bis die Bedienung gegangen ist. Ich werde nicht hier sitzen und mit ihr zu Abend essen. Ich werde das hier und jetzt hinter mich bringen.
»Jen, ich muss dir etwas sagen«, beginne ich.
Sie hält den Blick auf die Karte gerichtet. »Okay.«
»Ich denke, wir sollten das mit uns endlich beenden«, fahre ich fort.
Sie hebt den Blick und sieht mich ausdruckslos an. Mir fällt auf, wie stark sie geschminkt ist. »Was hast du gesagt?«
»Das geht schon viel zu lange so«, fahre ich fort. »Wir streiten, versöhnen uns, streiten wieder … und immer geht es um dasselbe. Ich bin es leid.«
»Du wirst mich nicht abservieren«, sagt sie mit solcher Kälte, dass es mich richtig wütend macht.
»Doch, genau das tue ich. Ich hätte das bereits längst tun sollen.« Ich stehe auf.
Ihre Kinnlade klappt herunter. »Das ist jetzt nicht dein Ernst, Cody.«
»Und ob.« Nun, da es raus ist, ist für mich sonnenklar, dass es die einzig richtige Entscheidung ist. Es war dumm von mir, das so lange mitzumachen. »Wir passen überhaupt nicht zusammen, Jen. Wir machen einander unglücklich. Wir klammern uns nur aneinander, weil wir fürchten, keinen anderen Partner zu finden. Aber so funktioniert das nicht. Das hat es nie. Das war’s. Es ist aus.«
Ich kann ihren mörderischen Blick zwischen den Schulterblättern spüren, als ich gehe. Aber, verdammt, ich habe einfach keine Lust mehr. Auch wenn wir uns heute Nacht versöhnen würden, wäre der nächste Streit schon vorprogrammiert.
Es ist erstaunlich, wie befreit ich mich auf dem Weg zu meinem Wagen fühle. Mir war gar nicht bewusst, wie sehr mich diese kaputte Beziehung belastet hat.
Ich steige in den Wagen und hole mir auf dem Heimweg beim Chinesen etwas zu essen. Ich wohne etwa eine Meile vom Zentrum entfernt, nicht direkt am Wasser, doch bis zum Strand sind es nur ein paar Minuten zu Fuß. Ich habe ein einfaches zweistöckiges Haus mit drei Schlafzimmern im Obergeschoss, einer schönen Küche und einem Gaskamin im Wohnzimmer. Hinter dem Haus gibt es einen großen Garten mit vielen Bäumen, die mich vor neugierigen Blicken schützen. Ich habe eine fast neue Immobilie gekauft, weil ich keine Zeit hatte für aufwendige Renovierungsarbeiten, und für mich allein ist es eigentlich zu groß.
Aber ich habe beim Kauf an die Zukunft gedacht. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich eines Tages heiraten und eine Familie gründen würde. Es frustriert mich, dass ich die letzten beiden Jahre vergeudet habe. Ich wusste schon früh, dass Jennifer nicht die Richtige ist. Warum bin ich nur so lange mit ihr zusammengeblieben?