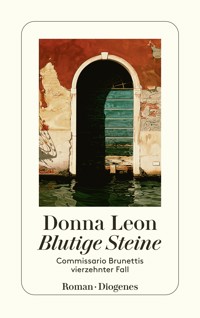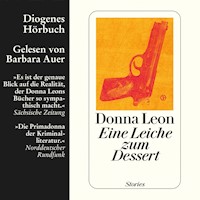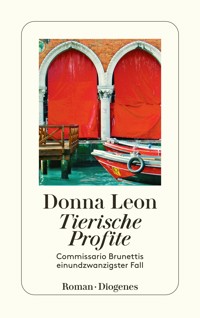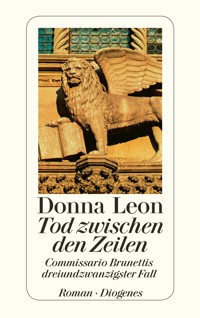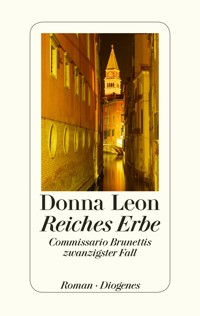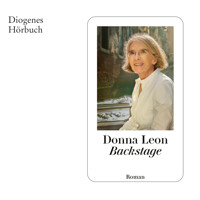11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und immer noch eine Schönheit, taucht eines Tages in der Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat? Schon will Brunetti das Ganze als übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu einem Überfall, der menschliche Abgründe offenbart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Donna Leon
Milde Gaben
Commissario Brunettis einunddreißigster Fall
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Werner Schmitz
Diogenes
Für Heike Bischoff-Ferrari
Blessed are they that considereth the poor and needy:
the Lord will deliver them in time of trouble,
the Lord preserve them and comfort them.
Selig ist er, der des Armen gedenkt, des hülflos Armen,
der Herr wird erhalten ihn zur Zeit der Trübsal,
der Herr bewahret und tröstet ihn.
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL,
FOUNDLING HOSPITAL ANTHEM
1
Brunetti hatte zwar den Gazzettino schon in den Papierkorb geworfen, doch das Thema des Leitartikels ließ ihn auch auf dem Heimweg von der Questura nicht los. Zu Hause auf dem Sofa versuchte er sich auf Ciceros Anklage gegen einen korrupten Beamten in den Reden gegen Verres zu konzentrieren, doch seine Gedanken kehrten immer wieder zu den Geldströmen zurück, die das Land seit dem Wüten der Pandemie geflutet hatten.
Mehr als 125000 Menschen waren schon umgekommen, und doch hatte dies der Gier kein Ende gesetzt. Wie Brunetti schon gefürchtet hatte, bediente sich das organisierte Verbrechen ungeniert aus dem praktisch unbewachten Trog. Das Geld fiel vom Himmel, ein verängstigtes Europa mästete seine Unternehmen. Die Namen der Direktoren mancher Firmen hatten ihn ebenso erschauern lassen wie die Namen mancher für die Verteilung der Mittel zuständigen Beamten. Er und seine Kollegen von der Guardia di Finanza würden noch von ihnen hören.
Kredite wurden gewährt, viele Geschäfte vor dem Untergang bewahrt, viel Gutes geschah, vielen wurde geholfen. Dennoch war Brunetti überzeugt, dass sich ein Gutteil des Geldes auf dem Weg zu seinen Empfängern in Luft auflöste und zahllose Unternehmen nur gegründet wurden, um Konkurs anzumelden und entschädigt zu werden.
Brunetti verstand von Wirtschaft nicht sehr viel, doch was das Betrügen und Stehlen anging, machte ihm niemand etwas vor: Die Verwüstungen, die das Virus in der Wirtschaft anrichtete, waren die perfekte Gelegenheit zu solchen Schurkereien. Er kannte die Tricks der Taschendiebe und Straßenräuber: Unruhe stiften, das Opfer ablenken und verunsichern, um es dann unbemerkt auszuplündern. Geschäftstüchtige Gauner hatten schnell erkannt, wie sie nun sogar ohne eigenes Zutun von der Angst und Verwirrung ihrer Opfer profitieren konnten.
Il Gazzettino berichtete von Gewerberaum, der von Hand zu Hand ging. Wo so viele Existenzen am Abgrund standen, sollte dies eigentlich ein ermutigendes Zeichen sein, Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Stadt, würden nicht gleichzeitig die überregionalen Zeitungen berichten, dass die diversen Mafias nicht wüssten, wohin mit dem vielen so unverhofft ergatterten Geld, das gewaschen und wieder ins Banksystem eingeschleust werden musste. Bot sich da ein Geschäft in guter Lage in Venedig nicht geradezu an? Über kurz oder lang würden die Touristen zurückkommen, selbst die Kreuzfahrtschiffe würden wieder aus der Versenkung auftauchen, auch wenn Brunetti sie eher als schwimmende Särge betrachtete.
Er verscheuchte diese Gedanken. Wozu sich vorschnell düsteren Spekulationen hingeben? Vielleicht würden die Menschen ja, täglich mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert, doch noch zur Vernunft kommen und andere Prioritäten setzen.
Ein Geräusch im Flur riss ihn aus seinen Gedanken. Er sah gerade noch, wie Chiara in ihr Zimmer verschwand, um sich in ihrer hermetischen Welt der sozialen Medien einzuigeln. Angst und Sorge um seine Kinder befiel ihn, sogleich aber flammte auch Hoffnung auf trotz allen Schadens, den die Welt genommen hatte, in der sie ihr Leben verbringen würden.
Um seine Stimmung zu verscheuchen, machte Brunetti sich auf den Weg zu Paolas Arbeitszimmer; die Tür stand offen, und er trat ein. Sie saß, die Brille mitten auf der Nase, vor ihrem Computer. Ohne aufzublicken, sagte sie: »Gut, dass du da bist.«
»Warum?«, fragte er und gab ihr einen Kuss auf den Hinterkopf.
Sie tippte einen Satz zu Ende, nahm die Brille ab und wandte sich ihm zu. Er merkte, wie ihre Augen sich erst auf die größere Entfernung einstellen mussten.
»Weil du stark genug bist, mich festzuhalten, wenn ich von der Terrasse springen will«, sagte sie so ruhig, als würde sie einem Fremden auf der Straße den Weg erklären.
Er ließ sich aufs Sofa fallen, streifte die Schuhe ab und legte die Füße hoch. Ihr Schreibtisch war fast leer, keine Bücher oder Papiere, nur eine leere Kaffeetasse.
»Falls es um die Uni geht, kann ich meine Pistole aus dem Schlafzimmer holen.«
»Für mich?«
»Nicht doch«, sagte er. »Für den, über den du schreibst.« Bevor sie antworten konnte, deckte er auch gleich die andere Möglichkeit ab: »Oder für den, an den du schreibst.«
»Volltreffer«, sagte sie.
»Also, an wen?«
»Severin, diesen Idioten.«
Er erinnerte sich nicht gleich, wer das war, dann aber fiel ihm ein Abendessen ein, zu dem ihn Paola vor fünf Monaten mitgeschleppt hatte. Ihr Kollege von der Anglistischen Fakultät, Claudio Severin, und dessen recht sympathische Frau, an deren Namen sich Brunetti nicht mehr erinnerte, hatten mit ihnen am Tisch gesessen.
»Seine Frau ist nicht an der Uni, stimmt’s?«, fragte Brunetti. Immerhin das wusste er noch.
»Nein. Sie ist Anwältin.«
»Gut, wenn die Leute einen anständigen Job haben«, bemerkte Brunetti in der Hoffnung, Paola zum Lachen zu bringen.
Sie lächelte nicht einmal. Folglich war die Sache ernst.
Brunetti wollte schon fragen, womit Severin sie so verärgert hatte, entschied sich dann aber für die neutralere Frage: »Was schreibst du ihm?«
»Dass ich mit seiner Einschätzung einer der Doktorandinnen nicht einverstanden bin.«
»Welche denn?«
»Anna Maria Orlando. Aus Bari, glaube ich. Hübsch. Schreibt sehr gut.« Ging es hier etwa, fragte er sich, um Vorurteile gegen Frauen aus dem Süden, die es wagten, klug zu sein?
»Und?«, fragte er.
»Severin hat sich in sie verknallt. Sie hat alle seine Vorlesungen besucht und ihn gebeten, ihr Doktorvater zu sein. Und jetzt hat er mir erzählt, er werde der Universität vorschlagen, sie als Forschungsassistentin einzustellen.«
»Soll ich etwa aufspringen und die Hände überm Kopf zusammenschlagen, als hätte ich dergleichen noch nie gehört?«, fragte Brunetti. Doch beim Gedanken an all die älteren Männer, die sich mit jüngeren Frauen ihr Leben ruinieren, setzte er in ernsterem Ton hinzu: »Und deine Mail?«
»Ich schreibe ihm inoffiziell, nicht als Mitglied des Gremiums, das sich mit solchen Einstellungen befasst, und weise ihn darauf hin, dass Signorina Orlando den Anforderungen der Fakultät wohl kaum genügen dürfte.«
»Als da wären?«, fragte Brunetti, neugierig mit den Zehen wackelnd.
»Außerordentliche Leistungen in den Seminaren«, sagte Paola und hob den Daumen; dann den Zeigefinger: »Fürsprache und Zustimmung ihrer früheren Professoren.« Für die letzte Bedingung kam der Mittelfinger hinzu: »Und mindestens zwei Veröffentlichungen in angesehenen Fachzeitschriften auf dem Spezialgebiet des Kandidaten.«
»Als da wäre?«
Paola antwortete nach kurzem Zögern: »Die Silbergabelromane.«
Er vergaß seine Zehen und fragte: »Die was?«
»Die Silbergabelromane. Davon habe ich dir schon einmal erzählt.«
Brunetti sah sie verständnislos an. »Kann mich nicht erinnern.« Nach einer Pause, die Paola zu seinem Bedauern nicht füllte, fragte er: »Also, worum geht es?«
»Englische Romane im 19. Jahrhundert voller langatmiger Belehrungen, wie man sich in Gesellschaft zu benehmen oder nicht zu benehmen hat.« Da er dazu schwieg, fügte sie hinzu: »Damals sehr populär.«
»Du hast sie alle gelesen?«, fragte er, nie so ganz sicher, was sie während ihres Studiums in Oxford getrieben hatte.
»Einen.«
»Erinnerst du dich an den Titel?«, fragte er. Paola vergaß nie etwas.
Sie schloss kurz die Augen, bis ihr der Name wieder einfiel: »Contarini Fleming.«
Brunetti wartete vergebens, bevor er sie bat: »Erzähl.«
»Es ist ziemlich kompliziert«, begann sie. »Die Mutter des Helden stirbt bei seiner Geburt; er wächst in Skandinavien auf und verliebt sich in eine verheiratete Frau, die ihn zurückweist. Verzweifelt geht er nach Venedig, wo er sich in seine Cousine verliebt. Die weist ihn nicht zurück, und dann stirbt auch sie im Kindbett.« Paola verstummte, ihr Blick ging ins Leere, ein Blick, den Brunetti ihr Pokergesicht nannte, weil er dann nie wusste, was sie im Schilde führte.
Wie wenn sie mit einer rhetorischen Frage ihre Studenten zum Reden bringen wollte, meinte sie: »Ist es nicht interessant, dass Frauen in viktorianischen Romanen so oft im Kindbett oder an Tuberkulose sterben?«
Brunetti schenkte sich die Antwort. Stattdessen fragte er: »Und das Buch war ein Erfolg?«
»Ja. Sehr.«
»Und der Autor? Was ist aus ihm geworden?«, fragte Brunetti, überzeugt, dass es mit dem Mann ein böses Ende genommen haben musste, nachdem er derlei nicht nur gelesen, sondern auch noch geschrieben hatte.
»Er wurde Premierminister von England«, antwortete Paola.
Das musste Brunetti erst einmal verdauen. Schließlich sagte er: »Um auf unser ursprüngliches Thema zurückzukommen: Wie alt ist Signorina Orlando?« Severin schätzte er auf Ende fünfzig.
»Ein- oder zweiundzwanzig, würde ich sagen.«
»Oje, oje, oje. Das verheißt nichts Gutes.« Und um Paola mit einer ihrer englischen Lieblingsredewendungen eine Freude zu machen, fügte Brunetti hinzu: »Tränen vor dem Schlafengehen.«
»Ich fürchte, an Schlafengehen ist nicht mehr zu denken, mein Lieber«, sagte sie und beugte sich über den Bildschirm.
Nicht im Geringsten abgeschreckt von ihrem Sarkasmus, blieb Brunetti beim Thema: »Was schreibst du ihm?«
»Ich schicke ihm eine Kopie ihrer Zeugnisse und der Stellungnahmen ihrer früheren Professoren.«
»Ist das erlaubt?«
Sie sah verblüfft zu ihm hoch. »Selbstverständlich. Sie sind Teil der Unterlagen, die jeden Studierenden von Jahr zu Jahr begleiten.«
»Und Professoren halten schriftlich fest, was sie von ihren Studenten halten?«, fragte Brunetti, als sich plötzlich die akademische Freiheit in ihrer ganzen Größe vor ihm auftat. Ach, wenn doch nur …
»Natürlich nicht«, antwortete Paola und nahm die Hände von der Tastatur. »Oder vielmehr, sie verwenden einen Code, den jeder kennt.«
»Ah«, seufzte Brunetti zufrieden. Wie beruhigend, dass Akademiker sich genau wie Polizisten verhielten, wenn sie einander bewerten sollten: Alles formuliert mit Blick auf die Folgen, die negative oder kritische Aussagen nach sich ziehen mochten. »Sehr eifrig« für »unbesonnen«; »von bemerkenswerter Ernsthaftigkeit« für »schwerfällig«; »offen für die Meinungen ihrer Kollegen« für »entscheidungsschwach«; »zeigt enorme intuitive Begabung« für »scheint sich mit dem Strafgesetzbuch nicht auszukennen«.
Brunetti nickte erleichtert; endlich musste er sich keine Illusionen mehr machen, dass es Institutionen geben könnte, in denen die Leistungen objektiv und ehrlich beurteilt wurden.
Er hielt die Zehen still und sagte: »Ich verstehe nur nicht, warum du dir überhaupt die Mühe machst, ihm zu schreiben.«
»Das habe ich dir schon einmal erzählt, Guido: Er war gut zu mir, als ich an der Uni anfing.« Sie drehte sich zu ihm um, wandte sich aber gleich wieder dem Bildschirm zu, fast, als sei die Bemerkung ihr peinlich.
Brunetti, der sich erinnerte, nickte nur. Paola fühlte sich jedem, der sie jemals freundlich behandelt hatte, auf ewig zu Dank verpflichtet, und er wusste nicht, ob das nun eine Tugend oder eine Schwäche war. Doch wie kam er nur darauf, dabei an Schwäche zu denken? »Also, was willst du ihm sagen?«
Den Blick auf den Bildschirm gerichtet, antwortete Paola: »Dass es ratsam wäre, wenn er sich die von der Universität online gestellten Anforderungen für den Posten einmal genau ansehen würde, und dass er sich fragen sollte, ob Signorina Orlando sie in jedem Punkt erfüllt.«
»Klingt vernünftig«, meinte Brunetti.
»Und ob«, stimmte Paola zu. »Insbesondere weise ich ihn auf die zwei Veröffentlichungen in angesehenen Fachzeitschriften hin.«
Brunetti war ein mutiger Mann, ein wissbegieriger Mann, und so fragte er: »Was sind das für Zeitschriften, die als angesehen gelten?«
Paola schloss kurz die Augen: »Viktorianische Literatur und Kultur und Journal für Viktorianische Kultur.« Da Brunetti sich unbeeindruckt zeigte, fügte sie hinzu: »Es gibt natürlich noch viele andere.«
»Hört sich an wie diese Zeitschriften, die bleiche Leute auf der Straße verkaufen.«
»Wir sind in Venedig, Guido«, sagte sie und wandte sich wieder ihrem Computer zu.
Brunetti insistierte nicht weiter und suchte lieber in der Küche nach etwas Essbarem, das ihm bis zum Abendessen über die Runden half.
2
Als Brunetti am nächsten Morgen zur Questura ging, strahlte ihm auf der Rialtobrücke die Sonne ins Gesicht. Auf dem Scheitel der Brücke blieb er stehen. Er betrachtete die Palazzi, die bis zur Universität in Reih und Glied standen und dann linker Hand aus dem Blickfeld verschwanden.
Am Fuß der Brücke bog Brunetti ab und machte erst bei Didovich wieder halt auf einen Kaffee an der Bar, wobei er die Schlagzeilen der Zeitung des Mannes neben ihm überflog. Dann ging er weiter, an der Miracolikirche entlang geradeaus zum Campo Santi Giovanni e Paolo, wo er die überwältigenden Fassaden der Basilica und des Ospedale auf sich wirken ließ. Er verweilte auf dem Campo, voller Sehnsucht, die Dinge noch einmal so zu sehen wie beim ersten Mal. Dann aber wurde ihm klar, dass er damals drei Jahre alt gewesen war und vermutlich nichts anderes wahrgenommen hatte als die Löwen an der Fassade des Ospedale und Colleonis Pferd.
Innehalten und Schönheit bewundern war in jüngerer Vergangenheit nicht möglich gewesen, als er und all jene, die noch zur Arbeit gehen mussten, dies nur sehr vorsichtig taten, stets den kürzesten Weg nahmen, auf das Vaporetto möglichst verzichteten, bei Wind und Wetter lieber zu Fuß gingen und um andere Passanten einen Bogen machten, wenn die keine Maske trugen. Jetzt hatte die Lage sich etwas entspannt, und Brunetti konnte wenigstens in diesem winzigen Punkt zur Vergangenheit zurückkehren und etwas zum reinen Vergnügen tun, und das ohne Furcht. Im langen Lauf des Lebens nur eine Kleinigkeit, die Brunetti jedoch viel bedeutete.
Pendolini, der Wachmann am Eingang, trug immer noch konsequent eine Maske. Viele von denen, die im Haus arbeiteten, verzichteten mittlerweile darauf. Hielten die sich für unverwundbar, weil sie ja schließlich Polizisten waren, oder hatten sie das Risiko, keine Maske mehr zu tragen, gründlich erwogen? Brunetti hatte seinen Bruder Sergio gefragt, der im Ospedale Civile arbeitete, und der hatte gesagt, bei der Arbeit trage er immer eine Maske, sonst nicht, Brunetti als vollständig Geimpfter solle allenfalls eine tragen, wenn er sich mit jemand Gefährdetem in einem kleinen geschlossenen Raum befände.
»Eine Frau möchte Sie sprechen, Commissario. Sie wartet schon eine ganze Weile«, begrüßte ihn der Wachmann durch seine Maske. Er wies auf eine Gestalt, die hinten in der Eingangshalle auf der Besucherbank saß und von der Brunetti nur die linke Hälfte erkennen konnte. Die andere Hälfte wurde von einem Mann verdeckt, der vor ihr stand und offenbar mit ihr redete. Über den beiden hing ein Foto der Fontana di Trevi, was Brunetti seit jeher rätselhaft fand.
»Wie heißt sie?«
»Das hat sie nicht gesagt, Signore. Sie meinte, sie kenne Sie.«
»Und wer ist das vor ihr?«
»Sieht nach Tenente Scarpa aus«, sagte der Wachmann. »Er muss nach unten gekommen sein, nachdem ich sie zum Warten dorthin geschickt hatte.«
Plötzlich wandte die Frau ihren Blick zum Eingang, und als der Mann daraufhin zur Seite trat und sich umdrehte, entpuppte er sich tatsächlich als Tenente Scarpa, der Assistent – andere hielten ihn eher für den Handlanger – von Vice-Questore Giuseppe Patta, Brunettis direktem Vorgesetzten.
Bei Brunettis Anblick mimte Scarpa ein Lächeln, raunte der Frau etwas zu, wandte sich dann langsam ab und ging zur Treppe. Obwohl Brunetti nun freie Sicht auf die Frau gehabt hätte, behielt er den Tenente im Blick, bis dieser hinter dem ersten Treppenabsatz verschwunden war.
Dann sah er zu der Frau hinüber, die eine Maske trug und ihm aus der Entfernung nicht bekannt vorkam. Schlank, eine Kurzhaarfrisur, die alles andere als knabenhaft wirkte und so viel Blond enthielt, dass sie alles andere als grau wirkte.
Auch sie hatte Scarpa auf der Treppe nachgesehen. Erst dann wandte sie sich zum Eingang. Sie hob die Linke und schwenkte sie wie ein Metronom, um ihn auf sich aufmerksam zu machen. In Brunetti stiegen Erinnerungen an alte – und nicht gerade die glücklichsten – Zeiten auf, denn diese Handbewegung konnte nur einer gehören: Elisabetta Foscarini. Ihre Familie hatte die viel größere Wohnung über Familie Brunetti bewohnt, damals, vor Jahrzehnten, in Castello. Ein alter Kriegskamerad von Brunettis Vater hatte ihnen die kleine Parterrewohnung mietfrei zur Verfügung gestellt. Als Gegenleistung erledigte sein Vater alle möglichen Arbeiten am und im Haus. Er fegte die Treppen, trug den Müll hinaus, machte kleinere Reparaturen und Besorgungen für die Hausbewohner und Nachbarn. In Castello gab es so gut wie keine Geheimnisse. Alle wussten, dass die Familie arm und der Vater seltsam war. Und dass sie umsonst dort wohnten.
Brunetti drehte sich zu Pendolini und bat ihn um eine Maske. Überrascht holte der Beamte eine unter dem Tresen hervor. Brunetti dankte, befestigte sie hinter den Ohren und ging Elisabetta entgegen.
Als sie die Wohnung bezogen, war er auf der Mittelschule. Elisabetta, ein Einzelkind, fünf oder sechs Jahre älter als er, ging auf die Morosini, die schon damals als die beste Schule der Stadt galt.
Nach kaum einem Jahr in der Wohnung ertrug Brunettis Vater die Großzügigkeit seines Freundes nicht mehr, und die Familie zog in eine noch kleinere Wohnung, ein noch schlimmeres Loch bei Santa Marta, wo er und sein Bruder Sergio sich ein Zimmer teilten und das Verhalten seines Vaters so seltsam wurde, dass man ihn, als ehemaligen Soldaten, ins Militärkrankenhaus brachte und dort so lange festhielt, bis er praktisch verstummt war und nichts Seltsames mehr hervorbrachte. Immerhin war sein Vater nach der Entlassung liebevoller zu seinen Söhnen und seiner Frau und drückte seine Gefühle freigebig mit Umarmungen aus, die ihm leichter fielen als Worte.
Elisabetta erhob sich leichtfüßig und kam ihm entgegen. Genau wie damals ging sie kerzengerade und mit weiten Schritten. Wie gut sie aussah, wie wenig die Jahre ihr angetan hatten. Als er stehen blieb, tat sie es ihm nach, ein Meter blieb zwischen ihnen. Ihre Augen lächelten. »Ah, Guido, wie schön, dich zu sehen«, sagte sie in reinstem Italienisch. Ihre Familie hatte nie Veneziano gesprochen, den Dialekt der unteren Schichten. »Wie gut du aussiehst«, fuhr sie fort. »Es ist …«, sie stockte und schloss kurz die Augen, »… so lange her, dass ihr aus Castello weggezogen seid. Aber immerhin konnten wir uns noch in der Stadt Hallo sagen.« Wieder lächelten ihre Augen. »Sehr venezianisch, nicht wahr?«
Brunetti lächelte ebenfalls und nickte, ja, sie waren einander immer wieder begegnet. Anfangs hatten die Männer in ihrer Begleitung ein paarmal gewechselt, dann war es immer derselbe gewesen. Schließlich kam ein Baby hinzu, aus dem ein kleines Mädchen und dann ein Teenager wurde.
Auch Elisabettas Haarfarbe und Frisur hatten sich im Lauf der Jahre mehrmals geändert. Bald nachdem sie begonnen hatte, die Haare kurz zu tragen, waren die Haare des Mannes, der weiterhin an ihrer Seite ging, allmählich weiß geworden, etwas, das sie bei ihren eigenen offenbar zu verhindern wusste. Manchmal waren Brunetti und Elisabetta stehen geblieben und hatten Erinnerungen ausgetauscht, freilich nur die guten. Einmal war der Weißhaarige dabei gewesen und auf einen Kaffee mitgekommen, Bruno del Balzo, ein erfolgreicher, stadtbekannter Geschäftsmann. Ihm gehörten nicht nur Unternehmen im Ausland, Fabriken für Maschinenteile, Kleidung und Schuhe, sondern auch Supermärkte in Marghera und Mestre und ein großes Feinkostgeschäft am Campo Santo Stefano, das auf Ausländer und die wachsende Zahl von Vegetariern und Veganern ausgerichtet war.
Seit gut zehn Jahren hatte Brunetti die beiden nicht mehr in der Gegend von San Marco getroffen und angenommen, sie seien umgezogen. Vor drei oder vier Jahren dann hatte er den Weißhaarigen einmal auf dem Campo Santi Giovanni e Paolo gesehen, wie er im Portal des letzten Palazzo linker Hand verschwand, als Brunetti gerade aus dem Rosa Salva kam.
»Schön, schön, schön«, begann Elisabetta wieder, ohne sich mit den albernen Verrenkungen aufzuhalten, die Erwachsene jetzt anstelle von Händeschütteln und Wangenküssen vollführten. Brunetti wusste um das Trügerische von Erinnerungen, dennoch machte das Wiedersehen mit Elisabetta ihm wenig Freude, nicht, weil er sie aus der härtesten Zeit seines Lebens kannte – und durch sie daran erinnert wurde –, sondern weil ihm gerade einfiel, wie sie einmal, als sie ins Haus ging, nicht auf seine von Weitem herankommende Mutter gewartet hatte, um ihr die Tür aufzuhalten. Sie war eine junge Frau aus angesehener Familie; sie hatte viele Freunde; ihre Familie galt als wohlhabend; und doch, dieser Mangel an simpler Höflichkeit hatte den jungen Brunetti schockiert und seiner Bewunderung für Elisabetta einen Dämpfer verpasst.
Er wollte gerade versichern, wie sehr ihn das Wiedersehen freue, da erklärte sie, während sie den Blick durch die riesige Eingangshalle schweifen ließ, als gehöre das alles Brunetti: »Wir haben deine Karriere verfolgt, meine Mutter und ich.« Sie standen auf Augenhöhe. Da waren nur ein paar Fältchen und Altersflecken, doch das tat ihrer Schönheit keinen Abbruch. »Aus irgendeinem Grund war meine Mutter stolz auf deinen Erfolg«, erklärte Elisabetta. »Sie hielt so große Stücke auf dich.«
»Wirklich?«, fragte Brunetti, erfreut, dass Elisabettas Mutter ihn nicht vergessen hatte.
Während sie das übliche Ritual beim Wiedersehen alter Bekannter aufführten, fragte Brunetti sich die ganze Zeit, was Elisabetta von ihm wollte. Doch wohl nicht über alte Zeiten plaudern oder darüber lamentieren, wie sehr Castello sich mit den Jahren verändert hatte.
Sie blickte um sich und fragte: »Können wir irgendwo reden, Guido?«
Er nickte; sie hatte ihn zweimal mit Vornamen angesprochen, woraus er schloss, dass es um etwas Wichtiges ging. Aber was mochte das sein?
Brunetti wies auf die Treppe, die der Tenente genommen hatte. »Mein Büro ist oben. Hoffentlich stört es dich nicht, zwei Stockwerke hochzusteigen.«
»Du liebe Zeit, nicht doch«, sagte Elisabetta. »Wir wohnen im vierten Stock. Ohne Aufzug.«
Brunetti dachte an den Palazzo, in den er ihren Mann am Campo Santi Giovanni e Paolo hatte verschwinden sehen. Wie wohl die Aussicht von da oben war? Vom vierten Stock aus mussten die Berge zu sehen sein. »Also, gehen wir?«, fragte er.
Er bot ihr nicht den Arm, denn in diesen Zeiten scheuten viele vor Berührung zurück. Keine Wangenküsse zur Begrüßung mehr, keine Umarmungen, und niemand stupste mehr einen Fremden am Arm, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er etwas verloren oder sich in der Tür geirrt hatte. Sang- und klanglos war ihnen allen eisige Förmlichkeit auferlegt worden. Brunetti fehlte der lockere, freundliche Umgang zwischen den Menschen sehr.
Auf der Treppe erkundigte Elisabetta sich nach seiner Familie, seiner Frau und den Kindern. Sie schien aufrichtig interessiert. Seine Frau, erklärte Brunetti nur, arbeite immer noch an der Universität, sein Sohn studiere dort und seine Tochter wolle in zwei Jahren damit anfangen. Dann verlangsamte er seine Schritte und fragte nach dem kleinen Mädchen, das er hatte aufwachsen sehen; ihren Mann ließ er außen vor.
Am Fuß der zweiten Treppe zögerte sie kurz. »Sie ist kein kleines Mädchen mehr. Sie ist über dreißig.« Elisabetta antwortete ebenso summarisch wie er selbst.
Oben angekommen, blieb Brunetti kurz stehen, falls Elisabetta eine Verschnaufpause brauchen sollte. In diesem Moment vernahm er Schritte und sah Claudia Griffoni die Treppe hochkommen. Als Griffoni registrierte, dass Brunetti nicht allein war, wollte sie mit zum Gruß erhobener Hand wortlos an ihnen vorbei nach oben gehen.
»Claudia«, rief Brunetti.
Griffoni drehte sich zu ihnen um.
»Darf ich dir eine alte Freundin vorstellen?« Brunetti trat einen Schritt zurück und sagte: »Elisabetta Foscarini.«
Griffoni streckte freundlich die Hand aus, eine Geste, die ihr Gegenüber offensichtlich überraschte. Elisabetta schüttelte lächelnd den Kopf, und Griffoni entschuldigte sich: »Oh, Verzeihung. Ich vergesse das immer wieder.«
Elisabetta behielt die Hand unten. »Piacere.«
»Ganz meinerseits, Signora.«
Um ihnen allen über den peinlichen Augenblick hinwegzuhelfen, erklärte Brunetti seiner Kollegin: »Wir haben als Teenager im selben Haus gewohnt.«
Griffoni zwinkerte der anderen Frau komplizenhaft zu. »Ich wusste gar nicht, dass der Commissario mal Teenager war.«
Elisabetta ließ ein wenig damenhaftes Prusten vernehmen, gestattete sich, laut aufzulachen, und sah grinsend zwischen Brunetti und Griffoni hin und her.
Bevor Brunetti etwas sagen konnte, nickte Griffoni den beiden zu und verzog sich nach oben.
In seinem Büro sorgte Brunetti erst einmal für frische Luft. Als er vom Fenster zurücktrat, stieß er beinahe mit Elisabetta zusammen. Er sprang beiseite, bat um Verzeihung und ließ sich ihren Mantel geben. Den Schnitt hatte er schon bewundert; jetzt hatten seine Hände Gelegenheit, auch den Stoff zu begutachten.
Er hängte das Teil in den Schrank und rückte einen Stuhl vor seinen Schreibtisch. Kurz spielte er mit dem Gedanken, sich hinter den Tisch zurückzuziehen, dann aber stellte er den zweiten Stuhl dem ihren gegenüber, jedoch in einiger Entfernung. Er nahm die Maske ab; davon ermutigt, tat sie desgleichen und verstaute ihre in einer verschließbaren Plastikhülle aus ihrer Handtasche.
Jetzt, wo er ihr ganzes Gesicht sehen konnte, bemerkte Brunetti noch deutlicher, wie gut Elisabetta sich gehalten hatte. Sie war schlanker als früher, nur um die Augen und unterm Kinn hatte die Zeit Spuren hinterlassen. Ihr Blick war noch derselbe: dunkeläugig, beharrlich, fest, ohne jede Spur jener latenten Koketterie, wie attraktive Frauen sie nicht selten ausstrahlen.
War er damals nicht wenigstens ein bisschen in sie verliebt? Irgendwie schon, dachte Brunetti, aber das waren andere Zeiten gewesen, und niemals hätte ein Junge aus seiner Schicht es gewagt, einem Mädchen wie ihr den Hof zu machen. Vermutlich hatte sie das mit einem einzigen Blick klargestellt, falls nicht schon die Sache mit der Haustür seine Leidenschaft hatte erkalten lassen.
Ihre Stimme holte ihn in die Gegenwart zurück, in der sie sich Auge in Auge gegenübersaßen. »Was für nette Kollegen du hast«, begann sie. Und da er schwieg, fügte sie hinzu: »Du bist nicht gerade beschäftigt?« Ihr anbiedernder Ton war ihm unangenehm.
»Ich habe jede Menge Zeit. Dieser Tage werden nur wenige Verbrechen begangen.«
»Na, das ist doch gut, oder?«, meinte sie geistesabwesend und ohne weiter nachzuhaken. »Ich möchte dich nicht stören.« Es klang beinahe, als hoffte sie auf ein baldiges Ende des Treffens, ein verbreiteter Wunsch bei denen, die in die Questura kamen.
Gedankenlos streckte sie die Hand aus, vielleicht, um ihn am Arm zu berühren, hielt aber noch rechtzeitig inne. Sie zog die Hand zurück und senkte den Blick. Beide schwiegen.
Plötzlich erinnerte Brunetti sich an einen Nachmittag – da mochte er dreizehn gewesen sein –, als er am Küchentisch, der einzigen Stelle, wo genug Platz zum Schreiben war, seine Hausaufgaben erledigte. Es klopfte an der Wohnungstür, und da seine Mutter gerade beim Vermieter war, dem sie zweimal wöchentlich die Wohnung putzte, musste er selbst öffnen.
Er ließ die Hausaufgaben liegen, um aufzumachen, und da stand Elisabettas Mutter mit einem großen Kochtopf vor der Tür.
Sie war eine große, erschreckend dünne und nicht sehr hübsche Frau mit schütterem Haar, das sie wie seine Großmutter in einem winzigen Knoten trug. Nie wäre man auf die Idee gekommen, dass sie mit einem reichen Notar verheiratet war, es sei denn, man war Venezianer und kannte die Vorgeschichte ihrer Ehe. Sie war das einzige Kind von Notaio Alberto Cesti, einem der erfolgreichsten Notare der Stadt. Dessen junger Assistent, Leonardo Foscarini, hatte sich, wie böse Zungen behaupteten, beim bloßen Anblick der Mandantenliste und der Summen, die sie einspielte, auf der Stelle in sie verliebt.
Elisabettas Mutter grüßte den jungen Brunetti und bat ihn um einen Gefallen: Ob sie den Topf dalassen könne? Er sah, wie groß der war, und bot an, ihn ihr abzunehmen.
»Danke, Guido«, sagte sie. »Er ist heiß, am besten stelle ich ihn einfach auf den Herd.« Sie machte drei Schritte, setzte den Topf ab und schüttelte die Hände aus, die zu lange die heißen Griffe gehalten hatten. Dampf drang unter dem Deckel hervor, und die Küche der Brunettis füllte sich mit dem Duft von Tomaten, Kräutern und Zwiebeln.
Er wollte ihr etwas anbieten, doch gab es nichts anderes anzubieten als Wasser, und das war ihm peinlich. »Was soll ich meiner Mutter sagen?«, fragte der junge Brunetti.
»Sie hat mir ihr Rezept für pasta e fagioli gegeben, und das habe ich heute probiert.« Elisabettas Mutter lachte – Brunetti, der sie noch nie hatte lachen hören, fand das schön. Sie rieb sich die Hände an der Schürze – Brunetti sah sie oder seine Mutter selten ohne dieses Kleidungsstück – und sagte irgendwie verlegen: »Ich habe nicht aufgepasst und anscheinend zu viele Bohnen und Pasta reingetan, und jetzt habe ich viel zu viel gekocht.«
Es war nicht das erste Mal, dass Signora Foscarini die Resultate ihrer mangelnden Kochkünste nach unten brachte und die Brunettis darum bat, ihr die Peinlichkeit zu ersparen, ihrer Familie »diese Bescherung« oder »dieses viel zu groß geratene Gericht« auftischen zu müssen. Und die Brunettis halfen ihr bereitwillig aus der Patsche.
Sie zeigte auf den Topf. »Ich musste ständig Wasser nachgießen, dabei wurde es immer mehr, und schließlich musste ich es auf zwei Töpfe verteilen. Das hier«, sagte sie, »ist nicht mal die Hälfte. Wir schaffen niemals alles, also sag deiner Mutter, sie soll euch bitten, beim Aufessen zu helfen.«
Brunetti war nicht in einer Welt aufgewachsen, in der Essen verschenkt wurde, erst recht nicht in großen Mengen, er wusste nur, Elisabettas Mutter war eine gute Frau. Wie sorgfältig sie ihrer Geschichte den Anstrich von Wahrheit zu geben versuchte, begriff er erst später. Jetzt dankte er ihr und wünschte nichts so sehr, als ihr etwas anbieten zu können, und sei es nur ein Apfel.
Sie ging zur Tür. »Hoffentlich schmeckt es euch«, sagte sie lächelnd. »Ich fürchte, wir alle werden noch die ganze Woche davon essen.«
Als sie gegangen war, nahm Brunetti den Deckel von dem heißen Topf. Essensduft schlug ihm entgegen: Bohnen, Tomaten und Zwiebeln, Rosmarin und Thymian. Und oben zwischen kleinen Möhrenscheiben schwammen so viele Stückchen Wurst, wie er noch nie gesehen hatte.
Ihn überkam ein wohliges Gefühl von Sicherheit: Schon ein Viertel vom Inhalt dieses Topfs hätte genügt, ihn satt zu machen. Jetzt, Jahrzehnte danach, erinnerte er sich nicht mehr, ob sie die Pasta an jenem Abend aufgegessen hatten oder wie viel er davon abbekommen hatte. Er erinnerte sich nur noch an die plötzlich in ihm aufsteigende Gewissheit, dass er nicht würde hungern müssen, zumindest nicht an diesem Abend.
Unwillkürlich erklärte Brunetti, zum ersten Mal aufrichtig freundlich, seit er Elisabetta unten getroffen hatte: »Es ist sehr schön, dich wiederzusehen.« Und in Erinnerung an die Güte ihrer Mutter fügte er hinzu: »Wir hatten großes Glück, in eurer Nähe zu wohnen.«
Er bemerkte ihre Verblüffung. Sie sah auf ihre im Schoß verschränkten Hände, dann zu Brunetti. »Meine Mutter hat immer gesagt, du seist ein guter Junge, Guido.«
Brunetti errötete. Um das zu überspielen, fragte er, ohne dass ihm auf die Schnelle eine schonendere Formulierung eingefallen wäre: »Lebt sie noch?«
Elisabetta schüttelte den Kopf. »Nein. Sie ist vor einigen Jahren gestorben.«
»Das tut mir leid«, sagte Brunetti, und er meinte es ernst. »Sie war sehr nett zu meiner Mutter.« Wieder riss sich eine Erinnerung los und begann, an die Oberfläche zu treiben.
»Oh, sie war zu allen nett«, sagte Elisabetta, als sei das Kompliment ihr unangenehm. Ja, richtig, dachte Brunetti; es ging um Freundlichkeit, um ihre oder seine Mutter.
»So hatte meine Mutter jemanden, mit dem sie reden konnte«, fügte Brunetti hinzu.
Elisabetta nickte. »Meine Mutter hat mir erzählt, wie sehr man sich um dich und Sergio gekümmert hat.«
Erstaunlich, dass Elisabetta all die Jahre den Namen seines Bruders behalten hatte. Doch Brunetti ließ sich seine Überraschung nicht anmerken. Um etwas zu erwidern, meinte er: »Damals habe ich nicht verstanden, wie einsam sie war, oder wie traurig, ich wusste nur, es tat ihr jedes Mal gut und half ihr über manche Tage, wenn sie mit ihr reden konnte.«
Elisabetta war sichtlich verwirrt. »Sprichst du von meiner Mutter?«, fragte sie, und es klang beinahe entrüstet.
Ihr Ton rief Erinnerungen wach, er hörte seine Mutter, selbst die Freundlichkeit und Geduld in Person, sagen: »Ich glaube, ihre Mutter weiß, Elisabetta hat kein so gutes Herz wie sie.« Mit einem Hemd seines Vaters am Bügelbrett stehend, hatte sie hinzugefügt: »Aber das scheint Elisabetta nicht zu kümmern.«
Ganz in diese Gedanken versunken, hatte Brunetti es schwer, auf Elisabettas Frage einzugehen. Schließlich platzte er heraus: »Nein doch, nein. Ich kannte sie ja kaum. Ich habe von meiner Mutter gesprochen, nicht von deiner, Elisabetta. Glaub mir bitte.«
Elisabetta schloss die Augen und presste die Lippen zusammen. Sie setzte zum Sprechen an, hielt inne, öffnete den Mund und dann die Augen und sagte schließlich: »Entschuldige, Guido. Ich habe das falsch verstanden.« Nachdenklich, als sinne sie einem neuen Gedanken nach, fuhr sie fort: »Vermutlich müssen Frauen mehr reden als Männer. Es hilft uns, wenn wir erzählen können, wie man uns behandelt und was wir von anderen halten und was uns glücklich macht oder traurig.«
»Während Männer nur über Geld und Macht reden?« Brunetti versuchte, die Frage wie einen Scherz klingen zu lassen.
»Richtig«, ging Elisabetta über den Scherz hinweg oder tat zumindest so, als habe sie ihn nicht mitbekommen.
Beide schwiegen, bis er sich vorbeugte und seine Hand auf ihre Stuhllehne legte. »Warum bist du zu mir gekommen, Elisabetta?«
Ihre Hände verkrampften sich. Sie versuchte, nach hinten auszuweichen, saß aber schon so weit hinten wie möglich und brachte nur den Stuhl zum Knarren. Sie wandte den Blick von ihm ab zum Fenster.
Nachdem Elisabetta mehrmals tief Luft geholt hatte, fuhr sie sich mit der Hand übers Gesicht, drehte sich wieder zu ihm um und erklärte: »Es geht um Flora, meine Tochter.«
Wieder sah Elisabetta zum Fenster, offenbar nach Worten suchend. Brunetti wusste, in Situationen wie dieser war es das Beste, abzuwarten und beharrlich zu schweigen.
Als sie die Sprache wiedergefunden hatte, sah sie ihm in die Augen und meinte: »Ihr Mann hat etwas gesagt, das sie das Schlimmste befürchten lässt.«
3
Brunetti hatte sich in langen Jahren antrainiert, keine Reaktion zu zeigen, wenn Zeugen, Opfer oder Verdächtige ihre Aussagen machten. Er hörte sich die Geständnisse von Mördern an, ohne mit der Wimper zu zucken; er hörte mit einer Miene, die nichts als Aufmerksamkeit bekundete, Verbrechensopfer unter Tränen von Übergriffen, Misshandlung und Vergewaltigung erzählen; er blieb äußerlich gelassen, wenn Mörder behaupteten, mit der Überwachungskamera am Haus des Opfers stimme etwas nicht.
Und auch jetzt widerstand er dem Drang, Elisabettas Hand zu nehmen, ihr Trost oder Hilfe anzubieten, während sie in den Abgrund blickte, der alle Eltern in Panik versetzt: dass ihrem Kind etwas zustoßen könnte.
Brunetti wusste nichts über die Frau, zu der Elisabetta herangewachsen war, nichts über ihre Ehe und schon gar nichts über ihre Tochter. Wie hatte Elisabetta sie erzogen? Glich sie ihrer Mutter oder ihrem Vater? Gab es Enkelkinder? Sie schwiegen immer noch beide, und er beschloss, Elisabetta so zu behandeln wie jede andere Unbekannte, die ihm ihre Geschichte erzählte.
Brunetti ergriff endlich das Wort und sagte: »Wenn ich das verstehen soll, Elisabetta, brauche ich mehr Informationen. Es mag dir unangenehm sein, über persönliche Dinge zu reden, aber es muss sein, sonst können ich oder die Polizei dir nicht helfen.«
Sie schoss nach vorn. »Genau das möchte ich nicht, Guido.« Ihre Stimme war schrill geworden, schnappte beinahe über. »Du kennst doch dieses Nest, wie schnell hier Tratsch und Gerüchte verbreitet werden, auch über Leute, die man gar nicht kennt.«
Wem sagte sie das? Wer ein Geheimnis bewahren wollte, musste es für sich behalten, aber das schafften nur die wenigsten. Elisabetta hob das Kinn. Als solle er ihre Worte auswendig lernen, sagte sie betont langsam und deutlich: »Guido, in all diesen Jahren hat meine Mutter nie etwas ausgeplaudert – kein einziges Wort –, was deine Mutter ihr erzählt hat.« Da er schwieg, fuhr sie fort: »Und auch ich habe nie etwas ausgeplaudert, was deine Mutter erzählt hat, wenn ich dabei war.« Aus dem Mund eines Fremden hätte dies wie eine Drohung geklungen; so aber nahm er es als Zeichen, wie ernst es ihr war.
Verlangte sie von ihm, dass er ebenfalls dichthielt? Dass seine Mutter etwas erzählt hatte, das auch nur im Entferntesten mit einer Gesetzesübertretung zu tun hatte, war ganz unmöglich. Wenn hingegen die Worte des Schwiegersohns Elisabetta so sehr beunruhigt hatten, dass sie bei der Polizei Hilfe suchte, ging es womöglich um eine Straftat.
Die Generation ihrer Eltern kannte Verbrechen nur vom Hörensagen. Sein Vater war ein ehrlicher, rechtschaffener Mann, dem die jahrelange Kriegsgefangenschaft aufs Gemüt geschlagen war, der sich aber seinen Anstand immer bewahrt hatte. Manchmal redete er wirres Zeug, doch das waren nur Worte. Außerdem hatten irgendwelche Geheimnisse, die Brunettis oder Elisabettas Eltern gehabt haben mochten, nach all den Jahren keine Bedeutung mehr und taugten nicht mehr für einen Skandal. Trank er? Trank sie? Waren die Kinder beim Ladendiebstahl erwischt worden? Hatte er eine Geliebte? Hatte sie einen? Fragen wie diese interessierten heute niemanden mehr. Die Zeiten hatten sich geändert und die meisten Erpresser arbeitslos gemacht. Ihre Mutter war gut zu seiner gewesen; alles andere zählte für Brunetti nicht.
Elisabetta deutete sein Schweigen offenbar als Zögern, ihr irgendeine Zusage zu machen, und begann daher erneut: »Wie gesagt, ich möchte nicht …«, doch Brunetti unterbrach sie.
»Also schön, Elisabetta«, sagte er, noch immer unter dem Eindruck seiner Erinnerungen. »Die Sache bleibt unter uns. Keine Polizei.« Misstraut denn wirklich jeder der Polizei?, fragte er sich. Trauten die Leute nur Familie und Freunden? Und selbst da hatten sie ihre Vorbehalte.
Er überlegte, was ihn erwarten konnte – Familienprobleme waren immer schlimm –, und sagte: »Ich möchte Commissario Griffoni dazuholen.«
Er sah Abwehr in ihren Augen, kam ihr jedoch zuvor: »Du kannst ihr vertrauen, Elisabetta. So sehr, wie du mir vertrauen kannst.«
Darüber dachte Elisabetta lange nach, bevor sie nickte.
Brunetti nahm sein Handy und wählte Griffonis Nummer.
»Sì?«, meldete sie sich beim ersten Klingeln.
»Komm bitte, und hör dir an, was meine Freundin zu sagen hat.«
»Zwei Minuten«, sagte Griffoni und legte auf.
»Sie ist gleich hier.« Worüber könnten sie sprechen, bis Griffoni eintraf? Von der Tochter wollte er nicht anfangen: Das Thema käme noch früh genug zur Sprache.
»Deine Mutter, war sie bis zum Ende geistig da?«, fragte er, wohl wissend, dass er damit eine Grenze verletzte. Der Geist seiner eigenen Mutter hatte sich schon lange verabschiedet, bevor dann auch ihr Körper starb, und Brunetti wusste nicht zu sagen, welcher Tod der schlimmere war, und für wen. In all den Jahren hatte er viele befragt, die Vater oder Mutter verloren hatten, aber nie etwas erfahren, das ihm weitergeholfen hätte.
Elisabetta antwortete kaum hörbar: »Sie war lange krank, aber sie war bis zum Ende bei sich.«
Weiteres blieb ihnen erspart, schon klopfte es dreimal, und Griffoni kam ins Zimmer.
Sie lächelte Elisabetta zu, holte sich den dritten Stuhl vom Fenster und setzte sich in gleicher Entfernung zu ihnen beiden. Sie wirkte vollkommen entspannt, und Brunetti registrierte, wie Griffonis Ruhe sich auf die andere Frau übertrug.
Zunächst einmal musste er Griffoni die Abmachung erklären, in die sie ungefragt einbezogen worden war. »Signora Foscarini spricht mit mir als einem alten Freund, nicht als Polizisten«, begann er und ließ seiner Kollegin Gelegenheit nachzufassen.
»Das heißt«, fragte sie denn auch, »wir ermitteln privat, und es kommt nicht als offizieller Fall in die Akten?« Dies war eine Missachtung der Vorschriften – oder Schlimmeres –, doch ihre Stimme blieb vollkommen ruhig und gelassen. Sie akzeptierte einfach, dass die Abmachung, die er mit seiner Freundin getroffen hatte, nun auch für sie galt.
»Ja«, meinte Brunetti nur.
Griffoni hielt ihr Notizbuch hoch. »Darf ich mitschreiben?«
»Ja«, sagte Brunetti mit einem Blick zu Elisabetta.
Elisabetta sah Griffoni unverwandt an und erklärte schließlich, wie um die Grenzen ihrer Macht zu testen: »Aber nur in Ihr Notizbuch; nichts geht in einen Computer.« Sie sah zu Brunetti, der zustimmend nickte.
Griffoni bestätigte lächelnd: »Selbstverständlich, Signora«, schlug das Notizbuch auf und zückte einen Stift.
Brunetti wandte sich Elisabetta zu. »Du hast mir erzählt, dein Schwiegersohn habe deiner Tochter etwas gesagt, das sie in Schrecken versetzt habe.«
Elisabetta nickte nur.
Griffoni hob den Stift. »Dürfte ich Sie bitten, mir Namen und Alter der beiden zu nennen, Signora, mir zu sagen, wie lange sie sich kennen und seit wann sie verheiratet sind?« Sie hielt das Notizbuch so, als sei es ein lebendiges Wesen, das die Fragen von sich aus stellte.
Das war eine Methode, die Brunetti selbst oft anwandte und empfahl: die Zeugen von etwas Vertrautem erzählen lassen; ihnen einfache Fragen stellen, auf die es einfache Antworten gab – Zahlen, zum Beispiel. Einmal in Schwung geraten, fiel es dem Gegenüber leichter, dann auch schwierigere oder verfängliche Fragen zu beantworten.
»Flora del Balzo, sie ist einunddreißig. Ihr Mann heißt Enrico Fenzo, er ist zwei Jahre älter. Keine Kinder.« Nach einer Pause fügte Elisabetta hinzu: »Noch nicht.«
Griffoni sah lächelnd von ihrem Notizbuch auf, als freue sie sich schon auf die schöne Liebesgeschichte von Elisabettas Tochter: »Und wie lange kennen sich die beiden?«
»Ungefähr sechs Jahre. Geheiratet haben sie vor drei Jahren.«
Griffoni schrieb das auf. Ohne den Blick zu heben, erkundigte sie sich im Plauderton: »Würden Sie sagen, die Ehe ist glücklich?«
Elisabetta warf Brunetti einen überraschten Blick zu. Griffoni sah weiter in ihr Notizbuch, und Brunetti mimte nur gelindes Interesse.
»Ich denke schon, ja«, sagte Elisabetta schließlich. »Auf alle Fälle bis vor zwei Monaten. Da hat Flora mir erzählt, Enrico habe sich verändert.«
»In welcher Weise?«, schaltete Brunetti sich ein.
»Flora sagt, er wirke nervös und geistesabwesend. Sie hat erst davon angefangen, nachdem ich sie und Enrico einmal zum Essen eingeladen hatte.« Sie verstummte und legte die Rechte an ihre Lippen.
Nach einiger Zeit fragte Griffoni: »Was ist passiert, Signora?«
»Flora rief mich am Tag der Einladung an und sagte, sie könnten nicht, das heißt, sie schon, aber Enrico müsse bis spät arbeiten, und allein kommen wollte sie nicht.«
Den Stift über dem Papier, fragte Griffoni: »Was arbeitet Ihr Schwiegersohn denn?«
»Er führt anderen Leuten die Bücher.«
Brunetti hatte keine Ahnung von den Arbeitszeiten in der Buchführung, aber er ließ ihre Bemerkung durchgehen, um Griffonis Fragerhythmus nicht zu stören.
Griffoni nickte, als verstünde es sich von selbst, dass Buchhalter bis in die späten Abendstunden arbeiteten. »Mögen Sie mir sagen, für wen er tätig ist?«, fragte sie und schenkte der anderen jenes warme Lächeln, mit dem sie schon oft die verstocktesten Zeugen zum Reden gebracht hatte.
»Er hat sich selbstständig gemacht als ragioniere«, antwortete die Ältere. »Er hat eine ganze Reihe privater Klienten: Leute mit kleinen Geschäften, die nicht genug Umsatz machen, dass sie einen Steuerberater brauchen. Er hat sein Büro bei Il Giustinian, dort arbeitet er. Allein.«
»Macht er das schon immer so?«, fragte Brunetti, der nun auch an dem Gespräch teilnehmen wollte, auch wenn es für ernstere Fragen noch zu früh war.
»Nein. Als er nach dem Studium seine Zulassung bekam, war er zunächst bei der Caritas angestellt, dann bei einer Steuerberatungsfirma in Noale, bis er sich schließlich selbstständig machte.«
Brunetti und Griffoni tauschten einen Blick aus, und als sie kaum merklich nickte, fragte Brunetti: »Kennst du seine Klienten?«
Elisabetta überlegte. »Ganz am Anfang, gleich nachdem er sein Büro aufmachte, hat Bruno ihn beschäftigt, und der war so zufrieden mit ihm, dass er Enrico seinen Freunden empfahl.«
Griffoni sah sie fragend an, offenbar kam sie nicht mehr mit, und Elisabetta erklärte: »Das ist mein Mann, Bruno del Balzo.«
»Und seine anderen Klienten? Kennen Sie die auch?«
»Nein, nicht wirklich. Er hat mal von zwei Restaurants und einem Optiker gesprochen.« Sie ließ ihre Handtasche aufschnappen, wühlte darin herum und nahm ein dunkelbraunes Brillenetui heraus: Brunetti erkannte den Namen des Optikers. Den Blick abgewandt, versuchte sie, sich an andere Klienten ihres Schwiegersohns zu erinnern, schüttelte dann aber den Kopf.
Weil er dieser Ansicht war und nicht, um etwas Schmeichelhaftes über Elisabettas Schwiegersohn zu sagen, bemerkte Brunetti: »In diesen Zeiten ist man sicher gut beraten, für ein breites Spektrum von Klienten zu arbeiten. Selbst beim härtesten Lockdown muss doch das eine oder andere Geschäft offen bleiben.« Mein Gott, dachte er, infiziert diese Krankheit jetzt wirklich alle unsere Gedanken?
»Aber die Namen wissen Sie nicht?«, fragte Griffoni.
Elisabetta dachte angestrengt nach. »Eins der Restaurants gehört einem Ottavio Pini«, sagte sie schließlich. »Ich könnte Flora fragen. Sie weiß vielleicht mehr.«
Brunetti kannte Pini von der Mittelschule her und aß gelegentlich in seinem Restaurant: Auf Pini war Verlass, er würde es nicht weitererzählen, wenn Brunetti ihn über Fenzo ausfragte. Aber das musste nicht für alle Klienten Fenzos gelten. »Nein«, sagte er schnell, »lass das lieber, Elisabetta.« Ihre Miene, verwirrt und erleichtert zugleich, ließ ihn verstummen.
Nachdem er eine Weile vergeblich gewartet hatte, dass Elisabetta den Faden wieder aufnahm, fragte er: »Hat er hier studiert, Elisabetta?«
Die Frage löste ihr die Zunge. »Ja. Bald nach seinem Studium ist er Flora begegnet, bei einem Essen mit Freunden.« In wärmerem Ton fuhr sie fort: »Sie hat mich gleich am nächsten Tag angerufen.« Als habe sie die Gefahr erkannt, sentimental zu werden, fügte sie hinzu: »Flora redet nicht viel.«
Wieder tauschten Brunetti und Griffoni einen Blick aus, was Elisabetta nicht mitbekam, da sie ihre Aufmerksamkeit dem Fenster zugewandt hatte. »Da ist etwas …«, begann sie und brach ab.
»Ja? Was denn?«, fragte Brunetti.
»Na ja, er kommt aus … einfachen Verhältnissen. Seine Mutter war nie berufstätig – wegen der vier Kinder –, und sein Vater hat im COIN gearbeitet, bis die dichtgemacht haben, als Schuhverkäufer, glaube ich.« Sie hob die Hände auf Brusthöhe und ließ sie wieder in den Schoß sinken. »Sie sind aus einer anderen …« Anscheinend brachte sie das Wort »Schicht« nicht über die Lippen, oder es fiel ihr nicht ein, aber Brunetti hatte schon verstanden.