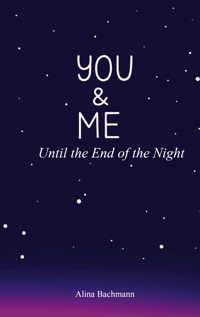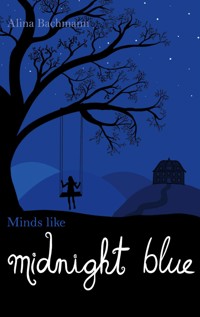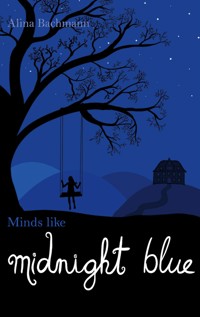
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Midnight Blue
- Sprache: Deutsch
Ramon ist 6 Jahre alt, als er seine erste Vision bekommt, in der er seine neugewonnene Freundin Luana sterben sieht. Kurz darauf stirbt diese tatsächlich, was alles in seinem Leben verändert. Es folgen weitere Visionen, die alle dasselbe Ende nehmen; die Person aus der Vision stirbt. Auf den Wunsch seiner Mutter begibt sich Ramon in Behandlung einer Therapeutin, die ihm nicht glauben möchte, was er sieht. Sie stellt Fehldiagnosen auf, die Ramon allmählich zu glauben beginnt, bis eines Tages ein neues Mädchen in dasselbe Haus wie er einzieht, das erstaunliche Parallelen zu Luana aufweist und auf den Namen Luna hört.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Judith, die immer an mich geglaubt hat, auch wenn ich es selber nicht getan habe.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 1
Obwohl es schon über 12 Jahre her war, kam es ihm so vor, als wäre es erst gestern gewesen. Die Erinnerung war noch lange nicht verblasst, sie hatte sich in sein Gedächtnis eingebrannt und er bezweifelte stark, dass er jemals in der Lage sein würde, diesen Tag vergessen zu können, wenn er es bis jetzt nicht einmal annähernd geschafft hatte, diesen Tag zu verdrängen.
Sommer, schon immer liebte er den Sommer. Er liebte es, die Zeit mit seinen unzähligen Freunden draußen zu verbringen, Abenteuer zu erleben und lange aufzubleiben, da die Sonne noch bis in die Nacht zu sehen war und somit diese erleuchtete. Es fiel ihm schon immer leicht, neue Freunde zu finden oder Leute anzusprechen, was ihn zu einem guten und lustigen Freund machte. Wollten seine Freunde raus, so fragten sie ihn immer als Erstes, ob er mitkommen wollte. Er war ziemlich beliebt bei ihnen. Sein bis jetzt noch so kurzes Leben von sechs Jahren verlief normal bis hin zu jenem Tag, der alles, wirklich alles, veränderte.
Es war ein Samstagmorgen, wie jeder andere, und seine Mutter beschloss, einen spontanen Ausflug zu seiner Oma zu machen. Sofort packte er die wichtigsten Sachen, die er für die etwas längere Fahrt gebrauchen konnte, in einen kleinen Rucksack. Seine Mutter packte noch ein zusätzliches Paar Socken und andere Klamotten ein, da sie vorhatten, zwei Tage dort zu bleiben. Dann ging die Fahrt los.
Er freute sich schon auf die alte Villa der Oma, die zwischen einem großen, abenteuerlichen Wald und einem Spielplatz lag. Er hätte sich keinen schöneren Ort auf der Welt vorstellen können.
Die Fahrt kam ihm dieses Mal gar nicht so lange vor; er merkte selber, wie er mit der Zeit immer geduldiger wurde. Er hatte gelernt abzuwarten und so verging die Zeit wie im Fluge. Sein kleines Herz klopfte vor Freude ganz schnell, als sie durch den Wald fuhren, der sie zum Hause der Oma führte.
Er mochte die alte, von Efeu bedeckte Villa, in der seine Oma schon seitdem er auf der Welt war, lebte. Er mochte die großen Fenster, durch die die Sonne ins Innere gelangte und für Licht und Wärme, in dem sonst so kalt wirkenden Haus, sorgte. Auch mochte er den verspielten Garten mit den Rosen und dem kleinen Pavillon neben dem winzigen Teich. Ihm war durchaus bewusst, dass das große Haus mit den vielen Zimmern schon bessere Tage gesehen hatte, doch er liebte es.
Die Villa war schon ziemlich alt, doch trotz der Aufforderungen ihrer Kinder, diese restaurieren zu lassen, damit ihr nicht eines Tages wortwörtlich das Dach auf den Kopf fallen würde, weigerte sich seine Oma, dies zu tun. Sie sagte immer, dass das Haus ein Stück Geschichte war und es ihre Pflicht wäre, diese zu schützen. Er sah das genau so, denn er war fasziniert von der Tatsache, dass dieses Haus nach so langer Zeit immer noch unverändert am selben Ort stand, an dem es gebaut wurde. Von der Geschichte, die seine Oma beschützte, kannte er nur Bruchteile. Eines Tages, sagte sie, so würde er die ganze Geschichte erfahren, aber jetzt war er noch zu jung dafür.
Nachdem noch andere Familienmitglieder bei der alten Villa angekommen waren, gab es Kaffee und Kuchen in dem kleinen Garten. Die Erwachsenen freuten sich, einander zu sehen, da sie alle in anderen Städten, überall verteilt im Land, wohnten und nur selten gemeinsam an einem Tisch saßen. Er hingegen fühlte sich aufgrund mangelnder Spielpartner ziemlich verloren. Deshalb erlaubte ihm seine Mutter, auf dem Spielplatz nebenan spielen zu dürfen, woraufhin er begeistert aufsprang und aus der Villa auf den Spielplatz stürmte.
Auch hier fiel es ihm nicht besonders schwer Freunde zu finden. Schnell hatte er sich einer Gruppe von vier Jungs angeschlossen und spielte mit ihnen Verstecken, bis er bemerkte, dass er von einem etwas kleineren Mädchen verfolgt wurde. Er musterte sie genauer und wollte dann wissen, ob sie mitspielen mochte, doch sie verneinte diese Frage. Sie hatte einen der Jungs schon vorher gefragt, ob sie mitspielen dürfte, doch sie wollten es nicht. Zwar war sie traurig darüber, doch sie ließ es sich nicht anmerken. Sie wusste nicht einmal, warum es sie traurig gemacht hatte Genau so wenig wusste sie, warum sie einen von diesen Jungs so gerne beobachtete.
Um das Schweigen, das mittlerweile über ihnen herrschte, zu durchbrechen, fragte er sie nach ihrem Namen; Luana. Ihre von Sommersprossen überzogenen Wangen glühten kurz auf, als sie das sagte. Noch bevor er sich vorstellen konnte, verabschiedeten sich seine neu gewonnenen Freunde von ihm, da es schon spät geworden war und ihre Eltern mit ihnen nach Hause gehen wollten. Innerlich freute sie sich, dass seine Freunde gehen mussten, doch äußerlich ließ sie sich nichts anmerken. Das Einzige, was sie ärgerte, war die Tatsache, dass er seinen Namen nicht genannt hatte. Zwar wusste sie ihn, da sie gehört hatte, wie einer der Jungs ihn gerufen hatte, doch das konnte er nicht wissen.
Als er wieder zu ihr zurückkam, wollte er wissen, wie alt sie war. Etwas schüchtern blickte sie auf ihre Hände und zeigte fünf Finger. Um zu zeigen, wie alt er war, wollte er noch einen weiteren, sechsten Finger herausstrecken und griff vorsichtig nach ihrer Hand. Doch in dem Moment, in dem sich ihre Hände berührten, passierte etwas Merkwürdiges.
Ein kurzes Kribbeln durchzuckte seinen Körper, das so schnell wieder vorbei war, wie es gekommen war. Er merkte, wie sich seine Stirn kräuselte, dann wurde sein Bild schwarz. Doch es blieb nicht lange schwarz. Schnell konnte er die Farben wiedererkennen - erst nur unscharf, dann wurde das Bild wieder scharf.
Nun befand er sich plötzlich nicht mehr auf dem Spielplatz, sondern mitten auf einer Straße vor einem großen Mehrfamilienhaus mit Garten. Er sah eine Frau, die erstaunliche Ähnlichkeiten mit Luana aufwies, dann sah er auch Luana. Sie spielte mit einem kleinen Ball. Doch plötzlich rollte dieser auf die Straße und Luana rannte ahnungslos hinterher. Sie sah das Auto nicht, was auf sie zufuhr, aber er sah es. Er konnte nichts machen. Ein Scheppern. Ein Schrei. Eine Autotür. Eine weinende Mutter. Stimmen. Viele Stimmen. Viele Stimmen, die wild durcheinanderredeten. Stille.
Sein Bild wurde wieder unscharf, dann wurde es schwarz und zu guter Letzt befand er sich wieder auf dem Spielplatz. Ein merkwürdiger Tagtraum. Erst nachdem er ein paar Mal geblinzelt hatte, wurde er sich wieder über seinen geistigen Zustand bewusst. Er befand sich wieder in der Realität. Das Ganze ging so schnell, dass sie gar nicht erst bemerkt hatte, dass etwas nicht stimmte. Und bevor er ihr sagen konnte, dass er sechs Jahre alt war, wurde auch sie von ihrer Mutter gerufen. Erschreckenderweise musste er feststellen, dass die Frau, die sich als Luanas Mutter erwies, genau wie die Frau aus seinem kurzen Tagtraum aussah. Sie verabredeten sich noch für den nächsten Tag, dann stieg sie ins Auto ein und sah, wie er ihrem Auto hinterherschaute, bis es hinter der Kurve verschwunden war.
Am nächsten Morgen hatte er es ziemlich eilig, zum Spielplatz zu kommen, er wollte unter keinen Umständen zu spät kommen. Mit unerklärlicher Vorfreude setzte er sich auf die Schaukel am Rande des Spielplatzes und wartete.
Nach einiger Zeit fing es an zu regnen, doch er wollte nicht aufstehen und ins Trockene gehen; er könnte sie ja verpassen. Also blieb er sitzen. Im strömenden Regen. Und wartete. Irgendwann verzog sich der Regen wieder. Kinder kamen und gingen, doch sie kam nicht. Dann irgendwann sah er ein vertrautes Gesicht. Luanas Mutter. Sie sagte ihm, er solle lieber nach Hause gehen, Luana würde nicht kommen können.
Sie musste es gar nicht aussprechen, da wusste er schon, was passiert war. Sein Tagtraum wurde wahr. Luana war tot.
„Sie sehen nicht gut aus“, sagte Frau Müller und seufzte.
„Ich sehe nie gut aus“, antwortete er kalt.
Er hatte es satt, fünf Stunden in der Woche in ihrem Sprechzimmer festzusitzen, ohne auch nur einen einzigen Fortschritt erlangt zu haben.
„Sie sind schon wieder so negativ“, mahnte sie ihn und setzte sich ihre eckige, rosa Brille auf die spitze Nase.
Sie begann in dem Schriftstück zu lesen, das er ihr vor wenigen Minuten überreicht hatte, und murmelte zwischendurch Sachen wie 'Interessant' oder 'Merkwürdig'.
Als sie sich durch die neusten Seiten geblättert hatte, setzte sie ihre Brille wieder ab und sah ihn mit ernstem Blick an: „Ich kann in Ihrem Traumtagebuch keine Unebenheiten finden. Keine Angstzustände, keine Tagträume und keine negativen Gedanken mehr. Sie wissen sicherlich, was das bedeutet, oder?“
„Dass Sie mich endlich entlassen können?“, fragte er hoffnungsvoll.
„Nein“, sie schüttelte den Kopf.
„Das heißt, dass wir etwas verändern müssen. Wenn Sie seit mehr als 10 Jahren nicht dazu bereit sind, sich zu öffnen, muss ich Sie an einen anderen Psychologen weiterleiten. Sie wissen, dass ich sehr interessiert an Ihrem Fall bin, aber das wäre nur zu Ihrem Besten. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie nicht damit aufhören, irgendwelche ausgedachten Geschichten in Ihre Tagebücher zu schreiben“, ihre Stimme war ruhig und sachlich, dennoch war er aufgebracht.
Wie sollte er ehrlich sein, wenn ihm niemand glaubte?
„Haben Sie in letzter Zeit noch einmal solche Träume gehabt?“, hakte sie etwas strenger nach.
„Es sind keine Träume, es sind Voraussagen“, warf er ein. Er hasste diese Diskussion. Es war reine Zeitverschwendung. Im Laufe der letzten 13 Jahre war er sich immer sicherer geworden, dass die ganze Sache mit Luana kein Zufall war. Es war eine Voraussage gewesen, doch niemand glaubte ihm.
Narkolepsie, Traumata, schwere Angstzustände und Depressionen, so lautete die Diagnose der Psychologin, deren Sprechstunden er anfangs freiwillig besucht hatte. Mittlerweile besuchte er sie nur noch, da er seiner Mutter versprochen hatte, wieder gesund zu werden und sein Leben unter Kontrolle zu bekommen, kurz bevor er merkte, dass ihre Zeit abgelaufen war. Auch ihren Tod hatte er vorhergesehen; es war nur einer von mittlerweile ziemlich vielen, weshalb es seine Meinung bezüglich seiner Voraussagen bestätigte. Gleichzeitig aber bestätigte dies auch Frau Müller mit ihren Diagnosen.
„Ramon“, sagte sie sanft, um ihn aus seinen Gedanken in die Realität zurückzuholen. „Sie wissen genau, dass das menschliche Gehirn in der Lage ist, Erinnerungen so zu manipulieren, dass man im Nachhinein denkt, man hätte etwas vorhergesehen“, ihre Stimme wurde wieder ernster.
Er schluckte. Klar, an ihrer Theorie war etwas Wahres dran, aber es war ja nicht so, als hätte er das nicht schon für sich selbst überprüft. Er hatte seine Voraussagen aufgeschrieben, noch bevor sie überhaupt eingetroffen waren und jedes verdammte Mal hatte er Recht gehabt. Aber das sagte er nicht. Sollte sich Frau Müller ihm doch überlegen fühlen.
„Wenn Sie das sagen“, murmelte er deutlich genervt von ihrer allwissenden Haltung ihm gegenüber.
Ja, er war mit seinen 19 Jahren deutlich jünger als sie, aber dennoch wusste er mehr über sich selbst, als sie jemals erfahren würde. Er wartete nur noch auf den richtigen Moment. Auf die richtigen Beweise, um ihr zu zeigen, dass sie immer falsch gelegen hatte.
Es konnte kein Zufall mehr sein, dass sich seine Voraussagen, seitdem sie angefangen hatten, stetig verändert hatten. Anfangs kamen sie nur bei Berührungen, später genügte ein Blickkontakt. Mittlerweile reichte es, dass er irgendeinen Menschen sah und sie traten auf. Zufällig und somit auch unkontrollierbar.
„Die Zeit ist um“, stellte Frau Müller mit einem Blick auf die Uhr fest.
Erleichtert verabschiedete er sich von ihr und trat hinaus in die Freiheit.
Er hatte Glück, es war noch nicht viel los auf den Straßen. Wenig Menschen bedeuteten für ihn, dass seine Voraussagen nicht so oft, oftmals auch gar nicht auftreten würden. Schnell stieg er in sein Auto, das er zu seinem 18. Geburtstag von seinem Vater geschenkt bekommen hatte, und fuhr die zwei Straßen bis zu seiner Wohnung.
Zwar hätte er den Weg um diese Uhrzeit auch problemlos zu Fuß gehen können, aber er wollte nichts riskieren. Wenn es um so etwas ging, war er lieber alleine. Es gab nur zwei Gründe für ihn, das Haus überhaupt zu verlassen: Einkaufen und die Sprechstunden mit Frau Müller. Die restliche Zeit verbrachte er alleine zu Hause. Zwar hatte er noch seinen Vater, doch er war direkt nach seinem Abitur ausgezogen. Er könne sich alleine besser auf seine Arbeit konzentrieren - so hatte er ihm seinen frühen Auszug begründet. In Wahrheit aber fürchtete er sich davor, auch ihn sterben zu sehen.
Diese Angst beeinflusste ihn so sehr, dass er fast immer alleine war. Seit seinem 7. Lebensjahr hatte er sich von all seinen Freunden abgewendet, nachdem er den Tod eines seiner Freunde vorhergesehen hatte. Nur einer von ihnen war übriggeblieben; Tim, sein bester Freund.
Aus irgendwelchen Gründen hatte Tim es mit ihm ausgehalten und deswegen fiel es ihm auch so schwer, ihn aus seinem Leben zu verbannen. Vielleicht tat ihm diese Freundschaft auch ganz gut. Ohne Freunde würde er vielleicht wirklich durchdrehen, aber mit Tim wusste er, dass er eine Person auf der Welt hatte, die trotz seiner komischen Visionen zu ihm hielt.
Das war ein guter Ausgleich für die regelmäßigen Sitzungen mit Frau Müller, die ihn behandelte, als wäre er anders, als würde ihm etwas fehlen, als wäre etwas falsch mit ihm.
Es war leicht, einen Parkplatz vor seinem Haus zu finden, da er in einer nur selten befahrenen Straße wohnte. Und genau deshalb war er so verwundert, dass vor seinem Haus ein großer Umzugswagen parkte. Er konnte sich nicht daran erinnern, dass in letzter Zeit jemand ausgezogen war, allerdings war er auch nicht großartig interessiert an seinen Nachbarn. Er hatte schon, seitdem er eingezogen war, vermieden, mit den Nachbarn in Gespräche verwickelt zu werden oder sie gar zu sehen.
Er hatte sich an den Rhythmus des Mehrfamilienhauses angepasst und wusste ungefähr, wer wann ein und aus ging. Zwischen diesen Zeiten konnte er sich frei durch das Treppenhaus bewegen. Das funktionierte bis jetzt ziemlich gut und die meisten seiner Nachbarn hatten ihn noch nie zu Gesicht bekommen, dennoch passierte es manchmal, dass er der freundlichen älteren Dame aus dem Erdgeschoss begegnete.
Er konnte es nicht übers Herz bringen, einfach so an ihr vorbeizulaufen und ihre freundliche Begrüßung zu ignorieren und bis jetzt verlief auch jede dieser Begegnungen gut, aber er wusste, dass das keine Versicherung für die Ewigkeit war. Er wusste, dass er besser aufpassen musste.
Zögernd stieg er aus seinem Auto aus und versuchte, sich so unauffällig wie möglich ins Haus zu schleichen. Erleichtert stellte er fest, dass keine Menschen in der Nähe des Umzugswagens waren. So schnell wie möglich versuchte er in den vierten Stock zu gelangen und wieder einmal schaffte er es, seine Wohnung zu erreichen, ohne auch nur einem Menschen zu begegnen.
Kapitel 2
Es dauerte ziemlich lange, bis alle Kartons in der Wohnung gelagert waren. Dementsprechend müde ließ sie sich auf ihr Bett fallen. Irgendwie kam ihr der vorherige Umzug angenehmer vor, was daran liegen konnte, dass sie jetzt alt genug war, um mitzuhelfen, und ihre Mutter diese Hilfe auch gut gebrauchen konnte.
Müde und erschöpft warf sie einen kurzen Blick auf den Wecker, der auf ihrem improvisierten Nachttisch – einem Karton gefüllt mit Büchern und anderen Sachen – stand, und stellte fest, dass sie länger still die Decke anstarrend dagelegen hatte, als sie dachte. Sie setzte sich auf, gähnte kurz und streckte sich. Sie würde heute nicht um eine heiße Dusche herumkommen.
Immerhin war es Sonntag und schon ziemlich spät. Sie hatte ziemlich geschwitzt und fühlte sich total ausgelaugt, aber das änderte auch nichts an der Tatsache, dass morgen ein ganz normaler Schultag sein würde. Niemanden würde es interessieren, dass sie keine Lust auf diese Stadt hatte oder das ganze Wochenende mit diesem Umzug beschäftigt war. Ihr Leben würde weitergehen und niemand würde sich für sie und ihre Probleme interessieren.
Generell hatte sie nicht verstanden, weshalb ihre Mutter unbedingt wegziehen wollte, und noch weniger verstand sie, weshalb diese Wahl ausgerechnet auf diese Stadt gefallen war, wo es doch so viele schönere Städte gab. Sie stieg aus der Dusche und wickelte sich in das hässliche, graue Handtuch ein, welches das Erstbeste war, das sie in dem ganzen Chaos finden konnte.
Beim Vorbeigehen zur Tür blieb ihr Blick an dem Spiegelschrank hängen, in dem sie ihr Gesicht erkennen konnte. Blass. Unter ihren Augen waren tiefe Schatten und auch sonst konnte sie nichts an sich finden, das auch nur irgendwie besonders schön, geschweige denn annähernd schön war.
Nicht heute.
Heute war nicht ihr Tag. Das wusste sie bereits, als sie sich am Morgen von ihrer besten Freundin Sina auf unbestimmte Zeit verabschieden musste. Dabei waren sie schon Freundinnen gewesen, seit sie überhaupt denken konnte. Sina war für sie die Schwester, die sie nie hatte und auch vom Aussehen hätten die beiden Schwestern sein können. Mit ihren braunen, langen Haaren und ihren Sommersprossen sahen sie sich immer schon sehr ähnlich. Nur ihre blauen Augen unterschieden sie stark von Sina.
Mit der Zeit ähnelten sie sich immer weniger, was ihrer Freundschaft allerdings keinen Schaden zufügte. Verdammt, sie wollte wieder zurück. Sie wollte nicht in die neue Schule gehen und erst recht nicht mitten im Schuljahr. Wäre es nach den Sommer- oder sonstigen Ferien gewesen, wäre das Ganze erträglicher. Aber so mittendrin im Schuljahr würde ein neues Gesicht in der Stufe stärker auffallen und genau das wollte sie nicht.
Sie wollte sich nicht einmal die Mühe machen, Freunde zu finden. Sie wollte einfach nur den nächsten Tag überleben und das bis zu ihrem Abitur.
„Luna, wenn du pünktlich kommen möchtest, dann steh sofort auf!“, hörte sie ihre Mutter rufen.
Ein Blick auf ihren Wecker verriet, dass sie viel zu spät dran war. Verdammt. Sie beeilte sich und schlüpfte in die erstbeste Jeans, die sie finden konnte. Darauf ein graues Shirt, eine Lederjacke und fertig. Nach einem Blick in den Spiegel musste sie feststellen, dass sie schon viel erholter aussah als am Tag zuvor, weshalb sie auf Foundation und Concealer verzichten konnte.
„Fertig“, rief sie, als sie aus dem Bad stürmte. Im Gehen griff sie noch nach ihrem Frühstück und einem Becher mit Kaffee, der schon auf der Küchentheke bereitstand und hastete mit ihrer Schultasche in der anderen Hand aus der Wohnung im dritten Stock.
Der Weg bis zu ihrer neuen Schule war kürzer als der zu ihrer alten Schule, weshalb sie ihn problemlos zu Fuß gehen konnte. In ihrer alten Heimatstadt musste sie immer den Bus nehmen. Vor dem Gebäude angekommen, atmete sie einmal tief durch, dann trat sie ein.
Die Tür der Eingangshalle ließ sich nur schwer öffnen, sodass ich mich zu fragen begann, wie die kleineren Schüler in der Lage sein konnten, diese zu öffnen, wo ich, eine Schülerin der gymnasialen Oberstufe, schon Probleme hatte. Es mochte wahr sein, dass ich nicht die Größte war und es durchaus Schüler der 7. Klasse gab, die größer waren als ich, dennoch würde ich mich mit meinen 1,67m nicht als winzig bezeichnen.
Mit offenem Mund stand ich also in der Eingangshalle der Schule und blickte mich erstaunt um. Irgendwie hatte ich mir meine neue Schule anders vorgestellt. Nicht ganz so alt und trostlos. Doch es war gut so. Ich mochte alte Sachen.
Die Wände der Eingangshalle waren aus dunklen, leicht moosigen Steinen gemauert, was der ganzen Halle eine ziemlich düstere, aber irgendwie auch magische Atmosphäre gab. Die dunkle Decke war ziemlich hoch, sodass es aussah, als würden die ewig langen Wände irgendwo in einem Nichts enden. Und tatsächlich würde ich nicht überrascht sein, wenn ich dort oben Hexen hätte fliegen sehen, so naturwidrig schien mir dieser Ort.
In der Mitte der runden Eingangshalle befand sich ein Baum, unter dem eine alte Holzbank stand. Allerdings kam mir der Baum dort aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse in der Eingangshalle ziemlich fehl am Platz vor. Tatsächlich grenzte es ein bisschen an Magie, dass der Baum hier stand und noch nicht abgestorben war, da sein Fotosynthesepotenzial hier nicht gerade atemberaubend sein konnte. Streberin. Beschimpfte ich mich selber in Gedanken und zwang mich, von dem Baum, dem Zentrum der Eingangshalle, wegzuschauen.
An der Wand gegenüber von der Eingangstür konnte ich ein paar Tische und Bänke erspähen. Bestimmt verbrachten die anderen Schüler hier ihre Pausen und Freistunden. An den Wänden rechts und links von mir gingen jeweils zwei Gänge ab. Wohin diese führten, war mir noch unklar. Vor meinem inneren Auge konnte ich schon sehen, wie ich mich hier tagtäglich verlaufen würde.
Man bräuchte ein Navigationssystem, um sich hier zurechtfinden zu können. Oder vielleicht bräuchte nur ich so etwas. Mein Orientierungssinn war noch nie besonders ausgeprägt gewesen, aber dafür hatte ich andere Talente. Gut versteckte Talente. So gut versteckt, dass ich sie selber noch nicht kannte.
Schließlich schaffte ich es, mich aus dieser Starre, ausgelöst durch eine gewisse Faszination und Abneigung für und gegen diesen Ort, zu lösen. Da ich so in Gedanken vertieft war, hatte ich nicht gemerkt, dass sich die Eingangshalle geleert hatte; der Unterricht hatte angefangen, und da ich generell schon spät dran war, hatte ich nicht mehr viel Zeit, um das Sekretariat aufzusuchen und meinen Stundenplan zu erhalten.
Da ich allerdings momentan das einzige atmende Lebewesen in dieser riesigen Halle war und die Schule um einiges größer und verwirrender war, als ich es erwartet hatte, wusste ich nicht, wie ich den Weg zum Sekretariat finden sollte, ohne mich mindestens einmal zu verlaufen.
Verzweifelt ging ich in Richtung des alten Baumes und setzte mich auf die Bank. Von dort aus hatte man einen besseren Überblick über die Gänge. Man hätte ja wenigstens ein paar Schilder anbringen können, dachte ich verärgert. Warum musste meine Mutter auch ausgerechnet hier hinziehen?
„Auf was wartest du?“, hörte ich eine Stimme hinter mir.
Erschrocken drehte ich mich um. Doch da war niemand. War ich gerade dabei, den Verstand zu verlieren oder hatte gerade der Baum mit mir geredet?
„Ich warte auf gar nichts“, behauptete ich trotzig und verwirrt zugleich.
„Und was machst du sonst hier?“, fragte dieselbe Stimme.
Das konnte nicht wahr sein. Ich redete gerade mit einem Baum. Mit einem verdammten Baum. Das war doch nicht möglich. Das konnte nicht möglich sein.
„Über den Sinn des Lebens nachdenken, was soll man sonst hier machen?“, antwortete ich mit einem sarkastischen Unterton.
„Falls du das Sekretariat suchst, ich kann dich hinbringen.“
Während ich in Gedanken überlegte, ob es normal sei, mit einem Baum zu reden, und ob es denn überhaupt möglich wäre, dass dieser mir den Weg zum Sekretariat zeige, löste sich eine Silhouette aus dem Schatten des Baumes.
„Bevor du mich weiterhin so fragend und verstört anguckst, nein, ich bin gerade nicht aus dem Baum getreten. Ich bin lediglich zu spät gekommen und dachte mir, du könntest vielleicht Hilfe gebrauchen“, lachte die Person und kam näher.
„Ich bin übrigens Julius.“
„Und ich werde an meinem ersten Tag zu spät zum Unterricht kommen“, sagte ich kalt.
Julius lachte kurz auf, dann gingen wir zusammen zum Sekretariat.
„Man sieht sich“, sagte er, nachdem er mich sicher zum Sekretariat geführt hatte und hob zum Abschied lässig seine Hand.
Ich sagte gar nichts, sondern öffnete die braune, schwere Tür, die den Gang vom Sekretariat abtrennte.
„Entschuldigen Sie die Verspätung, ich bin die neue Schülerin“, brachte ich hervor.
„Das ist doch kein Problem. Für Neulinge ist die Schule das reinste Labyrinth“, antwortete eine Sekretärin freundlich.
Daraufhin blätterte sie in einigen Ordnern und holte ein paar Blätter heraus, von denen eins mein zukünftiger Stundenplan war. Freundlich verabschiedete ich mich und kehrte in die Eingangshalle zurück, weil das der einzige Ort war, den ich sofort finden konnte und an dem ich mich fast schon ein wenig wohl fühlte.
Ich stellte meine Tasche auf einen der Tische und guckte mir die Blätter an. Ein paar Informationszettel zu Kursfahrten, Ausflügen, den Computerräumen und anderen Veranstaltungen. Dann erst widmete ich mich meinem Stundenplan.
Wenn man sich meine neue Schule so anschaute, hätte man damit rechnen können, Fächer wie Verteidigung gegen die dunklen Künste auf seinem Stundenplan vorzufinden, doch natürlich war dem nicht so. Also folgte ich meinem Stundenplan und machte mich auf den Weg zu meinem Geschichtsraum.
Zum Glück stand unter dem Stundenplan eine kurze Wegbeschreibung zu den einzelnen Räumen, sonst wäre ich vermutlich erst am Ende der Doppelstunde angekommen, falls ich den Weg überhaupt gefunden hätte.
Vor dem Raum angekommen blieb ich erst einmal stehen, um an der Tür zu lauschen, ob es sich hierbei tatsächlich um einen Geschichtskurs handelte. Es dauerte einige Minuten, bis ich mir halbwegs sicher war, die Wörter „Preußen“ und „Kaiser Wilhelm“ gehört zu haben.
Ich war entschlossen, reinzugehen. Ich müsste nur die Tür öffnen. Dazu müsste ich nur ein wenig an der Türklinke drücken. Es wäre nicht schwer und dennoch hielt mich etwas davon ab. Also stand ich da. Überlegend und mit mir selber kämpfend. Ich war mir sicher, dass ich es hinbekommen würde da reinzugehen, mich zu entschuldigen und auf den erstbesten Platz, den ich finden konnte, zu setzen.
Ich war bereit.
Langsam näherte sich meine Hand der Türklinke und umschloss diese. Bevor ich die notwendige Kraft investieren konnte, die die Tür endgültig öffnen würde, atmete ich noch einmal tief durch. Da spürte ich, wie sich die Türklinke unter meinen Fingern bewegte und die Tür aufging. Schnell wich ich einen Schritt nach hinten, um zu verhindern, dass ich die Tür gegen den Kopf bekam. Auf der anderen Seite des Türrahmens stand ein Junge vor mir, der bei meinem Anblick leicht zusammenzuckte.
Ich konnte nicht verhindern, dass ich rot wurde. Etwas verwirrt und genervt ging der Typ an mir vorbei und verschwand durch die nächstbeste Tür. Immer noch rot stand ich zwischen der immer noch offenen Tür und dem düsteren Gang mit der schlechten Belichtung.
Verdammt. Verdammt. Verdammt. So etwas konnte auch nur mir passieren.
„Und wer sind Sie?“, fragte mich der grauhaarige Lehrer mit spitzem Blick.
„Luna“, antwortete ich leise, sodass nur ich es hören konnte.
„Sie müssen die neue Schülerin sein“, stellte er nach einer unerträglich langen Pause fest.
Unsicher nickte ich.
„Dann kommen Sie mal rein und setzen Sie sich.“
Mit gesenktem Blick trat ich ein und suchte vergebens nach einem komplett freien Doppeltisch.
„Neben Jane ist noch ein Platz frei“, sagte der Lehrer überflüssigerweise.
Woher sollte ich bitte wissen, wer Jane war?
Jane stellte sich als ein blondes Mädchen mit großen Locken heraus, das in der letzten Reihe saß und gelangweilt auf ihrem Kaugummi herumkaute. Unsicher setzte ich mich auf den freien Platz neben ihr und der Lehrer führte seinen Unterricht fort. Den Typ, in den ich fast reingelaufen war, sah ich zum Glück nicht mehr.
„Jane, können Sie Luna in der Pause bitte nicht alleine lassen?“, fragte der Lehrer.
Na super, jetzt suchte mir mein Lehrer auch noch meine Freunde aus.
Genau wie ich, hatte Jane anscheinend keine großartige Lust, mich näher kennenzulernen, geschweige denn ihren Freunden vorzustellen, dennoch lotste sie mich in die Eingangshalle und nahm mich mit zu ihren Freunden.
In der dunkelsten und abgelegensten Ecke der runden Eingangshalle saß eine Gruppe von bereits fünf Leuten. Leider musste ich feststellen, dass sowohl der Typ, dem ich vor dem Geschichtsraum begegnete, als auch Julius unter ihnen waren.
„Finn“, flötete Jane und setzte sich neben den Geschichtstypen, der daraufhin versuchte, einen kleinen Abstand zwischen sich und sie zu bekommen, was ihr gar nicht erst auffiel, da sie viel zu sehr damit beschäftigt war, ihn aus runden Augen von der Seite anzuhimmeln. Ziemlich verloren stand ich bei diesen ganzen fremden Leuten und hoffte, dass Julius mich nicht ansprechen würde. Ich konnte nicht einmal genau sagen, was mich an ihm störte, aber irgendwie wirkte er unsympathisch und nervig.
„Hast du deinen Raum gefunden?“, fragte Julius und lächelte mich an.
„Ja, die Wegbeschreibungen auf dem Stundenplan sind echt gut“, antwortete ich höflich.
Ohne den Augenkontakt mit mir abzubrechen, strich er sich eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht. Dieser durchgehende Augenkontakt bewirkte, dass ich mich noch unwohler fühlte und ihm aus unerklärlichen Gründen immer mehr misstraute.
„Bist du sehr zu spät gekommen?“, versuchte er krampfhaft, die Unterhaltung aufrechtzuerhalten.
„Sie hatte sogar noch genug Zeit, um minutenlang vor der Tür zu stehen“, warf der Geschichtstyp, Finn, ein und lächelte mich entschuldigend an.
Ich seufzte genervt auf. Die ganze Situation war mir jetzt schon unangenehm.
„Mach dir nichts draus, wir waren alle einmal neu hier“, versuchte Finn, mich aufzumuntern.
„Aber vermutlich nicht einfach mitten im Schuljahr, sondern nach den Sommerferien und auch nicht als einzige neue Person“, warf ich ein.
„Das stimmt, aber das bedeutet nicht, dass wir uns sicherer als du gefühlt haben“, fing Finn an. „Ich für meinen Teil war ziemlich unsicher, als ich auf diese Schule hier gekommen bin.“
Ich musterte ihn von oben bis unten.
Er sah für mich nicht aus wie jemand, der die Wörter Selbstzweifel und Unsicherheit überhaupt in seinem Vokabular hatte. Er war groß, hatte dunkelbraune Haare, braune Augen und trug ein schwarzes Oberteil, was aussah, als sei es momentan im Trend. Es war unmöglich, dass er nicht zu den coolen und angesagteren Leuten aus der Stufe zählte. Vermutlich hatte Jane dieselben Gedanken wie ich, denn sie fing plötzlich an, sich an dem total irrelevanten Gespräch zu beteiligen.
„Stimmt doch gar nicht“, warf sie ein. „Du hast dich schon am ersten Tag mit den Leuten aus der Stufe über uns und den Lehrern angelegt.“
„Ach! War das an meinem ersten Tag? Konnte mich nicht mehr daran erinnern“, gab er cool zurück.
Das bestätigte meine Annahme, dass er eigentlich gar nicht unsicher war.
„Was hast du als Nächstes?“, fragte Finn mich dann. Ich stellte meine Tasche auf einen der Tische und begann in ihr herumzukramen, bis ich meinen Stundenplan gefunden hatte.
„Biologie.“
„Wenn du willst, kann ich dir den Raum zeigen, damit du nicht wieder vor der Tür stehen und warten musst“, bot er mir an und zwinkerte mir kurz und unauffällig zu.
„Ich denke, ich finde den Weg auch alleine“, lehnte ich sein Angebot ab.
„Du kannst mir aber gerne den Weg zur Turnhalle zeigen“, sagte Jane und fasste ihn an seinen Unterarm.
Mit einer gekonnten Bewegung schüttelte er ihre Hand ab: „Den Weg findest du auch alleine.“
Ich merkte, wie sich ihr Blick verfinsterte und beschloss, dass das der perfekte Moment war, um zu verschwinden.
„Ich gehe dann mal den Raum suchen“, verabschiedete ich mich schnell und ging. Im Rücken spürte ich noch lange den bohrenden und von Zorn erfüllten Blick von Jane.
Ich war ziemlich froh, als ich den Bio-Raum erreicht hatte, aber noch froher war ich, als ich feststellen musste, dass die letzten beiden Stunden ausfallen würden und ich früher nach Hause gehen konnte. Der Tag war äußerst merkwürdig verlaufen und ich wollte nur noch in mein Bett. Wollte mit niemandem mehr reden, nur noch schlafen.
Erschöpft schleppte ich mich die Treppen hoch, da sprach mich jemand an.
„Sind Sie die neue Mieterin im dritten Stock?“, hörte ich eine freundliche Stimme hinter mir. Langsam drehte ich mich um.
„Bitte, Sie müssen mich nicht siezen“, sagte ich. Ich fand es immer unangenehm, gesiezt zu werden, da ich nicht einmal volljährig war. Es war einfach seltsam und merkwürdig und man fühlte sich plötzlich so alt.
„Wir sind gestern erst eingezogen“, fügte ich aus Höflichkeit hinzu.
„Ja, das habe ich gesehen“, antwortete die ältere Dame.
Verwirrt musterte ich sie und ihr langes, weißes Haar, das ihr fast bis zum Bauchnabel reichte und zu einem seitlichen Zopf geflochten war. Ihre grauen Augen glitzerten und um ihren Mund hatten sich im Laufe der Jahre Lachfalten gebildet. Hinzu kam ihre offene und freundliche Art. Sie war mir von Anfang an sympathisch.
„Wie gefällt es Ihnen hier?“, fragte sie.
„Es ist schön hier“, log ich.
Eigentlich konnte ich noch gar nichts zu der Stadt sagen. Das Einzige, was ich bisher außerhalb meines Zimmers gesehen hatte, war die Schule. Ich hatte bisher noch keine Zeit, die Stadt zu erkunden und alleine hatte ich auch keine Lust, dies zu machen.
Sie lächelte.
„Das freut mich“, sagte sie mehr zu sich selbst als zu mir.
Ich schenkte ihr ein kurzes Lächeln und wartete ab. Eigentlich dachte ich, dass sie wieder in ihre Wohnung verschwinden würde, doch das tat sie nicht. Stattdessen stand sie keine zwei Schritte entfernt von mir und machte keine Anstalten, sich von der Stelle zu bewegen.
„Ich finde es hier auch sehr schön“, sprach sie nach einiger Zeit weiter.
Reflexartig nickte ich, um sie in ihrer Meinung zu bestätigen.
„Aber wenn man so alleine ist wie ich, dann sieht man nicht mehr so viel von der Stadt. Machen Sie nicht denselben Fehler wie ich. Suchen Sie sich Freunde und gehen Sie raus, erkunden Sie die Stadt. Nutzen Sie das Leben, das Eine, das Sie haben und erleben Sie etwas, okay?“
Ich unterband den Drang, ihr zu sagen, dass sie mich nicht siezen müsse, aber irgendetwas in mir drin sagte, dass sie das nicht interessieren würde.
„Ja, werde ich machen“, antwortete ich darauf.
„Falls Sie sich jemals alleine fühlen sollten, dann halten Sie die Augen offen. Im 4. Stock, direkt über Ihnen, wohnt ein junger Mann, keine drei Jahre älter als Sie. Vielleicht kann er Sie ja in der Stadt herumführen“, schlug sie mir vor und zwinkerte mir verschwörerisch zu.
Ungläubig lachte ich.
Ich bezweifelte, dass ich mich von fremden Leuten durch die Stadt führen lassen würde. Ein kurzes Pfeifen unterbrach die wieder eingetretene Stille.
„Oh! Das ist mein Tee. Hab noch einen schönen Tag, Luna!“
Daraufhin zog sie sich in ihre Wohnung zurück und mir blieb nichts anderes übrig, als ihr ungläubig hinterherzuschauen.
Wie war es möglich, dass sie meinen Namen kannte, obwohl ich mir schon den ganzen Tag Mühe gegeben hatte, ihn gegenüber niemandem zu erwähnen? Dieser Gedanke beschäftigte mich noch den ganzen Abend, bis ich mich mit der Erklärung zu trösten versuchte, dass sie gestern mitbekommen haben musste, wie meine Mutter mich gerufen hatte. Anders war es nicht möglich.
Das einzig Gute an dem Gespräch mit der freundlichen Dame war, dass mir die Leute aus meiner Schule plötzlich nicht mehr so merkwürdig vorkamen. Im Vergleich mit der Dame aus meinem Haus waren sie sogar noch annähernd normal. Immerhin haben die Leute aus meiner Schule – und ich weigerte mich strikt dagegen, diese nach einem so kurzen und unangenehmen Gespräch als Freunde zu bezeichnen – nicht versucht, mich mit irgendwelchen fremden Leuten zu verkuppeln.
Kapitel 3
Sieben Uhr aufstehen. Fertig machen. Losfahren. Wieder einmal eine Stunde meines Lebens verschwenden für eine Therapie ohne Erfolgschancen. Arbeiten. Jeden Kontakt zu Menschen vermeiden. Schlafen gehen.
Seitdem ich mein Abitur bestanden hatte, hatte sich mein Tagesablauf nicht großartig verändert. Ich hatte mich daran gewöhnt. Ich musste mich daran gewöhnen, wenn ich vermeiden wollte, dass ich irgendjemanden sterben sehen würde. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich keine Angst davor hätte, Beziehungen mit Menschen einzugehen, denn irgendwann, da war ich mir ziemlich sicher, würde ich diese sterben sehen und dieses Gefühl konnte ich einfach nicht mehr ertragen.
Ich hatte es satt, dass sich mein Leben so nach diesen Vorahnungen richtete. Ich hatte es satt, dass ich nicht so leben konnte, wie ich es wollte, und vielleicht war ich auch etwas erschöpft. Erschöpft von diesem Leben und dem, was es mir abverlangte.
Es gab Tage, da glaubte ich Frau Müller mit ihrer Diagnose Depression und wusste selber nicht genau, wie lange ich dieses Leben noch aushalten würde.
„Wie haben Sie geschlafen?“, Frau Müller sah mich mit einem Blick an, mit dem man verletzte Hundewelpen angucken würde.
„Schlecht“, grummelte ich vor mich hin und vermutlich war das auch das erste Mal seit Beginn der Therapie, dass ich ihr eine ehrliche Antwort gegeben hatte.
Auch Frau Müller muss das bemerkt haben, denn ich konnte beobachten, wie ein kurzes Lächeln über ihr Gesicht zuckte.
„Das ist doch ein Anfang“, sagte sie leise.
Vielleicht hatte sie damit recht und es war tatsächlich ein Anfang, aber nur für sie. Nicht für mich.
„Hatten Sie Albträume?“, bohrte sie weiter, nachdem die Stille, die den weißen, kalten Raum ausgefüllt hatte, unerträglich wurde.
Ich überlegte kurz. Wenn ich ehrlich war, konnte ich mich nicht einmal mehr an meine Träume von letzter Nacht erinnern. Das Einzige, was ich noch wusste, war, dass mich ein merkwürdiges Gefühl wachgehalten hatte.
Ich hatte keine Ahnung, was für ein Gefühl es war, auch wusste ich nicht, ob es wirklich zwanghaft negativ zu beurteilen war, dennoch hatte es mich, was auch immer es über mich aussagen mochte, vom Einschlafen abgehalten.
„Nicht wirklich“, antwortete ich ihr und beobachtete, wie sich Falten auf ihrer Stirn bildeten.
Noch bevor sie mich tadeln konnte, dass die Therapie nur Sinn haben würde, wenn ich mich öffnete und ehrlich zu ihr war und wir doch schon einen Schritt in Richtung Wahrheit und Akzeptanz meiner Probleme geschafft hatten, fügte ich noch hinzu: „Eigentlich kann ich mich gar nicht an meine Träume erinnern. Dass ich so schlecht geschlafen habe, lag aber daran, dass ich ziemlich lange wach gelegen habe und nicht einschlafen konnte.“
Zwar waren die Falten auf ihrer Stirn nicht verschwunden und auch ihre Blicke musterten mich weiterhin kritisch, dennoch sah sie nun deutlich zufriedener aus als vorher.
Vielleicht sollte ich aufhören, mich gegen die Therapie zu wehren. Vielleicht hatte Frau Müller recht. Vielleicht stimmte es, und ich war wirklich nicht normal und mir fehlte etwas. Wie sollte es auch anders sein? Ich hatte mehrere Menschen sterben sehen, mehr als die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben je sterben sehen würden. Vielleicht war es dann auch okay, einmal schwach und verwirrt zu sein. Sich der Therapie hinzugeben würde ja nicht direkt bedeuten, dass ich nachgeben und schwach werden würde. Hätte es nicht sogar etwas von Stärke, sich seinen Ängsten und Problemen zu stellen, wenn der natürliche Abwehrmechanismus der Verdrängung scheiterte? Eigentlich konnte ich mich glücklich schätzen, so besonders schlechte Abwehrmechanismen zu haben, da einem noch ganz andere Probleme drohten, wenn man in der Lage war, ein Ereignis aus dem Bewusstsein ins Unterbewusste zu verdrängen.
„Ich hatte so ein merkwürdiges Gefühl“, sprach ich mit gesenktem Blick weiter.
Aus den Augenwinkeln konnte ich sehen, wie sich Frau Müllers Gesicht nun vollkommen erhellte. Es waren immerhin ihre ersten Erfolge, was meinen Fall anging.
„Was für ein Gefühl?“, hakte sie nach.
Ich versuchte krampfhaft, mir dieses Gefühl in Erinnerung zu rufen, damit ich es irgendwie einordnen konnte. Es dauerte einige Minuten, bis ich die nötige Konzentration aufbringen konnte, mich zu erinnern und ich war Frau Müller ziemlich dankbar, dass sie nicht wie sonst üblich, die Stille mit irgendwelchen total dämlichen Fragen zu unterbrechen versuchte.
Ich legte meine Hände an meine Stirn, als würde es mir dadurch leichter fallen, mich zu erinnern, und atmete langsam ein und aus. Hätte ich doch nur Kaugummi dabeigehabt. Irgendwie meinte ich, mich daran erinnern zu können, dass ich mal gelesen hatte, dass Kaugummikauen einem dabei helfen konnte, sich an etwas zu erinnern.
Natürlich. An so einen Schwachsinn erinnerte ich mich, aber nicht an etwas, was mich momentan weiterbringen würde. Ich fing an, noch langsamer zu atmen und mit meinen Händen meine Schläfen, über die Strähnen meiner schwarzen Haare fielen, zu massieren. Dann, endlich, konnte ich mich an dieses sonderbare Gefühl erinnern. Es war ein Gefühl der Verbindung mit irgendetwas oder irgendjemandem. Etwas, das mein Herz schneller schlagen und meinen Puls rasen ließ. Ein Zustand der Aktivität.
Umso genauer ich mich zu erinnern versuchte, umso schwammiger wurde die Erinnerung wieder, sodass ich mir letztendlich nicht einmal mehr sicher war, ob ich mit irgendjemandem verbunden war – es käme mir auch durchaus lächerlich vor, wenn es so wäre – oder ob etwas anderes der Grund für diesen Zustand war.
„Es war ein merkwürdiges Gefühl“, begann er, obwohl er noch nicht bereit war etwas zu sagen.
Frau Müller sah ihn mit geweiteten Augen und angehobenen Augenbrauen an und wartete darauf, dass er weitersprach, doch er tat es nicht. Stille. Dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, hob er, wie in Trance, seinen Blick und sah Frau Müller tief in die Augen. Er wusste selber nicht genau, was er gerade tat. Eigentlich wollte er, so lange er sich noch unsicher war, schweigen, doch irgendetwas in ihm drin hatte die Kontrolle über ihn übernommen.
„Ich hatte das Gefühl, als würde alles zu Ende gehen.“
Er hatte den Satz kaum ausgesprochen, da fiel sein Kopf schon auf seine Brust und seine Augen schlossen sich. Nicht einmal Frau Müller sagte etwas, so verwirrt war sie von diesem Anblick und den Ereignissen der letzten Minuten.
„Ich fühle mich, als hätte mich ein Lkw überfahren“, begrüßte ich Tim, als dieser meine Wohnung betrat.
„Ich freue mich auch, dich zu sehen“, sagte er breit grinsend und schmiss sich auf mein Sofa.
Schmunzelnd schüttelte ich den Kopf und setzte mich zu ihm.
„Also, was gibt’s?“, fragte er.
„Wie kommst du darauf, dass es etwas Besonderes gibt?“
„Ramon, du wirst es mir vielleicht nicht glauben, aber ich kenne dich schon ziemlich lange... Ich merke, wenn etwas nicht stimmt.“
„Vermutlich kennst du mich mittlerweile besser, als ich mich selbst“, sagte ich schwach und seufzte leise.
„Das wollte ich jetzt nicht unbedingt aussprechen, aber da du es selbst gesagt hast, kann ich nichts dagegen einwenden“, lachte er.
Ich beneidete ihn so sehr um seine fröhliche und gut gelaunte Art. Er könnte echt viele Freunde haben, wenn er nicht so viel Zeit damit verbringen würde, seine Zeit mit mir zu vergeuden. Er könnte viel öfter ausgehen und andere Sachen machen, die normale Leute in unserem Alter machen würden. Stattdessen fuhr er, sobald ich ihn brauchte, zu mir, war immer telefonisch erreichbar und stand mir bei allem zur Seite.
Ich hätte keinen besseren besten Freund haben können als ihn, dennoch gab es Zeiten, in denen mich die Schuldgefühle einholten. Tim könnte in seinem Leben viel mehr erreichen als ich und das Einzige, was ihn davon abhielt, war ich.
„Ich hatte heute eine ziemlich merkwürdige Therapiestunde bei Frau Müller“, begann ich und dann erzählte ich ihm alles, was passiert war.
Auch erzählte ich ihm die eine Sache, die ich Frau Müller verschwiegen hatte. Und zwar, dass ich, nachdem mein Kopf auf meiner Brust lag, nur eine Sache vor Augen hatte: Luanas Gesicht.
„War es eine Voraussage?“, hakte Tim nach.
„Es war die merkwürdigste Voraussage, die ich je hatte“, bestätigte ich ihn.
„Aber sie ist schon tot. Sie kann nicht noch einmal sterben“, fuhr ich fort und sah, wie sich Tims Augen weiteten und er mich erstaunt ansah.
„Denkst du, dass du bald selber sterben wirst?“, fragte Tim ungewöhnlich ernst und es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass er sich ernsthaft um mich sorgte.
„Ich weiß es nicht... Das ist alles so verwirrend. Erst dieses merkwürdige Gefühl –“
„Das Gefühl, bald zu sterben“, warf Tim ein.
„Dann mein merkwürdiges Verhalten und dann Luana –“
„Die übrigens schon gestorben ist.“
Ich nickte stumm.
„Klingt doch ziemlich nach Sterben, oder?“, murmelte ich leise.
Tim sagte nichts. Er sah mich einfach nur stumm an. Es war ungewöhnlich, dass meinem Freund Tim einmal die Worte fehlten. Ich kannte ihn seitdem ich denken konnte, und noch nie kam es so weit, dass er nicht wusste, was er auf etwas antworten sollte. Und es war verständlich. Ich selber wusste auch nicht, was ich sagen, geschweige denn was ich überhaupt denken, sollte.
Jede meiner Voraussagen hatte zum Tod der, in ihr enthaltenen, Person geführt, aber Luana konnte nicht mehr sterben. Sie war schon tot. Sie war die erste Person, die ich hatte sterben sehen. Mit ihr fing alles an, aber was war, wenn mit ihr auch alles enden würde? Wenn die Voraussage mit ihrem Gesicht das Ende meines Lebens markierte.
Irgendwie klang das logisch für mich.
„Scheiße“, rief Tim nach einer Weile, vermutlich hatte er gerade denselben Gedanken wie ich.
„Was machen wir jetzt?“, fragte er mich.
Ich zuckte mit den Schultern.
„Ich weiß es nicht.“
Stille.
„Ich weiß es wirklich nicht... Genau deshalb hatte ich ja gehofft, du könntest mir diese dummen Gedanken ausreden.“
Ich versuchte, meine Stimme ruhig klingen zu lassen, doch ich scheiterte und hoffte, dass Tim das Zittern in meiner Stimme überhört hatte.
„Eigentlich können wir jetzt nur noch abwarten, oder?“, hakte Tim nach.
„Ich weiß es nicht.“
Dieses Mal gab es keine Hoffnungen, dass er das Zittern in meiner Stimme überhört haben könnte, da es unmöglich zu überhören war.
„Aber denkst du nicht, dass du deinen eigenen Tod ein bisschen anders vorhergesehen hättest?“, überlegte Tim.
Ich sparte es mir, ihm zu erklären, dass ich es nicht wissen konnte, weil ich genau wusste, dass er momentan mehr mit sich selbst redete, als mit mir, und deshalb wollte ich seinen Monolog nicht unterbrechen.
„Ich meine, du hast alle Tode erstaunlich genau vorhergesehen, da müsstest du doch auch bei dir selber wissen, wann es so weit ist... Und außerdem... Vielleicht ist es ja ein gutes Zeichen, dass du Luana gesehen hast. Es muss nicht immer alles schlecht sein... Wie kommt man überhaupt von dem Gefühl tiefer Verbundenheit auf das Gefühl, dass etwas bald enden wird? Und bist du dir sicher, dass du wirklich keine Verbundenheit zu Luana gespürt hast – ich meine, du hast sie gesehen?“
Die Gedanken sprudelten nur so aus ihm heraus und mir wurde wieder einmal bewusst, was ich ihm zumutete. Ich war eine Last für ihn, und wenn ich jetzt sterben würde, dann würde das alles noch viel schlimmer machen. Seine Reaktion bestätigte mich. Ich hatte tatsächlich alles richtig gemacht, indem ich mich seit diesem einen Tag größtenteils von anderen Menschen fernhielt. Das konnte man niemandem zumuten. Mich konnte man niemandem zumuten.
Nach einem Blick auf die Uhr stellte Tim fest, dass er schon wieder einmal zu spät zu einem Termin kommen würde. Ich sah ihm an, dass er sich ziemlich unwohl dabei fühlte, mich alleine zu lassen, deshalb versuchte ich ihm unauffällig zu signalisieren, dass es mir gut gehen würde; alleine.
Als Tim weg war, bemerkte ich erst, wie ruhig es bei mir zu Hause doch war. Normalerweise fiel mir nicht auf, wie einsam ich doch war, da mir meine Wohnung noch nie so still vorgekommen war, wie in diesem Moment.
Ich hatte nicht einmal Lust darauf, den Fernseher anzuschalten, um für Hintergrundgeräusche zu sorgen, also beschloss ich noch schnell den Müll herunterzubringen, danach könnte ich schlafen gehen oder so. Ich öffnete meine Wohnungstür und lauschte vorsichtig, ob ich jemanden hören konnte. Nichts.
Schnell warf ich einen Blick aus dem Fenster. Die Straße war leer. Nicht, dass ich es anders erwartet hätte. Es war kurz nach 16.00 Uhr. Die meisten Bewohner dieses Hauses waren zu diesem Zeitpunkt noch auf der Arbeit, außer vielleicht die ältere Dame aus dem Erdgeschoss, aber sie war mein kleinstes Problem.
Ich beeilte mich, nach unten zu gelangen, da ich immer mit allem rechnen musste, auch wenn ich bis jetzt immer gut davongekommen war. Dummerweise war ich so darauf bedacht, mich zu beeilen, dass ich viel Zeit dabei verlor, die Mülltonne zu öffnen, weil ich mir keine Zeit dafür nehmen wollte, die Müllsäcke abzustellen. Fluchend schaffte ich es dann doch, den Müll in die Tonne zu werfen, und beschloss innerlich, dass ich mir das nächste Mal die Zeit dafür nehmen würde, den Müll abzustellen.