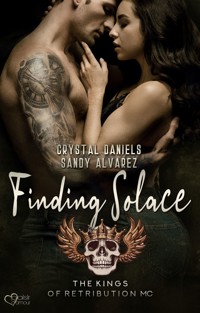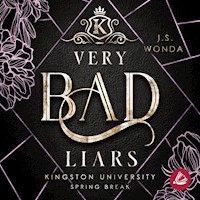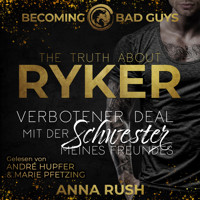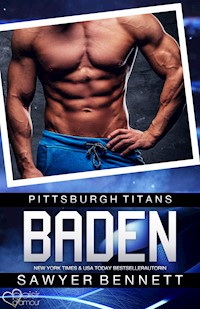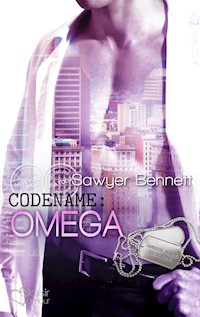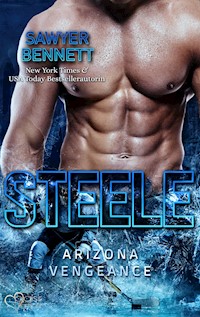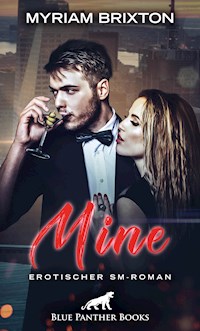
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: blue panther books
- Kategorie: Erotik
- Serie: BDSM-Romane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Dieses E-Book entspricht 336 Taschenbuchseiten ... Jonathan ist mächtig. Jonathan ist skrupellos. Jonathan ist reich. Sex ist für ihn ein Ventil, um neue Kräfte zu tanken. Kräfte, die er braucht, um seine undurchsichtigen Geschäfte, seine Karriere und seinen Machteinfluss voranzutreiben. Er benutzt Frauen, ohne auch nur das Geringste für sie zu empfinden - bis er auf Isabell trifft. Sie ist klug, schön und eine Kämpferin. Isabell möchte studieren und sich ein Leben in Würde und Freude zurückerobern. Ein Leben, das sie durch einen tragischen Schicksalsschlag verloren hat. Dafür ist sie bereit, ihren Körper zu verkaufen. Jonathan gabelt die junge Frau von der Straße auf und nimmt sie unter Vertrag. Ihr Körper gehört fortan ihm. Im Gegenzug dazu finanziert er ihr Studium und stellt ihr eine Wohnung zur Verfügung. Nur Jonathan ist ihr Körper vorbehalten. Sie ist sein Spielzeug, das er mit niemand anderem teilen will. Doch bald schon bemerkt Jonathan, dass Isabell anders ist. Dass sie ihn verändert und seinem Herzen gefährlich nahe kommt. Isabell wird für Jonathan zur Bedrohung, der er mit roher Gewalt begegnet. Wird die junge Frau es schaffen, ungebrochen aus diesem Deal hervorzugehen? Diese Ausgabe ist vollständig, unzensiert und enthält keine gekürzten erotischen Szenen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum:
Mine | Erotischer SM-Roman
von Myriam Brixton
Myriam Brixton wurde 1973 in London geboren und wuchs in einem Heim auf.Sie studierte Philosophie und lernte während eines Auslandssemesters einen hochrangigen afrikanischen Politiker kennen. Ihre heimliche Liebschaft mit dem fast dreißig Jahre älteren Staatsmann währte rund zehn Jahre, in denen sie stets versuchte, ihn von Demokratie, Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit zu überzeugen. Als sie sich 2003 schließlich von ihm trennte, tauchte sie unter und nahm zu ihrer eigenen Sicherheit eine neue Identität an.2009 kam der Staatsmann bei einem bis heute ungeklärten Flugzeugabsturz ums Leben.Vielleicht sind ihre Bücher auch eine Art Aufarbeitung ihrer Erlebnisse während dieser Jahre.
Lektorat: Sandra Walter
Originalausgabe
© 2019 by blue panther books, Hamburg
All rights reserved
Cover: AleksandarNakic @ istock.com
Umschlaggestaltung: www.heubach-media.de
ISBN 9783862774050
www.blue-panther-books.de
Kapitel 1
Eine Beziehung wollte ich nicht eingehen. Private Verpflichtungen waren nicht mein Ding. Rücksichtnahme, Beziehungsgespräche, die mir binnen weniger Tage den letzten Nerv raubten und überhaupt die Vorstellung, mit nur einer einzigen Frau zusammen zu sein, all das waren Argumente, die eindeutig gegen eine Beziehung sprachen. Zudem langweilte mich jede Frau innerhalb kürzester Zeit, spätestens dann, wenn ich mehrmals oder manchmal auch nur einmal mit ihr geschlafen hatte. Und dann war es meist unheimlich mühsam, diese Kletten wieder loszubekommen. Eine ewige Heulerei, die irgendwann in bösartige Beschimpfungen mündete.
Gleichsam anstrengend empfand ich Affären oder auch nur One-Night-Stands. Es kam immer auf das Gleiche hinaus. Ich wollte ficken, sonst nichts. Unverbindlich und ohne Emotionen. Aber die Mädchen verknallten sich zielsicher. Sie wollten ein Wiedersehen, sie wollten mehr und widerten mich ab diesem Moment unglaublich an.
So war es das »Elisa Galéen« geworden, wo ich meinen Durst nach körperlicher Befriedigung stillen konnte. Kein Geheule, keine Illusionen, keine falschen Hoffnungen, keine bescheuerten Dialoge. Und wenn, dann solche, die schmutzig waren und mich aufgeilten. Ich legte großen Wert auf ästhetische Frauen und die waren dort zu Hauf zu finden. All diese Mädels hätten das Zeug gehabt, Karrieren als Models anzustreben. Stattdessen ließen sie sich von sämtlichen wohlhabenden Männern der Stadt in den Arsch ficken. Sie verlangten ihren Preis, aber sie waren es, zumindest optisch, allemal wert.
Kapitel 2
Dr. Caruso öffnete auf seine elegant, charmante Art die Tür und begrüßte mich in seiner gewohnt arroganten Gastlichkeit. Dieser Mann hatte vermutlich weder Monate auf einer einsamen Insel verbracht, noch jemals eine Universität von innen gesehen. Er war der Typ Zuhälter, der durch Witz, Charme, Bauernschläue und jede Menge Verbindungen zu Politik und Polizei ein erotisches Imperium aufgebaut hatte. Er besaß Clubs in mehreren Metropolen der Welt und ließ die Mädchen geschickt von Club zu Club wechseln, sodass er den Kunden das Gefühl vermittelte, regelmäßig Frischfleisch vorzufinden. Ich wählte Katharina, eine große, blonde Schönheit mit blauen Augen, langen, glatten Haaren, einem sinnlichen Mund, von dem ich bereits wusste, was er in wenigen Augenblicken machen würde. Katharina bestand zu einem großen Teil aus Beinen. Sie erinnerte mich an ein Fohlen. Ich hatte sie bereits einige Male gebucht und wollte sie heute für die ganze Nacht haben. Inklusive Zimmer war ich mit fünftausend Dollar dabei. Extrawünsche ausgenommen. Ich konnte es mir leisten und ich wollte es mir leisten. Katharina würde am nächsten Tag nicht heulen und nicht nach einem Wiedersehen flehen. Ich würde mit ihr machen können, was ich wollte und wenn ich keine Lust mehr auf sie hatte, konnte ich sie zum Teufel schicken. Diese Art von Beziehung gefiel mir. Ich folgte Katharina aufs Zimmer und sie verschloss hinter uns die Tür.
Ich blickte an mir herab, auf meine High Heels, die schon beim Anprobieren geschmerzt hatten. Ich streifte mir das schwarze Minikleid über, das ich mir erst vor wenigen Tagen gekauft hatte. Es war ein billiger Laden gewesen. Einer dieser Läden, in denen alles für wenig Geld zu haben war und dessen Geruch die Atmosphäre eines Chemielabors vermittelte. Geschirr, Kleidung, Kinderspielzeug, selbst verpackte Lebensmittel konnte man hier erwerben, solange man keine Angst vor Krebserregern hatte. Das Kleid war simpel. Dünner Stoff, nicht viel davon, in der Form eines Schlauches. Es schlang sich eng um meinen Körper wie die Haut einer schwarzen Mamba. Ich hatte lange vor dem Spiegel gestanden und mich von allen Seiten betrachtet. Nicht, dass ich mich wohlgefühlt hätte. Im Gegenteil. Es war, als wäre ich nackt. Als stünde ich in diesem Giftladen wie die schwarze Mamba, die schon so lange nichts mehr erbeutet hatte. Ein ausgehungertes Tier, das vor Verlangen zu allem bereit war. War ich bereit für dieses Kleid? Ich musste es sein. Die Schuhe waren dagegen ein Klacks. Sie standen einige Regale weiter und gingen einfach mit.
Meine Haare verdeckten den tiefen Ausschnitt am Rücken des Kleides. Das gab mir etwas Schutz. Ich hatte ein großes Ziel oder vielmehr eine Vision und mir war klar, dass der Preis dafür ein hoher sein würde. Aber welche Preise hatte ich in meinem kleinen Leben nicht bereits bezahlen müssen?
Wackelig in meinen Schuhen, setzte ich mich in Bewegung. In jenes Viertel der Stadt, wo die teuren Hotels neben den Luxusboutiquen angesiedelt waren. In den Bars tanzte die finanzielle Elite des Landes mit den Schönen. Auch Touristen mit dementsprechendem monetären Background suchten diese Gegend auf.
In den Restaurants kostete eine Vorspeise so viel, wie ich an einem ganzen Tag als Babysitterin verdienen konnte. Vielleicht musste ich sogar zwei Tage dafür arbeiten. Ich hatte immer gerne auf Kinder aufgepasst, als ich noch zur Schule gegangen war. Doch nun war die Schulzeit vorbei. Das Abitur hatte ich in der Tasche. Mit Auszeichnung. »Großartige Leistung« hatte der Direktor bei der Zeugnisverteilung gesagt. Ich lächelte. Die Erinnerung an das Lob tat gut.
Als ich das noble Viertel erreicht hatte, blieb ich stehen. Und jetzt? Wie sollte ich mich verhalten? Wohin genau sollte ich gehen? Wie sollte ich gehen? Oder einfach stehen bleiben? Mein Herz schlug spürbar schneller. Ich blickte zu Boden. Da unten erschien es mir am sichersten.
Der Tag war ein anstrengender gewesen. Drei Meetings, ein Haufen unselbständiger Mitarbeiter, die abwechselnd mein Einverständnis gebraucht und mir damit auf die Nerven gegangen waren. Zusätzlich vier Telefone, die nicht aufhören wollten, zu läuten. Und das alles nach einer ganzen Nacht im »Elisa Galéen«. Mein Schädel brummte. Ich beschloss, auf dem Heimweg ein Bier im »Cult« zu nehmen. Hier brauchte ich dem Barkeeper nicht zu sagen, welche Sorte in welcher Größe ich unverzüglich serviert haben wollte. Alles war Routine und ich erhielt zu jeder Zeit einen Platz, oft zum Ärgernis anderer Gäste. Ich parkte meinen Porsche im Halteverbot. Der Weg ins »Cult« war von hier aus der kürzeste. Meine Laune war schlecht und die innere Unruhe setzte mir zu.
Kapitel 3
Ich bemerkte das Mädchen aus den Augenwinkeln. War es ein Kind? Kinder trugen für gewöhnlich keine Stöckelschuhe und auch keine schwarzen, eng anliegenden Kleider, die gerade einmal bis über das Gesäß reichten. Die Größe des Mädchens ließ auf ein Kind schließen, so auch ihr Körperbau. Ihre Kleidung jedoch sprach die Sprache der Erwachsenen. Sie stand dort drüben im Halbdunkeln unter der Straßenlaterne, regungslos, den Blick zu Boden gesenkt. Kurz darauf stieß ich die Tür zum »Cult« auf und fiel in einen der Lounge Sessel.
Ich wusste nicht, wie lange ich hier gestanden hatte. Ich fühlte mich miserabel und wollte weg. Ich hatte mich für einen Schritt entschieden, dessen Umsetzung in die Realität schon jetzt schwierig wurde. Ich stand einfach nur da und starrte auf den Boden. Nichts geschah, außer, dass meine Fußballen zu brennen begannen und die Riemen der Schuhe sich in meine Zehen schnitten. Ich wollte, dass jemand neben mir stehen blieb und mich ansprach und gleichzeitig wollte ich genau das überhaupt nicht. Ich zog die blöden Schuhe aus und begann, zu laufen. Morgen war ein neuer Tag und vielleicht war dann alles leichter.
Als ich am nächsten Abend meinen Porsche durch dieselbe Straße lenkte, war sie wieder da. Wie am Vorabend stand sie unter der Laterne und hielt die Hände gefaltet. Ihr Blick haftete am Boden. Betete sie? Oder wartete sie auf jemanden? Auf eine Eingebung? Hier? In dieser Kleidung? Das passte nicht zusammen. Als ich das »Cult« verließ, war sie verschwunden. Wie am Tag zuvor. Warum fiel mir das überhaupt auf? Es war Freitagnacht, das Wochenende stand bevor und ich hatte Lust, Druck abzulassen. Ich lenkte meinen Porsche in die Tiefgarage des »Elisa Galéen« und inhalierte den Anblick der Models, die mich an der Bar empfingen. Warum ich mich dann doch wieder für Katharina entschied, konnte ich mir nicht genau erklären. Vielleicht, weil sie meine Vorlieben bereits kannte und die ganze Nacht wacker durchhielt. Sie war schön, sie war heiß und sie war willig. Never change a winning team.
Rein gar nichts war leichter am nächsten Abend. Im Gegenteil, der Mut verließ mich schneller als am Tag zuvor. Mit den Schuhen in der Hand lief ich über den Asphalt, bis meine Füße rabenschwarz waren.
Den Samstag verbrachte ich mit Small Talk im Tennisclub. Viele meiner beruflichen Kontakte hatte ich hier geknüpft. Ich war ein guter Netzwerker, was sich beruflich als großer Vorteil herausstellte. Ich wusste stets, wie es um die Unternehmen im Land stand. Ich hatte meine Quellen und ein untrügliches Gespür, welche Unternehmen es sich lohnte, aufzukaufen. Renditenschwache Teile der Unternehmen wurden abgegeben, Lieferantenverträge gekündigt, wenn sie ihre Waren nicht im zweistelligen Prozentbereich günstiger anbieten konnten. Die Produktion wurde in Billiglohnländer ausgelagert. Um Personalkosten einzusparen, folgte meist eine gröbere Kündigungswelle und schon machte das Unternehmen satte Gewinne. Nach einigen Jahren verkaufte unsere Investorengruppe das Unternehmen weiter und schnitt mit einem saftigen Plus ab. Danach wurde das Spiel mit einer anderen Gesellschaft wiederholt. Die verkauften Betriebe hielten sich oft nicht mehr lange am Markt, weil sie ausgesaugt waren. »Hinter mir die Sinnflut« lautete mein Motto. Ich war ein Spieler, das Leben war ein Spiel. Geld zu verdienen, machte mir Spaß und ich hatte genug von beidem: von Geld und von Spaß.
Kapitel 4
Den Abend wollte ich zu Hause verbringen. Die vergangene Nacht mit Katharina war einmal mehr intensiv gewesen. Sie war mit Sicherheit noch völlig wund und fiel für die nächsten Tage aus. Der Gedanke gefiel mir. Ich hatte sie hart rangenommen. Es waren in Summe siebentausend Dollar, die mich die Nacht inklusive Extrawünsche gekostet hatte. Dr. Caruso würde sein Rennpferdchen schon wieder gesund pflegen.
Kapitel 5
Ob die Kleine wohl wieder unter der Laterne stand? Es war die Neugierde, die mich zu später Stunde doch noch auf die Straße lockte. Ich wollte wissen, ob sie da war. Im Halbdunkeln versteckt, den Blick im Boden versenkt, betend. Ein wenig mehr Beleuchtung hätte dieser Block durchaus vertragen. Kaum bog der Wagen um die Kurve, stach sie mir ins Auge. Als ich an ihr vorbeifuhr, streifte mich ein scheuer Blick. Vielleicht bildete ich mir das aber auch nur ein.
Ich riss den Porsche nach rechts in eine Parklücke und überquerte offensiv die Straße. Je näher ich dem Mädchen kam, desto winziger wurde sie. Jetzt, als ich vor ihr stand, reichte sie mir nicht einmal mehr bis zur Brust.
»Was tust du hier?« Sie antwortete nicht. Sie sah mich nicht einmal an.
»Ich sehe dich seit drei Abenden hier stehen. Auf wen wartest du?« Kein Ton entkam der Minifrau. Verstand sie mich überhaupt?
Mir war das weiße Auto schon die Tage zuvor aufgefallen. Dieses Rennauto, dessen Motorengeheul sich wie das Brüllen eines Löwen anhörte. Jeden Abend war es an mir vorbeigerauscht und hatte sein Röhren zum Besten gegeben. Es war gar nicht möglich gewesen, es nicht zu bemerken. Dass es nun aber genau jener weiße Hai war, welcher dort drüben in der Finsternis anhielt und seinen Herren ausspuckte, schnürte mir die Kehle zu. Ich sah eine mächtige Gestalt auf mich zukommen und fand mich in einem dieser grimmigen Träume wieder, in denen ich verfolgt wurde und meine Beine nicht gehorchten. Ich war gelähmt.
Kapitel 6
Erinnerungen, die ich längst verschüttet hatte, kamen in mir hoch. Ich war plötzlich wieder in jenem Heim, in welches ich nach dem Unfall meiner Eltern gebracht worden war. Ich war erst drei Tage dort gewesen, als mich der Betreuer nachts zu sich geholt hatte. Er brachte mich in sein Zimmer. Der Vorhang war zugezogen, sodass man von außen nicht hineinsehen konnte. An der Wand hingen Zeichnungen, die von Kindern gemalt worden waren. Zeichnungen von windschiefen Häusern und Tieren, deren Artenzugehörigkeit nur zu erraten war. Ein Bücherregal, in dem alles kreuz und quer lag, war an der Mauer festgenagelt. Das Bett war ungemacht. Er knipste auf dem Schreibtisch die Tischleuchte an und setzte mich darauf. Ich hielt die Luft an, irgendetwas war in diesem Moment nicht in Ordnung. Was das war, verstand ich erst, als er mir das Nachthemd über den Kopf zog. Er drohte mir, mich in den Keller zu sperren. Ein Sterbenswörtchen und ich säße in der feuchten Finsternis. Niemandem würde es auffallen, wenn ich verschwunden wäre. Es waren ohnehin viel zu viele Kinder hier. Ich war damals zehn Jahre alt. Ich glaubte ihm jedes Wort. Erstarrt saß ich vor ihm. Ich zitterte, obwohl mir nicht kalt war und es kostete mich immense Kraft, Luft in die Lunge zu ziehen. Meine Augen brannten. Sie wollten sich nicht schließen lassen. Sie hörten nicht auf, ihn anzustarren. Diesen Mann, der die nächsten Jahre auf mich aufpassen sollte. Ich wollte weinen, aber es ging nicht. Ich wollte »Bitte« sagen, aber auch das kam nicht heraus. Er bog den Draht der kleinen Tischlampe wie einen Spot zurecht, bevor er mit beiden Händen meine Beine auseinanderdrückte. Die Zeit hatte angehalten. Ich erinnerte mich an seinen Blick. Seine Augen traten hervor, sein Mund öffnete sich. Er sah aus, als hätte ihn von hinten eine Eisenstange getroffen. Er verwandelte sich in einen Zombie und nahm mich in seinem Horrorfilm gefangen. Ich erinnerte mich an den Augenblick, als er die Schreibtischlade aufzog und eine Kamera hervorholte. Die andere Hand griff nach mir. Ich wollte weg. Ich wollte schreien. Ich wollte treten. Nichts davon tat ich. Ich rührte mich nicht. Auch nicht, als seine Finger in mein Inneres drangen. Klick. Klick. Klick. Ich weiß nicht, wie viele Finger es gewesen waren, die sich wie Tentakel in meine geheimste Stelle gebohrt hatten. Nur das Klicken der Kamera nahm ich wahr. So, als wollten die Töne mich warnen, bloß den Mund zu halten. Er hob mich vom Tisch. Ich war eine Barbie. Meine Körperteile ließen sich verbiegen. Der Puppenspieler krümmte mich in jede Stellung. Nur meine Augäpfel blieben selbstbestimmt und richteten ihren Fokus genau dorthin, wohin mein »Ich« nicht sehen wollte. Es war das erste Mal, dass ich einen erigierten Penis sah. Mit einem Griff hatte er den Knoten seines Bademantels aufgezogen und sich in meinen Mund geschoben. Ich würgte und krümmte mich reflexartig nach vorne. Mein Hals war zu kurz. Ich war gefangen in einer Welt aus Brechreiz, aus Panik und der Gefahr, zu ersticken. Die Hand des Zombies hatte sich in den Haaren der Puppe festgekrallt. Die Geräusche, die von oben kamen, waren dämonisch. Es war das Böse, das sich aus der Finsternis anschlich. Lauter und lauter wurde es. Der Horror kam immer noch näher. Es waren die Klauen des Teufels, die mich festhielten! Ich konnte seine Hufen sehen! Und plötzlich war alles still. Alles ruhig. Alles wie erstarrt. Nichts regte sich mehr, so als wäre der Dämon zu Eis erstarrt. Ich übergab mich vor seinen Augen.
Wie ich damals zurück in mein Bett gekommen war, weiß ich nicht mehr. Hatte er mich getragen? War ich alleine gegangen? War ich jemandem auf dem Flur begegnet? Was war danach geschehen? Nichts davon war in meinem Gedächtnis geblieben. Die Stunden danach waren ausgelöscht. Erst, als ich mich mit meiner schwarzen Tasche auf der Straße wiederfand und keine Ahnung hatte, wohin ich gehen sollte, erst da setzte meine Erinnerung wieder ein. Wie viel Zeit dazwischen vergangen war und womit ich diese verbracht hatte, weigerte sich mein zentrales Nervensystem, wiederzugeben.
Kapitel 7
Ich blickte dem Fremden ins Gesicht. Warum war dieser Mann, der Herr des weißen Hais, zu mir gekommen? Warum stand er jetzt da und sprach mich an?
»Gib mir eine Antwort. Du erscheinst wie ein Mahnmal. Wie eine Betende. Eine Wartende. Eine zu Boden Starrende. Was tust du hier?«
Mein Hals war zugeschnürt. Ich hätte gesprochen, wenn es möglich gewesen wäre. Ich spürte nur mein Herz. Aber nicht dort, wo es hingehörte. Mein Herz pochte im Hals.
»Mädchen, du bist jung, du bist hübsch. Hier zu stehen, kann dumm für dich ausgehen. Du solltest zu Hause oder mit Freunden unterwegs sein, aber nicht alleine. Nicht in dieser Kleidung und nicht an dieser Straßenecke. Das könnte zu falschen Schlussfolgerungen führen, und das möchtest du doch nicht? Oder?«
»Das ist mein Vorhaben.« Ich hatte es gesagt. Es war raus.
Also doch das »Oder«? »Du stehst hier, um deinen Körper zu verkaufen? Habe ich dich richtig verstanden?«
»Ja.«
»Du bist ein Kind. Wie lange machst du das schon?«
»Ich bin Anfängerin.« Wie damals wollten sich nur noch meine Augäpfel bewegen. Ich war wieder die Barbiepuppe. Er hätte mich nur wegtragen müssen.
»Du bist Anfängerin.« Na klar, Mädchen, und ich bin total blöde. »Brauchst du Geld für Drogen?«
Die Kleine war doch krank, oder? So, wie sie dastand und gaffte. Riesige Augen. Völlig überzeichnet. Wie die einer Kuh. Die Körperhaltung so, als hätte ihr ein Unsichtbarer »Freeze!«ins Ohr gehaucht. Sie musste psychisch abgefuckt sein, ein anderes Bild ergab sich für mich nicht.
»Wo wohnst du? Ich bring dich heim.« Wollte ich sie wirklich in meinem Wagen haben? Was, wenn sie kotzte? Oder durchdrehte? Plötzlich ins Lenkrad griff? Sie war hübsch. Gestört, aber hübsch.
Wieder kein Ton. Nur Stille. Nein, ich wollte sie nicht in meinem Auto haben. Ich wollte sie ficken. Oder? Ach, scheiß drauf. Ich drehte mich um und ging.
Ich musste etwas sagen! Unbedingt! Seit drei Tagen kam ich nun hierher, ohne dass etwas passiert war. Hör auf, eine Barbiepuppe zu sein! Los jetzt! Mach den Mund auf, der Typ haut sonst ab! Rede endlich! »Ich bin Studentin. Ich muss Geld verdienen!«
Ich hatte gesprochen. Endlich. Noch dazu die Wahrheit. Zumindest einen Teil davon. Ich wollte an Geld kommen. In meinem Herzen war ich keine Prostituierte. In meinem Herzen war ich eigentlich gar nichts mehr, seit damals, als meine Eltern den Unfall gehabt hatten. Seit diesem Tag, der mein ganzes Leben vernichtet hatte. Ich wollte wieder zurück ins Leben! In ein schönes Leben! So, wie es einmal gewesen war. Dafür stand ich hier! Nur dafür! Vielleicht würde er derjenige sein, der mich hier rausholte. Ich hoffte es. Mir graute davor. Er wusste, was er wollte. Und ich wusste nicht einmal, wie es ging. Die Nacht im Heim hatte mir die Abgründe menschlicher Seelen gelehrt.
»Ich bin gesund, Sie können mich ruhig mitnehmen.« Das hatte ich jetzt wirklich gesagt? Aber was, wenn er nicht gesund war?
»Mädchen, wie alt bist du eigentlich? Ich möchte mich nicht wegen Kindesmissbrauch verantworten müssen.Warum suchst du dir nicht einen anständigen Job?«
»Ich kann beweisen, dass ich neunzehn bin. Was würden Sie bezahlen?« Hör auf, zu fragen! Nimm mich endlich mit!
»Ist dir eigentlich bewusst, was du gerade tust?«
Mann! Darüber wollte ich nicht nachdenken! Ich wusste selber, dass ich kneifen würde, wenn die Gedanken zu tief gingen. Augen zu und durch! Mit diesem Vorsatz war ich seit drei Tagen hierhergekommen. Und immer wieder abgehauen. Ich hatte ja versucht, einen anderen Job zu bekommen. Ich hatte die letzten Schulwochen nichts anderes getan, als nach Arbeit zu suchen. Ich schrieb Bewerbungen an alle möglichen Unternehmen. Ich erhielt sogar ein paar Einladungen zu Gesprächen. Selbst das eine oder andere Jobangebot war dabei gewesen. Allerdings war die Bezahlung bei all den Teilzeitangeboten dermaßen schlecht, dass ich damit kein Studium hätte finanzieren können. Und einen Vollzeitjob konnte ich nicht annehmen, weil ich Zeit für die Ausbildung benötigte. Ich wollte studieren. Ich wollte ein anderes Leben führen als jenes der letzten neun Jahre! Dieser Typ hatte keine Ahnung, wer ich war, woher ich kam und wie ich lebte! Aber er stellte bescheuerte Fragen!
»Entweder Sie buchen mich jetzt auf der Stelle, oder Sie gehen weiter. Wenn Sie hier neben mir nur rumstehen, dann vertreiben Sie mir die anderen Kunden.« Wow, war ich mutig. Ich hörte mich sprechen und verblüffte mich selber. Er war mein erster Kunde. Nicht mal das, er war mein erster Interessent. Eigentlich sollte ich ihn ködern, nicht verscheuchen. Aber seine Fragen verschlimmerten meine Unsicherheit. Er sollte damit aufhören! Ich wollte Geld verdienen. Ich wollte studieren. Ich wollte mein Leben zurück. Los, du Kerl, nimm mich jetzt mit!
»Wie heißt du?«
»Isabell.«
»Ist das dein richtiger Name?«
»So haben mich meine Eltern getauft.« Danke für die Idee, ich würde mir bei Gelegenheit einen Künstlernamen einfallen lassen.
Doch. Ich wollte sie ficken. Warum nicht auch mal eine Kranke ficken? Oder vielleicht mal gerade deshalb?
»Okay, wie viel willst du?« Schon wieder diese Glubschaugen. Was jetzt, Mädchen? Wollen oder nicht wollen?
Scheiße. Und jetzt? Der Typ fragte nach dem Preis. Schuhe ausziehen und rennen? Wie viel ich wollte? Keine Ahnung. Gar nichts. Ich wollte gar nichts, weil ich gar nicht wollte. Plötzlich war alles anders. Auf diesen Moment hatte ich gewartet und war gleichzeitig überhaupt nicht darauf vorbereitet. Mein Kreislauf kippte. Ich fühlte Übelkeit und Schwindel. Ich sollte mich hinsetzen. Schnell, bevor ich wegkippte. Ich kannte das bereits. Aber jetzt durfte ich nicht umfallen. Nicht jetzt. Komm, Isabell, denk an dein Ziel und mach weiter!
»Wie viel bin ich Ihnen denn wert?« Meine Stimme war verschwunden, ich konnte sie selbst nicht mehr hören. Der Typ kniff die Lider zusammen. Vor meinen Augen tauchten die Kinderzeichnungen auf. »Dreihundert.« Was hätte ich bloß sagen sollen? Wo konnte ich mich hinsetzen?
Die Kleine quasselte doch irgendetwas. Ich fragte sie nach einer Zahl, sie sagte eine Zahl. Eine x-beliebige. Mir erschien es, als konnte sie nicht klar denken. Benebelt von den Drogen? Psychopharmaka? Bipolar, Borderline? Auf alle Fälle durfte ich die Kondome nicht im Wagen vergessen. Wer wusste schon, was so ein Junkie an Ansteckungspotenzial mit sich herumschleppte. Ob sie spritzte? Ob sie mich überhaupt spüren würde? Oder war sie da unten auch benebelt? Ob sie stinken würde? Diese Gedanken riefen einen gewissen Ekel in mir hervor. Ich würde sie erst mal unter die Dusche schicken. Die Mädchen im »Elisa Galéen« waren allesamt supergepflegt und wurden wöchentlich durchgecheckt. Warum interessierte ich mich für eine Straßennutte? Weil sie winzig war und es mich aufgeilte, meinen Schwanz in den viel zu kleinen Körper zu stecken? Weil ich seit drei Tagen ihre Angst spüren konnte, die ihre gebückte Haltung im Halbdunkeln hatte erkennen lassen? In meiner Hose wurden alle Fragen mit »Ja« beantwortet. Kippte die Kleine jetzt etwa weg?
»Dreihundert. Für wie lange?« Ich reagierte blitzschnell und bekam sie unter den Armen zu fassen.
Ich konnte dem Druck im Kopf nicht mehr standhalten. Vor meinen Augen wurde es schwarz. Als ich zu mir kam, saß ich am Asphalt an die Laterne gelehnt. Er musste mich aufgefangen haben. Er hockte neben mir und hielt meine Schulter.
Seine letzte Frage war mir nicht verloren gegangen. Für wie lange? Jetzt stand er auf und blickte von oben auf mich herab.
»Pass auf, Mädchen. Ich nehme dich mit. Für zwei Stunden. Du bekommst deine dreihundert Dollar. Aber du machst, was ich von dir verlange. Keine Aufzahlung für Extrawünsche.« Ich sprach mit ihr, als wäre sie völlig normal. Als wäre sie nicht gerade weggekippt und insgesamt völlig durch den Wind. Innerlich war mir klar, dass es mein Schwanz war, der hier sprach. Und sie stank nicht. Zumindest nicht am Kopf. Für diese Beurteilung war ich ihr eben nahe genug gekommen. Auch das gefiel dem Schwanz.
Extrawünsche? Noch konnte ich davonlaufen. Ich konnte schnell laufen. Ich musste mir nur die High Heels ausziehen. Ohne sie konnte ich rennen wie ein Wiesel. Allerdings nur, wenn der Kreislauf funktionierte. Das tat er momentan nicht. Fürs Babysitten hatte ich fünf Dollar in der Stunde bekommen.
Das Mädchen hatte keinen blassen Schimmer vom Job als Nutte. Da saß sie auf der Straße und war stumm wie ein Fisch. Sie hatte sich scheinbar nicht die geringsten Gedanken darüber gemacht, was passieren würde, wenn sie wirklich jemand kaufen wollte.
Ich sah den Kerl durchdringend an. Was konnte der für Extrawünsche haben? Was gab es überhaupt an Extrawünschen? Ich wusste, was Sex war. Ich hatte mir vorgestellt, ich würde mich auf den Rücken legen. Ein Mann würde sich befriedigen, zahlen, gehen. Nein, ich hatte es mir nicht vorgestellt. Ich war ohne bildhafte Vorstellung hierhergekommen. Und ohne Extrawünsche. Dabei hätte ich nach der Nacht im Kinderheim alles wissen müssen. In meinem Gehirn war die Hölle los. Meine Gedanken prallten an die Kopfdecke, wurden umgeleitet und schlugen wie Blitze in die schwabbelige Masse ein. Seit drei Tagen kam ich nun hierher, um jetzt mit Kreislaufproblemen am Boden zu hocken und mir vor Stress fast in die Hose zu pinkeln.
»Wir gehen ins Hotel. Steh auf und komm.«
Die Kleine hockte wie eine Besoffene an die Laterne gelehnt und brachte keinen einzigen Laut hervor. Dabei waren wir vor wenigen Minuten bereits viel weiter gewesen. In meiner Hose war alles klar. Ich schnappte sie bei der Hand und zog sie hinter mir her. Das »Imperial« war einen Katzensprung entfernt.
Jetzt war es zu spät, um wegzurennen. Seine Pranke hatte zugepackt. Er hielt mich in seinen Fängen und schleppte mich wie eine Beute hinter sich her. Mir war übel, mir war schwindlig und ich war zu schwach, um mich zu befreien.
Die Hand des Mädchens fühlte sich zart an. Wie die Pfote eines Kätzchens. Das Kätzchen versuchte, zu bremsen, was in Anbetracht ihrer Winzigkeit lächerlich war. Ich spürte meine Erregung und zog … Wie hieß sie noch mal? … Isabell! … schneller die Straße entlang.
An der Rezeption angekommen, buchte ich die Junior Suite und ließ das Mädchen dabei nicht aus den Augen. Zum Davonlaufen war es jetzt zu spät. Der Deal war beschlossen. Die Kleine war drei Tage lang genau zu diesem Zweck auf die Straße gegangen. Mist! Die Kondome!
Die Blicke anderer Gäste entgingen mir nicht. Bestimmt entfachte in dem einen oder anderen Zimmer eine Diskussion zum Thema »mangelnde Zivilcourage«. Sie sah niemals aus wie neunzehn.
In der Suite angekommen, schloss ich die Tür ab und ließ Isabells Händchen los. Sie stand vor mir, rührte sich nicht und suchte den Teppich ab. »Sieh mich an.« Isabell hob den Kopf. Ihre Augen waren tränengefüllt. Das hatte ich gebraucht. Das war das Letzte, was ich vertragen konnte.
Was für einen bescheuerten Plan hatte ich mir da einfallen lassen? Es war wie damals, nur die Kinderzeichnungen fehlten. Es fühlte sich falsch an! Vollkommen falsch! Es hatte sich gestern falsch angefühlt und vorgestern auch. Warum war ich jeden Tag aufs Neue unter die Laterne gegangen? Mir war übel und schwindlig. Ich hatte alle Signale erhalten, die mein Körper aussenden konnte. Damals war es passiert. Heute hatte ich es in der Hand, mich dagegen zu entscheiden.
»Warum heulst du?« Meine Barschheit war berechtigt. Ich wollte ficken und mich nicht um irgendwelche seelischen Ungereimtheiten kümmern. Sie brauchte Drogen. Ich hatte das Geld dafür. Isabell sackte zu Boden und schluchzte hemmungslos los. Ich blätterte dreihundert Dollar auf den Tisch.
»Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe überhaupt noch nie mit einem Mann geschlafen. Ich will das alles gar nicht!«
Mir blieb die Spucke weg. Wie kam diese dumme Ziege dazu, sich zum Verkauf auf die Straße zu stellen, wenn sie es nicht wollte? Um mich zu verarschen? »Sag mal, spinnst du? Was soll dieses Theater?« Wut breitete sich in mir aus und ich kannte mich gut genug, um zu wissen, wie das ausgehen konnte.
»Es tut mir leid.« Oh Gott! Nein! Das war kein Theater! Vor mir lagen dreihundert Dollar. Genau das war es gewesen, woran ich gedacht hatte, als ich meine Pläne geschmiedet hatte. Geld. Geld, um von dort rauszukommen, wo ich momentan gefangen war. Neun Jahre hatte ich nun in Angst gelebt und ich dachte, ich wäre meiner Angst längst gewachsen. Aber hier in diesem Zimmer, mit diesem Mann, war ich plötzlich gar nichts mehr gewachsen. Ich fühlte mich winzig klein und schutzlos. So wie damals auf dem Schreibtisch. Angeleuchtet von der Tischlampe. Auf die Kinderzeichnungen starrend.
Ich wählte die Selbstbeherrschung, schlug die Tür zum Badezimmer hinter mir zu und hoffte, dass diese Irre verschwunden sein würde, wenn ich ins Zimmer zurückkehrte. Sollte ich Katharina ordern, jetzt, da ich das Hotel schon mal gebucht hatte? Aber eigentlich hatte ich die Schnauze gestrichen voll und wollte keine bescheuerte Schlampe sehen. Ich zog den Bademantel über und betrat den Salon.
Isabell stand vor mir. Völlig nackt. Meine Augen scannten den Barcode, der sich ihnen bot. Sie konnten gar nicht anders. Ein Körper aus kleinen Muskeln. Ein schmales Becken. Kleine, runde Brüste. Ihre Schultern breiter als ihre Taille. Die Beine zum Absprung bereit. ANSI Grade A. Gazellengleich. Höchste Ästhetikstufe. Selbstbeherrschung annulliert.
Warum hatte ich es getan? Aus dem gleichen Grund, weshalb ich damals geschluckt hatte, anstatt zu beißen? Weil ich die Barbie des Puppenspielers war? Weil ich mich in jede gewünschte Position verbiegen ließ? Weil mein Wille nichts zählte? Weil in mir plötzlich wieder das kleine Mädchen von damals erwachte? An diesen Wänden hingen keine Kinderzeichnungen. Ich stand alleine im Raum. Vor mir lagen dreihundert Dollar. Keine Ahnung, warum ich mir das Kleid über den Kopf gestülpt und das Höschen hatte fallen lassen. Ich wusste es nicht. Ich hatte es einfach getan. In mir bebte jede Faser.
Ich hätte sie rauswerfen sollen. Auf der Stelle. Stattdessen wählte ich die Nummer der Rezeption und bestellte eine Flasche Moët. Isabell hatte aufgehört, zu heulen. Durchgeknallt, wie sie war, konnte sie jedoch jeden Augenblick wieder damit anfangen. Sie benötigte keinen Grund dafür. Jenseits der ANSI Grade A Bewertung war das Ganze ein Zirkus, auf den ich im Grunde keine Lust hatte. Die Kleine war derartig bescheuert, dass ich nicht mehr zuordnen konnte, wer nun eigentlich der Bescheuerte von uns beiden war.
Diese Fratze. Er war in der Tür stehen geblieben und starrte mich an. Seine Augen musterten meinen Körper von oben nach unten und zurück. Nicht nur einmal. Innerlich vibrierte ich. Äußerlich hielt meine Haut still. Ich atmete die Angst hinaus und zog frischen Mut hinein. So gleichmäßig wie möglich. Ich konzentrierte mich auf meine Bauchdecke. Mut rein, Angst raus. Die Arme baumelten lose von den Schultern. Nichts versuchte ich,zu verdecken. Angst raus, Mut rein. Wieder und wieder, während seine Pupillen auf und ab rollten und dort haltmachten, wo es ihnen besonders gefiel.
Ich wollte mir keine Gedanken über die Umstände machen, warum eine Nutte eine Nutte war. Niemals hatte ich auch nur einen einzigen Augenblick damit verschwendet, über Katharinas Leben nachzudenken. Und Katharina war nur eines von unzähligen Mädchen, die ich mir gekauft hatte. Über keine von ihnen wusste ich Bescheid, zu keiner von ihnen hatte ich mir je eine Frage gestellt. Es hatte mich nie interessiert. Ich wollte nicht das Geringste über irgendeine von ihnen wissen. Der Page hatte geklopft und ich nahm ihm das Tablett an der Tür ab. Die Art, wie er an mir vorbeischielte, ließ erkennen, dass auch ihm gefiel, was er sah.
Ich hätte die dreihundert Dollar einfach nehmen können. Aber ich hatte eine Vision. Ich wollte mein Leben in den Griff bekommen. Ich wollte studieren. Ich wollte etwas aus mir machen. Ich hatte den Entschluss gefasst, an Geld zu kommen. Eines Tages wollte auch ich wieder in einem Zimmer wie diesem hier leben. Ein Zimmer wie dieses hatte ich nie gehabt. Mein Zimmer war klein gewesen, aber es war meines. Mit blauen Wänden. Ich hatte sie mir gewünscht und mein Vater hatte mir meinen Wunsch erfüllt. Im Winter, wenn es kalt wurde, konnte ich die Heizung aufdrehen. Ich liebte mein winziges Zimmer. Ich liebte unsere kleine Wohnung. Mehr hatte ich nie gebraucht. Ich war glücklich mit dem, was wir hatten. Der schönste Raum, den ich in den letzten neun Jahren gesehen hatte, war mein Klassenzimmer gewesen. Doch, nun wusste ich, warum ich mein Kleid über den Kopf gestülpt und mein Höschen zu Boden hatte fallen lassen.
Ich reichte Isabell ein Glas.
Das Hotelzimmer war großzügig und elegant eingerichtet. Durch das Fenster schimmerten die Lichter der Stadt. Ein edler, dunkelbrauner Tisch stand auf einem weißen Teppich. Zwei Ohrensessel aus schwarzem Leder waren zu beiden Seiten des Tisches ausgerichtet. Von der Decke hing ein mit Kristallen besetzter Lüster, der den Raum in ein sanftes Licht hüllte. Das riesige Himmelbett war mit einem seidigen, cremefarbenen Überzug bezogen. Eines Tages würde ich mir solche Dinge kaufen können. Dafür musste ich jetzt kämpfen. Mut rein, Angst raus, in tiefen Zügen! In einer Hand das Glas.
Ich versuchte, mich an meine Jugend zurückzuerinnern. Ich war nun fünfundvierzig Jahre alt. Meine ersten sexuellen Erfahrungen lagen gut dreißig Jahre zurück. Das erste Abenteuer war mit meiner Sportlehrerin gewesen. An sie erinnerte ich mich sofort. Eine verheiratete Frau, die umwerfend toll aussah. Sie hatte es damals darauf angelegt, mich zu verführen. Im Unterricht am Reck, als sie mir den Felgaufschwung vorzeigte und ich nur noch Titten wahrgenommen hatte. Riesentitten an der Stange. Es war ein Leichtes gewesen, mich in ihr Bett zu locken. Ich wollte nichts anderes als das. Sie zeigte mir alles. Alles, von dem ich im selben Moment ahnte, dass es mich nie wieder loslassen würde. Anfangs waren es durchwegs reifere Frauen gewesen. Frauen, bedeutend älter als ich, denen es wohl Spaß bereitet hatte, dem kleinen Jungen in der Pubertät die wenigen verbleibenden Gehirnzellen aus dem Kopf zu ficken. Hatte ich sie gesucht oder hatten sie mich gesucht? Wie auch immer, wir hatten uns gefunden. Sie zeigten mir, wo es langging und ich begriff, wo es in Zukunft langzugehen hatte. Erst viel später wandte ich mich Gleichaltrigen zu. Hatte mein Schwanz jemals die Möglichkeit bekommen, das Häutchen einer Frau zu durchdringen? War es jemals ich gewesen, der in den Genuss des ersten Stoßes gekommen war? Vielleicht. Vielleicht hatten sie es mir nicht gesagt? Wer sie? Wie hatten all die Titten und Muschis geheißen? Mir waren ihre Namen nicht in Erinnerung geblieben, weil es mir nie um Namen oder um Gesichter gegangen war. Spürte man es denn überhaupt, wenn die Folie platzte? Wenn Isabell die Wahrheit sagte, wenn sie wirklich bislang unberührt geblieben war, dann würde ich davon Notiz nehmen. Barbara! Die Sportlehrerin hatte Barbara geheißen. »Trink.« Ich stieß mein Glas an Isabells. Ich wollte, dass sie trank. Ich wollte, dass sie sich entspannte. Ich wollte es erfahren.
Mann, war das ein widerliches Getränk. Es schmeckte sauer. Nach Staub. Saurer Staub mit kleinen Kugeln. Nichts gegen den Durst, nichts für den Geschmack. Für gar nichts gut. Nur grauenvoll. Mut rein, Angst raus. Tief, tief. Und schlucken. Wie damals. Nur freiwillig.
»Trink aus! Alles! Wenn es dir nicht schmeckt, dann spül es runter.« Isabell verzog das Gesicht, als hätte ich ihr Essigwasser gegeben. Bis auf die Hand, die das Glas an ihre Lippen führte, stand sie regungslos vor mir. Vollkommen asexuell. Sie zeigte kein Anzeichen von Verführung. Geschweige denn von Geilheit oder Begierde. Nicht mal gespielte. Und ich hatte keine Lust, eine Holzlatte zu vögeln. Ich war nicht ihr Beschützer, der sie zärtlich in die Welt der Liebe einführen wollte. Meine Erektion klopfte an den Bademantel und ich schenkte Isabell schnell nach.
Ich hörte seinen Befehl wie durch eine Wand. Ich hoffte auf die betäubende Wirkung des Alkohols und tat, was er von weit weg befahl. Die Tante war bereits in den Vormittagsstunden benebelt gewesen. Vom Hier und Jetzt hatte sie all die Jahre, die ich sie kannte, wenig mitbekommen. Niemand konnte ihr etwas anhaben, denn sie hatte sich in ihre eigene Welt zurückgezogen. Wie es ihr dort erging, hatte ich nie festzustellen vermocht. In ihr Reich gab es keinen Zugang. Aber auch an jenem Ort musste es hart gewesen sein. Würde ich wie Tante Margot aggressiv werden?
Nach drei Gläsern setzte endlich, dafür aber abrupt, die Wirkung ein. Isabell lächelte und ließ sich rückwärts aufs Bett fallen.
Wo war ich gerade gewesen? In der Welt der Angst? Inmitten von kontrollierten Atemzügen? In Tante Margots wirrem Leben? Mir wurde heiß. Meine Wangen glühten. Schwindlig war mir vorher auch schon gewesen. Und übel. Jetzt war mir anders schwindlig. Und eigentlich kaum mehr übel. Oder? Trotz saurem Staub im Magen fühlte ich mich besser. Angst raus? Mut rein? Wozu denn? War doch alles ganz leicht. Trinken! Trinken gegen Denken! Oder gegen Fühlen? Tante Margot hätte es gewusst. Egal. Ich machte drei Schritte zurück und ließ mich einfach fallen. Ah! Wie weich! Jaja, gaff du nur. Mir doch egal.
So sah sie also aus, wenn sie lächelte. Der Moment war gekommen, mich auf sie zu werfen. Isabell war außer Gefecht. Ihre Beine lagen entspannt und leicht geöffnet auf dem Bett. Meine Hoden meldeten sich durch schmerzhaftes Ziehen. Ready, steady, go! Der Trieb in mir blies das Horn zur Jagd. Aber es gab nur ein einziges erstes Mal. Ein kleiner Riss und alles war vorbei. In einer Sekunde beendet. Abgespritzt. Wie schade drum. Du kleiner, besoffener Rohdiamant, ich werde in deine Welt vordringen, aber so, wie ich es will.
Nicht ich zuckte zusammen, als mich die Hand berührte. Mein Körper war es, der instinktiv reagierte. Die Haut zuckte. Vielleicht auch die Muskeln. Mein Gehirn konnte es nicht genau zuordnen. Erst als sich die Kinderzeichnungen an der Decke spiegelten, ortete ich, wohin seine Finger wanderten. Meine Schenkel hielten dem Druck seiner Arme nicht stand. Sie ergaben sich und öffneten ihm jene Stelle, an der alle Nerven zusammenliefen.
Isabell war unrasiert. Schwarzer, gekräuselter Pelz an jener Stelle, die in meinem Verständnis von Ästhetik glatt zu sein hatte. Es fühlte sich weich an. Als hätte ich ein kleines Tier in der Hand. Ich streichelte das Fell und schloss die Augen. Hinter dem schwarzen Vorhang lief ein Film ab. Er zeigte mich, wie ich mich von hinten einem Schimpansenweibchen näherte. Ich riss die Augen auf. Die Bilder gefielen mir ganz und gar nicht! Ich hatte sie nicht bewusst gewählt, die Assoziation war ohne mein Zutun im Gehirn entstanden. Ich wollte nicht wissen, wie es weiterging. Wie mochte wohl die Mutter des Mädchens aussehen? War auch sie eine Schönheit? Eine haarige? Was verbarg sich hinter dem Muff? Es dauerte einige Augenblicke, bevor ich mit beiden Händen ihre Schenkel ergriff, um dahinter zu blicken. Rosarot. Andeutungsweise. Schemenhaft. Es war da. Aber wo? Meine Hand legte sich über den kleinen Pelz, der alles verbarg. So, als wollte ich sie beschützen vor dem, was folgen würde. Es lag in meiner Hand, Isabells Erinnerung zu formen. Ich war der Herrscher über ihr Erlebnis. Wie wollte ich es gestalten? Hell oder dunkel? Hatte das eine Bedeutung für mich?
Jedes einzelne Haar gab die Berührung an ihren Ursprung weiter. Ich fühlte Tausende von Wurzeln. Dicht aneinander gedrängt versuchten sie, sich gegenseitig zu schützen. Wie ein Heer an Kämpfern, die mit Schwertern und Schildern bewaffnet auf das Signal warteten, das sie in die Schlacht trieb. Jedes Haar auf meinem Körper richtete sich in höchster Alarmbereitschaft auf. Ich bestand nur noch aus Gänsehaut. Meine Augen hielt ich zusammengepresst und dennoch konnte ich mitverfolgen, wo die seinen zum Stillstand kamen. Wohin seine Gier sie geleitet hatte. Mut rein, Angst raus, so leicht war es nun doch nicht mehr. Jetzt, wo es ernst wurde, verflog die Leichtigkeit. Verpuffte Alkohol im Ernstfall? Plötzlich löste sich seine Hand. Ich öffnete ein Auge und blinzelte in den Raum. Ich sah ihn im Bad verschwinden.
Mit den vereinbarten zwei Stunden würde ich nicht auskommen, das war mir klar. Mein Körper roch nach Testosteron. Die Aufregung, die ich empfand, war eine andere als jene im »Elisa Galéen«. Nähset, Badehaube, Zahnbürste, Bodylotion, Shampoo, Duschgel. All das suchte ich nicht. Wo war der verdammte Rasierer? Wenn man etwas suchte, war es doch immer das letzte, das man hervorzog. Ich sah bereits die Strähnen von Isabell abfallen. Zentimeter für Zentimeter würde ich sie freilegen. Jeder Zug mit dem Messer würde den zartrosa Schlitz mehr zum Vorschein kommen lassen. Das Kopfkino regte die Schweißdrüsen an. Und den Speichelfluss.
Was tat er? Ich hielt die Luft an. Er hatte die Badezimmertür nicht geschlossen und ich hörte das Rascheln. Es floss kein Wasser. Er wusch sich nicht die Hände. Auch die Dusche war nicht aufgedreht. Kokain? Oder was anderes? Hatte es mit mir zu tun? Ein wachsames Auge. Zwei hochkonzentrierte Ohren. Kein Atemzug. Wie sollte ich trotz aller Alarmbereitschaft erkennen, ab wann es Zeit zur Flucht wurde? Und dann bewegte sich die Tür. Irgendetwas hielt er in der Hand.
»Hör zu, Isabell, du bist eine hübsche Frau, aber ich stehe nicht auf üppige Schambehaarung. Es gefällt mir nicht und ich möchte für nichts bezahlen, das ich nicht haben will. Ich weiß nicht, was dir deine Mutter vorlebt, aber für meinen Geschmack ist dieser Pelz zu viel.« Ich sah sie eindringlich an. Ich wollte ihr deutlich machen, dass ich es mit der Schur ernst meinte. Das konnte doch nicht wahr sein! Sie hatte schon wieder Tränen in den Augen. Zum Teufel noch mal, was war das für eine Zicke! Es war zum Kotzen! Sie hatte es wirklich drauf, Erotik zu zerstören.
»Meine Mutter ist seit vielen Jahren tot. Als sie starb, war ich zu klein für solche Unterhaltungen.« Ich wollte nicht heulen und ihm auch nichts aus meinem Leben erzählen. Aber die Wut überkam mich wie ein Blitzschlag. Das, was er soeben gesagt hatte, war ein Peitschenhieb, der mich völlig unvorbereitet traf. Er hatte sein Messer in meinen wundesten Punkt gebohrt. Meine Stimme kippte. Ich hoffte, er hatte verstanden, was ich ihm entgegenpresste. Lass meine Mutter aus dem Spiel! Wenn Augen hätten töten können!
Es gab Dinge, die ich nicht wissen wollte. Ich wollte nicht wissen, dass Isabells Mutter tot war. Ich wollte nicht wissen, woran sie gestorben war. Ich wollte vögeln, verdammt noch mal! Und ich hatte Speichelfluss, weil in meinem Kopf längst der Film lief, in dem schwarzer, dicker Pelz von einer kleinen, feuchten Muschi abfiel! Verdammt noch mal!
Es war so vieles, das ich nicht wusste oder nicht wissen konnte, weil ich so viele Jahre auf mich alleine gestellt gewesen war. Niemand war da gewesen, der mir das Leben hätte erklären können. Einzig die Schule war mein Tor zur Außenwelt gewesen und alles, was dort vermittelt wurde, hatte ich wie ein Schwamm aufgesaugt. Schamhaarfrisuren waren kein Teil des Unterrichts gewesen. Lass meine Mama aus dem Spiel, ich warne dich!
Ich goss mir frischen Champagner ein und leerte ihn mit einem einzigen Schluck. Zwei Stunden waren fast um. Mir war die Lust gänzlich vergangen, diese blöde Kuh zu ficken. Alle Geilheit war beim Teufel. »Zieh dich an, ich bin für heute fertig mit dir.« Ich knallte ihr die dreihundert Dollar vor die Füße und wartete im Ledersessel, bis die dumme Schlampe verschwunden war. Ihr gehauchtes »Entschuldigung« hätte sie sich sparen können. Hau einfach nur ab, du dämliche Fotze! Ich wählte die Telefonnummer des »Elisa Galéen« und orderte Katharina in meine Suite.
Ich hatte alles verbockt. Es war schwierig, mich auf den Beinen zu halten. Ich wollte so schnell wie möglich aus dem Hotel. Aber es ging nicht schnell und schon gar nicht geradlinig. Ich torkelte und fühlte, dass mich die Leute angafften. Warum nur hatte er meine Mutter mit in den Dreck gezogen? Wie konnte er es wagen, von ihr zu sprechen, während ich mich zum ersten Mal prostituierte? Wie konnte er es sich herausnehmen, über ihre Behaarung zu sprechen? Sie war meine über alles geliebte Mama und, verflucht noch mal, sie hatte sterben müssen und ich hatte mich nicht einmal bei ihr verabschieden können! Alles wäre anders gelaufen, wenn dieser fürchterliche Unfall nicht passiert wäre. Ich versuchte, mich an die Gesichtszüge meiner Mutter zu erinnern. Aber es war nicht möglich, ein Bild von ihr entstehen zu lassen. Ich konnte sie mir nicht mehr vorstellen. Wusste ich denn nicht mehr, wie sie ausgesehen hatte? Wie waren ihre Augen gewesen? Ihr Mund? Ihre Nase? Mama! Ich schrie zum Himmel, als ich auf die Straße lief. Ich rannte so schnell es in meinem Zustand irgendwie möglich war. Zurück in mein Zuhause, in mein elendes Loch. Die Tränen machten es mir schwer, zu sehen.
Als ich am nächsten Morgen erwachte, war Katharina fort. Gott sei Dank. Ich ließ mir ein Frühstück ins Zimmer bringen. Es war Sonntag und ich hatte keine Eile. Meinen Plan, im Golfclub interessante Informationen zu sammeln, gab ich kurzentschlossen auf. Katharinas Geruch haftete noch an der Bettdecke. Angeekelt stand ich auf. Ich hatte sie gefickt. Lustlos, von hinten, ohne Extrawünsche. Ich wollte ihre Fratze nicht sehen. Es war klar, dass ich Katharina nie mehr buchen würde. Sie hatte ausgedient. Der Mief nach Katharinas Sex lag in der Luft und widerte mich maximal an.
Meine Augen wanderten durchs Zimmer. Da drüben lagen Schuhe? Wessen Schuhe? Katharinas? Augenblicklich stellten sich meine Haarwurzeln auf. Ich wollte nichts von ihr in meiner Nähe wissen. Die Dinger waren an Billigkeit kaum zu überbieten. Schwarzes Plastik, das nicht einmal versuchte, als Lederimitat durchzugehen. Nein, das waren nicht die Schuhe einer Edelnutte. Außerdem waren sie für Katharina viel zu klein. Sie mussten Isabell gehören! Das Mädchen war ohne Schuhe gegangen? Eine Frau, die ihre Schuhe vergaß? Jetzt, wo ich ausschließen konnte, dass es Katharinas Krempel war, hob ich die Dinger auf und sah sie mir genauer an. Sie waren winzig und erinnerten mich an Aschenputtel. Wo erstand man solchen Ramsch? Hatte sie wirklich so wenig Geschmack? Oder Geld? Bestimmt lag ich richtig mit meiner Theorie, dass sie ein Junkie war. In der Dunkelheit der Nacht war es nicht aufgefallen, mit welch potthässlichem Plastikschnickschnack das Mädchen herumlief. Warum machte ich mir eigentlich diese Gedanken?
Nach dem Frühstück verließ ich das Hotel und irrte ziellos in der Gegend umher. Ich ertappte mich dabei, dass ich nach Isabell Ausschau hielt. Warum? Und warum hatte ich ihre Schuhe eingepackt, anstatt sie einfach in den Mülleimer zu werfen?
Der Klang ihrer Stimme tauchte in meinem Kopf auf. Die Art, wie sie sprach, war gediegen. Ihre Aussprache war ohne unangenehmen Dialekt. Sie redete so, wie die Leute in den besseren Vierteln der Stadt es taten. Wieso war sie ins Drogenmilieu abgerutscht? War sie eines der sozial verwahrlosten Wohlstandskinder, deren Eltern keine Zeit für Erziehung hatten? Dann aber hätte sie sich nicht als Strichmädchen auf der Straße verkaufen und Schuhe im ein-Dollar-Shop erstehen müssen. Das passte nicht zusammen. Außer ihr Vater hatte den Entschluss gefasst, den kleinen Junkie vor die Tür zu setzen. Konnte sie wirklich Jungfrau sein oder tischte sie mir eine Geschichte auf? War die ganze Szene am Vorabend reine Show gewesen? Die Puzzleteile passten nicht zusammen. Und vor allem: Warum beschäftigte mich das so sehr?
Ich lag den ganzen Tag an mein Warmwasserrohr gekuschelt und versuchte, den Kopf so wenig wie möglich zu bewegen. Mein Schädel brummte und wenn ich nach draußen ins helle Licht blickte, stach es wie ein Degen durch die Augen in meinen Kopf. Ich fand nicht einmal die Kraft, mir frisches Wasser zu holen, obwohl ich unerträglichen Durst verspürte. Ich war nicht krank, sondern hatte einfach viel zu viel von diesem kugeligen Zeug getrunken. In meinem Magen rumorte es und ich schwor mir, diesen Blödsinn nie mehr zu wiederholen. Außerdem war ich traurig. Wieder und wieder versuchte ich, mir die Gesichter meiner Eltern in Erinnerung zu rufen. Aber auch jetzt, wo die Wirkung des Alkohols verschwunden war, spuckte mein Gehirn kein klares Bild aus. Hatte ich wirklich vergessen, wie mein Vater und meine Mutter ausgesehen hatten? Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als ein Foto der beiden. Aber wenn es davon noch welche gab, lagen diese in einer Lade bei Tante Margot oder vielmehr unter einem der Müllhaufen in Tantes Margots Wohnung. Und dorthin wollte ich um keinen Preis zurückkehren. Ich zog mir meine Decke über den Kopf und schloss die Augen. Vielleicht konnte ich ein wenig schlafen. Schlafen half mir immer, um für kurze Zeit meine Trostlosigkeit zu vergessen. Es war Hochsommer und in wenigen Wochen würde die Universität beginnen. Wenn ich dabei sein wollte, musste ich bis dahin genug Geld gesammelt haben, um das erste Semester bezahlen zu können.
Kapitel 8
All die Jahre hindurch hatte mir Waisengeld zugestanden. Nur lebte ich offiziell bei Tante Margot und so war sie es, die Monat für Monat mein Geld einkassierte. Niemals hätte sie es herausgerückt. Wäre aufgeflogen, dass ich in Wirklichkeit gar nicht bei ihr wohnte, hätte mich die Jugendwohlfahrt schnell wieder eingefangen und zurück ins Heim gesteckt. Noch am Unfalltag meiner Eltern war ich in das Kinderheim gebracht worden. Dort hatte es nur drei Tage gedauert, bis der Betreuer mich in der Nacht zu sich geholt hatte. Wohin sonst hätte ich flüchten sollen? Außer Tante Margot gab es auf dieser Welt niemanden mehr für mich. Meine Mutter hatte sich ihrer Schwester über viele Jahre hindurch angenommen und stets versucht, sie so gut wie möglich zu unterstützen. Bereits damals war Tante Margot dem Alkohol verfallen und ich vermied es tunlichst, meine Mutter bei den Besuchen zu ihrer Schwester zu begleiten. Wenn meine Mutter von ihren Besuchen nach Hause gekommen war, hatte sie stets einen fauligen Geruch hinter sich hergezogen. Wie eklig hatte ich das immer gefunden. Tante Margot war für mich Gammelfleisch. Aber welche Wahl hatte ich nach dem Vorfall im Waisenhaus? Gar keine. Ich lief mit meiner Tasche in der Hand durch die Straßen und läutete an Tante Margots Tür, um sie um Unterschlupf zu bitten. Den Vorfall im Kinderheim erwähnte ich nicht. Warum sie mich damals aufnahm, fand ich nie heraus. Vielleicht, weil sie meinte, es ihrer Schwester schuldig zu sein? Vielleicht aber auch nur, weil sie das zusätzliche Einkommen gut gebrauchen konnte. Dass sie es für mich tat, glaubte ich niemals. Sie hatte sich mächtig zusammengerissen, um beim Besuch der Jugendwohlfahrt nüchtern und gepflegt zu erscheinen. Wie sie ihre Wohnung damals entrümpelt und auf Vordermann gebracht hatte, war mir bis heute ein Rätsel geblieben. Die Jugendbehörde betraute sie mit meiner Obsorge und ward nicht mehr gesehen. Die Tante steckte das monatliche Geld ein, um sich mit Alkohol einzudecken. In der Wohnung schimmelte es vor sich hin und die Tante wurde immer aggressiver. Sie ließ mich spüren, dass ich sie störte. Ich musste auch von hier fortgehen, hatte aber keine Ahnung, wohin. Ich war zehn Jahre alt. Meine Eltern waren tot. Ich war von Gott und der Welt alleingelassen. Als ich damals durch Zufall mein jetziges Zuhause fand, spürte ich zum ersten Mal wieder einen winzigen Funken von Glück. Das war nun neun Jahre her. Verdammt noch mal, ich hatte in diesen einsamen Jahren so vieles erreicht. Da drüben in der Ecke lag mein Abschlusszeugnis aus der Schule. Es war der Türöffner für die Universität. Ich brauchte nur noch hineinzugehen. Mit genügend Kleingeld in der Tasche. Genau das wollte ich! Unbedingt! Komm jetzt, Isabell, steh auf und kämpf weiter!
Die Arbeitswoche begann mit dem gleichen Druck und derselben Hektik, wie die vorherige aufgehört hatte. Unselbständige Handlanger, mühselige Fleh-Schreiben von Geschäftsführern, deren Unternehmen wir aufgekauft hatten und nun damit beschäftigt waren, diese auszuquetschen. Die Burschen konnten die vorgeschriebenen Gewinne nicht erzielen und hofften auf mein Verständnis. Dieses aufzubringen, war nicht meine Aufgabe. Wer sich verkaufte, spielte von da an nach den Regeln desjenigen, der gezahlt hatte. Und das war in der Arbeitswelt ich. Und in der Privatwelt ebenso. Ich war genervt.
Kapitel 9
Zu Mittag traf ich mich im Pub nahe unseres Firmensitzes mit einem Freund. Als ich meine Bürotür zuwarf und Kurs auf den Lift nahm, wichen mir die Angestellten aus. Das taten sie immer. Natürlich fiel mir das auf. Sie versuchten, möglichst unauffällig kehrtzumachen. Sie bogen in einen Korridor ein, in dem sich Büros befanden, zu denen sie mit gefühlter Sicherheit gar nicht wollten. Andere mussten plötzlich aufs Klo. Kaum kamen sie mir in die Quere, änderten die meisten ihre Richtung. Ich war mir sicher, dass das keine Zufälle waren und nur jene in meiner Bahn blieben, für die es aus ihrer Sicht kein Entrinnen gab. Entweder, weil sie nicht spontan genug waren oder aber ausreichend intelligent, um selbst einzuschätzen, dass ihre Kursänderung glatt als Flucht identifiziert worden wäre. In solchen Fällen senkten sie den Blick und nuschelten ein kaum verständliches »Guten Tag, Mr. Campling«. Ich kannte das Bild auswendig: Schultern hoch, Kopf in die Versenkung und eine leichte, vertikale Drehung des Oberkörpers gegen die Wand. Lächerlich. Meist hatte ich mit diesen Leuten persönlich nichts zu tun. Sie arbeiteten in unterschiedlichen Abteilungen mit eigenen Abteilungsleitern und über ihnen stand die Personalabteilung mit dem Personalchef. Dennoch hegten diese Leute eine offensichtliche Abneigung gegen meine Person. Noch nie hatte ich mich vor die gesamte Belegschaft gestellt und hinausposaunt, dass mir ihre Einzelschicksale vollkommen egal waren. Vielleicht war es aber auch gar nicht nötig, es so deutlich zu verkünden. Wahrscheinlich war ohnehin alles klar. Wenn die Mitarbeiter unseres Konzerns nicht perfekt funktionierten, veranlasste ich deren Austausch. Was sonst? Was unterschied sie von ausrangierten Maschinen? Alles unnützes Zeug. Mir war mein Ruf im Heer der Diener nicht wichtig. Und wenn einmal einer der Ausrangierten mir in einem Anfall von Hysterie die Kündigung vor die Füße knallte und schrie, es ginge mir einzig und allein um Gewinnmaximierung, dann hatte er durchaus recht. Richtig, Herr Irgendwer. Musste man deshalb so laut werden? Es war nicht mein Anliegen, eine Wellnessoase für die Belegschaft zu schaffen. Wir lebten in einer globalisierten Welt der freien Marktwirtschaft. In einer Welt bestimmt von Angebot und Nachfrage. Wenn nicht wir die profitablen Geschäfte blitzschnell an Land zogen, dann schnappte sie uns ein anderer weg. In den Konzernen der Konkurrenz saßen auch keine Sozialarbeiter. Jeder Mitarbeiter hatte ihm zugeteilte Aufgaben. Sein einziger Nutzen bestand darin, diese zu erfüllen. Ich glaubte an den Sinn der Gewinnmaximierung und konnte gut mit den Gefühlsausbrüchen der Nutzlosen umgehen.
Kapitel 10
Der Mann, den ich zu Mittag im Pub um die Ecke traf, war ein angesehener Steuerberater der Stadt. Ich nannte ihn Freund, wissend, dass ich im Grunde keine wirklichen Freunde hatte. Typen, mit denen ich abhängte, die ihre Füße auf meine Couch legten, um ihre lustigen und traurigen Geschichten mit mir auszutauschen, die gab es in meinem Leben nicht. Auch ich erzählte niemandem meine Gedanken und Wünsche, da es außerhalb der Arbeitswelt ohnehin kaum welche gab. Hatte ich einen Wunsch, dann kaufte ich ihn mir. Ich schuf mir die Welt, die ich haben wollte. Ich war in den besten Jahren, mein Körper war topfit und mein Gehirn arbeitete wie eine High Speed Datenverbindung aus Glasfasern. Ich war eins siebenundachzig groß mit breiten Schultern, einem flachen Bauch, noch immer mehr dunkelbraunen als grauen Haaren und ich wusste um mein markantes Gesicht Bescheid. Persönlichkeitspsychologen hätten mich rasch als glatten A-Typ identifiziert. Meine Feindseligkeit, die diesem Typus zugeschrieben wurde, war nötiger Bestandteil einer aggressiven, kapitalistischen Welt, in der ich gerne die Rolle eines Machthabers einnahm. Mit allem, was dazugehörte.
Als ich in den Pub gelangte, saß Peter Rohman bereits an einem Ecktisch und erwartete mich. Der Grund unserer Treffen war selten der, dass wir den emotionalen Wunsch verspürten, uns zu sehen. Wir tauschten keine privaten Details aus unseren Leben aus. Vielmehr war es so, dass Peter Rohman durch seine Einblicke in die Finanzkraft jeder Menge Unternehmen, mir nützliche Informationen lieferte. Die Heuschrecken brauchten dann nur noch gezielt zuzuschlagen. Peter tat dies diskret und ohne genaue Angaben. Doch wenn man in der Lage war, eins und eins zusammenzuzählen, ergab sich ein klares Bild und Peter erhielt zum Dank ein unauffälliges Kuvert.
Zudem war Peter ein attraktiver Kerl, der in jungen Jahren Zehnkampf trainiert hatte und dessen Körper es ihm bis heute dankte. Peter war großgewachsen, blond mit blauen Augen und einem schälmischen Lächeln. Hie und da zog es uns gemeinsam ins Nachtleben, wo wir als Dark and Light die Aufmerksamkeit der Frauen auf uns zogen.
Es kam vor, dass diese gemeinsamen Touren in einer Hotelsuite endeten. Im Anhang hatten wir dann ein paar Frauen, mit denen wir als Grüppchen eine wilde Nacht verbrachten. Somit kannte ich Peter nicht nur als geschickten Geschäftsmann und Informanten, sondern auch als tabulosen Sexpartner. Über Peters Privatleben wusste ich sonst nichts. Wir waren beide einsame Wölfe, die sich nur dann zusammentaten, wenn es auf Beutezug ging. In der Finanzwelt und in der der Frauen.
Steh auf und kämpf weiter! Meinen ersten Anlauf als Professionelle hatte ich verbockt. Tränen, Trauer und Gefühlsausbrüche waren wohl nicht das, was Freier Nummer eins sich vorgestellt hatte.
Kapitel 11