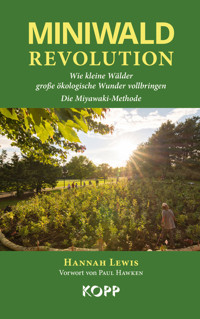
18,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Mit der Miyawaki-Methode die Welt verändern und kleine Wälder in Rekordzeit wachsen lassen
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der sich selbst die kleinste Fläche – ein verlassener Parkplatz, eine vergessene Ecke im Hinterhof oder ein freies Stück Land mitten in der Stadt – in einen dichten, lebendigen Wald verwandeln kann. Ein Wald, der in wenigen Jahren wächst, die Luft reinigt, die Umgebung kühlt und unzählige Tiere und Pflanzen beherbergt. Klingt wie ein Traum? Miniwald-Revolution von Hannah Lewis zeigt, dass es Realität ist – mit der bewährten Miyawaki-Methode.
Die Miyawaki-Methode – Miniwälder erreichen in nur 10 Jahren das Wachstum, für das ein normaler Wald 100 Jahre benötigt!
Der japanische Botaniker Dr. Akira Miyawaki hat eine revolutionäre Methode entwickelt, mit der auf kleinstem Raum ein nachhaltiger und widerstandsfähiger Wald entstehen kann. Durch die gezielte Auswahl einheimischer Pflanzenarten, eine dichte Bepflanzung und eine anfängliche intensive Pflege gedeihen Miniwälder bis zu zehnmal schneller als herkömmliche Wälder. Sie bieten nicht nur Lebensraum für Vögel, Insekten und Kleintiere, sondern auch wertvolle Vorteile für uns Menschen: Sie reduzieren Lärm, speichern Wasser und verbessern unser Mikroklima.
Erfolgreiche Miniwald-Projekte weltweit
Überall auf der Welt entstehen Miniwälder – in urbanen Zentren, an Schulen, in Wohngebieten und sogar auf Industriebrachen. Miniwald-Revolution nimmt Sie mit auf eine inspirierende Reise zu Projekten rund um den Globus und zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie selbst einen Miniwald anlegen können – sei es im eigenen Garten, auf einem Firmengelände oder gemeinsam mit Ihrer Gemeinde.
Eine revolutionäre Lösung, die jeder umsetzen kann!
Dieses Buch ist ein Aufruf zum Handeln, ein Hoffnungsschimmer in Zeiten der Umweltzerstörung – und eine Einladung an alle, die Natur zurück in unser Leben zu holen. Machen Sie mit und starten Sie Ihre eigene Miniwald-Revolution!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
1. Auflage März 2025
Copyright © 2022 by Hannah Lewis Kopp Verlag e. K. edition published by arrangement with Chelsea Green Publishing Co, White River Junction, VT, USA, www.chealseagreen.com
Titel der amerikanischen Originalausgabe:Mini-Forest Revolution
Copyright © 2025 für die deutschsprachige Ausgabe bei Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung aus dem Amerikanischen: Christ Language Services Satz, Layout und Covergestaltung: Schmieder Media GmbH Coverabbildung: © DinoKužnik / SUGi
ISBN E-Book 978-3-98992-094-1 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-10 Fax: (07472) 98 06-11
Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
Widmung
Im Gedenken an Dr. Akira Miyawaki (1928 bis 2021), denich weder kannte noch das Privileg hatte, mit ihm zusprechen, dessen Worte, Taten und ein ständig wachsendes Netzwerk vonFreunden auf der ganzen Welt mich jedoch täglich inspirieren.
Vorwort
VORWORT
Es kommt selten vor, dass ein Buch über Klimaschutzmaßnahmen so elegant geschrieben ist und sich fast wie von selbst liest. Ebenso selten lassen sich Maßnahmen finden, die von jedem umgesetzt werden können. Hannah Lewis beschreibt ein Geschenk an eine verzweifelte Welt, eine Möglichkeit, die Welt auf praktische, heilsame und bedeutende Art zu verändern, eine simple Handlung, die Schönheit schafft und verzaubert: einen Miniwald. Wem das Pflanzen eines Miniwaldes in Anbetracht der Größe des Ziels – der Umkehr der Erderwärmung – unzulänglich erscheint, sollte bedenken: Wälder sind letztlich Tausende von Miniwäldern, vereint durch ein gemeinsames Laubdach. Die außergewöhnlichen Wälder der borealen Zone und des Kongo-Beckens wurden nicht gepflanzt. Miniwälder hingegen können von Ihnen gepflanzt werden.
Wälder können gewaltige Flächen bedecken, etwa im Amazonasgebiet und auf Borneo. Ein Miniwald kann freie Landflächen bedecken, einen Kreisverkehr einer Landstraße, einen kleinen Teil des Spielplatzes eines Kindergartens. Einer der Vorteile eines Miyawaki-Miniwaldes, den Hannah Lewis so treffend beschreibt, ist seine potenzielle Allgegenwärtigkeit. Es gibt Hunderte Millionen mögliche Standorte für Miniwälder. Und im Gegensatz zum Amazonasregenwald werden diese nicht abgebrannt und durch Sojafelder und Viehweideflächen ersetzt.
Es gibt Aufrufe dazu, Milliarden von Bäumen zu pflanzen, um den Klimawandel zu »bekämpfen«. Dies soll der Klimakrise so schnell wie möglich entgegenwirken. In diesen Szenarien sind Bäume bloße Objekte, »Dinge des Waldes«, die ober- und unterhalb des Bodens Kohlenstoff binden. Baumplantagen können wie Geisterstädte sein, geräuschlos, weil es keine Vögel gibt. Keine Vögel, weil es keine Insekten gibt. Keine Insekten, weil es keine Blüten, keinen Nektar und keine Würmer gibt.
Bäume, die wie Soldaten in Reih und Glied stehen, sind das Gegenteil eines Waldes. Bäume sind wie wir. Wir sind soziale Wesen und Bäume sind es ebenso. Sie gedeihen dann, wenn sie mit einer Vielzahl von anderen Bäumen, Sträuchern und Pflanzen interagieren. Die Miyawaki-Methode entstand aus der Beobachtung von uralten Wäldern. Dr. Miyawaki sah sie als eine lebende, interaktive Einheit und nicht als Ansammlung von Bäumen.
Die Miniwald-Revolution nimmt uns mit auf eine Weltreise, um die außergewöhnliche Wirkung, die Miniwälder in verschiedenen Geländearten, Klimazonen und Standorten haben, zu erforschen. Hannah ist dabei Ihre Reiseführerin. Es gibt womöglich keine einzelne Lösung für das Problem des Klimawandels, die eine größere Bandbreite an Vorteilen bietet als Miniwälder: Wasser, Schatten, Abkühlung, Bestäubung, Nahrung, Vögel, Biodiversität, Kohlenstoffsenken, saubere Luft. Wenn ihnen der nötige Platz gegeben wird, breiten sich Miniwälder nicht nur nach oben, sondern auch seitwärts aus. Sie keimen, sie breiten sich aus, sie vergrößern sich. Auf Freiflächen sind sie die »Saat« eines Waldes. Sie erschaffen sich selbst und alles Leben.
Wenn über die Klimakrise berichtet wird, dann oftmals über die Geschwindigkeit, mit der die Gefahr zunimmt, und über das Fehlen ausreichender Maßnahmen auf allen Handlungsebenen. Wir werden überschüttet mit Nachrichten über die Probleme, Wahrscheinlichkeiten und Auswirkungen. Es ist fast zu viel, um noch nachzukommen. Was als Gegengewicht zu den Nachrichten fehlt, sind Chancen. Jedes Problem birgt eine versteckte Lösung in sich, sonst wäre es kein Problem. Die Miyawaki-Methode ist von entscheidender Bedeutung, weil sie von Menschen überall auf der Welt angewendet werden kann und, wie Hannah aufzeigt, auch von Gemeinden, Schulklassen, Städten, Vereinen, Familien und, ja, sogar von Staaten, wenn sie nur ihre Augen öffnen. Wir müssen nicht auf Regierungen, Banken und Konzerne warten, um zu handeln.
Um die potenziellen globalen Auswirkungen der Miyawaki-Miniwälder auf die Klimakrise gänzlich zu verstehen, müssen wir zunächst etwas in die Tiefe gehen und ein wenig Kohlenstoffbuchführung betreiben. Schätzungsweise 3 300 Milliarden Tonnen Kohlenstoff sind in terrestrischen Ökosystemen gebunden. Das ist viermal mehr Kohlenstoff, als sich in der Atmosphäre in Form von CO2 befindet. Wenn wir die Menge von an Land gespeichertem Kohlenstoff in den nächsten 30 Jahren um 9 Prozent erhöhen, werden wir das gesamte Kohlenstoffdioxid, das durch Kohle, Kraftstoff, Ölverbrennung, Abholzung und nicht-regenerative Landwirtschaft seit 1800 freigesetzt wurde, wieder an Land binden. Das würde bedeuten, dass die Menge des an Land gebundenen Kohlenstoffs jedes Jahr um 0,3 Prozent erhöht wird. Wir wissen, wie wir das erreichen können, nämlich durch regenerative Landwirtschaft, die Wiederherstellung von Feuchtgebieten, kontrollierte Beweidung, das Pflanzen von Mangroven und Aufforstung. Diese Maßnahmen sind bekannt und werden umgesetzt, aber sie übersteigen die Möglichkeiten von Einzelnen, Familien oder Kommunen. Miniwälder hingegen können von jedem und überall angelegt werden. Rund 2 Milliarden Hektar Land auf der Erde sind von Bodendegradation betroffen. Ein Miniwald kann die Menge an gebundenem Kohlenstoff in dieser Fläche mindestens verzehnfachen, wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Wenn ein Fünftel aller von Bodendegradation betroffenen Flächen zu Miniwäldern würden, könnten wir es schaffen, den gesamten Kohlenstoff, der seit 1800 in die Atmosphäre ausgestoßen wurde, wieder zu binden.
Miniwälder sind Orte, an denen wir dem Leben begegnen. Wir erkunden unseren Lebensraum, entdecken, was dort heimisch ist, regenerieren unseren Boden und kümmern uns um ein kleines Ökosystem, das Leben wiederherstellt. Zu sehen, wie ein Miniwald jedes Jahr mehrere Meter wächst, wie er vor unseren Augen immer komplexer und schöner wird, zu wissen, dass er einen direkten Einfluss auf die Biosphäre und die Atmosphäre hat – diese Beziehungen machen auch etwas mit uns. Sie nähren unsere Sehnsucht, etwas zu bewirken, unser Verlangen, uns mit dem zu verbinden, was sich regeneriert, und zu handeln. Fakten ändern unsere Meinung nicht. Taten ändern unsere Meinung. Sobald wir uns an den regenerativen Handlungen beteiligen, die Hannah hier vorstellt, verändert sich unser Selbstverständnis und unsere Vorstellung davon, was möglich ist. Ein Miniwald aus Ideen und Hoffnung wächst in uns allen heran.
– PAUL HAWKEN
Einleitung: Renaturierung in Roscoff
EINLEITUNG
Renaturierung in Roscoff
Es war an einem wolkenverhangenen Donnerstagmorgen Mitte Dezember, als eine Grundschulkasse in Gummistiefeln zusammen mit ihrem Lehrer sich einer Reihe von Kisten näherte, die mit einer Vielzahl von kleinen, dünnen Setzlingen gefüllt waren. »Wer hat Lust, auf dieser kleinen Fläche ein paar Bäume zu pflanzen, um einen Miniwald zu schaffen?«, fragte ich sie. »Und wer traut sich, dafür durch ein bisschen Matsch zu laufen?« Ihre fröhlichen Gesichter strahlten vor Begeisterung und sie beantworteten beide Fragen durch zustimmendes Nicken. Ich zeigte ihnen drei Gruppen von Pflanzen – einige Eichensetzlinge, die hoch wachsen würden, eine Handvoll mittelgroßer Bäume und mehrere kleinere Bäume und Sträucher – und wies die Kinder an, sich jeweils ein oder zwei Setzlinge aus jeder Gruppe zu nehmen.
Sie sammelten die Bäumchen ein, als wären es Geschenktütchen, und marschierten dann zielstrebig zu der ausgewählten Fläche, um einen Platz für ihre Bäume abzustecken. Einige Kinder arbeiteten fleißig und boten ihren Mitschülern an, ihnen zu helfen, sobald sie ihre eigenen Bäume gepflanzt hatten. Andere ließen sich vom matschigen Boden ablenken und lachten über das schmatzende Geräusch, das ihre Stiefel beim Gehen machten. Nach einer zweiwöchigen Verzögerung, verursacht durch tagelangen Regen, der die Fläche durchnässt hatte, war der Spaß überfällig.
Ich war begeistert von der Entschlossenheit, mit der die Kinder sich ans Werk machten. Sie prüften, ob die gegrabenen Löcher groß genug für die Wurzeln waren, und gruben tiefer, wenn das nicht der Fall war. Bevor sie aufbrachen, ermutigte ich sie, wiederzukommen und ihren Wald zu besuchen, und versprach ihnen, dass die Bäume im nächsten Jahr schon größer sein würden als sie selbst. Die ganze vordere Reihe der Kinder, die um mich herum standen, stellte sich auf Zehenspitzen und versuchte, meine Hand zu erreichen, die über ihren Köpfen schwebte und die zukünftige Größe der Bäume andeutete. »So schnell wachsen die?«, rief ein Junge aus der letzten Reihe.
Das war nun ihr eigener Wald. Ich freute mich darauf, zu sehen, was für ein Ort dieser Wald für sie werden würde: ein Zauberwald zum Erkunden, ein Platz, an dem sie die Tierwelt entdecken konnten, ein kleines, schlagendes Herz am Rande der Stadt.
Ich lebe in Frankreich, in einem kleinen, alten Küstendorf, in dem einst Piraten hausten. An diesem verregneten Ort zeigt sich die Sonne an den meisten Tagen nur sporadisch, oft kurz bevor der Nieselregen ganz aufgehört hat, sodass man regelmäßig Regenbögen bewundern kann. Ich komme ursprünglich aus Minneapolis. Im Jahr 2016 zog ich mit meiner Familie an die Nordwestküste der Bretagne, weil meinem französischen Ehemann eine Stelle in einer Meeresforschungsstation angeboten wurde.
Wir meldeten unsere Zwillinge an der hiesigen Schule an und fühlten uns schon bald wie zu Hause. Für jemanden wie mich, der in Minnesota aufgewachsen ist, fühlt sich dieser Ort magisch an: das Geschrei der Möwen, die salzige Luft, Häuser, die älter sind als mein Heimatland, und die mächtigen Gezeiten, die kleine Schiffe zweimal am Tag im Hafen festsetzen und ihre Masten im Wind schaukeln lassen.
Nachdem wir hierher gezogen waren, begann ich für eine in den USA ansässige gemeinnützige Organisation namens »Biodiversity for a Livable Climate« zu arbeiten. Ich fing an, über die Wissenschaft und Praxis der Wiederherstellung von Ökosystemen zu lesen und zu schreiben. Durch diese Arbeit habe ich voller Faszination von den unzähligen Geheimnissen erfahren, die sich direkt vor unseren Augen befinden und doch verborgen sind: davon, wie die Systeme der Erde das menschliche Leben erhalten. Wissenschaftler haben bis ins kleinste Detail erforscht, wie Organismen und Spezies zusammenwirken, um Kohlenstoff zu speichern, die Produktivität und Stabilität von Ökosystemen zu erhöhen und den Wasserkreislauf zu regulieren, und wie die Vegetation die Erde abkühlt.
Je mehr ich jedoch darüber las, desto mehr fühlte ich mich, als würde ich in zwei Parallelwelten leben. Einerseits wuchs mein Respekt für die lebenserhaltenden Systeme des Planeten, die bereits an ihre Grenzen gebracht worden sind. Andererseits musste ich feststellen, dass die täglichen Angriffe auf diese Systeme immer weiter fortgesetzt werden. Die Tatsache, dass die weltweiten Emissionen bis 2030 auf die Hälfte des Emissionslevels von 2010 reduziert werden müssen, steht im Widerspruch zur politischen Realität – dazu, dass die Versprechen der einzelnen Staaten, ihre Emissionen zu reduzieren, nicht mit den dafür nötigen systemischen Veränderungen einhergehen. Es sah so aus, als würde sich die weltweite Plastikverschmutzung bis 2030 verdoppeln. Meeresflora und -fauna erstickten bereits an dem allgegenwärtigen Plastik. 1 Warum also entwickelte sich unser Verhalten in die entgegengesetzte Richtung? Die Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich geschehen müsste, und dem, was wirklich geschah, löste in mir eine schwerwiegende kognitive Dissonanz aus.
Ich wollte meine zwei Welten vereinen, einen Raum für Gespräche schaffen. Gespräche darüber, wie rasant sich das Klima verändert, warum das so ist, wie wir den Prozess verlangsamen und widerstandsfähiger werden können, und darüber, was nicht in unserer Macht liegt. Keine einfache Aufgabe, denn der drohende Zusammenbruch unserer Zivilisation ist ein Tabuthema.
Dann stieß ich auf »MiniBigForest«, eine Initiative, die 2018 in der nahegelegenen Stadt Nantes ins Leben gerufen wurde. MiniBigForest unterstützt Städte, Schulen und private Einrichtungen dabei, auf kleinen Flächen innerhalb der Stadt artenreiche, ökologisch wirksame Miniwälder nach der Miyawaki-Methode anzulegen. Der erste Wald, den die Initiative gepflanzt hat, sollte als Lärm- und Schadstoffschutz gegen eine geplante Straßenerweiterung dienen.
Ich war sofort begeistert von dieser Methode, die mir sowohl ökologisch sinnvoll als auch äußerst praktikabel erschien. Anscheinend konnten mithilfe der Miyawaki-Methode unbebaute Grundstücke, Parkplatzränder und Rasenflächen in etwas Nützliches verwandelt werden – all die Freiflächen, die in den meisten Städten so vertraut und banal erscheinen, dass wir sie fast nicht wahrnehmen.
Mir hat das Motiv des »Talking Heads«-Lieds »(Nothing But) Flowers« immer schon gefallen: Asphalt, der sich in Ökosysteme verwandelt. Noch besser gefiel mir aber die Chance, einen solchen Wandel tatsächlich herbeizuführen. Und während dieser Gedanke in mir erste Blüten trieb, war ich bereit, die ersten Schritte zu gehen, um meine zwei Welten wieder miteinander zu verbinden.
Dieses Buch handelt von der Geschichte, wie mich die Miyawaki-Methode in ihren Bann schlug und ich mich aufmachte, um mehr über diesen visionären Wissenschaftler zu erfahren, von der ökologischen Theorie, auf der die Methode basiert, von den Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, und von den Menschen überall auf der Welt, die diese Methode anwenden.
Kapitel 1 führt ein in die Grundlagen der Miyawaki-Methode, die ihr zugrunde liegenden ökologischen Konzepte und die weltweite Bewegung, die sich um die Methode herum entwickelt. In Kapitel 2 erfahren wir mehr über den Werdegang und die Philosophie des japanischen Pflanzenökologen Dr. Akira Miyawaki und darüber, wie die Miyawaki-Methode auf Überreste alter Wälder in Ländern wie Indien und Japan zurückgreift. Außerdem wird in Kapitel 2 das auf der Miyawaki-Methode aufbauende Maruvan-Projekt vorgestellt, bei dem lokale Wasserkreisläufe in einem semiariden Gebiet Indiens durch die Wiederherstellung der einheimischen Vegetation wiederbelebt werden. In Kapitel 3 wird die Beziehung zwischen Vegetation und Wasser anhand von Miniwald-Projekten in Maharashtra (Indien), Buea (Kamerun) und der Qazvin-Provinz (Iran) näher untersucht.
In Kapitel 4 besuchen wir hochmoderne urbane Zentren in Europa, in denen die Menschen wieder mit der Natur in Kontakt treten wollen – als wäre sie ein lange verschollenes Familienmitglied. In Paris ist die Miyawaki-Methode Teil eines größeren Vorhabens, nämlich der Verringerung der Hitzebelastung durch die Belebung der innerstädtischen Vegetation. Dutzende Städte in den Niederlanden legen in Zusammenarbeit mit Schulen Miniwälder an, um Kindern die Möglichkeit zu geben, die Natur kennenzulernen und eine Verbindung zu ihr herzustellen. In Kapitel 5 erkunden wir einige der gar nicht mal so kleinen Miniwälder, die Miyawaki selbst in Zusammenarbeit mit weltweit tätigen japanischen Konzernen, Städten und Verbänden unter anderem in Japan, den USA und China angelegt hat.
Kapitel 6 nimmt uns mit nach Beirut (Libanon), ins Yakama-Reservat (US-Bundesstaat Washington) sowie in ein Arbeiterviertel im Osten Londons, wo Miniwälder bei der Bewältigung von Traumata und Trauer aufgrund von staatlichen Versäumnissen, Kolonialismus und Armut helfen sollen.
In Kapitel 7 geht es um Ökosysteme: Was sind Ökosysteme? Wie funktionieren sie? Welche Rolle spielt der Mensch in der Natur? Wie kann es uns bei der Bewältigung der Klimakrise helfen, wenn wir ein Verständnis für diese Konzepte entwickeln? Kapitel 8 enthält eine praktische Anleitung dafür, wie man mit der Miyawaki-Methode eine unbebaute Fläche in ein Ökosystem verwandelt – von der Zusammenstellung eines Teams über die Identifizierung einheimischer Klimaxarten bis hin zur Vorbereitung des Bodens, der Bepflanzung und der Pflege des Waldes. Die Geschichte führt uns am Ende nach Roscoff, Frankreich, wo der Stadtrat im Februar 2021 ein Miyawaki-Miniwald-Projekt auf einem begrasten Parkplatz am Rand einer malerischen Klippe mit Meerblick genehmigte. Im Dezember 2021 haben wir den Miniwald gepflanzt.
Indem ich Geschichten von Miniwäldern aus der ganzen Welt erzähle, darunter auch meine eigene, hoffe ich, nicht nur die große internationale Besorgnis über die Zerstörung der Natur zu verdeutlichen, sondern auch die Möglichkeit zu bieten, direkt vor Ort aktiv zu werden, um zur Lösung eines gemeinsamen Problems beizutragen, für die alle an einem Strang ziehen müssen. Die Miyawaki-Methode beruht auf einem ausgefeilten Verständnis der Vegetationsökologie und ist so konzipiert, dass sie die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Wiederherstellung der Ökosysteme anregt und fördert. Genau diese Kombination aus Wissen und praktischer Zugänglichkeit ist es, die die Miyawaki-Methode so revolutionär macht.
Kapitel 1: Die Miyawaki-Methode
Kapitel 1
Die Miyawaki-Methode
Die Logikhinter der Miyawaki-Methode besteht darin, direkt ein beständiges Laubdachaus Klimaxarten zu schaffen, ohne die Sukzessionsstufen durchlaufen zu müssen. Dadurch entsteht in Rekordgeschwindigkeit ein humideres, schattiges Waldmikroklima.
– ELGENE O. BOX 1
Eingemummelt in eine Regenjacke und gekrönt von einem breitkrempigen Strohhut stand Dr. Akira Miyawaki vor zweiunddreißig eingetopften, zarten Setzlingen – jeder von ihnen mit einem Bild des ausgewachsenen Baumes versehen, zu dem er eines Tages heranwachsen würde. »Ich werde Ihnen ein paar der zweiunddreißig Arten nennen«, erklärte er den Mitarbeitern des Automobilzulieferers Toyoda Gosei in Lebanon im US-Bundesstaat Kentucky. Die Anwesenden hörten ihm aufmerksam zu. »Es ist sehr schwierig, sich alle zweiunddreißig Arten zu merken. Aber bitte versuchen Sie, sich drei oder vier zu merken. Das hier ist eine Amerikanische Buche«, erklärte Miyawaki, während er einen der jungen Bäume herumgab. Er ermunterte alle, den Setzling zu befühlen, alle fünf Sinne zu benutzen, um diese Pflanze kennenzulernen, die ein integraler Bestandteil des Waldes sein würde, den sie gleich pflanzen würden. 2
»Die Bäume, die wir hier auf dem Gelände pflanzen, dienen nicht der Holzproduktion oder der Verschönerung der Gegend«, erläuterte Miyawaki. »Dieses Projekt ist für Sie gedacht – für die Menschen vor Ort. Es soll Ihr Leben vor Katastrophen schützen.« Für manche mag diese Aussage übertrieben geklungen haben. Doch Miyawaki hatte mit eigenen Augen gesehen, wie einheimische Bäume und Wälder Unglaubliches leisteten: Sie überstanden Erdbeben, während die gebaute Infrastruktur um sie herum zusammenbrach, verhinderten die Ausbreitung von Bränden und stoppten sogar Autos, die sonst nach einem Tsunami ins Meer gespült worden wären.
Bereits wenige Tage später leiteten die Schulungsteilnehmer selbst rund 4 000 Kollegen und Mitglieder der Gemeinde dabei an, 35 000 Bäume und Sträucher entlang des Werksgeländes zu pflanzen. Innerhalb weniger Jahre würden sich die winzigen Setzlinge, die sie einst in ihren Händen hielten, in einen hohen, dichten Waldstreifen zwischen der Produktionsstätte und den umliegenden Lagerhäusern und Ackerflächen verwandeln. Dieser schmale Streifen, der Lebensraum für Flora und Fauna in einer sonst industriell geprägten Gegend bietet, sollte als Puffer für die unmittelbare Umgebung gegen extreme Wetterphänomene dienen. Er ist einer von Tausenden von Naturwäldern, die weltweit nach der Miyawaki-Methode gepflanzt wurden.
Diese Methode, die es ermöglicht, in vergleichsweise kurzer Zeit einen ausgewachsenen Naturwald zu schaffen, basiert auf einer sorgfältigen Auswahl der Pflanzenarten, die am besten an die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind. Diese Tatsache allein ist schon beeindruckend – ein voll entwickelter Wald ist nicht nur ein wunderschönes Landschaftselement, ein Schutz vor extremer Hitze, verschmutzter Luft, Überschwemmungen und Dürre, sondern bietet uns auch Möglichkeiten zur Wissensvermittlung und Aufklärung – und ist letztlich Teil der Lösung der globalen Klimakrise. Die Miyawaki-Methode ist aber auch deshalb so faszinierend, weil sie auf Flächen jeder Größe angewendet werden kann – hierdurch ist der Begriff Miniwald entstanden, der kleine, dichte Wälder beschreibt, die überall auf der Welt in städtischen und ländlichen Gebieten Wurzeln schlagen. Stellen Sie sich einmal vor, wie eine Fläche von nur sechs Parkplätzen in einen Wald verwandelt wird – das ist machbar! Dass solch ein winziges Wäldchen als »Wald« bezeichnet wird, verweist auf die natürliche Struktur und Zusammensetzung der Vegetation, nicht auf die Grundfläche. Ein richtiger Wald ist in der Tat deutlich größer. Dennoch sind die Auswirkungen enorm: Mit genügend Engagement kann jeder überall seine Mitmenschen in den Prozess der Wiederbelebung verödeter Flächen einbeziehen, eine kleine Fläche nach der anderen.
Den Wald vor lauter Bäumen sehen
Miyawaki entwickelte die nach ihm benannte Wiederaufforstungsmethode in den 1970er Jahren, als die rasante Entwicklung Japans in der Nachkriegszeit ihre Schattenseite zeigte, und zwar in Form von Umweltverschmutzung und der Abholzung der Wälder. Dieser junge Wissenschaftler hatte etwas verstanden, was nicht unbedingt selbstverständlich ist, nämlich dass wir Menschen für unser Wohlbefinden und Überleben auf funktionierende Ökosysteme angewiesen sind.
»Es ist die Vegetation – insbesondere Wälder mit mehreren, komplexen Schichten bestehend aus verschiedenen Bäumen – die zahlreiche Umweltprozesse und -bedingungen steuert«, schrieb Miyawaki in seinem 2006 erschienenen Buch The Healing Power of Forests (auf Deutsch etwa »Die heilende Kraft der Wälder«), das er gemeinsam mit dem amerikanischen Ökologen Elgene O. Box verfasst hat. 3
Etwa ein Viertel der Landfläche der Erde ist von Wäldern bedeckt, doch schätzungsweise 82 Prozent der Wälder sind in unterschiedlichem Ausmaß durch industrielle Abholzung und andere Eingriffe geschädigt. Sie haben zumindest zum Teil die Fähigkeit verloren, ihre wichtige Schutzfunktion zu erfüllen. 4 Obwohl die Vegetation grundsätzlich dem kahlen Boden vorzuziehen ist, ist ihre Fähigkeit, ökologische Funktionen zu erfüllen, unterschiedlich. Ein Großteil des Grüns in Städten und Vorstädten besteht aus einer Kombination von modischen Zierpflanzen, vereinzelten Bäumen und dem allgegenwärtigen Rasen, der gemäht und bewässert werden muss, um seine teppichartige Perfektion beizubehalten. In den ländlichen Gebieten dominieren Monokulturen die Agrarlandschaft.
Die Pflanzen, die wir als Unkraut bezeichnen, wachsen in allen Zwischenräumen – und wie Miyawaki zu schätzen lernte, haben eine heilende Wirkung auf das Land, ähnlich wie Schorf auf der Haut. »In der Natur will Land nicht kahl bleiben«, schrieb Miyawaki. 5 Doch Unkräuter haben selten die Chance, sich zu komplexeren, blattreicheren Gemeinschaften zu entwickeln, weil sie ständig zertrampelt oder beseitigt werden. Die Flächen, die sie bewachsen, bleiben nur spärlich bedeckt. Im Gegensatz zu einer einschichtigen Vegetation wie verunkrauteten Stellen oder gepflegten Rasenflächen verfügen Wälder über fünf- bis dreißigmal mehr Grünflächen und sind daher »wesentlich effektiver bei der Erfüllung ökologischer Aufgaben«. 6
Einen Wald zu pflanzen ist nicht dasselbe, wie einfach nur Bäume zu pflanzen. Wir pflanzen Bäume aus vielen verschiedenen Gründen: zur Gewinnung zahlreicher Rohstoffe wie Holz, Obst, Öl und Gummi, zur Gestaltung und Beschattung von Gärten, Straßen und Parks, als Schutz vor Wind und Erosion sowie als Kohlenstoffspeicher. Die Auswahl der Baumarten und die Art ihrer Pflanzung hängen von der jeweiligen Nutzung ab. Eine Holzplantage etwa kann aus der Ferne einem Naturwald ähneln, aus der Nähe jedoch ist ein monotones Gittermuster zu erkennen. Ziel ist es, eine Plantage mit einheitlichen, schnell wachsenden, geradstämmigen Bäumen zu schaffen, die für große Erntemaschinen gut zugänglich ist. Wenn hingegen unser einziges Ziel die Bindung von Kohlenstoff ist, könnten wir einige schnell wachsende Arten pflanzen, um rasch ein Ergebnis zu erzielen.
Wo liegt also das Problem, wenn man Bäume pflanzt und keine Wälder?
Kurz gesagt: Es sind die Wechselwirkungen, die wir zwar nicht sehen können, die jedoch die ökologischen Prozesse vorantreiben, die wir so wertschätzen. In den letzten Jahrzehnten wurde viel Forschung betrieben, wodurch einige dieser bislang verborgenen Wechselwirkungen ans Tageslicht kamen. »Ein Wald ist viel mehr als das, was man sieht«, erklärt Suzanne Simard, deren bahnbrechende Forschung zeigt, wie unterirdische Pilznetzwerke die Bäume verbinden, sodass sie untereinander kommunizieren und Nährstoffe austauschen können. Diese Austauschbeziehungen ermöglichen es dem Wald, »sich so zu verhalten, als wäre er ein einzelner Organismus«, mit einer Art Intelligenz. 7 Ein Naturwald ist eine Gemeinschaft von gemeinsam existierenden, interagierenden Organismen – Bäume, Sträucher, Moose, Pilze, Bakterien, Insekten, Tiere (einschließlich des Menschen als gleichwertiges Mitglied der Gemeinschaft) –, die aufeinander angewiesen sind, um sich Nahrung, Schutz und andere Lebensgrundlagen zu sichern.
Durch die Interaktion zwischen den Arten wird das Ökosystem als Ganzes gestärkt. Mykorrhizapilze beispielsweise (Pilze, die mit dem Wurzelsystem von Pflanzen eine für beide Seiten nützliche Beziehung eingehen) ermöglichen es Pflanzen, Kohlenstoff in den Boden zu übertragen, wo er schließlich für Hunderte oder Tausende von Jahren gespeichert werden kann. Außerdem verbessern diese Pilze die Struktur des Bodens, wodurch er schwammartig wird und in der Lage ist, reichlich Regenwasser aufzunehmen, das zum Teil weiter in den Boden sickert und die Grundwasserspeicher wieder auffüllt. Ein lebendiger Boden, der reich an organischen Stoffen ist, ist entscheidend für die Fähigkeit eines Waldes, Überschwemmungen und Dürren abzumildern. Diese lebenswichtigen Beziehungen entstehen jedoch nur, wenn die Pflanzen in einer natürlichen Gemeinschaft wachsen und gedeihen können. Wenn wir lediglich einzelne Bäume oder Baumplantagen als Monokulturen pflanzen, entgehen uns viele der Vorteile, die sich aus diesem Geflecht von Wechselwirkungen ergeben.
Das Anpflanzen eines Waldes stellt eine Verbesserung gegenüber dem Anpflanzen einer rasterartigen Holzplantage dar. Umso besser ist das Pflanzen eines Waldes nach der Miyawaki-Methode, denn so wird sichergestellt, dass der Wald bestmöglich an seine Umgebung angepasst ist: Er ist stabiler, widerstandsfähiger gegen Belastungen und letztendlich leistungsfähiger.
Die meisten Menschen werden nie die Möglichkeit haben, ein großes Projekt zur Wiederherstellung von Ökosystemen im erforderlichen Umfang durchzuführen – sie haben dazu weder die Mittel noch die Zeit. Ein Miniwald hingegen kann von kleinen Gruppen von Menschen überall auf der Welt unter verschiedensten Bedingungen und Umständen gepflanzt werden. Es handelt sich um einen revolutionären Ansatz zum Pflanzen von Bäumen, der sich von Indien bis in die Niederlande und weit darüber hinaus durchsetzt.
Was ist die Miyawaki-Methode?
Ein Altwald – gemeinsprachlich oft fälschlicherweise als Urwald bezeichnet – ist ein natürlicher Wald, der noch weitgehend unberührt von menschlichen Eingriffen ist (wenn auch nicht zwangsläufig frei von menschlicher Präsenz). Diese Wälder haben längst ihre Schlusswaldphase erreicht – ein Prozess, der oft Jahrhunderte dauert. Infolgedessen beherbergen sie eine unglaubliche Artenvielfalt und übernehmen zahlreiche Ökosystemfunktionen.
Die Miyawaki-Methode ist deshalb so einzigartig, weil sie die Bedingungen für die Entstehung eines natürlichen Klimaxwaldes innerhalb von Jahrzehnten statt Jahrhunderten herstellt. Im Mittelpunkt der Methode steht die Auswahl einer Kombination von einheimischen Pflanzenarten, die für die spezifischen Bedingungen am jeweiligen Ort am besten geeignet sind. Wie sich zeigen wird, ist die Auswahl dieser Pflanzen nicht immer ganz einfach.
Außerdem stützt sich die Miyawaki-Methode auf einige wenige Schlüsseltechniken, um den Erfolg jeder Anpflanzung zu gewährleisten. Dazu gehören die Verbesserung der Bodenqualität sowie das dichte Pflanzen der Bäume, um einen bis zur Klimax entwickelten Naturwald zu imitieren. Außerdem muss der Miniwald in den ersten 3 Jahren etwas gepflegt werden, etwa durch Unkrautjäten oder Bewässerung. Das Besondere ist jedoch, dass sich ein Wald, der nach der Miyawaki-Methode und unter Einhaltung dieser einfachen Richtlinien gepflanzt wurde, selbst erhält.
Die Bäume wachsen schnell (bis zu 1 Meter pro Jahr), haben eine äußerst hohe Überlebensrate (von über 90 Prozent) und binden Kohlenstoff besser als Monokulturen. Die Miyawaki-Methode zeichnet sich außerdem dadurch aus, dass sie den Schwerpunkt darauf legt, ganze Gemeinden in den Prozess der Planung und Anpflanzung eines Waldes miteinzubeziehen. Ob man nun 3 Jahre alt ist oder 83: Fast jeder kann einen kniehohen Setzling in ein kleines Loch im Boden pflanzen. Auf jeden Fall aber kann man zumindest die Rückkehr einer Art Wildnis in einen bis dahin leeren Raum schätzen und würdigen.
Das Potenzial eines Miniwaldes
Bei der Miyawaki-Methode werden einheimische Arten gepflanzt – aber nicht einfach irgendwelche einheimischen Arten. Die Methode beinhaltet eine sorgfältige Untersuchung der sogenannten potenziellen natürlichen Vegetation (pnV). Dieser ungewöhnliche Ausdruck steht für das theoretische ökologische Potenzial einer Fläche. Anders ausgedrückt: Die potenzielle natürliche Vegetation ist »die Art von natürlicher Vegetation, die sich etablieren könnte, wenn über einen längeren Zeitraum keinerlei menschliche Einflüsse auf einen Standort einwirken würden«. 8 Die pnV eines Standorts hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der aktuellen klimatischen Bedingungen, dem Boden und der Topografie.
Doch inwiefern unterscheidet sich die potenzielle natürliche Vegetation von den Pflanzen, die in den Städten um uns herum wachsen? Zunächst einmal sind in fast allen besiedelten Gebieten viele Pflanzen nicht heimisch und benötigen daher Pflege, um zu überleben oder sich zu vermehren.
In Anbetracht der Tatsache, dass der Großteil der Erdoberfläche durch Verstädterung, Landwirtschaft, Straßenbau, Bergbau usw. erheblich verändert wurde, ist es alles andere als offensichtlich, wie die ursprüngliche Vegetation an einem bestimmten Ort ausgesehen hätte. (Die ursprüngliche Vegetation und die potenzielle natürliche Vegetation sind nicht unbedingt identisch, aber sie liegen nah beieinander.) Um dieses Geheimnis zu lüften, braucht man Neugier, Geduld und Hartnäckigkeit. Es ist jedoch ein sehr guter Ansatz, die Wiederherstellung von Ökosystemen aus dem Blickwinkel der potenziellen natürlichen Vegetation in einem Gebiet zu betrachten, weil es zeigt, welche Arten am besten in einer bestimmten Umgebung gedeihen und dadurch mehr Flora und Fauna ermöglichen.
Um die potenzielle natürliche Vegetation eines bestimmten Gebiets zu ermitteln, ist es hilfreich, die Abfolge zu verstehen, in der sich Pflanzengemeinschaften entwickeln.
Der Lauf der Natur
Überlässt man ehemals bewaldete Flächen sich selbst, können sie durch einen Prozess, der in der Biologie als Sukzession bezeichnet wird, wieder zu einem Klimaxwald heranwachsen, wobei sich die biologischen Komponenten des Ökosystems im Laufe der Zeit verändern, wenn größere und langlebigere Pflanzengemeinschaften das Land besiedeln. Wie bereits erwähnt, kann dieser Prozess Jahrhunderte dauern. Ein grundlegender Aspekt der Miyawaki-Methode ist, dass sie den langwierigen und unberechenbaren Verlauf der natürlichen Sukzession umgeht und sich stattdessen auf die Pflanzen konzentriert, die den theoretischen Endpunkt der Sukzession bilden.
In der Natur beginnt der Sukzessionsprozess dann, wenn leichte Samen herangeweht werden und auf kahlem Boden keimen. Widerstandsfähige, schnell wachsende Pflanzen wie Klee, Wegerich und Löwenzahn werden in der Wissenschaft als Pionierarten bezeichnet und profitieren von reichlich Sonnenlicht und Platz. Sie haben eine kurze Lebensdauer, produzieren viele Samen und schützen den Boden. Es folgen größere, ausdauernde Kräuter und Gräser, dann Sträucher und Pionierbäume wie Birken, Pappeln oder Kiefern.
»Jede neue Artengruppe entsteht deshalb, weil sich die Umweltbedingungen, insbesondere der Boden, verbessert haben. Jede neue Art etabliert sich, weil sie Schatten besser aushält als die vorherigen Arten und unter deren vorhandenen Blattwerk heranwachsen kann«, schreibt Miyawaki. 9 Er erklärt, dass gerade dann, wenn eine Pflanzengemeinschaft ihr volles Potenzial zu erreichen scheint, die Samen der nachfolgenden Gesellschaft im Schatten ihrer Vorgänger keimen. Die Arten eines jeden neuen Sukzessionsstadiums sind in der Regel größer, vertragen mehr Schatten und sind langlebiger als die Arten des vorangehenden Stadiums.
»Die Pflanzengemeinschaft und ihre physische Umwelt stehen in ständiger Wechselwirkung«, so Miyawaki, »bis sich schließlich die für die Umwelt am besten geeignete Gemeinschaft herausbildet, die nicht durch andere Pflanzenarten ersetzt werden kann. In Regionen mit ausreichendem Niederschlag und adäquatem Boden bildet die endgültige Gemeinschaft schließlich einen Wald.« 10
Theoretisch ist diese letzte Pflanzengemeinschaft, die sogenannte Klimaxgemeinschaft (auch Klimaxgesellschaft), nicht leicht zu verdrängen. Große Bäume, die in ihrer jeweiligen Umgebung als Klimaxarten gelten, leben Hunderte oder Tausende von Jahren und bilden Baumkronen aus, die das Innere des Waldes beschatten und kühl und feucht halten. Durch den Schatten, den sie werfen, verdrängen sie Pionierarten und dominieren so den Wald.
»Solange keine größeren Umweltveränderungen eintreten, ist die Klimax normalerweise die stärkste Form der biologischen Gesellschaft und insofern stabil, als sich seine dynamischen Veränderungen in Grenzen halten«, schrieb Miyawaki. 11 Solche Ökosysteme sind, zum Teil aufgrund des durch sie selbst geschaffenen Mikroklimas, tendenziell widerstandsfähiger gegenüber äußeren Bedingungen wie Hitze oder Dürre.
Wie könnte die Klimaxvegetation aussehen? In der Regel gibt es in einem bestimmten Gebiet mehrere verschiedene Klimaxgesellschaften. In einem Flusstal etwa können Schwarzpappeln und Weiden wachsen, während auf den nahe gelegenen Berghängen Kiefern und Tannen vorherrschen. In flacheren Regionen mit mäßig feuchten Böden besteht die potenzielle natürliche Vegetation aus immergrünen Arten oder sommergrünen Laubbäumen wie Lorbeer, Eiche, Ahorn oder Buche. Miyawaki-Wälder wurden meistens in derartigen Gebieten gepflanzt. Doch nicht alle Biome auf der Erde sind dichte Wälder. Natürliche Graslandschaften, Dornstrauchsavannen und Sanddünen zum Beispiel haben ihren eigenen ökologischen Wert und sollten im Allgemeinen nicht durch Wald ersetzt werden – weder durch die Miyawaki-Methode noch auf andere Art und Weise –, außer vielleicht entlang ihrer Uferzonen.
Das Anlegen einesMiniwaldes: Die Grundlagen
Die Regeneration des Bodens ist eine der Grundlagen für die Schaffung eines Miniwaldes auf einer degradierten Fläche. Tatsächlich ist dies der entscheidende erste Schritt – das Ziel ist es, den lebendigen Boden eines gesunden Klimaxwaldes nachzubilden. Dies geschieht auf natürliche Weise während der verschiedenen Phasen der Sukzession, aber da die Miyawaki-Methode sofort zur Klimaxphase übergeht, ist ein wenig Vorbereitung erforderlich, um dies zu kompensieren. Ohne einen lockeren Boden mit viel organischer Masse werden die Bäume es schwer haben, richtig zu wachsen. Beim Anlegen eines Waldes nach der Miyawaki-Methode wird der Boden in der Regel aufgelockert und mit organischem Material angereichert (weitere Informationen hierzu findet man unter »Den Boden vorbereiten«).
Ein weiteres Merkmal der Miyawaki-Methode ist die Pflanzdichte. Der Volksmund sagt, dass Pflanzen um Licht, Wasser und Bodennährstoffe konkurrieren, weshalb zwischen den Pflanzen viel Platz sein sollte, um diesen Wettbewerb zu entschärfen. Doch ein Miyawaki-Wald funktioniert anders. Bei einem Miyawaki-Wald liegt die Pflanzdichte in der Regel bei drei Pflanzen pro Quadratmeter. Diese Dichte hilft dabei, das Ziel der Wiederherstellung von Ökosystemen zu erreichen. In einem Naturwald wachsen die Pflanzen schließlich auch nicht in gleichmäßigen, großen Abständen zueinander. Das dichte Anpflanzen fördert die wechselseitigen und konkurrierenden Interaktionen zwischen den Pflanzen und begünstigt Verbindungen mit Mikroorganismen im Boden. Es fördert außerdem einen gesunden Wettbewerb um Sonnenlicht, der das Wachstum der Pflanzen beschleunigt.
Mulchen ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Miyawaki-Methode. Nach dem Einpflanzen wird der Boden mit einer dicken Schicht Mulch bedeckt, ähnlich dem Laub, das den Waldboden bedeckt. Sobald die jungen Bäume herangewachsen sind, werden sie auf natürliche Weise Laubmulch auf dem Waldboden verteilen. Der Mulch schützt den nackten Boden vor Wasserverlust durch Verdunstung, Erosion und extremen Temperaturen. Außerdem unterdrückt Mulch das Wachstum von Unkraut und zersetzt sich schließlich im Boden, wodurch dieser mit Nährstoffen angereichert wird.
Während sich die Pflanzen in den ersten Jahren etablieren, müssen sie in der Regel gelegentlich bewässert und gejätet werden, aber nach 3 Jahren sind die jungen Miniwälder so weit entwickelt, dass sie das Entstehen von Unkraut durch ihren Schatten verhindern und den Boden schützen. Sie sind dann in der Regel autark und benötigen keinerlei Pflege: kein Beschneiden, kein Gießen, kein Düngen, keine Schädlingsbekämpfung – und zwar niemals.
Eine neue Welle
Im Jahr 2014, im Alter von 86 Jahren, schrieb Miyawaki: »Ich hoffe, dass alle Japaner mit ihren eigenen Händen kleine Setzlinge pflanzen, um ihr eigenes Leben und das ihrer Lieben zu schützen und die üppige Vegetation Japans zu erhalten. Ich wünsche mir, dass das Know-how und die Ergebnisse dieser ökologischen Aufforstung in der ganzen Welt verbreitet werden.« 12
Tatsächlich war der engagierte Botaniker bereits auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen, denn er leitete über einen Zeitraum von 5 Jahrzehnten Waldpflanzungen an fast dreitausend Orten in achtzehn Ländern. Miyawaki wurde 2006 mit dem Blue Planet Prize für seine globale Führungsrolle bei der Bewältigung von Umweltproblemen ausgezeichnet, wodurch seine Botschaft noch weiter verbreitet wurde. Miyawakis Partnerschaft mit international tätigen Industrieunternehmen aus Japan war der Schlüssel dazu, seine Methode so weit zu verbreiten, dass sie von anderen Gruppen aufgegriffen wurde, was zu einer zweiten Welle von Projekten führen sollte.
Diese neue Welle begann im Jahr 2014, als die Methode durch das Internet einen großen Aufschwung erfuhr. Ein junger Ingenieur, der die Miyawaki-Methode entdeckt und schätzen gelernt hatte, hielt im Rahmen der TED-Talk-Reihe einen Vortrag über diese Technik der Waldanpflanzung. Das fünfminütige Video wurde mit weit über einer Million Aufrufe zu einem weltweiten Hit. 13 Shubhendu Sharma arbeitete in einem Toyota-Werk in Bangalore, Indien, als Miyawaki dort 2009 eine Pflanzaktion leitete. Sharma meldete sich freiwillig, um beim Pflanzen zu helfen, und war fasziniert davon, wie ein natürlicher Wald aus seinen Bestandteilen – dicht gepflanzte einheimische Sträucher, Unterholz und Baumkronen – zusammengesetzt werden kann, um die verschiedenen Schichten eines funktionalen Waldes nachzuahmen.
Das neue Wäldchen des Autokonzerns wuchs prächtig. Davon beeindruckt recherchierte Sharma weiter und arbeitete sich ein in die ökologischen Konzepte, auf der die Methode beruht. Er pflanzte in seinem eigenen Garten einen Wald und beobachtete seine Entwicklung. 9 Monate nach dem Anpflanzen hatte der junge Wald bereits zehn Vogelarten angezogen, die er in seinem Garten zuvor noch nie beobachtet hatte.
Diese Erfahrung prägte Sharmas Verständnis von Wäldern und eröffnete ihm eine Welt voller Möglichkeiten. Sharma war glücklich mit seinem Job in der Autoindustrie gewesen. Es war sein Traumjob. Doch der Teil seines Denkens, der ihn dazu brachte, Montagelinien für Autos zu entwerfen, wurde von der Miyawaki-Methode angezogen.





























