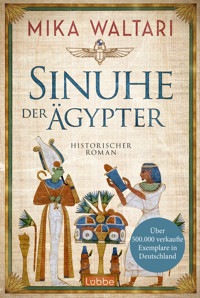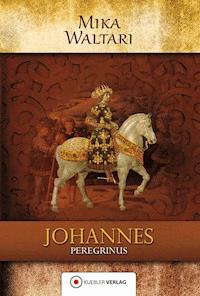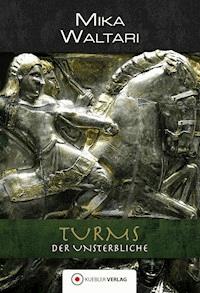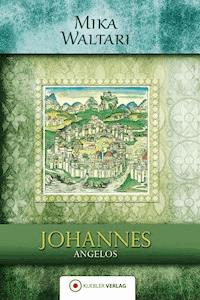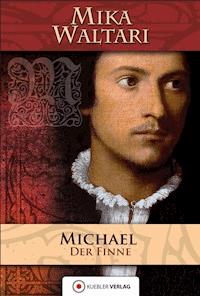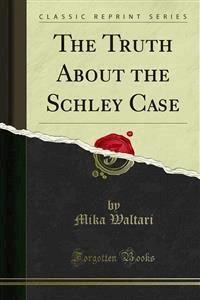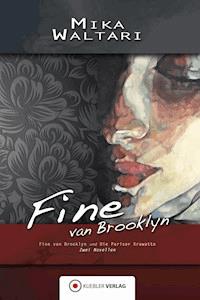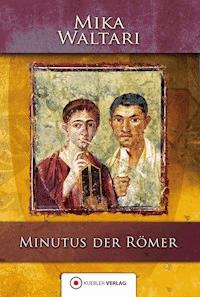
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kuebler Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Mika Waltaris historische Romane
- Sprache: Deutsch
Neu und vollständig übersetzt. Protagonist des Romans ist Minutus Lausus Manilianus, der in seinen Erinnerungen von seinem Leben berichtet. Als Halbwaise in Antiochia aufgewachsen, übersiedelt er in jugendlichem Alter zusammen mit seinem Vater nach Rom. Dort freundet er sich mit dem nur wenig jüngeren Lucius an, dem späteren Kaiser Nero, unter dessen Herrschaft er die übliche Ämterlaufbahn durchläuft und in Rom Karriere macht. Dabei gerät Minutus in engen Kontakt mit den ersten Christen, die sich gerade von einer jüdischen Sekte zu einer eigenständigen Religionsgemeinschaft entwickeln. Er erlebt das Zerwürfnis zwischen Neros machthungriger Mutter Agrippina und ihrem Sohn und wird Zeuge der ersten Christenverfolgungen unter Kaiser Nero nach der großen Feuersbrunst von Rom sowie der Wirren nach Neros Tod. Bald darauf übernimmt Vespasian die Herrschaft, mit dem Minutus eine alte Bekanntschaft verbindet. So wird er zu einem wichtigen Mitarbeiter Kaiser Vespasians. Eine zentrale Rolle im Leben des Protagonisten spielen auch verschiedene Frauen aus dem römischen Adel, seine Ehen und Liebesaffären, die Minutus in so manche politische Intrige verstricken. Mit diesem Roman gelang Mika Waltari, dem finnischen Altmeister historischer Romane, ein weiteres faszinierendes Werk, das ein anschauliches und facettenreiches Bild vom Leben in der Hauptstadt und den Provinzen des Römischen Reich im 1. Jahrhundert n. Chr. zeichnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1552
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mika Waltari
Minutus der Römer
Kuebler Verlag
DER AUTOR
Mika Waltari (1908–1979) gehörte zu den produktivsten finnischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Er ist in seiner finnischen Heimat nach wie vor äußerst populär und hat dort den Status eines modernen Klassikers. Sein Werk umfasst rund hundert Titel, darunter Romane, Erzählungen, Theaterstücke, Reiseberichte, Drehbücher und Hörspiele. Im Ausland wurde er besonders durch seine historischen Romane bekannt, denen oftmals der Sprung auf die Bestsellerlisten gelang (Sinuhe der Ägypter, Michael der Finne, Michael el-Hakim, Johannes Angelos, Turms der Unsterbliche, Minutus der Römer und andere). Sie zeichnen sich sämtlich durch sorgfältige Recherche aus und schildern auf packende Weise menschliche Schicksale in verschiedenen Epochen.
DER ROMAN
Protagonist des Romans ist Minutus Lausus Manilianus, der in seinen Erinnerungen von seinem Leben berichtet. Als Halbwaise in Antiochia aufgewachsen, übersiedelt er in jugendlichem Alter zusammen mit seinem Vater nach Rom. Dort freundet er sich mit dem nur wenig jüngeren Lucius an, dem späteren Kaiser Nero, unter dessen Herrschaft er die übliche Ämterlaufbahn durchläuft und in Rom Karriere macht. Dabei gerät Minutus in engen Kontakt mit den ersten Christen, die sich gerade von einer jüdischen Sekte zu einer eigenständigen Religionsgemeinschaft entwickeln. Er erlebt das Zerwürfnis zwischen Neros machthungriger Mutter Agrippina und ihrem Sohn und wird Zeuge der ersten Christenverfolgungen unter Kaiser Nero nach der großen Feuersbrunst von Rom sowie der Wirren nach Neros Tod. Unter dessen Nachfolger Vespasian spielt Minutus eine wichtige Rolle bei der Eroberung Jerusalems. Außerdem wird sein Lebensweg von verschiedenen Frauen aus dem römischen Adel geprägt. Seine Ehen und Liebesaffären verstricken Minutus in allerlei politische Intrigen, die sich verhängnisvoll für ihn auswirken können …
DER HERAUSGEBER
Die Reihe Mika Waltaris historische Romane, in deren Rahmen Minutus der Römer erscheint, wird von Andreas Ludden betreut und herausgegeben. Der Herausgeber, der diese Romane auch teilweise neu übersetzt hat, gilt als Kenner der Werke Waltaris und lehrt Finnisch am Baltischen Institut der Universität Münster.
Mika Waltari
Minutus der Römer
oder:
Die Feinde der Menschheit
Historischer Roman
Ungekürzte Übersetzung aus dem Finnischen von Andreas Ludden Andreas Ludden
Mehr Informationen: www.kueblerverlag.de
Impressum
Copyright der deutschen Übersetzung © 2016 by Kuebler Verlag, Lampertheim
© The Estate of Mika Waltari and WSOY, Helsinki
Original title „Ihmiskunnan viholliset“
First published in Finnish by WSOY in 1964, Helsinki, Finland
Übersetzt nach der im Jahre 2005 erschienenen 14. Auflage, Verlag WSOY, Helsinki, ISBN 951-20744-6.
Ungekürzte Übersetzung aus dem Finnischen von Andreas Ludden
Herausgeber der Reihe „Mika Waltari“: Andreas Ludden
Umschlaggestaltung: Daniela Hertel, Grafissimo!
Korrektorat: Cristoforo Schweeger
ISBN Buchausgabe: 978-3-86346-080-8
ISBN: Digitalbuch, EPUB 978-3-86346-307-6
Die Übersetzung wurde gefördert von FILI – Finnish Literature Exchange, Helsinki.
I.
Die Erinnerungen des römischen Senators
Minutus Lausus Manilianus
aus den Jahren 46 bis 79 n. Chr.
Die Juden, die, von Chrestus angestachelt, immer wieder Unruhen verursachten, verbannte er aus Rom.
Sueton: Kaiserbiographien. Claudius, Kapitel 25.
Als junger Mann war er während der ersten fünf Jahre seiner Herrschaft war er so überragend und trug so viel zur Entwicklung Roms bei, dass Trajan des Öfteren zu Recht bemerkte, die Verdienste der übrigen Kaiser würden von den ersten fünf Jahren Neros in den Schatten gestellt.
Aurelius Victor: Über die Kaiser, Kapitel 5.
Erstes Buch
Antiochia
Der Veteran Barbus rettete mir das Leben, als ich sieben Jahre alt war. Ich erinnere mich noch daran, wie ich meine Amme Sophronia hinters Licht führte, um an das Ufer des Orontes zu gelangen. Der rasch dahinströmende Fluss mit seinen vielen Strudeln reizte mich, und ich beugte mich über die Uferböschung, um die im Wasser aufsteigenden Blasen zu betrachten, die aussahen wie Ochsenaugen. Da kam Barbus zu mir und fragte freundlich: »Willst du schwimmen lernen, mein Junge?«
»Ja«, antwortete ich. Barbus blickte sich um, ergriff mich gleichzeitig am Nacken und an einem Bein und warf mich weit hinaus in den Strom. Daraufhin ließ er ein lautes Geschrei ertönen, rief Hercules und den römischen Jupiter um Hilfe an, riss sich sein zerschlissenes Obergewand vom Leib und stürzte sich Hals über Kopf in die Fluten.
Angelockt von seinem Ruf, lief sogleich viel Volk zusammen. Alle sahen es und bezeugten einstimmig, dass mich Barbus unter Gefährdung seines eigenen Lebens aus dem Fluss rettete, ans Ufer trug und mich dort so lange schüttelte, bis ich all das Wasser, das ich geschluckt hatte, wieder ausspuckte. Als die kreischende und sich die Haare raufende Sophronia endlich zur Stelle war, hob mich Barbus auf seine starken Arme und trug mich bis nach Hause, obwohl ich mich wehrte und strampelte, denn sein schmutziges Hemd und sein nach Wein stinkender Atem waren mir zuwider.
Mein Vater konnte mich nicht sonderlich leiden, aber er bewirtete Barbus mit Wein und glaubte ihm seine Schilderung, ich sei an der Uferböschung ausgerutscht und ins Wasser gefallen. Ich widersprach diesem Bericht nicht, denn ich hatte gelernt, im Beisein meines Vaters lieber mucksmäuschenstill zu bleiben. Im Gegenteil, ich hörte ganz gebannt zu, als Barbus mit einfachen Worten von seiner Legionärszeit erzählte, während der er nicht nur die Donau und den Rhein, sondern auch den Euphrat in voller Rüstung durchschwommen hatte. Auch mein Vater trank auf den Schrecken etwas Wein und ließ nicht unerwähnt, wie er in seiner Jugend, in der er eine rhodische Philosophenschule besuchte, aufgrund einer Wette von Rhodos zum Festland geschwommen war. Er und Barbus kamen zu dem festen Entschluss, dass ich endlich schwimmen lernen sollte. Mein Vater gab dem Veteranen auch neue Kleidung, sodass Barbus beim Umkleiden Gelegenheit hatte, uns seine zahlreichen Narben zu zeigen. Die schlimmsten trug er auf dem Rücken. Diese hatte er sich angeblich als Gefangener der Parther in Armenien zugezogen, die ihn gegeißelt hätten, um ihn danach gemäß römischer Sitte zu kreuzigen. Seine getreuen Kameraden aber hätten ihn im letzten Augenblick durch einen Überraschungsangriff gerettet.
Danach blieb Barbus in unserem Haus und begann, meinen Vater als seinen Herrn zu bezeichnen. Er begleitete mich zur Schule und holte mich von dort wieder nach Hause ab, sofern er nicht allzu betrunken war. Vor allem aber erzog er mich zu einem Römer, denn er war tatsächlich in Rom geboren und aufgewachsen und hatte volle dreißig Jahre in der XV. Legion gedient. Darüber verschaffte sich mein Vater auch völlige Sicherheit, denn obgleich er oft ziemlich zerstreut und überhaupt ein in sich gekehrter Mensch war, war er doch nicht so dumm, etwa einen desertierten Legionär in sein Haus aufzunehmen.
Barbus lehrte mich nicht nur schwimmen, sondern auch reiten. Auf seine Anregung hin verschaffte mir mein Vater ein eigenes Pferd, damit mich, als ich vierzehn Jahre alt wurde, die Jungritterschaft von Antiochia in ihre Reihen aufnehmen konnte. Zwar hatte Kaiser Gaius Caligula den Namen meines Vaters eigenhändig aus dem Verzeichnis der römischen Ritter gestrichen, aber in Antiochia gereichte dies meinem Vater eher zur Ehre als zur Schande, denn man erinnerte sich dort noch gut, was für ein Tunichtgut Caligula schon als kleiner Junge gewesen war. Er wurde dann ja auch im Circus Maximus in Rom ermordet, nachdem er sein Lieblingspferd zum Senator ernennen wollte.
Damals hatte es mein Vater schon, wenn auch widerwillig, in Antiochia zu einigem Ansehen gebracht, sodass man ihn gerne zum Mitglied der Gesandtschaft gemacht hätte, die dem neuen Kaiser Claudius anlässlich seines Regierungsantritts die Glückwünsche unserer Stadt überbringen sollte. Dabei hätte er sicher auch seine Ritterwürde zurückerhalten. Doch mein Vater weigerte sich strikt, nach Rom zu reisen. Später erwies sich auch, dass es triftige Gründe für diese Weigerung gab. Er selbst aber sagte nur, er wünsche sich ein stilles und zurückgezogenes Leben, und es verlange ihn nicht wieder nach der Ritterwürde.
Genauso beiläufig, wie Barbus in unser Haus gekommen war, wuchs auch das Vermögen meines Vaters. Er pflegte verbittert zu sagen, er habe kein Glück gehabt, denn an dem Tag, als ich geboren wurde, habe er die einzige Frau verloren, die er je wirklich geliebt hätte. Doch schon in Damaskus hatte er es sich zur Gewohnheit gemacht, am Todestag meiner Mutter auf den Markt zu gehen und einen Sklaven zu kaufen, der sich in elender Verfassung befand. Diesen behielt er für eine gewisse Zeit in seinem Hause und päppelte ihn auf, um ihm sodann die Freiheit zu schenken. Seinen Freigelassenen erlaubte er, den Namen Marcius – nicht aber Manilianus – zu tragen, und gab ihnen Geld, sodass jeder von ihnen in die Lage versetzt wurde, seinen erlernten Beruf auszuüben. So wurde einer seiner Freigelassenen der Seidenhändler Marcius, ein anderer der Fischer Marcius. Marcius der Friseur erwarb sich ein Vermögen, indem er Frauen mit künstlichem Haar nach der letzten Mode versorgte. Am reichsten aber wurde Marcius der Bergmann, der meinen Vater dazu gebracht hatte, ihm ein aufgegebenes Kupferbergwerk in Kilikien zu kaufen.
Mein Vater bedauerte oft, es sei ihm nicht vergönnt, auch nur die kleinsten Werke der Barmherzigkeit zu tätigen, sodass ihm daraus weder Nutzen noch Ruhm entstehe. Dennoch ließ er so manchem seine Unterstützung zukommen, ob er es nun verdiente oder nicht, wobei er glaubte, als unbekannter Wohltäter im Hintergrund bleiben zu können. Dabei war er Fremden gegenüber weitaus freigebiger als mir, seinem eigenen Sohn.
Nachdem er sieben Jahre in Damaskus verbracht hatte, ließ er sich in Antiochia nieder und diente dort als der sprachkundige und ausgeglichene Mann, der er war, dem Prokonsul für eine gewisse Zeit als Ratgeber in jüdischen Angelegenheiten, in denen er sich auf seinen vielen Reisen in Judäa und Galiläa große Sachkenntnis erworben hatte. Da er von weichherziger und gutmütiger Natur war, sprach er sich stets für Kompromisslösungen aus und verwarf härtere Maßnahmen. Auf diese Weise wurde er bei den Antiochenern recht beliebt. Er hatte zwar seine Ritterwürde verloren, aber trotzdem wählte man ihn nach gewisser Zeit in den Stadtrat, nicht etwa, weil er energisch und willensstark gewesen wäre, sondern weil jede Partei glaubte, er werde ihr noch nutzen können.
Als Caligula gefordert hatte, eine Statue, die ihn als Gott darstellte, im Tempel zu Jerusalem und in allen Synagogen in den Provinzen aufzustellen, war meinem Vater sogleich klar gewesen, dass eine solche Maßnahme bewaffnete Aufstände nach sich ziehen würde. Er riet den Juden, sich nicht auf nutzlose und Gegenreaktionen herausfordernde Proteste zu verlegen, sondern erst einmal Zeit zu gewinnen. So gaben die Juden von Antiochia dem römischen Senat zu verstehen, sie hätten eigentlich selbst wertvolle Statuen von Kaiser Gaius in Auftrag geben wollen, um sie in ihrer Synagoge aufzustellen, aber bei deren Anfertigung sei entweder ein Missgeschick passiert, oder schlimme Vorzeichen hätten ihre frühzeitige Aufstellung verhindert. Als Kaiser Gaius dann ermordet wurde, errang mein Vater wegen seiner Weitsicht großen Ruhm. Ich glaube allerdings nicht, dass er von dem Mord im Voraus etwas gewusst hat; er wollte nur, wie es seine Art war, Unruhen unter den Juden verhindern, denn diese hätten den Handelsbeziehungen der Stadt sehr geschadet.
Aber mein Vater konnte auch starrsinnig sein. Als Mitglied des Stadtrates weigerte er sich strikt, Tierschauen und Gladiatorenkämpfe für das Volk auszurichten; nicht einmal zu Theateraufführungen ließ er sich bewegen. Auf den Rat seiner Freigelassenen hin ließ er allerdings in der Stadt eine Säulenhalle errichten, die seinen Namen trug. Die Läden, die sich dort etablierten, brachten ihm reichlich Mieteinkünfte ein, sodass ihm auch dieses Unternehmen nicht nur Ruhm, sondern dazu noch wirtschaftlichen Nutzen eintrug.
Die Freigelassenen meines Vaters konnten nicht verstehen, warum er mich immer so unwirsch behandelte und wollte, dass ich mich mit seiner einfachen Lebensweise begnügte. Sie wetteiferten untereinander darin, mir Geld für meine Bedürfnisse zukommen zu lassen, schenkten mir schöne Kleider, ließen Sattel und Zaumzeug meines Pferdes prächtig schmücken und versuchten, so gut sie konnten, keinen von meinen Streichen meinem Vater zu Ohren kommen zu lassen. Jung und unverständig, wie ich war, mühte ich mich nach Kräften, mit den jungen Adeligen der Stadt in allem gleichzuziehen oder, besser noch, sie zu übertrumpfen. In ihrer Kurzsichtigkeit glaubten die Freigelassenen, dieses Verhalten würde ihre eigene Position stärken und meines Vaters Ruhm mehren.
Durch Barbus wurde meinem Vater klar, wie wichtig es für mich war, mir gute Lateinkenntnisse anzueignen. Das schlichte Legionärslatein, das Barbus sprach, brachte mich allerdings nicht viel weiter. Deshalb ließ mein Vater mich Vergil und die Geschichtsbücher des Titus Livius lesen. Abends erzählte mir Barbus von den Hügeln Roms, von den Traditionen und Sehenswürdigkeiten der Stadt, von ihren Göttern und Feldherren, sodass in mir eine brennende Sehnsucht nach Rom entstand. War ich doch kein Syrer, sondern Römer durch Geburt, aus dem Geschlecht der Manilier und des Maecenas, wenngleich meine Mutter Griechin gewesen war. Natürlich wurde auch mein Studium des Griechischen nicht vernachlässigt. So war ich schon als Fünfzehnjähriger mit den Werken vieler Dichter vertraut. Zwei Jahre lang war der aus Rhodos stammende Timaios mein Lehrer. Mein Vater hatte ihn nach den Unruhen auf der Insel gekauft und hätte ihn dann auch freigelassen, doch Timaios hatte seine Freilassung erbittert abgelehnt, mit der Begründung, es bestehe kein wirklicher Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Freien, vielmehr liege die Freiheit im Herzen eines jeden Menschen.
Dieser verbitterte Timaios machte mich nicht nur mit den griechischen Dichtern, sondern auch mit der stoischen Philosophie vertraut. Für meine Lateinstudien hatte er nichts übrig, denn seiner Meinung nach waren die Römer Barbaren. Er verachtete Rom auch deshalb, weil die Römer Rhodos seiner ererbten Freiheitsrechte beraubt hatten. Immerhin war seine Heimat, gestützt auf den hervorragenden Ruf ihrer Philosophenschulen, ein selbstständiger Staat gewesen, in dem keine Steuern erhoben wurden, bis die führenden Männer der Insel sich erdreistet hatten, ein paar römische Bürger zu kreuzigen, wodurch sie die Geduld des römischen Senats überforderten.
Viel gab ich allerdings nicht auf Timaios' Philosophie, denn er hielt sich selbst nicht daran, sondern war dem Genuss guten Essens nicht abgeneigt und schätzte sein bequemes Bett. Auch ging es ihm als Sklaven im Hause meines Vaters bestimmt besser, als wenn er sich seinen Lebensunterhalt als freischaffender Sophist in Rhodos hätte erwerben müssen. Ein inspirierender oder gar berühmter Philosoph war er jedenfalls nicht.
Ich gehörte zu einer Clique Antiochener Knaben, die sich mit Reiterspielen zu vergnügen pflegten. Wir waren etwa ein Dutzend und wetteiferten untereinander mit gewagten Mutproben und ausgelassenen Streichen. Wir bildeten eine verschworene Gemeinschaft und brachten unter einem Baum Opfer dar. Als wir einmal von unseren Reitübungen heimkehrten, beschlossen wir, in vollem Galopp durch die Stadt zu jagen, wobei jeder von uns einen der Kränze rauben sollte, die über den Türen der Läden zu hängen pflegten. Ich selbst schnappte mir aus Versehen einen schwarzen Eichenlaubkranz von einer Tür, der anzeigte, dass es in dem Haus einen Todesfall zu betrauern gab. Dabei wollten wir eigentlich nur die Kaufleute ärgern. Ich hätte das als böses Vorzeichen nehmen sollen, und dennoch hängte ich, wenn auch im Herzen Furcht empfindend, diesen Kranz an unseren Opferbaum.
Jeder, der sich mit den Verhältnissen in Antiochia auskennt, wird sich vorstellen können, was für eine Empörung dieser Streich verursachte. Natürlich gelang es der Polizei nicht, uns zu fassen. Trotzdem waren wir gezwungen, alles selbst zu gestehen, denn sonst wären alle bestraft worden, die sich an den Reiterspielen zu beteiligen pflegten. Wir kamen mit Geldstrafen davon, denn die Richter wollten unsere Eltern nicht bloßstellen. Danach begnügten wir uns damit, unser Unwesen außerhalb der Stadt zu treiben.
Eines Tages erblickten wir am Flussufer eine Gruppe von Mädchen, die irgendwelche geheimnisvollen Riten ausführten. Wir hielten sie für Bauernmädchen, und mir kam die Idee, dass wir sie entführen könnten, so wie die alten Römer die Sabinerinnen geraubt hatten. Ich erzählte meinen Eidbrüdern diese alte Legende, und sie waren davon ganz begeistert. So ritten wir zusammen ans Ufer, und jeder von uns riss das Mädchen, das ihm gerade am nächsten war, zu sich aufs Pferd hoch. Das war allerdings leichter gesagt als getan, denn es kostete uns viel Mühe, die sich heftig wehrenden und schreienden Mädchen vor uns auf dem Sattel festzuhalten. Ich wusste auch gar nicht, was ich mit meiner Gefangenen überhaupt anfangen sollte, und so kitzelte ich sie, um sie zum Lachen zu bringen. Nachdem ich ihr, wie ich fand, hinreichend deutlich zu verstehen gegeben hatte, dass sie sich völlig in meiner Gewalt befand, ritt ich zurück und ließ sie wieder frei. Genauso machten es auch meine Kameraden. Die Mädchen bewarfen uns mit Steinen, als wir uns im Galopp von ihnen entfernten. Unterdessen überkamen uns böse Ahnungen, denn als ich meine Gefangene vor mir auf dem Sattel festhielt, hatte ich bemerkt, dass sie durchaus kein Bauernmädchen war.
Tatsächlich stammten die Mädchen aus guten Familien, und sie waren von der Stadt ans Flussufer gekommen, um sich dort zu reinigen und gewisse Opferriten auszuführen, die bei Erreichen der Geschlechtsreife für sie verpflichtend waren. Das hätten wir auch an den farbigen Bändern erkennen können, die sie zur Warnung an die Uferbüsche gehängt hatten. Aber wer von uns kannte sich schon in den geheimen Bräuchen junger Mädchen aus?
Vielleicht hätten die Mädchen all dies auch geheim gehalten, um ihren guten Ruf zu wahren, aber sie hatten eine Priesterin bei sich, und diese Frau, die ihr Amt sehr ernst nahm, glaubte, wir hätten uns absichtlich einer solchen Entehrung schuldig gemacht. So zog mein Einfall einen fürchterlichen Skandal nach sich. Es wurde sogar gefordert, wir müssten als Wiedergutmachung die Mädchen heiraten, denn dadurch, dass wir ihre geheime Opferzeremonie gerade im wichtigsten Augenblick gestört hatten, hätten wir ihre Keuschheit gröblichst verletzt. Zum Glück trug aber noch keiner von uns die Mannestoga.
Mein Lehrer Timaios war über den Vorfall so erbost, dass er mich mit dem Stock traktierte, obwohl er ein Sklave war. Barbus entwand ihm den Stock mit Gewalt und riet mir, aus der Stadt zu fliehen. Da er abergläubisch war, fürchtete er auch die Götter Syriens. Timaios fürchtete die Götter nicht, weil sie für ihn nur Symbole waren, jedoch war er der Meinung, mein Verhalten habe ihm als meinem Lehrer Schande bereitet. Am schlimmsten war, dass sich die Sache nicht vor meinem Vater geheim halten ließ.
Ich war unverständig und zugleich sensibel. Als ich sah, wie entsetzt und empört die anderen waren, begann ich meine Tat für schlimmer zu halten, als sie tatsächlich gewesen war. Timaios hätte als alter Mann und Stoiker seine Gemütsruhe bewahren sollen und mir bei diesem Schicksalsschlag eher mit aufmunternden Worten zur Seite stehen müssen als meine Niedergeschlagenheit noch anzustacheln. Doch nun zeigte er seinen wahren Charakter und ließ mich seine ganze Verbitterung spüren, als er sagte:
»Was glaubst du eigentlich, wer du bist, du aufgeblasener und widerwärtiger Nichtsnutz? Zu Recht gab dir dein Vater den Namen Minutus – Unbedeutender. Deine Mutter war nur ein leichtfertiges griechisches Mädchen, eine Tänzerin, ja, schlimmer noch, vielleicht gar eine Sklavin. So weit zu deiner Abstammung. Ganz nach Recht und Gesetz und nicht aus Willkür hat Kaiser Gaius den Namen deines Vaters aus der Liste der Ritter gestrichen, denn der wurde zur Zeit des Statthalters Pontius Pilatus aus Judäa verbannt, weil er sich in das abergläubische Treiben der Juden hineinziehen ließ. Er ist ja nicht einmal ein echter Manilius, sondern nur ein adoptierter Manilianus. In Rom hat er sich sein Vermögen mithilfe eines schändlichen Testaments erschlichen und war in einen Skandal mit einer verheirateten Frau verwickelt, sodass er nie wieder dorthin zurückkehren kann. Du bist also ein Nichts und wirst immer nur noch nichtswürdiger, du verdorbener Sohn eines habgierigen Vaters!«
Er hätte noch weiter in diesem Ton gesprochen, wenn ich ihm nicht ins Gesicht geschlagen hätte. Darüber war ich allerdings sogleich selbst entsetzt, denn ein Schüler darf seinen Lehrer einfach nicht schlagen, auch wenn dieser ein Sklave ist. Aber er hatte mich zuerst mit dem Stock malträtiert, und ich konnte ihm nicht erlauben, das Andenken meiner Mutter zu entehren, auch wenn ich sie nie gekannt hatte. Und was er über meinen Vater gesagt hatte, so glaubte ich, er würde lügen, weil er einen Groll gegen ihn hegte.
Timaios wischte sich zufrieden das Blut von den Lippen, lächelte maliziös und sagte: »Danke, mein lieber Minutus, für diesen Hinweis. Aus Krummem wächst nichts Gerades und aus Niedrigem nichts Edles. Was deinen Vater betrifft, so wisse auch, dass er heimlich mit den Juden Blut trinkt und in seinem Gemach den Becher der Fortuna verehrt. Sonst könnte er nicht so erfolgreich sein und so reich werden, und das ohne eigenes Verdienst. Ich aber habe genug von ihm und von dir und von dieser ganzen ruhelosen Welt, in der die Falschheit über das Recht triumphiert und die Weisheit an der Türschwelle sitzen muss, während die Frechheit Feste feiert.«
Doch ich achtete nicht mehr auf seine Worte, denn ich hatte in meiner eigenen Not genug Dinge, die jetzt zu bedenken waren. Mich beherrschte nur der blinde Wille, mit irgendeiner kühnen Tat zu beweisen, dass ich eben nicht unbedeutend war. Auf diese Weise wollte ich meine Untat wiedergutmachen. Zusammen mit meinen Eidbrüdern erinnerte ich mich an die Kunde von einem Löwen, der eine halbe Tagesreise von der Stadt entfernt Viehherden gerissen hatte und den zu fangen man gerade Vorkehrungen traf. Es geschah selten, dass sich ein Löwe so nahe an eine Großstadt wagte, und er war das große Gesprächsthema in Antiochia. Ich dachte, wenn ich zusammen mit meinen Kameraden jenen Löwen lebendig einfinge und wir ihn dem Amphitheater der Stadt schenken würden, könnten wir dadurch nicht nur unsere Tat ungeschehen machen, sondern auch großen Ruhm ernten.
Dieser Gedanke war so absurd, wie ihn nur die Verzweiflung einem fünfzehnjährigen Jüngling eingeben konnte, der sich in seinem Innersten zutiefst verletzt fühlte. Das Verrückteste aber war, dass Barbus am Abend jenes Tages völlig betrunken war und den Plan sofort für großartig erklärte. Ihn abzulehnen wäre für ihn, der uns so viel von seinen Heldentaten erzählt hatte, auch schwierig gewesen. Hatte er doch bei zahlreichen Gelegenheiten zusammen mit seinen Legionärskameraden Löwen mit Netzen gefangen, um sich zu seinem kargen Sold etwas hinzuzuverdienen.
Wir mussten schnell aus der Stadt verschwinden, denn die Polizei war vielleicht schon unterwegs, um mich festzunehmen. Außerdem war ich mir sicher, dass man uns spätestens am nächsten Morgen die Pferde für immer wegnehmen würde. Sechs meiner Kameraden erreichte ich noch, denn nur drei waren so klug gewesen, ihren Eltern das Vorgefallene sofort zu berichten, woraufhin diese sie umgehend aus der Stadt fortgebracht hatten.
Meine zutiefst verschreckten Kameraden waren von meiner Idee so begeistert, dass sie sich gleich auszumalen begannen, was für eine großartige Heldentat wir vollbringen würden. Heimlich holten wir unsere Pferde aus den Ställen und ritten aus der Stadt hinaus. Inzwischen hatte sich Barbus vom Seidenhändler Marcius einen Beutel Silbermünzen besorgt und war ins Amphitheater gegangen, um dort einen erfahrenen Großwildjäger zu bestechen, der uns begleiten sollte. Die beiden beluden einen Wagen voll mit Netzen, Waffen und ledernen Schutzanzügen und stießen dann außerhalb der Stadt bei unserem Opferbaum zu uns. Barbus hatte auch noch Fleisch, Brot und zwei große Weinkrüge mitgebracht. Der Wein machte mich hungrig, denn ich war wirklich so furchtsam und niedergeschlagen gewesen, dass ich zu Hause keinen Bissen herunterbekommen hatte.
Bei Mondschein brachen wir auf. Barbus und der Großwildjäger machten uns mit ihren Erzählungen von den Methoden der Löwenjagd in verschiedenen Ländern Mut. Sie schilderten alles so eingehend, dass ich und meine Kameraden, vom Wein befeuert, sie zu warnen begannen, sie sollten sich ja nicht in unsere Fangaktion einmischen, sondern die Ehre ganz allein uns überlassen. Das versprachen die beiden auch bereitwillig und versicherten, sie wollten uns nur mit ihren Ratschlägen und ihrer Erfahrung helfen, sonst aber würden sie sich selbstverständlich zurückhalten. Ich hatte im Amphitheater mit eigenen Augen gesehen, wie leicht eine Gruppe erfahrener Männer einen Löwen mit dem Netz einfangen kann und wie mühelos ein mit zwei Speeren bewaffneter Mann ein solches Tier zu erlegen vermag.
In der Morgendämmerung erreichten wir das Dorf, in dessen Nähe der Löwe zuletzt gesehen worden war. Dort wurden gerade die morgendlichen Herdfeuer entfacht. Die Gerüchte, die besagt hatten, das Dorf sei in Angst und Schrecken vor dem Löwen erstarrt, erwiesen sich jedoch nicht als richtig, denn die Dorfbewohner schienen im Gegenteil besonders stolz auf »ihre« Raubkatze. Seit Menschengedenken war in ihrer Gegend kein Löwe mehr gesehen worden. Das Tier hauste in einer Höhle in einem nahen Berg und hatte sich einen Pfad zu einem Bach ausgetreten. In der vergangenen Nacht hatte es eine Ziege gefressen, welche die Dorfbewohner an jenem Pfad an einen Baum gebunden hatten, damit der Löwe nicht ihre wertvolleren Herden anfiel. Menschen waren von ihm noch nie angefallen worden. Im Gegenteil, wenn er seine Höhle verließ, pflegte er sein Kommen mit dumpfem Gebrüll anzukündigen. Er war auch nicht besonders wählerisch, sondern gab sich im Notfall auch mit Aas zufrieden, sofern die Schakale ihm dabei nicht zuvorkamen. Übrigens hatten die Dorfbewohner bereits einen stabilen Käfig gebaut, in dem sie den Löwen nach Antiochia bringen wollten, um ihn dort zu verkaufen. Ein Löwe, den man mit einem Netz gefangen hat, muss nämlich so sorgsam gefesselt werden, dass seine Glieder unverletzt bleiben, sofern man ihn nicht sofort in einen Käfig sperrt, wo man ihm die Fesseln abnehmen kann.
Als die Dorfbewohner von unserem Plan hörten, waren sie keineswegs begeistert. Doch zum Glück hatten sie den Löwen auch noch nicht verkauft, und als sie erfuhren, in welcher Notlage wir uns befanden, setzten sie uns so zu, dass Barbus ihnen zweitausend Sesterze für den Löwen zahlen musste. Für so viel Geld versprachen sie sogar, uns auch den Käfig zu überlassen, den sie bereits gebaut hatten. Nachdem der Handel abgeschlossen und das Geld ihnen ausgehändigt worden war, begann Barbus plötzlich vor Kälte zu zittern und schlug vor, wir sollten uns nun alle schlafen legen und das Einfangen des Löwen auf morgen verschieben. Bis dahin würden sich die Leute in Antiochia auch über den Skandal, den wir losgetreten hatten, wieder beruhigen. Aber der Großwildjäger wandte dagegen ganz zu Recht ein, dass sich gerade jetzt am Vormittag die beste Gelegenheit böte, den Löwen aus seiner Höhle zu scheuchen, da er gerade gefressen und seinen Durst gestillt hatte, schläfrig sei und von begrenzter Bewegungsfähigkeit.
Barbus und er legten also ihren Lederschutz an, und von Männern aus dem Dorf geleitet, ritten wir bis an den Abhang des Berges. Dort zeigten die Dorfbewohner uns den Pfad des Löwen und seine Tränke, die großen Abdrücke seiner Tatzen und auch frischen Kot. Wir konnten sogar die Ausdünstungen des Raubtiers spüren, und unsere Pferde wurden scheu. Während wir uns langsam der Höhle näherten, wurde der Aasgeruch immer stechender, und unsere Pferde zitterten, verdrehten die Augen und weigerten sich, sich auch nur einen Schritt weiterzubewegen. Das verwunderte uns sehr, denn sie waren an Horngeschmetter und den Lärm der verschiedensten Instrumente gewöhnt, und bei verschiedenen Übungen waren wir mit ihnen sogar über brennendes Feuer geritten.
Da wir nichts im Voraus bedacht hatten, waren wir wohl der Meinung gewesen, auf dem Rücken unserer Pferde seien wir vor den Angriffen des Löwen einigermaßen sicher. Aber nun mussten wir vom Sattel steigen und die Pferde wegschicken, so verängstigt waren sie von dem bloßen Geruch des Raubtiers. Ratlos näherten wir uns also der Höhle zu Fuß, bis wir das dumpf grollende Schnarchen des Löwen hören konnten. Es dröhnte so furchtbar, dass die Erde unter unseren Füßen davon erbebte. Allerdings kann es auch sein, dass uns nur die Knie zitterten, da wir nun zum ersten Mal in unserem Leben auf die Behausung eines Löwen zugingen.
Die Dörfler hatten vor ihrem Löwen überhaupt keine Angst, sondern versicherten uns, er werde bis zum Abend durchschlafen, so sehr hatten sie sich an seinen regelmäßigen Lebenswandel gewöhnt. Auch beteuerten sie, sie hätten ihn so sehr gemästet, dass er ganz fett und faul geworden sei, und unsere größte Schwierigkeit werde darin bestehen, ihn aus seinem Schlupfwinkel zu locken.
Durch das Gebüsch vor seiner Behausung hatte sich der Löwe einen breiten Pfad getrampelt. Die Ränder der Höhle waren so hoch und steil, dass Barbus und der Tierfänger zu beiden Seiten gut geschützt hochklettern konnten. Von dort aus wollten sie uns mit ihren Ratschlägen helfen. Sie wiesen uns an, wie wir das schwere Seilnetz vor den Ausgang der Höhle spannen sollten, wobei je drei von uns es an beiden Enden festhalten mussten. Der Siebte sollte hinter dem Netz laut rufend herumspringen, sodass der in seinem Schlaf aufgestörte und von der Sonne geblendete Löwe auf ihn losgehen und dadurch direkt in unsere Falle springen würde. Das Netz sollten wir dann so oft wie möglich um den Löwen herumwickeln und dabei darauf achten, dass wir dem Maul und den Tatzen des wütenden Tieres nicht zu nahe kämen. Als wir diese Ratschläge überdachten, wurde uns klar, dass die Sache bei Weitem nicht so einfach war, wie die beiden Männer sie darstellten.
Wir setzten uns nieder, um zu beratschlagen, wer von uns den Löwen aus seinem Schlaf wecken sollte. Barbus riet uns, es sei am besten, dem Tier mit dem Speer einen Schlag auf sein Hinterteil zu versetzen, sodass es aufgeschreckt, aber nicht verletzt würde. Der Großwildjäger versicherte, er hätte uns gern diesen kleinen Dienst erwiesen, aber seine Knie seien steif vom Rheumatismus, und im Übrigen wolle er uns auch nicht um unseren Ruhm bringen.
Meine Kameraden begannen mich verstohlen zu mustern und versicherten, sie würden aufrichtigen Herzens mir die Ehre überlassen. Ich hätte mir ja das Ganze ausgedacht, und ich hätte sie auch dazu verleitet, den »Raub der Sabinerinnen« zu spielen, womit unser Abenteuer begonnen hatte. Den stechenden Löwengeruch in meiner Nase spürend, gab ich meinen Kameraden nachdrücklich zu bedenken, dass ich meines Vaters einziger Sohn sei. Als wir diesen Umstand bedachten, erwies sich, dass ganze fünf von uns die einzigen Söhne ihrer Väter waren, was unser Verhalten hinreichend erklären dürfte. Einer hatte nur Schwestern, und der Jüngste von uns, Charisios, beeilte sich zu erklären, sein Bruder stottere stark und sei auch sonst körperlich behindert.
Der Großwildjäger wurde ungeduldig und schlug vor, wir sollten Eisenstangen erhitzen, Fackeln anzünden und mit Rauch und Feuer den Löwen aus der Höhle scheuchen. Die syrischen Landleute widersprachen diesem Vorschlag heftig, denn wegen der langen Hitzeperiode war das Gebüsch ganz trocken und verdorrt; ein Herumhantieren mit Feuer würde alles in Brand setzen, und es bestünde die Gefahr, dass sich die Feuersbrunst bis nach Antiochia ausbreitete, ganz zu schweigen von der Vernichtung der Felder und Dörfer.
Mir war klar, dass meine Kameraden mich bedrängten und ich gehen musste, ob ich nun wollte oder nicht. Barbus vergoss etwas Wein aus dem Krug, rief mit zitternder Stimme Hercules zu Hilfe und versicherte, er liebe mich mehr als seinen Sohn, auch wenn er niemals einen eigenen Sohn gehabt hatte. Die Aufgabe sei unpassend für mich, sagte er, aber als alter Legionärsveteran sei er durchaus bereit, selbst in die Höhle zu gehen und den Löwen zu wecken. Wenn er dabei wegen seiner schlechten Augen und geschwächten Beine das Leben verlöre, so hoffe er doch, dass ich für eine feierliche Einäscherung sorgen und eine Gedächtnisrede auf ihn halten würde, damit all seine ruhmreichen Taten dem ganzen Volk bekannt würden. Mit seinem Tode würde er bezeugen, dass alles, was er mir im Laufe der Jahre über sein Leben erzählt hatte, zumindest teilweise wahr sei.
Als er tatsächlich nach seinem Speer griff und begann, mühselig den steilen Abhang hinabzuklettern, wurde auch ich weich, und wir umarmten einander innig und unter Tränen. Ich konnte nicht zulassen, dass er, so alt wie er war, für mich in den Tod ging, wo ich uns doch die ganze Sache eingebrockt hatte. Deshalb bat ich ihn, meinem Vater zu berichten, dass ich wenigstens mannhaft gestorben sei, und dass mein Tod alles wiedergutmachen würde, da ich ihm ja nichts als Verdruss bereitet hatte, wo doch schon meine Mutter bei meiner Geburt gestorben war und ich nun auch noch, wenn auch ohne böse Absicht, seinen guten Namen in ganz Antiochia in den Schmutz gezogen hatte.
Barbus nötigte mich, einen ordentlichen Schluck Wein zu trinken, denn nichts tue richtig weh, versicherte er mir, wenn man genug Wein im Magen habe. So trank ich ein paar Schlucke Wein und beschwor meine Kameraden, das Netz nur ja kräftig festzuhalten und um keinen Preis den Griff zu lockern. Dann ergriff ich den Speer mit beiden Händen, biss die Zähne zusammen und schlich mich auf dem Löwenpfad in den Felsspalt. Während mir das Geschnarche des Löwen in den Ohren dröhnte, konnte ich undeutlich seine liegende Gestalt erkennen. Ich stieß ihn mit dem Speer an, ohne genau zu sehen, wo ich ihn getroffen hatte, und sogleich hörte ich ihn aufheulen. Da heulte ich ebenfalls auf und rannte schneller als jemals bei einem Wettlauf im Gymnasium geradewegs in das Netz, das meine Kameraden vorschnell hochgehoben hatten, ohne zu warten, bis ich es übersprungen hätte.
Noch strampelte ich in den Schlingen des Netzes, da kam der Löwe knurrend aus seiner Höhle herausgehumpelt, blieb verblüfft stehen und betrachtete meine Versuche, mich zu befreien. Er war so groß und furchteinflößend, dass meine Kameraden seinem Anblick nicht gewachsen waren, sondern das Netz losließen und schreiend Reißaus nahmen. Der Großwildjäger hingegen brüllte uns seine Anweisungen zu und schrie, wir sollten das Netz sofort über den Löwen werfen, bevor sich seine Augen an das Licht gewöhnt hätten, denn sonst könne er uns gefährlich werden.
Auch Barbus schrie und beschwor mich, den Mut nicht sinken zu lassen und daran zu denken, dass ich Römer sei und aus dem Geschlecht der Manilier. Falls ich in Gefahr geriete, werde er herunterkommen und den Löwen mit seinem Schwert töten, aber erst solle ich versuchen, ihn lebend einzufangen. Ich weiß nicht, welcher von diesen Ratschlägen größere Wirkung auf mich hatte, aber nachdem meine Kameraden das Netz losgelassen hatten, konnte ich mich leichter aus dessen Schlingen befreien. Dennoch machte mich ihre Feigheit so wütend, dass ich das Netz von mir abwarf, mich umwandte und dem Raubtier direkt in die Augen sah. Der Löwe starrte mich aus seinem majestätischen Antlitz an, höchst ergrimmt und mit einer Miene, als sei er zutiefst beleidigt, wobei er leise wimmerte und eine seiner hinteren Tatzen anhob, aus der Blut floss. Ich hielt das Netz vor mir hoch und zog es hinter mir her. Es war schwer für einen einzelnen Mann, aber trotzdem gelang es mir, es dem Löwen überzuwerfen. Dieser tat einen Satz nach vorn, verfing sich dabei im Netz und fiel auf die Seite. Mit fürchterlichem Gebrüll begann er sich auf dem Boden zu wälzen und wickelte sich dabei immer mehr ein, wobei es ihm nur ein einziges Mal gelang, mit einer seiner Tatzen nach mir zu schlagen. Dabei spürte ich, wie stark er war, denn ich flog Purzelbäume schlagend ein gutes Stück weit davon, und das rettete mir gewiss das Leben.
Barbus und der Großwildjäger feuerten sich mit ihren Rufen gegenseitig an. Der Jäger stieß mit seiner hölzernen Forke den Kopf des Löwen fest zu Boden, und Barbus gelang es, dem Tier eine Schlinge des Netzes um eines der Hinterbeine zu wickeln. Die syrischen Landleute wollten schon zu Hilfe eilen, aber ich brüllte ihnen Flüche entgegen und verbot ihnen, sich einzumischen. Stattdessen befahl ich meinen feigen Kameraden, zurückzukommen und den Löwen zu fesseln, weil sonst unser ganzes Unternehmen ein Misserfolg wäre. Das taten sie schließlich auch, obwohl sie die Krallen des Löwen zu spüren bekamen. Der Großwildjäger sicherte die Seile und Knoten, bis der Löwe so straff gebunden war, dass er sich kaum noch regen konnte. Unterdessen saß ich auf der Erde, zitterte vor Wut und war so ergrimmt, dass ich mich zwischen meinen Knien erbrach.
Die syrischen Landleute schoben eine lange Holzstange zwischen die Tatzen des Löwen und trugen ihn dann ins Dorf. Wie er so an der Stange hing, war er längst nicht mehr so groß und prächtig wie noch kurz zuvor, als er aus seiner Höhle ans Tageslicht gekommen war. Eigentlich war er ein altes und geschwächtes, von Flöhen befallenes Tier mit kahlen Flecken in der Mähne, und als wir ihm einen Knebel ins Maul schoben, kamen ziemlich abgenutzte Zähne zum Vorschein. Ich fürchtete, er könnte von den Fesseln erdrosselt werden, während man ihn ins Dorf trug.
Zwar versagte mir immer wieder die Stimme, aber dennoch gelang es mir unterwegs, meinen Kameraden deutlich zu sagen, was ich von ihnen hielt und wie ich über ihre Eidfreundschaft dachte. Wenn ich etwas gelernt hätte, so sagte ich, dann das, dass man sich auf keinen Menschen verlassen könne, wenn es um Leben oder Tod ging. Meine Kameraden schämten sich für ihr Verhalten und wussten mir nichts zu entgegnen, erinnerten mich aber auch an unseren gemeinsamen Schwur und daran, dass wir den Löwen zusammen gefangen hätten. Die größte Ehre wollten sie mir gerne zugestehen, aber sie wiesen auch auf die Schrammen hin, die sie abbekommen hatten. Ich zeigte ihnen meinen Arm, von dem noch immer Blut floss, sodass mir schwach in den Knien wurde. Schließlich kamen wir zu dem Schluss, dass wir alle lebenslang Narben von dieser unserer Heldentat davontragen würden.
Im Dorf feierten wir ein Fest und brachten dem Löwen ein ehrenvolles Opfer dar, nachdem wir ihn lebendig und glücklich in einen stabilen Käfig eingeschlossen hatten. Barbus und der Großwildjäger betranken sich, während die Mädchen des Dorfes uns zu Ehren Ringtänze aufführten und uns bekränzten. Am nächsten Tag mieteten wir ein Ochsengespann, um den Käfig damit abzutransportieren, und zogen mit einem Ehrengeleit und Kränzen auf unseren Häuptern nach Antiochia. Dabei achteten wir darauf, dass die Wunden, die wir uns im Kampf zugezogen hatten, deutlich sichtbar waren, indem wir sie mit blutdurchtränkten Verbänden kennzeichneten.
Am Stadttor wollten die Polizisten uns sofort festnehmen und unsere Pferde beschlagnahmen. Doch ihr diensthabender Offizier war klüger und gab uns höchstpersönlich das Geleit, als wir sagten, dass wir uns freiwillig zum Rathaus begeben und dort melden wollten. Zwei Polizisten machten uns mit ihren Knüppeln den Weg frei, denn wie immer in Antiochia war sofort viel müßiges Volk zusammengelaufen, als bekannt wurde, dass etwas Aufsehenerregendes passiert war. Zuerst bedachte uns die Volksmenge mit Flüchen und warf mit Straßenkot und faulem Obst nach uns, weil sich das völlig übertriebene Gerücht verbreitet hatte, wir hätten alle Mädchen und dazu noch die Götter der Stadt entehrt. Doch von dem Lärm und den Rufen der Volksmenge aufgeschreckt, begann unser Löwe dumpf zu brüllen und fand dann wohl so viel Gefallen an seiner eigenen Stimme, dass er mit dem Gebrüll überhaupt nicht mehr aufhörte, woraufhin unseren Pferden der Schweiß ausbrach, während sie unruhig zu tänzeln begannen und ihre Köpfe ängstlich herumwarfen.
Es mag sein, dass der erfahrene Großwildjäger seinen Anteil daran hatte, den Löwen zum Brüllen zu bringen. Jedenfalls wich die träge und aufgescheuchte Volksmenge bereitwillig vor uns zurück, und als man unsere blutbefleckten Verbände sah, ließen sich einige Frauen zu Tränen rühren und begannen gar, hysterisch zu kreischen.
Wer je mit eigenen Augen die breite und meilenlange Hauptstraße Antiochias mit ihren endlosen Säulenhallen gesehen hat, der wird begreifen, dass unser Zug, je weiter er kam, immer mehr die Gestalt eines Triumphzuges annahm statt der eines Geleitzugs der Schande. Es dauerte nicht lange, bis die erregte und gerührte Volksmenge uns Blumen auf den Weg zu streuen begann. Jung wie wir waren, nahm unser Selbstvertrauen mächtig zu, sodass wir uns bei unserer Ankunft am Rathaus eher als Helden denn als Verbrecher fühlten.
Die führenden Männer der Stadt hatten keine Einwände, dass wir zuallererst den Löwen, den wir gefangen hatten, der Stadt zum Geschenk machten und ihn Jupiter dem Beschützer weihten, den man in Antiochia hauptsächlich unter dem Namen Baal kennt. Erst danach wurden wir vor die Strafrichter geführt. Mit diesen aber verhandelte bereits ein von meinem Vater beauftragter berühmter Jurist. Außerdem machte unser freiwilliges Erscheinen tiefen Eindruck auf das Gericht.
Zuerst forderte der Jurist eine Vertagung, um die Sache von allen Seiten her zu untersuchen. Zum Zweiten bestritt er, dass ein Strafgericht für die Behandlung der Angelegenheit zuständig sei, indem er Beweise dafür anführte, dass es sich lediglich um eine private Streitsache und keinesfalls um ein kriminelles Vergehen handele. Drittens verwies er auf das Orakel der Daphne als die höchste Schiedsstelle, wenn es um alte religiöse Riten und deren mögliche Verletzung ging. Einen schlagenden Beweis für eine solche Verletzung habe bisher allerdings niemand beibringen können, meinte er, vielmehr handle es sich nur um Gerüchte.
Als wir seine machtvolle Stimme vernahmen, fühlten wir uns ziemlich sicher. Auch wurden wir keineswegs ins Gefängnis geworfen, sondern alle nach Hause entlassen, um dort unsere Wunden pflegen zu können. Die Pferde allerdings wurden uns erbarmungslos weggenommen, das war nicht zu verhindern, und wir mussten uns bittere Worte über die Disziplinlosigkeit der Jugend anhören und was überhaupt von der Zukunft zu erwarten sei, wenn die Sprösslinge der ersten Familien der Stadt dem Volk so ein schlechtes Beispiel gaben, und wie das alles ganz anders gewesen sei, als unsere Eltern und Vorfahren noch jung gewesen waren.
Als ich aber mit Barbus nach Hause kam, hing an der Tür ein Totenkranz. Zunächst wollte niemand mit uns sprechen, nicht einmal Sophronia. Doch schließlich brach sie in Tränen aus und berichtete, mein Lehrer Timaios habe abends zuvor gewünscht, dass man ihm eine Schüssel heißen Wassers aufs Zimmer bringe, und sich dann die Adern geöffnet. Erst am Morgen sei er leblos aufgefunden worden. Mein Vater habe sich in seinem Zimmer eingeschlossen und sei nicht einmal dazu bereit, seine Freigelassenen zu empfangen, die erschienen waren, um ihn zu trösten.
Niemand hatte den mürrischen und abweisenden Timaios, für den nie etwas gut genug war, wirklich gemocht, aber ein Todesfall ist immer eine ernste Sache, und ich konnte nicht die Augen davor verschließen, dass ich schuld daran war. Immerhin hatte ich meinen Lehrer geschlagen und ihm durch mein Verhalten Schande bereitet. Ich wurde von Entsetzen gepackt und vergaß, dass ich Aug' in Auge einem Löwen gegenübergestanden hatte. Mein erster Gedanke war, das Haus meines Vaters für immer zu verlassen, zur See zu gehen, Gladiator zu werden oder mich als Söldner bei der am weitesten entfernten römischen Legion in eisigen Gefilden zu verdingen oder an der heißen Grenze des Partherlandes. Aber ich konnte nicht aus der Stadt fliehen, ohne ins Gefängnis zu kommen, und deshalb dachte ich trotzig daran, dieselbe Tat zu begehen wie Timaios, um dadurch meinen Vater von aller Verantwortung reinzuwaschen und ihn zugleich von meiner schändlichen Gegenwart zu befreien.
Auch Barbus war sehr erschrocken, aber er sagte: »Minutus, wenn alles verloren ist und man keine Hoffnung mehr hat, dann ist es am besten, den Stier bei den Hörnern zu packen.«
»Dann zeig mir den Stier!«, entgegnete ich verdrossen.
Barbus erklärte, er habe bildlich gesprochen. Seiner Meinung nach solle ich nur tapfer vor meinen Vater hintreten, und das lieber sofort als später. »Solltest du dich aber fürchten«, sagte er, »dann gehe ich zuerst zu ihm und nehme den ersten Wutausbruch auf mich. Zumindest kann ich dann berichten, wie du allein und mit bloßen Händen einen wütenden Löwen eingefangen hast. Wenn er auch nur noch die geringste Spur väterlicher Gefühle für dich hegt, dann sollte ihn das gnädig stimmen.«
Ich überlegte. »Wenn ich gehen muss, dann gehe ich«, befand ich schließlich. »Du bist genauso mein Lehrer wie Timaios. Es reicht, wenn dieser elende Stoiker sich meinetwegen umgebracht hat. Mein Vater könnte so böse werden, dass du dich deswegen in dein Schwert stürzen würdest, und das wäre doch ganz sinnlos. Außerdem glaubt mein Vater nicht einmal die Hälfte von dem, was du ihm erzählen würdest, und ich habe nicht vor, den Löwen auch nur mit einem Wort zu erwähnen, sofern er mich nicht selbst fragt, wo ich gewesen bin.«
»Wenn ich dein Vater wäre«, meinte Barbus, »würde ich dich wahrscheinlich gründlich auspeitschen lassen und dann alles für dich tun, was in meinen Kräften steht. Eigentlich ist es falsch, dass dein Vater dich nie mit der Peitsche gezüchtigt hat. Denk daran, dir ein Stück Leder zwischen die Zähne zu stecken, und vergiss dabei auch nicht die ehrenvollen Narben auf meinem Rücken.«
Er umarmte mich zärtlich und machte sich daran, seine wenigen Sachen zusammenzusuchen, denn er war sicher, dass mein Vater ihn aus dem Haus jagen würde.
Doch mein Vater empfing mich auf ganz andere Weise, als ich gedacht hatte, obwohl ich das eigentlich hätte ahnen können. Er verhielt sich im Allgemeinen ja nie so, wie andere Menschen sich gewöhnlich benahmen. Gezeichnet von nächtelangem Wachen und Weinen, stürzte er mir entgegen, schloss mich in die Arme, drückte mich an seine Brust, bedeckte mein Haar und meine Wangen mit Küssen und wiegte mich in seinem Schoß wie ein kleines Kind. So zärtlich hatte er mich noch nie zuvor in seinen Armen gehalten, denn als ich noch klein war und mich nach Zärtlichkeiten sehnte, weigerte er sich stets, mich anzurühren, ja auch nur anzublicken.
»Minutus, mein Junge!«, flüsterte er. »Ich dachte schon, ich hätte dich auf ewig verloren, und du wärest mit diesem Trunkenbold von Veteran bis an die Grenzen der Erde ausgerissen, da ihr ja auch noch Geld mitgenommen hattet. Mach dir keine Gedanken wegen Timaios. Er wollte sich nur für sein Sklavendasein und seine billige Philosophie an dir und an mir rächen. Nichts kann auf Erden Schlimmes passieren, was man nicht auf irgendeine Weise wiedergutmachen und verzeihen könnte.«
Weiter sagte er: »Ach Minutus, ich bin nun einmal kein guter Erzieher, habe ich mich doch nicht einmal selbst erziehen können. Aber du hast die Stirn und die Augen deiner Mutter und ihre kurze gerade Nase, und auch den schönen Mund deiner Mutter hast du. Kannst du mir je verzeihen, dass ich so hartherzig gewesen bin und dich so sehr vernachlässigt habe?«
Seine unbegreifliche Zärtlichkeit machte auch mich ganz weich, sodass ich laut loszuweinen begann, obwohl ich bereits fünfzehn Jahre alt war. Ich warf mich vor meinem Vater zu Boden, umschlang seine Knie mit den Armen und bat ihn für all die Schande, die ich ihm bereitet hatte, um Verzeihung. Ich versprach, mich zu bessern, wenn er mir dieses eine Mal noch vergeben könnte. Mein Vater wiederum fiel vor mir auf die Knie, umarmte und küsste mich, sodass wir beide um die Wette einander um Verzeihung baten. Ich fühlte mich unendlich erleichtert und glücklich darüber, dass mein Vater selber die Verantwortung für Timaios' Tod und für meine Schuld daran übernahm, sodass ich nur umso lauter weinte.
Barbus aber, der mein lautes Weinen vernommen hatte, konnte nun nicht mehr an sich halten. Unter furchtbarem Getöse stürzte er mit gezücktem Schwert und Schild ins Zimmer, weil er glaubte, mein Vater würde mich verprügeln. Mit lautem Wehklagen folgte ihm Sophronia auf den Fersen, riss mich mit Gewalt aus der Umklammerung meines Vaters und drückte mich im nächsten Augenblick fest an ihren üppigen Busen. Beide, Barbus und Sophronia, beschworen meinen grausamen Vater, er solle lieber sie schlagen, denn sie trügen an allem viel mehr Schuld als ich. Ich sei doch noch ein Kind und hätte mit meinen harmlosen Streichen bestimmt nichts Böses bezweckt.
Mein Vater war verblüfft. Er erhob sich und wies den Vorwurf der Grausamkeit entschieden zurück. Er versicherte, mich nicht geschlagen zu haben. Seine Verwirrung bemerkend, rief Barbus laut alle Götter Roms an und schwor, er werde sich in sein Schwert stürzen, um seine Schuld auf dieselbe Weise zu sühnen wie Timaios. In diese Idee hatte er sich so hineingesteigert, dass er sich vermutlich tatsächlich verletzt hätte, wenn nun nicht wir alle drei, mein Vater, Sophronia und ich, ihm mit vereinten Kräften das Schwert und den Schild entwunden hätten. Was er mit dem Schild vorhatte, konnte ich nicht begreifen; später erklärte er mir, er habe befürchtet, mein Vater könnte ihm einen Schlag auf den Kopf versetzen, und sein altes Haupt würde so starke Stöße wie damals in Armenien nicht mehr aushalten.
Mein Vater schickte nun Sophronia los, das beste Fleisch zu kaufen und ein Festmahl zuzubereiten, da wir nach der Rückkehr von unserem Abenteuer bestimmt Hunger hätten. Er selbst habe auch keinen Bissen mehr herunterbekommen, seit er mein Verschwinden bemerkt habe und ihm klar geworden sei, dass er bei der Erziehung seines Sohnes völlig versagt habe. Er ließ auch seine Freigelassenen, die sich gerade in der Stadt aufhielten, zu dem Mahl einladen, denn auch sie waren meinetwegen in höchster Sorge gewesen.
Mit eigenen Händen wusch mir mein Vater die Wunden aus, bestrich sie mit Wundsalbe und verband sie mit Leinenbinden, obwohl ich meinen blutigen Verband gern noch eine Zeit lang zur Schau getragen hätte. Barbus bot sich die Gelegenheit, von dem Löwen zu erzählen, sodass meinem Vater angst und bange wurde und er nur noch mehr sich selbst die Schuld an allem gab, da sein Sohn lieber den Tod im Rachen des Löwen gesucht hatte als sich seinem Vater anzuvertrauen, damit dieser die Folgen seiner kindlichen Streiche aus dem Wege räumte.
Schließlich wurde Barbus vom vielen Reden durstig und ließ uns beide allein. Mein Vater wurde ernst und sagte, es sei nun an der Zeit, mit mir über meine Zukunft zu sprechen, da ich bald die Mannestoga anlegen würde. Jedoch falle es ihm schwer, die richtigen Worte zu finden, weil er sich mit mir nie so unterhalten habe, wie es zwischen Vater und Sohn üblich sei. So sah er mich denn mit unruhigen Blicken an und suchte vergebens nach den richtigen Worten, mit denen er mich erreichen könnte.
Auch ich blickte ihn an und sah, dass sein Haar schütter geworden war und sich Furchen in sein Gesicht eingegraben hatten. Mein Vater war dem fünfzigsten Geburtstag inzwischen näher als dem vierzigsten, und in meinen Augen war er ein alternder, einsamer Mann, der sich seines Lebens ebenso wenig freuen konnte wie an den Reichtümern seiner Freigelassenen. Ich warf einen Blick auf seine Buchrollen, und zum ersten Mal fiel mir auf, dass es in seinem Zimmer keine einzige Götterstatue gab, ja nicht einmal das Abbild eines Schutzgeistes. Mir kamen die bösen Anschuldigungen in den Sinn, die Timaios ausgestoßen hatte.
»Marcus, mein Vater«, sagte ich, »mein Lehrer Timaios hat vor seinem Tod hässliche Worte über dich und meine Mutter gesagt. Nur deshalb schlug ich ihm ins Gesicht. Nicht, dass ich meine schlimme Tat verteidigen wollte, aber erzähl mir doch endlich einmal davon, wie das war mit meiner Mutter und dir. Ich habe das Recht, alles zu wissen, selbst wenn es etwas Schlimmes sein sollte. Wie könnte ich sonst als Mann Verantwortung für mich und mein Handeln übernehmen?«
Mein Vater sträubte sich zunächst; er rieb die Hände aneinander und wich meinem Blick aus. Dann sagte er stockend: »Deine Mutter starb bei deiner Geburt, und das konnte ich weder dir noch mir selbst verzeihen, und zwar bis zum heutigen Tage, wo ich in dir zum ersten Male das Abbild deiner Mutter sehe, auch wenn du breitere Schultern hast als sie. Erst als ich fürchtete, dich zu verlieren, ist mein Sehvermögen zurückgekehrt, und ich begriff, dass mir in meinem Leben letzten Endes nicht viel Wertvolles geblieben ist, abgesehen von dir, meinem Sohn Minutus.«
»War meine Mutter Tänzerin, ein leichtsinniges Geschöpf und eine Sklavin, so wie Timaios dies in seiner Bosheit behauptet hat?«, fragte ich geradeheraus.
Mein Vater wurde böse und rief: »Nimm solche Worte nicht noch einmal in den Mund, Minutus. Deine Mutter war eine wertvollere Frau als jede andere, die ich gekannt habe, und sie war gewiss keine Sklavin, auch wenn sie sich aufgrund eines Gelübdes für eine gewisse Zeit dem Dienst an Apollo geweiht hatte. Zusammen mit ihr bin ich in Galiläa und Jerusalem umhergewandert, auf der Suche nach dem König der Juden und seinem Reich.«
Seine Worte verstärkten meinen furchtbaren Verdacht. Mit zitternder Stimme sagte ich: »Timaios sprach davon, du seist in geheime Ränke der Juden verwickelt gewesen, sodass der Statthalter dich aus Judäa habe ausweisen müssen. Deshalb hättest du auch deine Ritterwürde verloren, also nicht nur aufgrund einer Laune von Kaiser Gaius.«
Auch mein Vater begann zu zittern und erklärte: »Ich habe es lange vor mir hergeschoben, dir dies alles zu berichten, bis du lernen würdest, mit deinem eigenen Kopf zu denken. Ich wollte dich ja nicht zwingen, das zu denken, was ich selbst nicht völlig begreife. Irgendeinen Sinn hat deine Erziehung also doch gehabt, denn dank Sophronia hast du die Zuneigung erfahren können, die ich dir nicht zu geben vermochte. Barbus hat dich vor dem Ertrinken gerettet und mich dazu gebracht, zu verstehen, dass du ein Recht darauf hast, zum Römer zu werden. Timaios habe ich gekauft, damit du lernen solltest, die Sinnlosigkeit aller irdischen Götter in dieser zugrunde gehenden Welt zu begreifen und auch die Sinnlosigkeit der Philosophie. Die hat er durch seinen eigenen dummen Tod ja auf das Anschaulichste bewiesen. Davor habe ich dich auf die allgemeine Schule gehen lassen, damit du andere Kinder kennenlerntest. Auch ein Pferd gab ich dir, denn nach Recht und Gesetz bist du schließlich von altem römischem Ritteradel. Doch jetzt bist du an einem Scheideweg angelangt, und du musst selbst entscheiden, welchen Weg du einschlägst. Ich kann nur voller Schmerz die Hände ringen und hoffen, dass du die richtige Wahl triffst. Ich kann dich zu nichts zwingen, weil ich dir nur Unsichtbares anzubieten habe, das ich selbst nicht verstehe.«
»Vater«, versetzte ich erschrocken, »du hast doch nicht etwa heimlich den jüdischen Glauben angenommen, wo du dich so viel um jüdische Angelegenheiten kümmerst?«
»Aber Minutus«, sagte mein Vater verwundert, »du bist mit mir im Bad gewesen und hast mit mir im Gymnasium Leibesübungen betrieben. Dabei hast du doch wohl selbst gesehen, dass mein Körper nicht das Zeichen ihres Bundes aufweist. Schließlich hätte ich mich sonst im Bad lächerlich gemacht.«
»Ich verhehle nicht«, fuhr er fort, »dass ich viel in den heiligen Schriften der Juden gelesen habe, um sie besser zu verstehen. Aber sonst hege ich eher Groll gegen sie, weil es gerade Juden waren, die ihren König gekreuzigt haben. Auch wegen des traurigen Todes deiner Mutter habe ich den Juden gegrollt, ja sogar ihrem König, der am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und ein unsichtbares Reich gegründet hat. Seine jüdischen Jünger glauben zwar, dass er gewissermaßen von einem Tag auf den anderen zurückkehren kann, um ein sichtbares Reich zu gründen, aber das alles ist sehr kompliziert und widerspricht dem gesunden Menschenverstand, und ich kann es dir nicht erklären. Deine Mutter wäre dazu eher in der Lage gewesen, denn als Frau verstand sie von diesem Reich mehr als ich. Ich begreife immer noch nicht, warum sie deinetwegen sterben musste.«
Ich begann am Geisteszustand meines Vaters zu zweifeln und dachte daran, dass er sich in allen Dingen anders verhielt als die Menschen sonst. So fragte ich erregt: »Du hast also doch mit den Juden Blut getrunken bei ihren abergläubischen Geheimriten?«
Da wurde mein Vater sehr ärgerlich und verteidigte sich: »Diese Dinge verstehst du nicht, weil du nichts davon weißt.«
Aber er öffnete die mit einem Schlüssel verschlossene Truhe, nahm einen abgenutzten hölzernen Becher heraus, hielt ihn zärtlich in seinen Händen, zeigte ihn mir und sagte: »Dies ist der Becher deiner Mutter Myrina. Aus diesem Becher haben wir gemeinsam in einer mondlosen Nacht auf einem Berg in Galiläa die Arznei der Unsterblichkeit getrunken. Und der Becher wurde nicht leer, so viel wir auch daraus tranken. Uns erschien auch der König und sprach mit jedem von uns, obwohl wir mehr als fünfhundert Menschen waren. Deiner Mutter sagte er, sie würde nie mehr in ihrem Leben dürsten. Ich wiederum versprach seinen Jüngern danach, dass ich nie zu jemandem darüber sprechen und keinem ihre Lehre enthüllen würde, denn sie waren der Meinung, das Reich sei nur für die Juden bestimmt, und ich als Römer hätte keinen Anteil daran.«
Mir wurde klar, dass ich den verzauberten Becher vor mir sah, den Timaios als den Becher der Fortuna bezeichnet hatte. Ich nahm ihn in die Hand, doch war er in meiner Hand und in meinen Augen nichts als ein abgenutzter Holzbecher, auch wenn es mich rührte, dass meine Mutter ihn in den Händen gehabt und in Ehren gehalten hatte. Ich sah meinen Vater mitleidig an und sagte:
»Ich kann dich für deinen Aberglauben nicht tadeln, denn die Zauberei der Juden hat schon so manchem den Kopf verdreht, der klüger ist als du. Zweifellos hat dir dieser Becher Erfolg und Reichtümer verschafft, aber von Unsterblichkeit will ich lieber nicht reden, um dich nicht zu verletzen. Und wenn du von einem neuen Gott sprichst, so sind auch früher schon Götter gestorben und wieder auferstanden, so wie Osiris und Tammuz und Attis und Adonis und Dionysos, von anderen ganz zu schweigen. Das sind aber alles nur gleichnishafte Märchen, die von denen in Ehren gehalten werden, die in die geheimen Riten eingeweiht sind. Gebildete Menschen trinken doch kein Blut, und von Geheimriten aller Art habe ich wegen der dummen Mädchen, die irgendwelche Büsche mit bunten Bändern behängen, die Nase voll.«
Mein Vater schüttelte den Kopf, presste die Hände aneinander und klagte: »Oh, könnte ich dich nur dazu bringen, es zu verstehen!«
»Ich verstehe nur allzu gut, obwohl ich nur ein Knabe bin«, versicherte ich ihm. »Das eine oder andere weiß ich auch, schließlich bin ich in Antiochia aufgewachsen. Du sprichst von einem Chrestus oder Christus. In diesem neuen Aberglauben liegt noch viel mehr Schande und Verderbnis als in den übrigen Lehren der Juden. Er wurde zwar ans Kreuz genagelt, aber ein König war er nicht, und er ist auch nicht von den Toten auferstanden, sondern seine Jünger stahlen seinen Leichnam aus dem Grab, damit sie in den Augen des Volkes nicht jegliches Ansehen verlören. Überhaupt lohnt es sich nicht, viele Worte über ihn zu verschwenden. Die Juden reden ja schon genug.«
Aber mein Vater widersprach mir: »Doch, er war wirklich ein König. So besagte es auch eine Inschrift an seinem Kreuz in drei Sprachen. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Wenn du nicht den Juden glaubst, dann glaub wenigstens dem römischen Statthalter. Und seine Jünger haben auch nicht seinen Leichnam gestohlen, obwohl der oberste Rat der Juden die Wachleute bestach, damit sie das behaupteten. Ich weiß das alles, weil ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Ich bin dem Auferstandenen auch begegnet, am Ostufer des Galiläischen Meeres, jedenfalls glaube ich noch immer, dass er es war. Er war es, der mich dazu brachte, deine Mutter zu finden, die damals in der Stadt Tiberias in großen Schwierigkeiten steckte. Seit diesen Ereignissen sind zwar sechzehn Jahre vergangen, aber ich kann mir immer noch alles lebhaft in Erinnerung rufen, wenn du mich durch dein Unverständnis zornig machst.«
Ich wollte meinen Vater nicht unnötig aufregen. »Ich habe nicht vor, mich mit dir über göttliche Dinge zu streiten«, beeilte ich mich zu sagen. »Es gibt nur eine einzige Sache, die ich wissen will. Kannst du nach Rom zurückkehren, wann immer du willst? Timaios hat behauptet, du könntest wegen deiner Vergangenheit nie wieder nach Rom zurück.«
Mein Vater richtete sich auf, runzelte die Stirn, sah mir streng in die Augen und sagte: »Ich bin Marcus Mezentius Manilianus, und natürlich kann ich nach Rom zurückkehren, wann ich will. Ich befinde mich durchaus nicht im Exil, und Antiochia ist auch kein Verbannungsort, so viel sollte dir wenigstens klar sein. Aber ich hatte meine persönlichen Gründe, nicht nach Rom zurückzukehren. Jetzt könnte ich zwar schon zurückgehen, falls es nötig sein sollte, weil ich ein gewisses Alter erreicht habe und nicht mehr so empfindlich auf äußere Einflüsse reagiere wie ein Jüngling. Nach den Gründen zu fragen, kannst du dir sparen. Du würdest sie sowieso nicht verstehen.«
Ich war sehr erleichtert über seine Worte und rief aus: »Du sprachst von einem Scheideweg und von meiner Zukunft, die ich selbst wählen müsste. Was meintest du damit?«
Mein Vater wischte sich unentschlossen über die Stirn, wägte sorgfältig seine Worte und meinte schließlich: »Zurzeit wird hier in Antiochia jenen, die eine genauere Vorstellung von diesem Weg haben, allmählich klar, dass das Reich nicht nur ein Reich der Juden ist. Ich vermute, oder um ganz ehrlich zu sein, ich weiß, dass sie auch unbeschnittene Griechen und Syrer getauft und zu ihren Mahlfeiern zugelassen haben. Das hat viel Streit verursacht, aber zurzeit wirkt hier auch ein Jude aus Zypern, dem ich selbst schon in Jerusalem begegnet bin, als der Geist über sie kam. Er hat einen Juden aus Tarsus namens Saulus zu seinem Gehilfen gemacht. Auch ihn habe ich schon einmal gesehen, und zwar seinerzeit in Damaskus, als er in die Stadt gebracht wurde. Er hatte aufgrund einer göttlichen Erscheinung sein Augenlicht verloren, bekam es aber später wieder zurück. Wie auch immer, ich will mich jetzt nicht näher über ihn äußern; jedenfalls ist er ein Mann, den man gesehen haben sollte. Es ist mein größter Wunsch, dass du diese beiden Männer einmal besuchst und dir ihre Lehre anhörst. Wenn sie dich überzeugen können, werden sie dich durch die Taufe als Untertan in das Reich Christi aufnehmen, und du darfst an ihren heimlichen Mahlfeiern teilnehmen. Also ohne beschnitten zu sein, und du brauchst auch nicht zu befürchten, das jüdische Gesetz befolgen zu müssen.«
Ich glaubte, ich hätte mich verhört, und rief: »Wünschst du dir tatsächlich, ich sollte mich in die geheimen Riten der Juden einweihen lassen, um irgendeinem gekreuzigten König oder einem Reich zu dienen, das es gar nicht gibt? Oder wie soll ich das sonst ausdrücken, was man nicht sehen kann?«