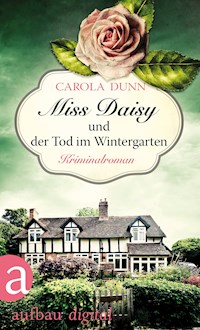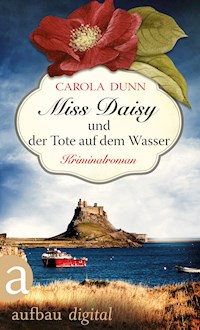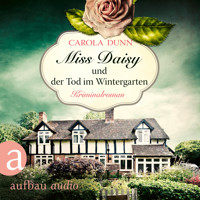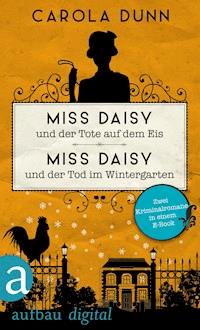7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Miss Daisy ermittelt
- Sprache: Deutsch
Anonyme Briefe für Lord John. Ob sich Miss Daisy da nicht überschätzt hat? Ihr Schwager Lord John hat sie gebeten herauszufinden, wer ihm seit einiger Zeit diese kompromittierenden anonymen Briefe ins Herrenhaus von Oakhurst schickt. Zu Anfang kommt sie ausgesprochen gut voran mit ihren Ermittlungen, doch dann entdeckt sie eines Nachmittags auf dem Friedhof eine Leiche, erschlagen von einem Granitengel. War es ein Unfall oder gar Mord? Und führt die Spur zu dem treuherzigen Landpfarrer, dem eleganten Arzt oder den frömmelnden Damen in ihren viktorianischen Villen? Ein neuer Fall für die junge, charmante Miss Daisy und ihren Verlobten Alec Fletcher von Scotland Yard. "Miss Daisy hat all das, was auch den Charme der Miss Marple- oder Hercule Poirot-Stories ausmacht." Westdeutsche Allgemeine.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über Carola Dunn
Carola Dunn wurde in England geboren und lebt heute in Eugene, Oregon. Sie veröffentlichte in den USA mehrere historische Romane, bevor sie die »Miss Daisy«-Serie zu schreiben begann.
Folgende Titel liegen vor:
Miss Daisy und der Tote auf dem Eis
Miss Daisy und der Tod im Wintergarten
Miss Daisy und die tote Sopranistin
Miss Daisy und der Mord im Flying Scotsman
Miss Daisy und die Entführung der Millionärin
Miss Daisy und der Tote auf dem Wasser
Miss Daisy und der tote Professor
Miss Daisy und der Tote auf dem Luxusliner
Informationen zum Buch
Anonyme Briefe für Lord John
Ob sich Miss Daisy da nicht überschätzt hat? Ihr Schwager Lord John hat sie gebeten, herauszufinden, wer ihm seit einiger Zeit diese kompromittierenden anonymen Briefe ins Herrenhaus von Oakhurst schickt. Zu Anfang kommt sie ausgesprochen gut voran mit ihren Ermittlungen, doch dann entdeckt sie eines Nachmittags auf dem Friedhof eine Leiche, erschlagen von einem Granitengel. War es ein Unfall oder gar Mord? Und führt die Spur zu dem treuherzigen Landpfarrer, dem eleganten Arzt oder den frömmelnden Damen in ihren viktorianischen Villen?
Ein neuer Fall für die junge, charmante Miss Daisy und ihren Verlobten Alec Fletcher von Scotland Yard.
»Miss Daisy hat all das, was auch den Charme der Miss Marple- oder Hercule Poirot-Stories ausmacht.« Westdeutsche Allgemeine
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Carola Dunn
Miss Daisy und der tote Professor
Roman
Aus dem Englischen von Kirk Gerald
Inhaltsübersicht
Über Carola Dunn
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Epilog
Impressum
Prolog
Der Befehl kam, als sich im Osten die Morgendämmerung ankündigte. Die murrenden Männer verstummten, als sie aus dem modrigen, stinkenden Graben krochen – ihrer notdürftigen Zuflucht in den letzten beiden Tagen. Tief gebückt rannten sie mit aufgepflanzten Bajonetten durch den Nebel über das Niemandsland auf den unsichtbaren Feind zu.
Die Vordersten legten zwanzig Yards zurück, ehe die Mine hochging. Der halbe Zug verschwand bei der Explosion in Flammen, Dreck und Blut.
Der Geistliche schluckte ein trockenes Schluchzen hinunter und stolperte auf die nächsten Schreie zu. Grenadier Harvey ›Enry‹ Arvey –, ein Cockney-Depp, der immer ein fröhliches Wort für einen deprimierten Kumpel übrig hatte, der den jungen verdutzten Rekruten zeigte, wo’s langgeht, und der auf seine irgendwo in den Midlands in einer Munitionsfabrik arbeitende Frau stolz war, auf die Jungen, zwei für immer lädierte Photographien …
Henry Harvey, ohne Beine, verblutete fern der Heimat.
Der Geistliche kniete nieder. Als die schweren Geschütze zu feuern begannen, bebte unter ihm die Erde. Mit Harveys schlaffer Hand in der seinen betete er laut. Still verfluchte er den Herrn.
1
»Schätzchen, ich wünschte, ich könnte. Aber Johnnie hat mich zum Lunch eingeladen, und er wird jeden Moment hier sein.«
»Johnnie?« Der eifersüchtige Ton in Alecs Stimme klang durch den Draht bis an Daisys Ohr.
Mit einem kleinen selbstgefälligen Lächeln erklärte sie: »Johnnie Frobisher – Lord John – mein Schwager.«
»Oh, Lady Johns Johnnie.« Seine Erleichterung war offenkundig, obgleich er etliche Meilen weit weg war, im New Scotland Yard.
»Lady Johns Johnnie!« lachte Daisy. »Ich weiß, sie hat dich sicher gebeten, sie Violet zu nennen, Schatz. Egal, jedenfalls ist er heute in der Stadt und hat mich zum Lunch eingeladen.«
»Ins Ritz vermutlich oder ins Savoy«, sagte Alec trübsinnig. Das Gehalt eines Detective Chief Inspectors vertrug keine Lunchs im Ritz.
»Schätzchen, du weißt, ich würde lieber mit dir im Lyons’ Corner House ein Welsh Rarebit essen, aber woher sollte ich wissen, daß du heute Zeit hast? Oh, es klingelt an der Tür, ich muß rennen.« Sie wandte sich um und rief die Treppe hinunter zur Putzfrau in der Küche im Souterrain: »Ich geh schon, Mrs. Potter! Alec, ich ruf dich heute abend von zu Hause an. Bis da-a-nn, mein Lieber.«
Sorgfältig hängte Daisy den Hörer des nagelneuen Telephons ein, das sie und Lucy sich erst vor einer knappen Woche geleistet hatten. Lucy hatte den kompletten Anschluß zu ihrem Photoatelier in den alten, zu Wohnquartieren umgebauten Remisen bezahlt. Es befand sich hinter der schmukken Wohnung, die sie sich teilten, aber Daisys Anteil an den allgemeinen Kosten war noch hoch genug. Sie lebten wieder genügsam von Eiern, Käse und Sardinen; da kam ein Essen in einem guten Restaurant gerade richtig.
Wie dem auch sei, so sehr sie Johnnie mochte, sie hätte lieber mit Detective Chief Inspector Alec Fletcher gespeist. Seit dem wunderbaren Wochenende im New Forest hatte sie ihren Verlobten kaum zu Gesicht bekommen.
In diese Erinnerungen versunken, starrte sie in den Spiegel über dem Flurtisch, und das kleine selbstgefällige Lächeln kehrte zurück. Sie richtete den blauen, mit weißen Rosen bekränzten Strohhut auf ihren honigbraunen, kurzgeschnittenen Locken. Der Hut paßte zur Farbe ihrer Augen, die Alec bei schlechter Laune als »irreführend harmlos« zu beschreiben pflegte, doch wenn er milder gestimmt war, wählte er schmeichelhaftere Worte.
Daisy trug ein Leinenkostüm in einem dunkleren Blauton, weiß paspeliert. Ziemlich schick, fand sie, wenn sie nur eine elegante jungenhafte Figur hätte. Von den geraden Linien und dem auf den Hüften sitzenden Gürtel konnte man nicht sagen, daß sie ihr standen.
Als sie die Nase über ihre runden Kurven rümpfte, die Alec für so herrlich knuddelig hielt, bemerkte sie drei Sommersprossen. Auf dem Lande kein Problem, aber in der Stadt inakzeptabel; schnell tupfte sie etwas Puder darauf. Den kleinen Leberfleck an ihrem Mundwinkel zu verbergen hatte sie aufgegeben, seit ihr Alec erzählt hatte, daß man ein Schönheitspflästerchen im achtzehnten Jahrhundert neckisch als »Küßchen« bezeichnet hatte.
Mit einem Seufzer bedauerte sie, daß Johnnie sie ausgerechnet an einem der wenigen Tage zum Lunch eingeladen hatte, an denen sich Alec zur Mittagszeit vom Yard verdrücken konnte.
Während sie zur Vordertür ging, zog sie sich die Handschuhe an. Als sie öffnete, stieß sie auf eine Hitzewand wie von einem Schmelzofen. Selbst hier in Chelsea stank die Großstadtluft nach vor sich hin schmorendem Asphalt und Abgasen.
»Der reinste Backofen, nicht?« begrüßte sie Johnnie.
Wie Alec war er Mitte Dreißig und mittelgroß, aber – im Gegensatz zu Alec – schmächtig und blond. Er war makellos gekleidet, ein hellgrauer Straßenanzug im unverkennbaren Schnitt der Savile Row. Nur das sonnengebräunte Gesicht verriet den Gentleman vom Lande, der für diesen Tag in die Stadt gekommen war. Von der braunen Haut hob sich die weiße Linie einer von der Kinnlade bis zur Stirn hochführenden Narbe scharf ab. Ansonsten war sein hervorstechendstes Merkmal die Nase, die in seiner Familie von einer Generation zur anderen vererbt wurde.
Mit dem weichen Hut fächelte er sich Luft zu. »Puh!«
»Ganz furchtbar!« stimmte Daisy zu. »Was in aller Welt zog dich an so einem Tag vom tiefsten Kent weg, wo es in euren Obstgärten jetzt himmlisch sein muß?«
Ein Hauch von Röte färbte Johnnies Wangen. »Oh, äh, Geschäfte«, meinte er verlegen, und während er Daisy in seinen kastanienbraunen Sunbeam-Tourenwagen half, fügte er noch rasch hinzu: »Ich dachte, wir fahren nach Belgravia, das ist eine passable Gegend und liegt am nächsten. Soll ich das Verdeck schließen, wegen der Sonne?«
»Nein, danke. Da ersticken wir doch.«
Die Höflichkeit verbot es zu fragen, welche Art von Geschäften ihn so nervös wie einen Grashüpfer herumhopsen ließen, aber das konnte Daisy nicht daran hindern, sich zu wundern. Sie hoffte, er steckte nicht in finanziellen Schwierigkeiten wie so viele Landwirte in jenen Tagen. Sein ältester Bruder, der Marquis, war ungeheuer reich, aber Johnnie würde ihn unter keinen Umständen bitten, ihm unter die Arme zu greifen.
Vielleicht würde er beim Lunch der Verführung ihrer arglosen Augen erliegen und beichten, was los war. Daisy hatte nie richtig begriffen, warum sich die Leute, selbst absolut fremde, ihr anvertrauten, aber sie taten es.
Als er Richtung Belgravia Hotel fuhr, erkundigte sie sich nach Vi und den Jungen.
»Ich dachte, du hast mit ihr gesprochen, seit du das Telephon hast legen lassen.«
»Das ist doch fast eine Woche her!« Über sein typisch männliches Unverständnis für das weibliche Mitteilungsbedürfnis mußte sie den Kopf schütteln. Zweifellos hörte er von seinen Brüdern nur bei einer Geburt, einer Hochzeit oder einem Todesfall.
»Um die Wahrheit zu sagen – versprich mir, daß du nichts Lady Dalrymple erzählst!«
»Großes Ehrenwort«, antwortete Daisy sofort. »Mutter erzähle ich nie etwas, wenn ich nicht unbedingt muß.«
»Violet möchte nicht, daß sie es schon erfährt«, sagte Johnnie, wobei er puterrot wurde, »aber sie hat gerade festgestellt …, äh, daß sie noch ein Baby kriegt.«
»Wunderbar! Gratuliere. Zumindest ist sie nicht krank, nicht wahr? Ist es das, was dir Sorgen macht?«
»Nein, nein, im Augenblick scheint es ihr gutzugehen. Aber es gibt einen anderen Grund, warum … Nun, das kann warten. Wie kommst du mit dem Schreiben voran, Daisy?«
Die Andeutung, daß er alles noch vor ihr ausbreiten würde, brachte Daisy dazu, ihre Neugier, ihre größte Sünde, zu zügeln. Sie berichtete Johnnie von dem Artikel über prächtige Herrenhäuser, den sie gerade für die Zeitschrift Town and Country fertiggestellt hatte, und jenen über das London Museum, den sie für ihren amerikanischen Verleger nun in Angriff nehmen wollte.
Johnnie warf ein »Wirklich?« und ein »Interessant!« ein, aber sie vermutete, daß er ihr gar nicht zugehört hatte.
Um das zu überprüfen, brabbelte Daisy nun aus Spaß einen Nonsens-Vers von Lewis Carroll vor sich hin. Dann bog der Sunbeam in Grovesnor Gardens ein.
»Das hört sich alles ganz faszinierend an. Da sind wir ja schon.« Ihr Schwager hielt vor dem Hotel.
Was war eigentlich los?
Johnnie riß sich sehr zusammen, um mit dem livrierten Portier und Maître d’hôtel zu verhandeln. Man wies ihnen einen Tisch in einer ruhigen Ecke zu. Im Restaurant war nicht viel los, da jeder, der nicht verrückt war und es sich leisten konnte, aus der Stadt geflohen war.
Johnnie blickte flüchtig in die Karte und fragte: »Daisy, was möchtest du? Sie haben sehr gute Austern à la Rockefeller. Der amerikanische Einfluß breitet sich wohl überall aus, nehme ich an.«
»August hat kein ›R‹«, betonte Daisy. »Da ißt man keine Austern. Du bist zerstreut.«
»Tut mir leid«, entschuldigte er sich kleinlaut.
»Glücklicherweise mache ich mir sowieso nicht viel aus Austern. Als erstes etwas Kaltes, bitte. Vielleicht Melone, oder gibt es auch Consommé Madrilène?«
Mit sichtlicher Mühe wandte sich Johnnie der Speisekarte zu. Daisy lehnte einen Cocktail ab, da sie davon immer müde wurde und am Nachmittag noch etwas arbeiten wollte. Sie entschied sich für eisgekühlte Brühe, der dann Seezunge Colbert, Hühnchen Mireille und Pfirsich Melba folgen sollten. Johnnie bat ganz geistesabwesend um eine Scheibe vom Braten.
»Ich werde wohl eine ganze Woche lang nicht mehr essen müssen«, sagte Daisy, als der Kellner mit der Bestellung verschwand. »Wie kann man nur einem Essen seinen Namen geben? Melba geht natürlich auf Lady Nellie zurück, aber wer war Colbert?«
John zwinkerte vergnügt zu ihr hinüber.
»Egal! Vielleicht bekomme ich etwas darüber heraus; das könnte einen unterhaltsamen Artikel abgeben.« Sie lehnte sich vor. »Jetzt aber, Johnnie, jetzt sag mir, was los ist.«
»Nun, es ist … ich … Nein, ich möchte dir nicht das Essen verderben. Warte bis zum Kaffee damit. Meinst du nicht, daß wahrscheinlich alle Gerichte nach ihren Erfindern benannt wurden?«
»Ja, wahrscheinlich. So was Dummes! Die Austern Rockefeller heißen wohl so nach dem Millionär, nicht wahr? Und ich glaube, Madrilène kommt von Madrid.« Daisy nahm sich die Freiheit, um abzuschweifen, auch wenn sie nun langsam unruhig wurde wegen der Neuigkeiten, die angeblich so schlecht ausfielen, daß sie beinahe ein so göttliches Mahl bedrohten.
Wenn es Violet gutging, war Johnnie dann womöglich krank? Hatte man ihm nur noch sechs Monate zu leben gegeben, oder war etwas ähnlich Schreckliches passiert? Wollte er, daß Daisy die Nachricht Vi überbrachte? Mein Gott, es war einfach nicht zum Aushalten!
Er wirkte nicht krank, eher nur von Sorgen geplagt. Seine tapferen Versuche, zur Unterhaltung beizutragen, endeten einzig in Schweigen, und in seinem Essen stocherte er nur herum. Daisy zwang sich, jeden köstlichen Happen zu genießen, wozu sie sich sowohl körperlich als auch mental ein wenig überreden mußte. Johnnie schob seinen Braten und die französischen Bohnen auf dem Teller herum. Von seinem Pfirsich Melba kostete er nicht einmal, obwohl die Pfirsiche und die Himbeeren frisch und nicht aus der Dose waren und einfach himmlisch schmeckten.
»Werden Sie den Kaffee im Salon einnehmen, Sir?«
Johnnie blickte zu Daisy hinüber, die den Kopf schüttelte, denn sie ging davon aus, daß es einfacher war, hier an ihrem Tisch ein ernsthaftes Gespräch zu führen. Da sie an nicht mehr als nur einen kleinen Imbiß zum Mittag gewöhnt war, hatten die vielen Speisen den gleichen Effekt wie ein Cocktail. Sie fürchtete, der verlockenden Bequemlichkeit der Sessel des Salons zu erliegen und einzuschlafen.
Der Kaffee kam. Der Kellner entfernte sich wieder. »Gut«, sagte Daisy, »komm endlich zur Sache.«
Johnnie wich geschickt ihrem Blick aus und sagte: »Nun, nach allem, ich glaube nicht …«
»Jetzt kneif nicht! Du kannst mich nicht länger auf die Folter spannen und zusehen, wie ich mir alle möglichen schrecklichen Dinge ausmale. Deine … hatten deine Geschäfte hier in London etwas mit der Harley Street zu tun?«
»Harley Street?« Bestürzt sah er in ihre besorgten Augen, und da konnte er nicht länger an sich halten. »Aber nein, keine Ärzte, ich bin so gesund wie ein Pferd. Daisy, Violet hat mir höchst außergewöhnliche Dinge über dich berichtet, wie du hier und da Mördern auf die Spur kommst und Entführer dingfest machst und so weiter.«
»Na ja«, sagte Daisy vorsichtig, die nun ganz wach war. »Ich habe Alec ab und zu geholfen, Fälle aufzuklären, auch wenn es ihm schwerfällt, das zuzugeben.«
»Ich brauche Hilfe«, platzte es aus Johnnie heraus. »Kannst du nicht ein paar Tage nach Oakhurst runterkommen? Violet würde keinen Verdacht schöpfen, wenn du mal aus der Stadt raus wolltest. Vielmehr wäre sie ganz entzückt, wenn du kommst und ein bißchen bleibst. Und vielleicht gestattet dir Fletcher, seine kleine Tochter mitzubringen. Auf eurer Verlobungsfeier haben sie und Derek sich auf Anhieb ganz prächtig vertragen. Sind im gleichen Alter, oder? Violet sagte neulich, daß es nicht gut sei, wenn ein Kind in der Sommerhitze in der Stadt festsitzt.« Mit einem Gefühl des Triumphs lehnte er sich zurück.
Aber Daisy lenkte ihn unbarmherzig wieder auf sein eigentliches Anliegen. »Alles schön und gut, und ich glaube schon, daß Belinda ganz begeistert wäre, aber welche Art Hilfe brauchst du denn nun? Geht es um irgendwelche Ermittlungen? Ich bin kein Privatdetektiv, wie du weißt. Alec ist der Kriminalbeamte.«
»Auf keinen Fall die Polizei! Das hat nichts mit der Polizei zu tun. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es ein Verbrechen ist, und ich möchte auf keinen Fall, daß noch eine andere Person davon erfährt. Also …«
»Wovon erfährt?«
Johnnie zog an seiner plötzlich viel zu engen Harrow-Krawatte. Wieder überströmte ein Schimmer von Röte das sonnengebräunte Gesicht, so daß sich die bisher im diffusen Licht des Innenraumes kaum sichtbare Narbe abzeichnete. »Nun, äh …«
»Ich muß wissen, in welchem Fall ich ermitteln soll, Johnnie! Da ich eigentlich gerade jetzt kaum Zeit zur Verfügung habe, ist es schon in Ordnung, du mußt mir nicht gleich alles offenbaren.« Daisy trank die Tasse bis zum letzten Tropfen aus und wollte sich die Handschuhe überstreifen.
»Nein, bitte.« Er streckte eine Hand über den Tisch. »Ich muß es jemandem erzählen, sonst werde ich noch verrückt, und du bist der einzige Mensch, dem ich es anvertrauen kann und der mir vielleicht einen praktischen Rat gibt. Folgendes – ich erhalte ganz entsetzliche anonyme Briefe – ich glaube, unsere Vettern in Übersee nennen so etwas ›Verleumdungspost‹.«
»Du lieber Himmel!« rief Daisy aus und fügte aufrichtig hinzu: »Ich kann mir gar nicht vorstellen, daß es auf der Welt etwas gibt, womit man dich erpressen könnte.« Auch wenn sie Johnnie mochte, und er paßte sehr gut zu ihrer Schwester, so hatte sie ihn doch immer für einen kleinen Langweiler gehalten.
»Es geht nicht eigentlich um Erpressung. Jedenfalls noch nicht, auch wenn ich vermute, daß es eines Tages darauf hinausläuft. Im Augenblick werden noch keine Forderungen gestellt, außer der Aufforderung zu bereuen und nicht mehr zu sündigen. Aber man kann doch nicht mit etwas aufhören, was man ein einziges Mal vor vielen Jahren getan und auf der Stelle bereut hat.«
»Schwierig, ja. Und worum geht es?«
Johnnie wurde blaß. »Mußt du es denn wirklich wissen?«
»Ich nehme an, du willst, daß ich den ominösen Briefeschreiber finde. Wie soll ich der Sache nachgehen, wenn ich die Briefe nicht einmal gesehen habe und nicht weiß, was dahintersteckt?«
»Also kommst du dann?« fragte er ungeduldig.
»Ich bin nicht sicher. Vielleicht kann ich es einrichten. Aber ich müßte Einblick in diese üblen Zuschriften nehmen. Wenn du also nicht willst, daß ich aus den Briefen direkt von deinen bösen Taten – verzeih, von deiner bösen Tat – erfahren soll, mußt du sie mir lieber selber beichten.«
»Ja.« Seine Schultern sackten zusammen. »Ja, du hast recht. Aber zu Violet oder Fletcher kein Wort. Versprich es.«
»Ich verspreche es.«
»Ich möchte nicht, daß du glaubst, ich wolle mich entschuldigen, aber ich will dir die Umstände erläutern.«
»Dann mal los«, sagte Daisy.
Das Feldlazarett war im Herbst 1917 vollgestopft mit Verwundeten von der dritten Schlacht von Ypern – Wipers, wie die anderen Mannschaften die ruinenartigen Überreste der belgischen Stadt sarkastisch nannten, da man sie beinahe dem Erdboden gleichgemacht hatte. Von kompakten Bunkern aus, die von einem Schlamm-Meer umgeben waren, hatten die Boches aus Maschinengewehren und mit Senfgas auf die im Sumpf steckengebliebenen britischen Truppen losgefeuert, um sie zu Hunderttausenden auszulöschen.
Erschöpfte Ärzte nähten und amputierten und evakuierten jene, die hinter den Linien überlebt hatten, so schnell wie es die verfügbaren Transporte erlaubten. Nicht weniger überfordert, säuberte man in den Lazaretten den menschlichen Abfall, der zu ihnen geschickt worden war, und sah hilflos zu, wie die Patienten in Scharen an Infektionen und vom Gas zerfressenen Lungen starben.
Natürlich erhielt Major Lord John Frobisher die bestmögliche Behandlung. Noch der kleinste Granatsplitter wurde aus seinem Körper herausgeschnitten. Für die grob zusammengeflickte Wunde in seinem Gesicht konnte man nichts weiter tun, als sie sauberzuhalten.
Per Schiff wurde er zur Rekonvaleszenz nach England geschickt, seine Wange war immer noch ganz geschwollen, der tiefe Riß war ein schauderhaftes rotes Brandmal.
»Es hat mir nicht viel ausgemacht, solange ich mit den Männern zusammen war«, erklärte ihr Johnnie. »Es schien mir ganz egal zu sein, da es so viele Verwundete gab, die weitaus schlechter dran waren als ich. Dann legte das Schiff in Dover an, und all die anderen begaben sich auf den Truppentransport nach London. Ich nahm den Regionalzug nach Oakhurst.«
»Vi und das Baby waren in Worcestershire«, sagte Daisy, »bei uns zu Hause auf Fairacres.«
»Ja, aber ich war müde und kaputt, stand unter Anspannung, taugte für die zivilisierte Gesellschaft einfach nicht. Ich benötigte ein, zwei Tage, um mich wieder aufzuraffen, ehe ich Violet sehen wollte. Ich hatte das Gefühl, daß ich sie kaum kannte – wir waren erst ein Jahr verheiratet, wie du dich erinnern wirst, als ich nach Frankreich ging, und ich war seitdem nur vierzehn Tage auf Urlaub gewesen.«
»Den du auf Fairacres verbracht hast«, erinnerte sich Daisy. »Und Derek hatte solche Angst vor dem Fremden, der behauptete, sein Vater zu sein, und Violet mußte sich allein um ihn kümmern, da die Hälfte der Männer eingezogen war und nun die Dienstmädchen die schwere Männerarbeit verrichten mußten. Und Mutter war ganz Mutter.«
Sie warfen sich einen mitleidvollen Blick zu. Lady Dalrymple, die nun Viscountess-Witwe war, fand immer einen Anlaß, sich zu beklagen. Zu dieser Zeit, schien sich Daisy zu erinnern, litt ihre Mutter unter der Ungerechtigkeit, daß ihr Schwiegersohn auf Urlaub kam, wohingegen man ihren Sohn Gervaise immer noch nicht nach Hause gelassen hatte. Gervaise bekam seine zwei Wochen Urlaub später. Er verbrachte die Hälfte davon in London, ehe er wieder nach Flandern zurückkehrte, in seinen Tod.
Einige der Kriegswunden waren nicht sichtbar, und sie heilten nur langsam.
Daisy schüttelte den Kopf, wollte ihre Erinnerungen abschütteln. »Du hättest gleich nach Fairacres kommen sollen«, sagte sie. »In Kent war es viel zu gefährlich, es liegt viel zu nah am Kontinent und wurde regelmäßig bombardiert. Vater hätte Vi nie nach Oakhurst gehen lassen.«
»Guter Himmel, nein, auf keinen Fall. Lord Dalrymple will ich keine Schuld geben.«
»Aber ich verstehe, daß du zuerst nach Hause wolltest, nach den Feldlazaretten und allem.«
»An jenem Tag hätte ich es beinah nicht geschafft«, sagte Johnnie. »Dreimal umsteigen, und ich bin immer wieder eingeschlafen. Die Züge waren praktisch leer, da man schon die meisten Frauen und Kinder evakuiert hatte. Als ich den Bahnhof von Rotherden erreichte, gab es keine Droschke mehr. Unser Chauffeur war natürlich bei der Armee, aber mich hat auch sonst niemand erwartet. So ließ ich mein Gepäck am Fahrkartenschalter und lief ins Dorf. Der Gasthof Hop-Picker öffnete gerade, und ich ging hinein, um mich für den endlosen Marsch zum Haus hinauf zu stärken.«
»Fast eine Meile vom Bahnhof, und den ganzen Weg bergauf. Und niemand da, der dich mitgenommen hätte«, pflichtete ihm Daisy bei.
»Die Tochter des Gastwirts, Maisy, die ich von klein auf kannte, schrie los, als sie mich sah. Sie riß sich zusammen und bediente mich, aber sie brachte es nicht über sich, mir ins Gesicht zu sehen. Du kannst glauben, was du willst, aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht darüber nachgedacht, wie ich auf Frauen wirken würde. Auf Violet.«
»Oh, Johnnie!«
»Bis dahin hatte ich es immer nur mit Krankenschwestern zu tun gehabt, die viel Schlimmeres gewöhnt waren.« Er betastete seine dünne weiße Narbe. »Jetzt ist sie verblaßt, aber damals war sie scheußlich, geradezu ekelhaft, und ich wußte nicht, wie sie verheilen würde. Rasch trank ich meinen Whisky aus, war froh, daß ich einen doppelten bestellt hatte, da ich nicht die Nerven hatte, einen zweiten zu verlangen. Glücklicherweise regnete es. So stahl ich mich mehr oder weniger durchs Dorf, ohne jemandem zu begegnen. Plötzlich hörte der Regen auf, und die Sonne kam heraus. Gerade als ich am Pfarrhaus vorbeiging. Erinnerst du dich an Rotherden?«
»Ja, natürlich.« Seit Kriegsende war Daisy oft dort gewesen. »Das Pfarrhaus ist gleich neben der Kirche, die sich genau auf der anderen Straßenseite von euren Toren befindet, also warst du in Sicherheit.«
»Das hatte ich auch gedacht.«
Gegenüber dem Pfarrhaus, auf der anderen Seite der Tore des Gärtnerhauses von Oakhurst, stand ein kleines Haus im Queen-Anne-Stil, das mit Schindelbrettern verschalt war und die in der Gegend üblichen Dachziegeln trug. Ein hübsches Anwesen, das ziemlich dicht an der Straße lag, aber nach hinten über einen großen Garten verfügte. Ein oder zwei Jahre vor Ausbruch des Weltkrieges war es von einer kinderlosen Witwe erworben worden. Mrs. LeBeau war damals um die Dreißig und eine attraktive und kultivierte Frau.
John, der frisch verheiratet war und sich in seinem Eheleben eben einrichten und die Verwaltung des Besitzes erlernen wollte, den ihm ein Onkel überlassen hatte, hatte kaum von ihr Notiz genommen.
»Gerade als ich vorbeiging, trat Mrs. LeBeau aus der Tür. Ich wußte, daß sie für gewöhnlich um diese Zeit ihr Haus verließ – irgendwann waren wir miteinander bekannt gemacht worden, und wenn ich mich recht erinnere, so hatte Violet sie ein- oder zweimal zum Vormittagskaffee eingeladen. So eine Art Bekanntschaft war das. Auf jeden Fall begrüßte sie mich und fragte, ob ich auf Heimaturlaub sei. Ich konnte ihr da schlecht ausweichen.«
Er hatte sich umgedreht, um ihren Gruß zu erwidern. Als die nach Westen wandernde Sonne in sein Gesicht schien, mußte sie schlucken.
»Sie Armer, Sie sehen erschöpft aus«, sagte sie. »Werden Sie denn im Herrenhaus erwartet? Lady John ist nicht anwesend, soweit ich weiß. Treten Sie ein, trinken Sie Tee und essen Sie ein paar Kekse, ehe Sie weitergehen. Ich wollte gerade dieses Buch zu Mrs. Molesworth zurückbringen, aber das kann warten.«
Nach dem Scholokadenriegel aus einem Automaten am Bahnhof zum Mittag und einem doppelten Whisky, den er viel zu rasch hinuntergestürzt hatte, sehnte sich John förmlich nach einem Tee, vom Mitgefühl ganz zu schweigen.
»Du wirst schon drauf gekommen sein«, sagte er zu Daisy, »daß ich die Nacht über dort geblieben bin.«
Daisy wußte nicht, was sie sagen sollte. Da sie in dem Boheme-Viertel Chelsea wohnte, hatte sie mit einer Reihe von Leuten zu tun, deren Ehegelübde häufiger übertreten als eingehalten wurden. Sie nahm an, daß es so lange nichts ausmachte, wie es weder Ehemann noch Ehefrau als störend empfanden. Aber es war etwas anderes, wenn ihr Schwager der eigenen Schwester gegenüber untreu gewesen war.
Wie würde es wohl die stille, zurückhaltende und selbstbeherrschte Violet aufnehmen, wenn sie es jemals herausfand?
»Violet darf nichts davon erfahren!« sagte Johnnie in Daisys Schweigen hinein. Er blickte sie irgendwie flehend und herausfordernd zugleich an. »Gerade jetzt. Doch … ich habe dir gesagt, daß ich es sofort bereut habe, aber es war irgendwie nur halbe Reue. Ich war nicht Mrs. LeBeaus erster Liebhaber, seit sie ihren Mann verlor. Also habe ich mir in der Hinsicht nichts vorzuwerfen. Und sie machte mir Mut, Violet mit meiner Verwundung gegenüberzutreten.«
Ohne es zu wollen, mußte Daisy nicken. »Ja, ich verstehe. Es war nur das eine Mal, und du hast keinem davon erzählt?«
»Keiner Menschenseele.«
»Dann muß Mrs. LeBeau die Briefe geschrieben haben.«
»Das hatte ich zuerst auch vermutet, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß sie es wirklich getan hat. Seit Kriegsende habe ich sie häufig auf Gesellschaften getroffen, und nie hat sie auch nur die leiseste Andeutung darüber gemacht. Nicht einmal einen verstohlenen Blick. Außerdem, ganz gleich was du von ihrer Moral hältst, sie ist in anderer Hinsicht eine Lady durch und durch, wohlerzogen und gebildet. Der Stil der Briefe ist schlecht und fehlerhaft, und zudem sind sie noch ziemlich … ziemlich schmutzig.«
»Das könnte vorgetäuscht sein«, führte Daisy an. »Hast du sie wenigstens mitgebracht?«
»Nein. Ich wollte nicht, daß man sie bei mir findet, wenn mich vielleicht ein Bus umfährt«, sagte Johnnie sarkastisch. »Den ersten habe ich verbrannt, aber im August ist es schwer, einen Vorwand dafür zu finden, Dinge zu verbrennen. Die anderen sind zu Hause in meinem Schreibtisch eingeschlossen. Kommst du also?«
Angenommen, der nächste Brief geht direkt an Vi? Daisy seufzte. »Ja, ich werde kommen. Gib mir ein paar Tage, um im London Museum Nachforschungen für einen Artikel anzustellen, den ich dann auf Oakhurst schreiben kann. Jetzt muß ich aber los. Um drei Uhr habe ich eine Verabredung mit dem Kurator.«
»Ich werde dich hinfahren.« Er schob seinen Stuhl zurück und ging um den Tisch, um ihr behilflich zu sein. »Äh, wo liegt das eigentlich? Wenn es um Museen geht, kenne ich mich nicht so aus.«
Sie lachte. »Lancaster House, gleich neben St. James’s Palace. Gar nicht weit weg. Vielen Dank, aber ich spaziere lieber durch die Parkanlagen. Ich brauche die Zeit, um mich ein wenig zu sammeln.« Als sie das Restaurant verließen, fragte Daisy: »War es dein Ernst, was die Einladung von Belinda nach Oakhurst angeht?«
»Aber sicher. Wir würden uns freuen, wenn sie mitkäme.«
»Belindas Großmutter würde es sicher nicht gern sehen, wenn man ihr ›Flausen in den Kopf setzt, die über ihren Stand hinausgehen‹, aber ich bin mir sicher, daß sich Alec freuen wird. Ich überlasse es ihm, Mrs. Fletcher zu überreden. Ich werde anrufen, wenn ich weiß, an welchem Tag und mit welchem Zug wir kommen.«
»Natürlich übernehme ich die Fahrkarten«, sagte Johnnie schroff.
Daisy hielt auf den Stufen des Hotels inne und küßte ihn auf die Wange. »Du bist ein lieber Kerl, Johnnie. Ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen. Mach’s gut! Bis bald.«
»Mach’s gut, Daisy. Oh, übrigens, ich glaube nicht, daß nur ich diese Post bekomme. Lomax hat neulich so eine Andeutung gemacht, aus der ich schließe, daß er ein weiteres Opfer ist.«
Als Daisy in die Buckingham Palace Road einbog, wurde ihr klar, wie dumm die Zusage von ihr gewesen war. Sie stöhnte. Erstens hatte sie nicht die leiseste Ahnung, wie man den Urheber der anonymen Briefe ausfindig machen konnte. Zweitens, wie sollte sie, wenn sie fündig würde, den Übeltäter davon abhalten, die Kavalierssünden der Opfer weiterzuverbreiten?
Mehrere Opfer also. Brigadekommandeur Lomax und wie viele andere Leute noch könnten vielleicht Wert darauf legen, ihren Peiniger unbehelligt davonkommen zu lassen. Womöglich stach Daisy bei der Geschichte in ein ganzes Wespennest!
2
DU BIST EIN HUNDSGEMEINER HÄUCHLER, EIN PHARISEER! DU HAST DEN MUMM, IM RICHTERSTUL ZU SITZEN UND ARME LEUTE WEGEN DIEBSTAHL HINTER GITTERN ZU BRINGEN, UND HAST SELBST MIT EINER HURE VERKEERT.
SCHMUTZIKER EHEBRECHER! DU HAST DEINE FRAU BETROGEN. SCHÜRTZENJÄGER MÜSSEN BESTRAFT WERDEN.
HUREREIH IST EINE SÜNDE. DU GLAUBST, DU BIST DAMIT DAFONGEKOMMEN, ABER DU BIST ERWISCHT WORDEN, UND DU WIRST LEIDEN, DU WIEDERLICHER LÜSTLING.
DEINE AFFAIRE IST BEKANNT. DU KANNST DER GERECHTIKKEIT NICH ENTKOMEN. DU HAST FERDIENT, IN DER HÖLLE ZU SCHMOHREN.
»Das sind sie«, sagte Johnnie, »außer dem ersten. Die Briefumschläge habe ich weggeworfen, aber sie waren alle mit der gleichen Handschrift versehen und abgestempelt im Dorfpostamt. Es tut mir leid, daß ich dich mit solchen Scheußlichkeiten konfrontieren muß. Manchmal habe ich das Gefühl, daß ich das Ganze doch hätte voraussehen müssen, und dann fallen sie mir wieder in die Hände, und …« Verwirrt blickte er sich in der Bibliothek um.
In jenem altehrwürdigen Raum aus dem siebzehnten Jahrhundert waren die primitiven Briefe überraschend fehl am Platze. Zwei Wände wurden gänzlich von Regalen eingenommen. Dort drängten sich die in Kalbsleder gebundenen Folianten nur so; sie waren über Jahrhunderte hinweg gesammelt und seit ihrem Erwerb äußerst selten, wenn überhaupt, aufgeschlagen worden. Die Sessel waren ähnlich hochbetagt und lederbezogen, aber inzwischen zu einer wohltuenden Schäbigkeit abgewetzt, so auch der ausgeblichene türkische Teppich auf den Eichendielen. Der aus Mahagoni und indischem Satinholz angefertigte Sheraton-Rollschreibtisch, an dem Johnnie saß, schien von den Papieren, die auf der blankpolierten Oberfläche verstreut lagen, wie besudelt.
»Sie enthalten nichts Schlimmeres, als in vielen modernen Romanen steht, außer der Rechtschreibung.« Daisy schüttelte den Kopf. »Und das hier klingt recht unglaubwürdig.«
»Was meinst du damit?«
»Sieh mal, fast jedes längere Wort ist orthographisch falsch, aber die Kommas zum Beispiel sind richtig.« Sie überflog die Briefe, die mit einem stumpfen Bleistift in Großbuchstaben auf billiges Schreibpapier geschrieben worden waren. »Tatsächlich, alle Satzzeichen sind richtig – das ist höchst ungewöhnlich.«
»Bei Kommas bin ich mir selbst nicht so sicher«, gestand Johnnie.
»Und es ist genauso ungewöhnlich, daß nur die längeren Wörter fehlerhaft geschrieben sind. Ein Mädchen aus meiner Klasse, die sehr schlecht buchstabieren konnte, schrieb die langen Wörter kaum falsch, da sie sie wegen ihrer Unsicherheit immer im Wörterbuch nachschlug. Aber bei einsilbigen Wörtern wie bei den Unterschieden von ›seit‹ und ›seid‹ zum Beispiel wußte sie nicht Bescheid.«
»Das kann sein. Aber jemand ohne große Bildung hält es nicht für nötig, die Schreibung nachzuschlagen, und besitzt nicht einmal ein Wörterbuch.«
»Nein«, stimmte ihm Daisy zu, »aber er würde auch kürzere Wörter falsch schreiben, so wie Muht statt ›Mut‹, oder Höle statt ›Hölle‹.
»Oder Sünnde statt ›Sünde‹«, warf Johnnie ein, der nun begriffen hatte. »Huhre statt ›Hure‹.«
»Oder weiß Gott etwas anderes für ›Pharisäer‹. Mir scheint es eher, als hätte der Verfasser bei jedem längeren Wort innegehalten und überlegt, wie man es falsch schreiben könnte.«
»Wie steht es mit dem Wort ›Affaire‹?«
»Das macht am meisten mißtrauisch. Wie oft kommt es schon vor, daß das englische Wort auf solche Weise geschrieben wird, daß es zufällig der richtigen französischen Schreibung entspricht, wie man es von der oft gebrauchten affaire de coeur kennt? Nein, ich glaube, dein Briefeschreiber hat das Wort, ohne nachzudenken, niedergeschrieben; daher scheint mir, daß er einen gewissen Grad an höherer Bildung besitzt.«
»Verdammt noch mal, Daisy, ich will nicht glauben, daß sich einer aus unseren Kreisen diese … diese Schmierereien ausgedacht hat«, sagte Johnnie düster. »Ich gehe davon aus, daß es jemand ist, den ich kenne. Hast du einen Plan, nach dem du vorgehen wirst, um sie ausfindig zu machen?«
»Oder ihn.«
»Werden solche Dinge nicht gewöhnlich von frustrierten alten Jungfern verfaßt? Oder von einem Mann«, fügte er rasch hinzu, als Daisy die Stirn runzelte. »Meinst du, du hast auch nur die kleinste Aussicht …?«
»Daddy! Tante Daisy!«
Als sein Sohn und Erbe in die Bibliothek stürmte, schob Johnnie die Briefe rasch in die Schublade und schloß sie ab. Derek, einem drahtigen Neunjährigen mit strohblondem, sonnengebleichtem Haar, folgte ein dünnes, einen halben Kopf größeres Mädchen, das rote Zöpfe trug und etwas langsamer näher kam. Alecs Tochter Belinda blieb schüchtern neben Daisy stehen, während Derek vor seinem Vater haltmachte.
»Daddy, Mama hat sich ausgeruht und sagt, wir können im Sommerhaus Tee trinken, weil Mrs. Osborne erscheint, also kommst du mit uns zum Tee und spielst dann gleich Cricket mit, weil du sie doch auch nicht leiden kannst? Du kannst auch kommen, Tante Daisy. Ich meine«, korrigierte er sich, »wir würden uns über deine Gesellschaft freuen. Mrs. Osborne mag keine Kinder. Sie tut nur so und tätschelt einem den Kopf und nennt mich einen hübschen kleinen Mann.«
»Entsetzlich!« sagte Daisy lachend.
»Ganz und gar. Ab-so-lut er-nie-dri-gend.« Er blickte Belinda an, und aus irgendeinem Grund brachen beide in Gelächter aus, schon jetzt hatten sie ihren Spaß an einem Scherz, von dem die Erwachsenen ausgeschlossen waren. Im allgemeinen ließ Derek Mädchen links liegen. Doch die Tochter eines richtigen Detective Chief Inspectors von Scotland Yard war eine Klasse für sich.
»Derek, so darfst du aber über Mrs. Osborne nicht reden«, wies ihn sein Vater zurecht. »Und wie du darauf kommst, daß ich sie nicht mag … Nein, erzähl mir nichts. Wo soll das bloß hinführen. Wie sich die Manieren der Kinder heutzutage verändern. Bemüh dich bitte um ein wenig Zurückhaltung!«
»Na gut, Daddy, aber kommst du nun? Bitte!«
»Und Sie, Miss Dalrymple.« Belindas Hand glitt in Daisys.
»Ich glaube nicht, Liebes. Mrs. Osborne ist die Frau des Pfarrers, nicht wahr?« Wer wüßte sonst besser über alles im Dorf Bescheid als sie? »Ich fürchte, sie könnte es mit Recht für eine Beleidigung halten, wenn ich nicht erscheine.«
Belinda packte fester zu. »Ich komme mit. Darf ich?«
»Möchtest du nicht lieber Cricket spielen?« fragte Johnnie freundlich.
»Oh, ja, M… Mylord«, stammelte das Mädchen und blickte mit großen Augen scheu zu ihm auf, deren Grau einen Deut grünlicher schattiert war als die von Alec.
»Daddy, sie muß dich doch nicht mit ›Mylord‹ anreden, oder?«
»Guter Gott, nein. ›Onkel John‹ wäre wohl viel passender«, erwiderte Johnnie und warf Daisy einen spöttischen Blick zu, die merkte, wie sie errötete – eine fürchterliche viktorianische Angewohnheit, die sie verachtete, doch nie zu unterdrücken vermochte.
Dereks Bemerkung steigerte ihre Verwirrung noch. »Ich nehme an«, sagte er nachdenklich, »daß du Tante Daisy nicht eher ›Mama‹ nennen kannst, bis sie mit deinem Vater verheiratet ist. Sag lieber Tante Daisy, so wie ich. Komm jetzt mit Daddy und mir zum Tee. Cricket macht mehr Spaß zu dritt als zu zweit, und Peter zählt nicht. Du bist einfach besser als er, auch wenn du ein Mädchen bist.«
Gleichmütig nahm Belinda diesen Vergleich ihrer sportlichen Fähigkeiten mit denen seines fünf Jahre alten Bruders hin. »In Ordnung«, sagte sie.
Sie traten alle auf die Terrasse hinter dem alten Herrenhaus aus rotem Ziegelstein, das aus der Zeit Jakobs I. stammte. Die Hitze, die in London ganz unerträglich schien, war hier eher eine angenehme Wärme, die von einer leichten, nach Hopfen duftenden Brise aufgefrischt wurde. Dennoch hielt sich der große schwarze Hund, der zu ihrer Begrüßung mit dem Schwanz wedelte, japsend im Schatten. Violet wirkte in ihrem einfachen baumwollenen Voilekleid und dem breiten Hut entzückend luftig gekleidet. Sie saß in einem weißen Korbsessel, und Peter spielte auf dem für die Gegend von Kent typischen Belag aus Kieselsandstein zu ihren Füßen.
Daisys jüngerer Neffe war ein rundliches, stilles Kind, das sich ganz gut ein paar Stunden lang allein beschäftigen konnte. Er schaute von dem Holzpferd mit dem Karren auf, das er um die Sesselbeine seiner Mama schob, und blickte Daisy an, die er seit ihrer Ankunft noch nicht gesehen hatte, aber er sagte nichts. Daisy beugte sich hinunter, um ihn zu küssen.
»Ich wurde zum Tee ins Sommerhaus gebeten, Schatz«, sagte Johnnie. »Ist das in Ordnung?«
»Ja, geh nur mit den Kindern mit. Du versäumst hier nichts. Und nimm bitte Peter mit. Verschwinde lieber, ehe Mrs. Osborne eintrifft.«
Ihr Ehemann sah mit vorgespielt ängstlichem Blick zum Haus zurück.
»Los, Belinda, ich werde dir hinterherrennen!« rief Derek. »Komm schon, Tinker!«
Als der große schwarze Hund seinen Namen hörte, sprang er auf.
»Vielleicht sollte ich Peter lieber an die Hand nehmen«, sagte Belinda unentschieden und warf einen leicht nervösen Blick auf Tinker Bell.
»Lauf nur mit Derek los«, sagte Johnnie. »Ich bringe Peter mit. Komm schon, mein Kerlchen.«
»Ich will auch rennen«, verkündete Peter und trottete über den Rasen den anderen hinterher. Tinker sprang zu ihm zurück und leckte sein Gesicht ab, ehe er wieder Derek und Belinda folgte. Johnnie bildete die Nachhut.
»Meine Güte«, seufzte Vi, »der arme Peter wird nie gut im Sport sein, fürchte ich. Das ist für einen Jungen ein großes Handicap.«
»Blödsinn«, sagte Daisy aufmunternd. »Ich nehme an, daß aus ihm ein ausgezeichneter Ringer oder ein guter, solider Schlagmann wird, so einer, der stundenlang drinbleibt.«
»Vielleicht. Belinda ist ein nettes Mädchen. Daisy, ich hoffe, dir macht es nichts aus, daß ich sie gebeten habe, mich Tante Violet zu nennen.«
»Aber nein, wie kommst du darauf?«
»Nun, falls du vielleicht Zweifel hättest …«
»Keine«, stellte Daisy klar. »Ich liebe Alec einfach, und Bel auch. Mrs. Fletcher ist ein wenig wie das berühmte Haar in der Suppe, aber wir werden uns schon arrangieren. Wie war es bei dir? Hattest du denn Zweifel, ich meine, als ihr verlobt wart?«
»Eigentlich nicht, aber das war ganz anders.«
Daisy hob die Augenbrauen. »Wieso?«
»Oh, ich heiratete einen passenden Mann, der mir mehr oder weniger von meiner Mutter ausgesucht worden war, und alle Welt spendete Beifall. Wohingegen du doch nicht alles machst, was man von dir erwartet.«
»Du warst nicht in Johnnie verliebt?« fragte Daisy schokkiert. Als ihre Schwester heiratete, war sie fünfzehn gewesen und hatte immer geglaubt, es sei die romantischste Verbindung, die es geben könnte.
»Damals nicht«, sagte Vi leise. »Na ja, ich habe ihn schon sehr gemocht, mehr als all die anderen Verehrer, und …«
»Mrs. Osborne, Mylady«, verkündete ein Diener.
Eine große, kräftige Frau um die Vierzig trat auf die Terrasse hinaus und verströmte eine solche Entschlossenheit, wie sie eher den Kanadiern in Flandern angestanden hätte, die sich im Spätherbst 1917 auf Passchendaele zu bewegten. Ihr Gesicht war puterrot, und in ihrem grauen Seidenkleid sah sie aus, als wäre ihr zum Ersticken heiß. Im Vergleich zu Daisys und Violets leichten Baumwollgewändern war sie außerdem für die Tageszeit viel zu auffallend gekleidet. Daisy erkannte sie wieder, da sie ihr schon ein- oder zweimal bei früheren Besuchen begegnet war.
Auch sie erkannte Daisy wieder. Nachdem sie ihre Gastgeberin begrüßt hatte, sagte sie auf ziemlich wunderliche Weise: »Ein kleiner Vogel hat mir ins Ohr gezwitschert, daß Sie soeben in unserem ländlichen Zipfel der Erde eingetroffen sind, Miss Dalrymple. Wie geht es Ihnen?«
»Es ist sehr angenehm, bei diesem Wetter der Stadt zu entkommen.«
»Das stimmt, London ist im Sommer unerträglich. Ich versuche immer, die Stadt im August zu meiden. Und für Kinder ist es noch schlimmer – ich habe gehört, daß Sie ein kleines Mädchen mitgebracht haben?«
Offensichtlich hielt es Mrs. Osborne für ihre Pflicht, jedem kleinsten bißchen Klatsch nachzujagen. Wenn man annahm, daß sie ebenso bereit war, den Tratsch auch weiterzugeben, konnte sie für den Fall der mysteriösen Briefe ganz nützlich werden. Also schluckte Daisy ihren Verdruß hinunter und antwortete mit einem Lächeln: »Die Tochter meines Verlobten.«
Mrs. Osborne lächelte ebenfalls und entblößte dabei ihre Zähne, die wie schräge Grabsteine aneinandergereiht dastanden. »Ah, ja. Wir erfuhren von der Verlobung aus der Times. Gestatten Sie mir, Sie dazu zu beglückwünschen. Ein Mr. Fletcher, glaube ich. Sind das die Fletchers aus Nottinghamshire?«
»Nicht eigentlich.« Daisy warf Vi einen schelmischen Blick zu. »Die Verbindungen nach Schottland sind enger. Und wie geht es Ihrer Familie, Mrs. Osborne? Ich hoffe, der Pfarrer ist wohlauf?«
»Aber ja«, erwiderte Mrs. Osborne mit merkwürdiger Betonung, als versuchte sie, sich selbst davon zu überzeugen. »Sein Bruder ist gerade während der langen Ferienzeit ein paar Wochen bei uns. Er ist in Cambridge Professor für klassische Philologie. Er und Osbert führen derart hochgebildete Gespräche, daß ich kaum ein Wort davon verstehe.« Jetzt brachte sie ein eher dünnes Lachen hervor.
»Wie geht es den Kindern?« erkundigte sich Violet höflich.
»Heute morgen habe ich gerade einen Brief von Gwendoline erhalten, Lady John. Sie verbringt eine wunderbare Zeit mit ihren Vettern. Die Osbornes aus Cambridgeshire, wissen Sie, Miss Dalrymple. Mein Sohn, Jeremy, ist in Österreich mit ein paar Freunden von seiner Schule auf Klettertour. Eine Privatschule natürlich und wirklich ganz ausgezeichnet, auch wenn sie zu den nicht so bekannten gehört. Ich fürchte, wir könnten uns Eton oder Harrow nicht leisten, aber man muß doch eine bestimmte Position aufrechterhalten, nicht wahr, Lady John?«
»Durchaus«, sagte Vi, deren Söhne schon vor ihrer Geburt in Harrow eingeschrieben worden waren, automatisch, ohne daß sie etwas dazu hätte sagen können.
»Jeremy und Gwendoline werden beide vor dem Kirchenfest hier sein, ehe sie in die Schule zurückkehren. Ende dieses Monats findet das Kirchenfest statt, Miss Dalrymple. Heutzutage scheinen viele Leute im August wegzufahren«, fügte sie abfällig hinzu und sprach weiter, als zwei Hausmädchen das georgianische Silber und das königliche Doulton-Service auf dem Korbtisch abstellten. »Was gewöhnliche Bauern oder Ladenbesitzer einen Tag an der Küste wollen, das begreife ich nicht.«
»Abwechslung und Erholung, ein bißchen Spaß für ihre Kinder, nehme ich an«, sagte Daisy, die sich bemühte, nicht zu bissig zu klingen.
»Sie sollten lieber ihr Geld sparen, das würde ich ihnen anraten. Ich danke Ihnen, Lady John, chinesischer Tee mit Zitrone bitte und zwei Stück Zucker.«
»Indischen mit Milch bitte, Vi«, sagte Daisy prompt, die wohl ihre konträre Auffassung unterstreichen wollte, »ohne Zucker. Ein Sandwich mit Brunnenkresse, Mrs. Osborne?« Sie reichte ihr eine Platte mit kantenlosen dunklen Brotdreiecken herüber.
»Von ihrem eigenen Bach, Lady John?« Die Frau des Pfarrers nahm ein Sandwich und nagte vornehm an einer Ecke. »Köstlich. Ich sage immer, es ist unmöglich, Brunnenkresse zu kaufen, die so gut ist wie die, die auf Oakhurst wächst.«
»Ich werde ein Bund davon zum Pfarrhaus schicken lassen«, versprach Violet.
»Zu freundlich! Und nun komme ich noch einmal auf das Fest zurück. Ich wollte mich gern mit Ihnen darüber unterhalten, Mylady. Ich hoffe bloß, Ihnen macht es nichts aus, Miss Dalrymple, wenn ich und Lady John ein wenig über Angelegenheiten der Gemeinde sprechen?«
»Keineswegs«, erwiderte Daisy. »Wirst du dieses Jahr wieder das Fest eröffnen, Vi?«
»Ja, in der Tat, Lady John ist ziemlich unentbehrlich.«
»Ich bin keineswegs so unentbehrlich wie Sie, Mrs. Osborne.«
Mrs. Osborne zupfte an sich herum. »Wenn die Kirche nicht ganz auseinanderfallen soll, muß sich jemand um diese Dinge kümmern«, sagte sie, wobei sie versuchte, bescheiden zu wirken, »und gewöhnlich fällt so etwas immer auf die Pfarrersfrau zurück. Es würde nichts geschehen, wenn man den Leuten nicht sagte, was zu tun ist, und wenn man es nicht kontrolliert, ganz gleich wie gern sie helfen wollen. Wie dem auch sei, es wäre wünschenswert, wenn einige Leute vielleicht nicht ganz so erpicht darauf wären, sich in den Vordergrund zu drängen«, fügte sie mit einem bedenklichen Stirnrunzeln hinzu, »das ist auch ein Grund, zu dem ich Sie befragen möchte, Lady John.«
»Ja?« fragte Violet mit einem ein wenig entsetzten Blick.
»Es geht um Mrs. LeBeau.« Ihre Stimme klang unerbittlich. Daisy horchte auf, während sie versuchte so zu wirken, als interessiere sie sich mehr für ein Stück des hervorragenden Banbury-Kuchens. Mrs. Osborne setzte ihre Rede fort: »Irgendwie hat sie erfahren, daß unsere Wahrsagerin, die sonst immer kam, dieses Jahr nicht auftreten kann; also bot sie sich an, deren Rolle zu übernehmen.«
»Ich meine, Mrs. LeBeau würde eine wunderbare Wahrsagerin abgeben«, sagte Vi. »Ich glaube, du hast sie noch nicht kennengelernt, Daisy? Sie ist dunkel und schrecklich faszinierend. Mit einem glänzenden Schal über dem Kopf wird sie wie ein Zigeunerin aussehen.«
»Das können Sie doch nicht ernsthaft denken, Lady John! Diese Dame in einem abgedunkelten Zelt allein zu lassen, und die Männer gehen einer nach dem anderen hinein – das bringt Ärger.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: