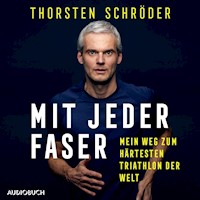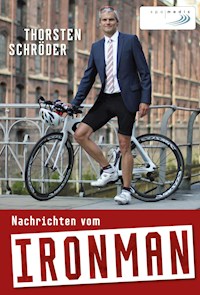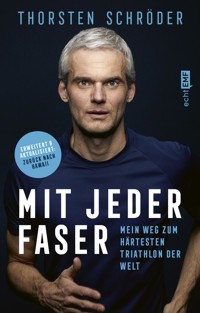
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Michael Fischer
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Back to Kona!
Als Kind kennt Tagesschau-Nachrichtensprecher Thorsten Schröder nur eine Leidenschaft: Fußball. Doch dann beendet ein Rückenleiden seine Vereinskarriere. Statt den Ball zu treten, darf er als bewegungsfreudiger Teenager nur noch sehr eingeschränkt Sport treiben. Schwimmen, Radfahren und Laufen sind aber drin.
Aus der Not wird über die Jahre eine flammende Passion für jene Sportart, die alle drei Disziplinen vereint, den Triathlon. Immer größer werden die Herausforderungen, denen er sich im Wettkampf stellt, immer härter sein Training. Bis er sich schließlich vornimmt, die Qualifikation für den legendären Ironman Hawaii zu erlangen. Und so beginnt das atemberaubende Projekt Kona.
In der aktualisierten und erweiterten Neuausgabe erzählt "Thorso" Schröder nicht nur von seiner Teilnahme am härtesten Triathlon der Welt, sondern auch von der Zeit danach - und wie er sich auf den Weg macht, seinen Traum von Hawaii ein weiteres Mal wahr werden zu lassen.
Motivation für jeden, der die sportliche Herausforderung sucht, für eine Langdistanz trainiert, einen Marathon schaffen möchte, am Trainingsplan feilt – und Unterhaltung für all die, die Sport lieber passiv genießen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Thorsten Schröder
Mit jeder Faser
Mein Weg zum
härtesten
Triathlon der Welt
Impressum
Die Ereignisse in diesem Buch sind größtenteils so geschehen, wie hier wiedergegeben. Aus Gründen des Personenschutzes und für den dramatischen Effekt sind jedoch einige Namen und Ereignisse so verfremdet worden, dass die darin handelnden Personen nicht erkennbar sind.
Alle in diesem Buch veröffentlichten Aussagen und Ratschläge wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden, ebenso ist die Haftung des Autors bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.
Für die Inhalte der in dieser Publikation enthaltenen Links auf die Webseiten Dritter übernehmen wir keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Bei der Verwendung im Unterricht ist auf dieses Buch hinzuweisen.
echtEMF ist eine Marke der Edition Michael Fischer
1. Auflage
Erweiterte, aktualisierte Neuausgabe 2023
© Originalausgabe 2019 Edition Michael Fischer GmbH, Donnersbergstr. 7, 86859 Igling
Covergestaltung: Michaela Zander und Jonas Högerl
Umschlagfotos: Enno Kapitzka (vorne), Alexander Tempel (Autorenbild)
Bilder: Kämpfen auf Hawaii; Training am See; Abkühlung dringend nötig: © Frank Wechsel/spomedis;Zieleinlauf auf Hawaii: © Nils Flieshardt/spomedis; Mit “Hase” Markus: © Marathon Photos;Alle anderen: © privat
Satz: Jonas Högerl
Herstellung: Anne-Katrin Brode
ISBN 978-3-7459-1853-3
www.emf-verlag.de
Inhalt
Prolog
Ohne Ball nix los
Ich habe Rücken
Schleichend zum Triathlon
Vom Radio zum Fernsehen
Erste Male
Es geht voran – beruflich und sportlich
Über kurz oder lang von kurz zu lang
Von der Schwierigkeit, ein Ironman zu werden
Willkommen in meiner neuen Welt
Feuerprobe Frankfurt
Ich bin angefixt
Der Plan
Es geht los
Alles auf Hawaii
Eine Sache des Kopfes
Der Trainingscountdown beginnt
Kölle Alaaf
Trainingstage
Der richtige Treibstoff
Ohne Hilfe geht es nicht
Auf Minutenjagd
Verpeilt beim Härtetest
Feinschliff
Frankfurter Qualen
Die pure Enttäuschung
Letzte Chance in der Heimat
Hawaii, ich komme!
Das Rennen meines Lebens
Der Traum von Hawaii 2.0
Thorsten, wir haben ein Problem
Kleine Schritte
Abstriche
Trainingscamp daheim
Aufholjagd
Back to Kona
Und wer jetzt noch nicht genug hat …
Danksagung
Prolog
„Jaaa!“ – Ich schieße von der Holzbank hoch, als hätte mir das graue, wollene Halstuch meiner Freundin Wiebke, mit dem ich gerade noch hochnervös auf dem Tisch herumgespielt habe, einen Stromstoß versetzt. „Ja, ja, jaaaaa!“, brülle ich, während meine Fäuste wild durch die Luft fliegen. Wäre die Sporthalle unter meinem Geschrei bebend zusammengebrochen – es hätte mich nicht gewundert. Ist sie aber zum Glück nicht. So kann ich von meinem Platz am Ende der Halle loslaufen in Richtung Bühne. Nach drei, vier Schritten hat sich so viel Energie in mir aufgestaut, dass ich drohe überzusprudeln. Ich hebe ab zum ersten Freudensprung. Nach ein paar Metern folgt der nächste Hüpfer. Erstaunlich, wie leicht das geht. Eben hatte ich noch Muskelkater, schwere Beine und war müde.
Kein Wunder, 19 Stunden zuvor war ich durch das Ziel eines Ironman-Rennens gewankt, nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und einem Marathon. Alles für einen Traum, von dem ich bis vor wenigen Augenblicken nicht wusste, ob er sich erfüllen würde.
Erschöpft und mit leiser Hoffnung hatte ich mich nach wenigen Stunden Schlaf hierher nach Hamburg-Wilhelmsburg geschleppt, zur Siegerehrung, bei der die Athleten bekanntgegeben würden, die sich qualifiziert hatten für das Sehnsuchtsrennen des Langdistanz-Triathlons: die Weltmeisterschaft in Kona auf Hawaii. Und der Sprecher hat gerade verkündet, dass ich einer von ihnen bin. Mit zwei Worten, die mich schon mein Leben lang begleiten, sich aber nie so gut angehört haben wie in diesem Moment: „Thorsten Schröder“.
Ich bin plötzlich hellwach und voller Energie. Würde vor mir ein Baum aus dem Boden wachsen, ich würde ihn ausreißen. Würde sich mir ein Drache in den Weg stellen, ich würde ihn mit einem Faustschlag schachmatt setzen. Warmgeboxt bin ich ja schon.
Nach einem 50 Meter langen Ekstase-Jubel-Sprint erreiche ich die kleine Treppe zur Bühne. Die Stufen hinauf sind ein Witz für mich. Ich nehme sie behände, locker und setze oben noch einen letzten Freudensprung drauf. Muskelkater? Keine Spur!
Mir strecken sich Hände entgegen, in die ich kräftig und mit einem glückseligen Lächeln einschlage. Ich umarme Menschen, die ich nicht kenne. Adrenalin ist eine tolle Sache. Vor allem, wenn es den Körper flutet, weil sich ein Traum erfüllt, für den man hart gearbeitet hat: Ich bin einer der Glücklichen, die in zwei Monaten an der Ironman-Weltmeisterschaft teilnehmen dürfen. Ich gehöre dazu! Ein Moment, für den ich gebangt und gehofft, für den ich neun Monate lang alles Mögliche und Unmögliche getan habe. Ich bin an meine Grenzen gegangen, körperlich, psychisch und organisatorisch. Habe Material und Ausrüstung teuer optimiert, meinen Urlaub für Trainingscamps geopfert und mir den geliebten Wein und die Schokolade verkniffen. Hätte ich allerdings geahnt, welche Quali-Zeiten ich hinlegen muss, um nach Hawaii zu kommen – ich hätte das Projekt Kona niemals in Angriff genommen. Und trotzdem war es mit das Beste, was ich jemals erleben durfte. Dabei hat es etwas gedauert, bis ich meine Liebe zum Triathlon entdeckte.
Ohne BALL nix los
Ginge es nach meinem jugendlichen Ich, wäre das hier ein Fußballbuch. Jeden Samstagnachmittag hörte mein Vater die Reportagen der Bundesligaspiele im Radio und guckte danach die Sportschau. Meinen Kinderaugen und -ohren blieb das nicht verborgen, und ein bisschen interessierte mich der Ball schon, aber noch besser gefiel mir damals mein Kettcar. Aber nicht lange.
Zu meiner Leidenschaft wurde Fußball 1974, ich war sechs Jahre alt, und in Deutschland fand die Weltmeisterschaft statt. Seit die deutsche Nationalelf im eigenen Land um den WM-Titel spielte, rollte der Ball im Garten, und das Kettcar stand still. Nicht nur für die Dauer des Turniers, sondern ständig. Der Fußball erklomm den Thron meiner Lieblingsspielgeräte. Erstmals zog mich ein großes, weltweites Sportereignis komplett in seinen Bann. Ich saß auf unserem Sofa im Wohnzimmer und schaute fasziniert zu, wie Mannschaften aus Ländern, deren Namen ich zum ersten Mal hörte, wie Haiti und Zaire (so hieß damals die heutige Demokratische Republik Kongo), in meist vollen deutschen Stadien gegeneinander antraten. Fußball war offenbar ein Sport, der überall auf der Welt beliebt ist. Auch bei meiner Familie. Mein Vater diskutierte mit meinem Onkel, dem Fleischermeister oder unserem Nachbarn wild über das Turnier: toller Schuss von Breitner gegen Chile, die Holländer spielen schönen Fußball, was ist bloß mit Netzer los, was für eine peinliche Niederlage gegen die DDR, ausgerechnet gegen die. Und meine Schwester Anke schwärmte für den schönen Brasilianer Francisco Marinho. Der mit den langen Haaren. Es packte jeden. Mich auch.
Ich sah, wie Franz Beckenbauer die Bälle mit eleganten Bewegungen an seine Mitspieler verteilte und wie Gerd Müller sie ins Tor schoss – oder stocherte. Beide wurden meine Helden! Ihnen wollte ich es nachmachen. Hoffentlich irgendwann einmal vor zigtausenden Zuschauern im Stadion, vorerst aber im eigenen Garten oder auf dem Sportplatz. Von da an gab es mich nicht mehr ohne einen Fußball. Dieses Spiel hatten die Engländer oder schon vorher die Chinesen – ganz egal eigentlich – allein für mich erfunden. Das stand fest. Nur im Klassenzimmer und im Bett verzichtete ich auf einen Ball. Und auch das nicht freiwillig.
In jeder freien Minute trommelte ich Nachbarskinder und Klassenkameraden zusammen, um zu kicken. Entweder auf der Straße oder auf dem Bolzplatz, der zu Fuß in zehn Minuten zu erreichen war. Einer meiner Freunde wollte immer Pierre Littbarski sein, der mit den O-Beinen. Ich hatte keinen absoluten Favoriten. Mal war ich Beckenbauer, mal Keegan, mal Müller. Manchmal auch alle zusammen. Denn wenn ich allein spielen musste, vervielfältigte ich mich und lieferte mir in unserem Garten dramatische Matches gegen mich selbst. Ich war gleichzeitig Flankengeber und Kopfballspieler, Mittelstürmer und Verteidiger oder Schütze und Torwart. Der Apfelbaum mitten auf dem Rasen wurde zum Gegenspieler, der sich mir immer wieder in den Weg stellte, aber selten eine Chance hatte. Meist umdribbelte ich ihn locker. Manchmal brachte er mich aber auch zu Fall: Weil ich beim Vorbeilaufen mein Bein seitlich ausstreckte, um am Stamm hängenzubleiben – so könnte es ein unbeteiligter Beobachter behaupten. Für mich aber war ganz klar, dass der Baum mich böse gefoult hatte. Ich wälzte mich auf dem Boden und hielt mir vor schlimmem imaginärem Schmerz das Schienbein. Logo, das gab Elfmeter. Da zögerte der Schiri nicht lange, der ebenfalls ich war. Nur eine Rote Karte gab es nie, den Baum vom Rasen zu schicken, ging ja nicht.
Beim Fußball konnte ich mich so austoben, wie ich es brauchte. Ich hatte nicht nur die normale Energie eines Grundschulkindes, sondern war – so würde ich es ausdrücken – besonders lebhaft. Mein Vater bezeichnete mich mit wachsender Resignation entweder plattdeutsch als „Wippsteert“ oder hochdeutsch als „Zappelphilipp“, und meine Mutter verzweifelte an meiner Garderobe: Kein Hemd konnte meinem Bewegungsdrang standhalten, ständig rutschten sie aus der Hose.
Wenn ich mir heute auf alten Super-8-Filmen selbst zuschaue, dann sehe ich einen jungen Kerl mit einer ganzen Schar Hummeln im Hintern. Selbst beim Versuch, die Familie aufzustellen und in Ruhe zu filmen, tanzte ich wortwörtlich aus der Reihe und machte Faxen. Man sieht genervte Blicke der Eltern und der beiden etwas älteren Schwestern sowie vergebliche Versuche, meinen Arm zu packen und mich zu bändigen. Heute würden manche Voreilige wohl ADHS bei mir diagnostizieren und mir irgendwelche Pillen verabreichen. Keiner würde glauben, dass es dieser Junge in ferner Zukunft schaffen würde, in der Tagesschau eine Viertelstunde und in den Tagesthemen gar eine halbe Stunde lang ruhig stehen zu bleiben. Mit dem Hemd in der Hose!
1974 verschrieb aber noch kein Arzt Ritalin, stattdessen schrieb ich Fußballgeschichte am Fließband im elterlichen Garten in Reinbek-Neuschönningstedt in Schleswig-Holstein, nur wenige Kilometer vor den östlichen Toren Hamburgs. Doch trotz meiner Leidenschaft weigerte ich mich, in einen Fußballverein einzutreten. Weder das rote Trikot des Vereins des Nachbar-Stadtteils FC Voran Ohe, noch das blaue des TSV Glinde wollte ich überstreifen. Aus gutem Grund, denn: Was passierte, wenn ich mitten im Spiel aufs Klo musste? Ich konnte doch nicht einfach vom Platz laufen, während die anderen weiterspielten. Dieses große Problem hatten meine Eltern offenbar völlig übersehen, als sie mich fragten, ob ich Vereinsfußball spielen wollte. Wie gut, dass ich damals schon mitdachte. Drei Jahre lang konnten mir meine Eltern meine Klo-Sorge nicht nehmen. Erst mit neun Jahren vertraute ich meinen Körperfunktionen so weit, dass ich doch noch Mitglied beim FC Voran wurde.
Neben dem Fußball hatte kein anderes Hobby auch nur einen Millimeter Platz. Eigentlich. Meine Eltern versuchten trotzdem, mich auf den Musikgeschmack zu bringen. Sie schwärmten von den schönen Liedern, die eine Tochter von Bekannten auf der Heimorgel spielte. „Willst du das nicht auch mal versuchen, Thorsten?“ Heimorgelmusik war damals voll im Trend, ihr Star hieß Franz Lambert. Der „Zauberer an der Hammondorgel“ sorgte auch in Halbzeitpausen von Fußballspielen für fröhliche Unterhaltung, deshalb war er auch mir ein Begriff. Mich interessierte aber mehr, was während der beiden Halbzeiten passierte als das musikalische Geschehen dazwischen. Nein, wollte ich also natürlich nicht, dieses Orgelspielen. Dann bliebe ja weniger Zeit zum Fußballspielen.
Und doch war mir am Silvesterabend 1977 plötzlich klar: Ich werde Heimorgel lernen! Meine Eltern hatten nämlich das entscheidende Argument vollkommen vergessen: Es hatte langes, glattes, schwarzes Haar, war zuckersüß, hatte ein hinreißendes Lachen und hieß Anja. Die musikalische Tochter der Bekannten. Sie war 10 Jahre alt, genauso wie ich, und keine Hundertstelsekunde ließ ich das wunderbare Wesen aus den Augen, ich wich nicht von ihrer Seite. Dieser nicht blonde Engel verursachte bei mir Glückseligkeit und aufgeregtes Herzwummern. Gleich am Neujahrstag sagte ich meinen Eltern, dass ich es mir überlegt hatte. Sie waren begeistert: Was für ein toller Sohn! Er war vielseitig interessiert. Nicht nur an Sport, sondern auch an Kultur.
Fortan fuhr ich mit Anja Woche für Woche ins „Musikstudio Erbe“ zum Orgelunterricht. Daheim ließ ich öfter den Ball liegen, um mich durch die „Schule für electronische Heimorgeln“ zu musizieren. Mit Liedern wie „Muß i denn, muß i denn“, „Mein Hut, der hat drei Ecken“, oder dem „Schneewalzer“ erfreute ich meine Eltern, Omas und Opas und Freunde und Bekannte, wenn sie sich anhören durften, welche Fortschritte der Junge gemacht hatte.
Ich übte gerne und viel, um Anja zu beeindrucken. Aber der Schuss ging nach hinten los. Jahre später erfuhr ich, dass sie mich doof fand, weil ich mir die begehrte blaue Heimorgel-Urkunde früher ertastet hatte als sie. Obwohl sie vor mir angefangen hatte. Ich hatte also ein gewisses Talent für die Orgel, aber noch mehr für den Fußball. Zumindest in meinem kleinen Fußballuniversum gehörte ich immer zu den Besseren. Ich konnte gut mit dem Ball umgehen, hatte ein Gefühl für ihn, einen guten Blick für die Mitspieler und den tödlichen Pass.
Einzeltraining beim FC Voran und zwei Sichtungsspiele beim Hamburger Fußball-Verband machten mir ein paar Monate lang sogar Hoffnung, dass ich aus meinem Talent etwas machen könnte: vielleicht eine Karriere à la Uli Hoeneß, dem ich ähnliche Fähigkeiten am Ball attestierte wie mir. Ich bereitete mich auf alle Eventualitäten vor und bat meine Mutter, ein Foto von mir in voller Nationalmannschaftsmontur zu schießen: weiße Stutzen, schwarze Hose, weißes Shirt. Nur die Flagge fehlte auf dem Trikot. Kurzerhand ernannte ich meine Mutter zum Zeugwart und bat sie, mir die fehlende Flagge aufzunähen. Was ich nicht bedacht hatte: Die Nationalspieler trugen nicht die schwarz-rot-goldenen Farben auf der Brust, sondern den Bundesadler.
Ein kleiner Schönheitsfehler, aber ich sah generös darüber hinweg, auch wenn dadurch ein nur fast perfektes „Nationalspieler“-Foto entstand. Darauf sieht man mich kerzengerade auf dem heimischen Rasen stehen, die Hände hinterm Rücken verschränkt, das Kinn leicht angehoben, zwischen meinen Füßen liegt mein Ball. Mein Gesicht wird durch den Schatten des Baums leicht verdunkelt (er wollte sicher gerade wieder zum Foul ansetzen). Ich hielt das Foto sowohl fürs Panini-Album als auch für Autogrammkarten geeignet; also signierte ich es eigenhändig. Weil man das als Fußballstar eben so macht. Ich war vorbereitet, der Rest war allein Sache des Bundestrainers. Der meldete sich aber partout nicht. Nicht einmal Spielerbeobachter kamen. Das könnte unter anderem daran gelegen haben, dass ich zu langsam lief. An diesem Manko arbeiteten wir beim Oher Einzeltraining leider vergebens. Oder es lag an meinen viel zu dünnen, kraftlosen Oberschenkeln, die mein Trainer bemängelte. Da halfen auch die Extrasteaks nichts, zu denen er mir geraten hatte. Ein paar Jahre später hatte der deutsche Fußball mit Lothar Matthäus eine adäquate Alternative zu mir gefunden. Er war tatsächlich viel schneller als ich und hatte viel kräftigere Oberschenkel.
Mit den Riesenmuskelpaketen von Big Jim konnte aber auch ein Lothar Matthäus nicht mithalten. Big Jim war meine Actionfigur. Ein 24 Zentimeter großes Männchen, breitschultrig mit Bodybuilder-Muckis, von seinen Herstellern eindeutig dazu auserkoren, böse Feinde dank seiner unbändigen Kraft zu besiegen. Zum Fußballer war Big Jim mit diesem Körperbau nicht gemacht. Aber vielleicht ahnte ich ja damals schon, dass man Großes erreichen kann, selbst wenn man nicht dafür geschaffen ist.
Mit Big Jim machte ich mein Kinderzimmer zur Stätte epischer Rasenschlachten: Ich zog ihm Trikot, Hose, Stutzen und Schuhe an und machte ihn zum Helden der Fußballspiele auf dem graubraunen Teppich in meinem Zimmer. Dort traf sich ganz Europa. Ich hatte im KICKER gelernt, dass es Vereine gab aus Städten mit teils unaussprechlichen Namen wie Durres, Debrecen, Turku, Braga, Mielec oder Bor-de-aux (was ich genauso aussprach, wie man es schreibt). In Erdkunde konnte mir lange kein Gleichaltriger das Wasser reichen.
Wenn die Clubs aus aller Welt in meinem Kinderzimmer gegeneinander spielten, war die Hütte voll und tolle Stimmung garantiert. Und weil sonst niemand der Öffentlichkeit von diesen fußballerischen Meilensteinen berichtete, nahm ich das selbst in die Hand und wurde mit meinen neun Jahren zu einem dieser Sprechakrobaten, die mich so faszinierten. Samstag für Samstag, wenn die Bundesliga spielte, schaltete ich das Radio ein und lauschte bewundernd den dauerredenden Männern, die inmitten der mehr oder weniger lärmenden Zuschauer saßen, das Mikro in der Hand, Kopfhörer auf dem Kopf, und wunderbar lebhaft, enthusiastisch, klagend und blumig erzählten, was sie vor sich auf dem Rasen und um sich herum auf den Tribünen erlebten.
Die Kommentatoren beamten mich aus Neuschönningstedt ins Stadion nach Dortmund, München oder Frankfurt.
Das wollte ich auch können. Und weil für das große Stadion-Klangerlebnis im Kinderzimmer die Geräusche der Zuschauer fehlten, übernahm ich diesen Job gleich mit und versuchte, Jubel, Raunen und Anfeuern von 30 000 bis 80 000 Menschen nachzuahmen. Ich fand, das klappte ganz gut und klang echt.
Auch mit 13 oder 14 Jahren machte ich das noch, versteckte meinen Big Jim aber und spielte heimlich. Also, Zimmertür zu, auf den Teppich sinken, in der einen Hand Big Jim, in der anderen den kleinen, schneeweißen Ball, der eigentlich zum Tischfußballspiel gehörte. Den Kommentar flüsterte ich, und Torschreie und Jubel wurden leise gedimmt. Wie peinlich wäre es gewesen, wenn meine Eltern mich beim „Puppenspielen“ erwischt hätten! Oder, noch schlimmer, meine Schwestern! Hörte ich die Treppe knarzen, verschwanden Ball und Big Jim ganz schnell in der Schublade.
Dass ich weiterspielte, hatte einen einzigen Grund. Ich hatte einen neuen Traumberuf: Fußballkommentator. Und dafür musste ich üben. Ich kommentierte Big-Jim-Spiele. Ich kommentierte, wenn ich im Garten kickte. Ich kommentierte Bundesligaspiele aus der Sportschau, die ich auf Video aufgenommen hatte. Wir hatten schon sehr früh ein solches Gerät. Mein Vater hatte sofort zugeschlagen, als die ersten dieser topmodernen Dinger in den Läden standen.
Notfalls wäre ich auch ein Schreiberling geworden. Um auf diesem Gebiet Erfahrung zu sammeln, gab ich eine Fußballzeitschrift heraus. Leser gab es leider fast keine. Nur meine Mutter und meine Schwestern blätterten freundlicherweise ab und an durch die zehn, zwölf Seiten meiner „Fußball-Tag“, wie ich das in loser Folge erscheinende Blatt nannte.
Redaktion, Layout, Grafik – alles mein Werk. Eine One-Man-Show. Für schlappe 30 Pfennig wurde dem Leser viel geboten: Spielberichte und Interviews, Autogrammkarten (die Unterschriften der Spieler musste ich leider fälschen), Bilder der Teamtrikots zum Ausschneiden und Sammeln. Alles, wofür das Fanherz schlägt. Ich schrieb sämtliche Texte selbst, mit der Hand und Bleistift oder Kuli – und ich war gnadenlos ehrlich zu meinen Lesern: Am Ende von Ausgabe Nr. 2/1981 hieß es in der Vorschau auf das folgende Heft: „In der nächsten Fußball-Tag wissen wir noch nicht, was wir bringen.“ Ich verstand es meisterhaft, die Spannung aufrechtzuhalten und Kaufanreize zu schaffen.
Für mich stand fest: Beruflich musste es unbedingt „Irgendwas mit Fußball“ sein. Meine Karriere als aktiver Fußballer sollte damals allerdings nur noch wenige Monate dauern.
Ich habe Rücken
Das Ende begann nach einem Ligaspiel, als ich 14 Jahre alt war. Mittags hatte ich für den FC Voran auf dem Platz gestanden und alles gegeben. Offenbar etwas mehr als alles, denn mein Rücken fing an, sich zu beschweren. Ich saß in meinem Zimmer in meinem gemütlichen alten Sessel und spürte, dass irgendetwas nicht stimmte. Keine drei Stunden nach dem Spiel konnte ich mich kaum noch bewegen. Nach vorn beugen ging nicht, den Oberkörper zur Seite drehen war unmöglich. Ein Gefühl, als wären sämtliche Muskeln, Sehnen und Bänder in meinem Rücken erstarrt. Ich versuchte aufzustehen. In Zeitlupe drückte ich mich mit beiden Händen von den Sessellehnen ab, um auf die Beine zu kommen. Ungefähr so dynamisch wie der Star-Wars-Roboter R2-D2 zockelte ich mit einer Hand am Geländer ungelenk die Treppen hinunter, dorthin, wo Rettung nahte. Auch mein Vater hatte häufig Rückenprobleme, deshalb hatten wir das Nötigste immer im Haus. Meine Mutter brauchte nur den kleinen weißen Arzneischrank zu öffnen und nach der Salbe zu greifen, „die so schön brennt“, wie Vater immer sagte, wenn Mutter sie ihm auf den Rücken schmierte. Nun war zur Abwechslung ich dran. Sie brannte zuerst tatsächlich auf meinem Rücken, aber dann wurde es wohlig warm. Nach drei, vier Stunden löste sich die völlige Erstarrung, bis sie ganz verschwunden war. „Das hätte ich überstanden“, dachte ich. „Kann passieren, wahrscheinlich eine falsche, abrupte Bewegung, die meinem Rücken nicht gefallen hat.“
Aber die Erstarrung kehrte zurück. Nur eine Woche später, wieder nach einem Spiel für Ohe, konnte ich mich erneut nicht bewegen. Und wieder musste mich meine Mutter mit der Salbe retten. Aber diesmal war da noch etwas anderes: In meinen Oberschenkeln kribbelte es, als liefen unzählige Ameisen kreuz und quer. Ich versuchte, dieses unangenehme Gefühl wegzukratzen und musste feststellen, dass sich zum einen die Ameisen davon nicht beeindrucken ließen und ich zum anderen nicht viel von meinem Kratzen spürte. Dort, wo die Ameisen herumkrabbelten, waren meine Beine ein bisschen taub. Jetzt wurde es mir unheimlich. Was war das denn? Und was konnte man dagegen tun? Eine Salbe gegen krabbelnde Ameisen in den Beinen hatten wir nicht im Arzneischränkchen. Also tat ich, was ich für das Beste in einer solchen Situation hielt: abwarten. Und, siehe da, sowohl Rückenschmerzen als auch Ameisenkribbeln waren am Abend weg. Ich war erleichtert, aber merkwürdig war es doch. Zumal es dem Krabbelgetier bei mir zu gefallen schien. Jede Woche besuchte es mich wieder, und auch der Rücken versteifte sich weiter nach jedem Ligaspiel. So konnte es nicht weitergehen. Nachdem die Beschwerden auch nach einigen Monaten nicht verschwunden waren, fuhren meine Mutter und ich zum Orthopäden. Der ließ mich röntgen und besah sich dann die Bilder. In meiner jugendlichen Unbekümmertheit machte ich mir keine großen Sorgen. Ich war einfach nur gespannt, wo die Ursache für meine Probleme lag. Auch der Arzt, dem meine Mutter und ich gegenübersaßen, wirkte nicht sonderlich besorgt und was er sagte, klang auch erst mal nicht so schlimm: Wirbelgleiten lautete seine Diagnose, die mir ungefähr genauso viel sagte wie ägyptische Schriftzeichen. Der Arzt erklärte, dass dabei ein Wirbelkörper in der Lendenwirbelsäule auf dem darunterliegenden nach vorn gleitet und auf die Nerven drückt. Bis dahin für mich immer noch nicht tragisch, doch dann ließ er die Bombe platzen: „Das Problem wird umso größer, je heftiger du Sport treibst. Wenn du Fußball spielst, bekommst du das hinterher unangenehm zu spüren. Darum solltest du das von nun an sein lassen.“
Ich glaubte, mich verhört zu haben. Ich starrte ihn an und wartete darauf, dass er sagte: „Nur ein Scheheerz!“ Aber da kam leider nichts. Langsam sickerte die Bedeutung seiner Worte in mein Bewusstsein, und mir wurde schummrig. Plötzlich drehte sich alles, und ein Wirbelwind rauschte durch meinen Kopf. Ich nahm gerade noch wahr, dass der Doktor fragte: „Alles in Ordnung mit dir?“ und dann kollabierte ich, zusammen mit meiner Fußballwelt. „Schnell, die Beine hochhalten“, hörte ich aus einer fernen Galaxie den Hiob sagen, der behauptete, mein Arzt zu sein. Jemand legte mir ein Kissen unter den Kopf und brachte ein Glas Wasser. Aber der Schalter meiner Lebensgeister ließ sich nur sehr mühsam wieder von „Aus“ auf „Ein“ umlegen. Nur langsam lichtete sich das Schwarz vor meinen Augen und machte dem sorgenvollen Gesicht meiner Mutter Platz. Ich kam wieder zu mir – und mir schwante, dass dieser Tag alles verändern würde. War ein Leben ohne Fußball überhaupt möglich – oder sinnvoll? Und wie lange sollte dieser unerträgliche, fußballlose Zustand anhalten? Für immer? „Nein, nicht für immer“, machte mir der Arzt ein bisschen Hoffnung, als ich noch immer etwas benommen wieder neben meiner Mutter saß. Es gebe, so sagte er, eine Lösung für das Wirbelgleiten: Man könne es an der Uniklinik in Hamburg-Eppendorf operieren. „Ganz erfolgreich. Gehen Sie da mal hin.“
Meine Mutter war besorgt, mein Vater unsicher. Eine Operation am Rücken ist schließlich keine Kleinigkeit. Dort verlaufen Nervenstränge, dort ist das Rückenmark. Ich sah die Sache entspannter. Zwar hatte ich schon mitbekommen, wie wichtig eine intakte Wirbelsäule für einen funktionierenden Körper ist, und auch von Querschnittslähmung hatte ich schon gehört. Aber die Operation sollte mich ja gerade wieder funktionsfähig machen. Die Ärzte würden schon wissen, was sie tun – und um wieder Fußball spielen zu können, hätte ich noch einiges mehr auf mich genommen, als mich auf einen OP-Tisch zu legen. Zugegeben, auch mir wäre wie meinen Eltern Krankengymnastik deutlich lieber gewesen, aber wenn es nun mal nicht anders ging, mussten wir eben den großen Schritt wagen. Nachdem auch ein zweiter Orthopäde bestätigt hatte, dass eine Operation unvermeidbar war, weil sonst Lähmungen drohten, stimmten wir einem Eingriff zu. Heute würde man wohl tatsächlich erst einmal versuchen, dem Problem mit ausgiebig Physiotherapie oder Osteopathie beizukommen. Aber damals, Anfang der 80er-Jahre, war es eben anders.
Als ich den Professor kennenlernte, der mich operieren sollte, war ich mir sicher, dass ich das Richtige tat. Der Mann mit den vielen Locken auf dem Kopf, der runden Brille auf der Nase und dem milden, wissenden Lächeln versprach mir: „Wir kriegen dich schon hin. Bald kannst du wieder schwerste Gewichte stemmen.“ Messerscharf kombinierte ich: Wenn selbst Gewichtheben möglich sein sollte, dann doch wohl erst recht so etwas Banales wie Fußball. Ich sah mich schon wieder im roten Ohe-Trikot auflaufen, Pässe spielen, dem Gegner den Ball abjagen und, wenn nötig, über den Platz grätschen.
An meine Mutter gewandt erklärte der Arzt das genaue Prozedere: Er würde ein Stück aus meinem Beckenkamm zwischen den betreffenden Wirbeln platzieren, quasi als Bandscheibenersatz. Dort sollten die Knochen dann verwachsen. Sie würden von ventral operieren, also vom Bauch aus. Blitzschnell war ich gedanklich vom Fußballplatz zurück im Untersuchungsraum, und mein überlegenes Grinsen verschwand. Meines Wissens nach befand sich die Wirbelsäule nicht am Bauch, sondern mehr so Richtung Rücken. Meine Mutter war offenbar ähnlich irritiert: „Vom Bauch aus?“, fragte sie. Mit zehn Fragezeichen. „Ja“, bestätigte der Arzt. „So kommen wir besser an die Problemstelle, weil der Wirbel nach anterior rutscht, also nach vorne.“ Mutter gab sich zufrieden, ich aber blieb skeptisch. Wenn ich den Biounterricht nicht völlig falsch verstanden hatte, waren da doch ein paar Organe im Weg. Musste der Arzt die dann alle rausholen, um an die Wirbelsäule zu kommen? Eine gruselige Vorstellung, aber meinetwegen. Wenn er Milz, Leber und all das andere Geglibber wieder ordentlich dorthin zurücklegte, wo er es hergeholt hatte, sollte er sich eben von ventral vorarbeiten. Da musste ich durch, wenn ich wieder Fußball spielen wollte. Für meine Leidenschaft war ich gewillt, jegliches Leiden zu akzeptieren.
Doch nach der OP traf es mich mit voller Wucht. Ganze vier Wochen lang lag ich starr im Krankenhausbett. Für einen „Zappelphilipp“ wie mich eine Tortur. Aber das dicke Ende folgte noch: Ich sollte ein Jahr lang ein Korsett tragen. Und diese Plastikschale um meinen Rumpf, mit der ich schließlich nach Hause entlassen wurde, entpuppte sich als die wahre Folter. In der Theorie klang es einleuchtend: Mein Rumpf sollte stabilisiert werden, damit die beiden einst beweglichen Wirbelkörper in aller Ruhe mit dem dazwischengesetzten Knochenstück aus meinem Becken verwachsen konnten. De facto war ich damit aber genauso unbeweglich wie zuvor durch die Rückenschmerzen. Mit dem Unterschied, dass diese Steifheit nun anhalten würde – für ein ganzes Jahr! Dass ich als bewegungsfreudiger Fünfzehnjähriger angesichts dieser monströsen Zeitspanne nicht die Nerven verlor, verdankte ich allein der Aussicht darauf, dass danach alles besser werden würde.
Das Korsett wurde ein Teil von mir. Ich musste es permanent tragen, auch nachts im Bett und beim Duschen. Um mich von meiner Plastikhülle zu befreien, hätte ich eine Säge gebraucht. An die Schrauben, die das Ungetüm mit drei metallenen Querstreben am Rücken zusammenhielten, kam ich allein nicht heran. Mein hautenges Gefängnis durfte nur ein Fachmann öffnen – und auch der nur dann, wenn es mir darin unerträglich eng wurde, weil ich zugenommen hatte. Statt wie andere nur in einen Laden zu gehen und die Klamotten eine Nummer größer zu kaufen, marschierte ich zusätzlich zum Orthopädietechniker, damit der mein Korsett eine Nummer weiter machte. Dazu löste er die Schrauben, bog die Hälften auseinander, schnitt das Korsett vorn der Länge nach auf und fügte eine zwei oder drei Zentimeter breite Plastikschicht ein, um den Umfang zu vergrößern. Für ein paar Augenblicke war ich befreit. Endlich frische Luft an Bauch, Brust, Rücken! Meine Haut sog den Sauerstoff auf wie ein Verdurstender das Wasser. Der leicht süßsaure Modergeruch, der aus der geöffneten Plastikschale stieg, verflüchtigte sich leider nur langsam. Zudem wurde der Techniker immer flinker, denn ich gab ihm jede Menge Gelegenheit zum Üben: alle drei bis vier Wochen war ich bei ihm.
Verantwortlich dafür war ganz besonders der Samstagabend: Zu „Wetten, dass …?“, „Auf los geht’s los“ oder einem spannenden Spielfilm holte mein Vater immer Chips und Schokolade aus dem Süßigkeitenschrank im Schlafzimmer meiner Eltern. Und wer sich nicht bewegt und weiterfuttert wie gehabt, der nimmt zu.
Außerdem gab es Limo oder Cola. Wasser war für mich lange Zeit nur zum Waschen und Kochen da, runter bekam ich das nicht. Mit sechs oder sieben Jahren hatten mir mal Bekannte meiner Eltern in Köln „Sprudelwasser“ angeboten, eine Getränkebezeichnung, die ich gleichgesetzt hatte mit Zitronenlimo, die sprudelt ja auch. Aber natürlich war Sprudelwasser nichts anderes als „Mineralwasser“, wie ich erschreckt hatte schmecken müssen. In einer eindrucksvollen Fontäne war der erste und einzige Schluck, den ich davon genommen hatte, umgehend auf dem gedeckten Kaffeetisch gelandet. Widerliches Zeug!
Wenig später hatte es so ausgesehen, als wäre der große Moment gekommen, in dem ich vom Saulus zum Paulus wurde. Wir hatten damals in sengender Sommerhitze ein Fußballturnier gespielt. Schweißüberströmt und fast ausgedörrt hatte ich nach einer Flasche Wasser gegriffen und sie hastig ausgetrunken. Das hatte so gutgetan und geschmeckt! Das Etikett hatte verraten: Es war tatsächlich Wasser. Und ich war in der Lage gewesen, es ganz ohne Würgereflex zu trinken. Ich war darüber mehr begeistert gewesen als über unseren zweiten Platz beim Turnier. Zu Hause hatte ich meinen Eltern stolz verkündet: keine Cola, keine Sprite, keine Fanta mehr. Wir trinken von nun an nur noch gesundes Wasser, von dieser einen, allerleckersten Sorte. Denn natürlich hatte ich schon damals gewusst, dass Unmengen Zucker nicht gesund sind. Doch als ich zu Hause den ersten Schluck meiner „Lieblingswassersorte“ genommen hatte, war das ungute Bäh-Gefühl zurück. Mir ging ein Licht auf: Es lag daran, dass es nicht brütend heiß war und ich keinen Sport machte. Gebt mir mein Zuckerwasser zurück!
Erst viele Jahre später stieg ich doch noch auf Wasser um, als der Verstand über meine Geschmacksnerven triumphierte und ich merkte, dass ich mich an den neutralen Wassergeschmack gewöhnen musste. Die Umstellung war nicht einfach. Die Süße hatte mich süchtig gemacht. Zum Glück wurde ich dank meines Willens den Würgereflex los, sonst hätte ich später auf der Triathlon-Langdistanz ein ziemliches Problem bekommen, so ganz ohne Wasser.
Dabei hätte es mir schon in meiner Korsettphase ganz gutgetan, zumindest bei der Flüssigkeitsaufnahme ein paar Kalorien einzusparen. Denn immer deutlicher machte sich meine suboptimale Ernährungsphilosophie an Gewicht und Umfang bemerkbar. Den schlanken, drahtigen Jungen, der ich einmal war, gab es nicht mehr. Da ich mir dank des Korsetts aber nicht in meine Speckröllchen kneifen konnte, ließ sich das Mehrgewicht noch eine gute Weile lang verdrängen. Es war eine Nachbarin, die wir im Supermarkt trafen, die schließlich die Wahrheit aussprach. Zu meinen Eltern gewandt sagte sie: „Thorsten hat ganz schön zugelegt.“ Der Spiegel hatte also nicht gelogen: Ich war dicker geworden. Unter meinem vollen, dichten, braunen Haar lag ein rundes Gesicht mit Pausbacken und dem Ansatz eines Doppelkinns.
So richtig schlimm fand ich es nicht: Das Problem würde sich ohnehin von allein erledigen, wenn ich nach meiner Korsettzeit wieder Gewichte heben und – viel wichtiger – Fußball spielen konnte. Ein Jahr lang etwas mehr von mir selbst herumzuschleppen, sollte doch durchzuhalten sein! Zumal ich, ganz ungeplant, einen Ersatz für mein aktives Gekicke gefunden hatte: beim Kicken zuschauen. Nicht im Fernsehen, sondern im Stadion.
Mein Vater nahm mich im Jahr 1983 eines Nachmittags mit zu einem Spiel des damaligen Drittligisten FC St. Pauli. Es war Liebe auf den ersten Kick. Mit uns im Stadion standen ungefähr 5 000 Menschen, machten einen Höllenlärm, peitschten mit ihren Schlachtrufen die eigene Mannschaft nach vorn und sangen nie etwas Abschätziges über den Gegner. Ein buntes Völkchen aus Freaks mit farbigen Haaren, totalen Normalos und echten Sankt Paulianern, Menschen aus dem Stadtteil. Zum Beispiel St. Pauli-Willi. In Fußballschuhen, Stutzen, kurzer Hose und FC-Trikot hätte er auch ein Auswechselspieler sein können. Wenn da nicht seine Riesenwampe, die Tröte in der Hand und sein fortgeschrittenes Alter gewesen wären. Er stand immer direkt hinter dem Zaun. „Wir werden Herbstmeister“, brüllte er. „Wir gewinnen 3:0.“ Selbst wenn es 1:1 stand.
Am Ende gab es jedes Mal donnernden Applaus für die Männer in Braun-Weiß. Nicht, weil sie schönen Fußball gespielt hatten (das hatten sie nicht). Sondern weil sie sich reingehängt, gekämpft und alles gegeben hatten. Das wurde honoriert – und war genau meins! Drei Jahre zuvor hatte ich auf dem Ascheplatz vor dem Stadion mit Voran Ohe eine 1:12-Klatsche gegen die St.-Pauli-Jugend kassiert. Das gefiel mir gar nicht. Aber von nun an würde ich mich über jeden Sieg von St. Pauli freuen, das stand fest. Ich hatte meinen Verein gefunden. Trotz dritter statt erster Liga. „Irgendwann“, so dachte ich, „werde ich nicht mehr regelmäßig kommen können, weil ich wieder selbst gegen den Ball trete.“ Aber ich wusste jetzt, wo ich bis dahin eine üppige Dosis Fußball bekommen konnte.
Der FC St. Pauli blieb mein Verein. Heute starte ich in seinen Farben bei Marathons, Triathlons und Radrennen. Die Liebe zu ihm ist nie verschwunden.
Schleichend zum Triathlon
Nach einem Jahr, ich war mittlerweile 16 Jahre alt, wurde ich endlich aus meinem „Gefängnis“ entlassen. Der Orthopädietechniker setzte den Schraubenzieher an, löste nach und nach die Schrauben des Korsetts und drückte es auseinander. Ich wandt mich heraus, spürte Luft auf meiner Haut statt klebrigem Schweiß und fühlte mich, als hätten sich mit dem Korsettverschluss auch wieder alle Möglichkeiten für mich geöffnet. Ich hatte die Zeit in Plastik überstanden. Ein erhebendes Gefühl.
Natürlich hatte ich mich – Realist, der ich bin – nicht bereits für den gleichen Tag mit meinen Kumpels zum Kicken verabredet. Mir war klar, dass meine Bauch- und Rückenmuskulatur erst wieder aufgebaut werden mussten, bevor ich zurück auf den Rasen konnte. Das Korsett hatte ihnen einen großen Teil ihrer Arbeit abgenommen und sie abschlaffen lassen. Aber ich hatte mir von der Korsettfreiheit doch deutlich mehr erwartet. Meinen persönlichen Gesundheitstest bestand ich jedenfalls nicht: Sich rücklings auf den Teppich legen und ausprobieren, ob es wehtun würde. Kaum berührte mein Oberkörper den Boden, war ein leichter Schmerz da. Genau an der Stelle, die operiert worden war. Und wieso war da wieder ein leichtes Kribbeln in den Beinen?
Anderthalb Monate nachdem ich das Korsett losgeworden war, musste ich zur Nachuntersuchung ins Uniklinikum. Mir war mulmig zumute, ich fühlte mich beklemmt und nervös. Die untapezierten Wände in „Depressiv-Betongrau“ strahlten zudem nicht gerade Optimismus aus. Meine Mutter und ich warteten bereits eine Stunde. Jede Menge Zeit, um mir auszumalen, was uns der Professor gleich verkünden würde: „Schauen Sie mal auf die Röntgenbilder, da sieht man sehr deutlich, dass die Operation leider misslungen ist. ’Tschuldigung.“ Ich stellte mir vor, dass meine Wirbel herumrutschten wie eine Plattenspielernadel mit Schlagseite und ich froh sein konnte, überhaupt noch aufrecht zu stehen. Ameisen? Die würden mein kleinstes Problem sein. Zweieinhalb Stunden Warten. Die wussten hier, wie man Spannung und Dramatik aufbaut.
Drei Stunden. Mein Name ertönte, und ich war überzeugt, dass mein Leben vorbei war.
Bevor ich über die Schwelle ins Besprechungszimmer trat, atmete ich ganz tief durch, mein Herz schmiss den Turbo an und pochte mir im Stakkato bis zum Hals. Neben dem Schreibtisch des Professors hingen an einem Leuchtkasten Abbildungen meiner Wirbelsäule, auf die der Arzt deutete: „Schauen Sie mal auf die Röntgenbilder, da sieht man sehr deutlich …“ Bevor ich ob der Befürchtung, dass meine schlimmsten Fantasien wahr werden könnten, wieder umkippen konnte, wich der Doktor von meinem Super-GAU-Drehbuch ab: „… da sieht man sehr deutlich, dass die Wirbel und das Knochenstück schön miteinander verwachsen sind.“ Noch bevor das Lämpchen der Freude mein Gesicht komplett erhellen konnte, schränkte er ein: „Trotzdem musst du vorsichtig sein. Abrupte Bewegungen tun dem Rücken und der operierten Stelle nicht gut. Deshalb erst mal auch weder Gewichtheben noch Fußball spielen.“ Ein halbes Jahr sollte ich mich noch gedulden, dann würden wir „weitersehen“. Ich war immerhin teilerleichtert. Die schlimmsten Befürchtungen hatten sich nicht bewahrheitet, die schönsten Hoffnungen aber auch nicht. Ich akzeptierte sein Urteil, wobei mir der Verzicht auf Hanteln deutlich leichter fiel als der auf den Ball. Dennoch musste ich, der ein Jahr lang zur Untätigkeit verdammt gewesen war, wie ein angebundenes Wildpferd, endlich mal wieder nach Herzenslust herumspringen und mich austoben. Der Arzt hatte auch gleich eine Empfehlung parat, wie ich meinem Rücken Gutes tun und gleichzeitig Sport treiben konnte: „Schwimm doch mal“, riet er. Schwimmen? Ich war überhaupt nicht begeistert. Kein Ball weit und breit und immer nur hin und her pflügen? Langweilig! Schwimmen taugte in meinen Augen nur als Beleg, wie unterschiedlich schnell Zeit vergehen kann: Während sich eine Stunde im Wasser quälend lang zog, vergingen 60 Minuten beim Fußball wie im Flug. Das Einzige, was mir im Schwimmbad gefiel, war, die Rutsche runterzurasen und mit einer Arschbombe das Wasser hochspritzen zu lassen. Diese Disziplinen hatte der Orthopäde aber leider nicht gemeint. Dass er auch Radfahren und Laufen – und damit sämtliche Triathlondisziplinen – als Alternativen vorgeschlagen hatte, bekam ich vor lauter Schreck über die verhasste Bewegung im Wasser gar nicht mehr mit. Vermutlich, weil ich Triathlon damals noch nicht kannte.
Meine Abneigung gegenüber dem Wassersport lag gar nicht mal daran, dass ich nicht (gut) schwimmen konnte. Das konnte ich! Mit Stolz trug ich sogar das Fahrtenschwimmer-Abzeichen mit den blauen Wellen auf meiner Badehose, das ich mir mit einer halben Stunde schwimmen und einem Sprung aus drei Metern Höhe verdient hatte. Über Wasser hätte ich mich also problemlos eine längere Zeit lang halten können. Ich hatte nur keine Lust dazu. Selbst als aktiver Triathlet freundete ich mich erst mit dieser Disziplin an, als ich für die Langdistanz trainierte.
Zu meinem Element wurde das Wasser nur, wenn ich mit meinen Eltern und Schwestern die Ferien am Meer verbrachte: an der Ostsee oder der Adria. An der jugoslawischen Küste sprang ich von Felsen ins klare, türkisblaue Wasser und schwamm schnell zurück ans Ufer, nur um wieder hineinzuspringen, diesmal statt mit einer Arschbombe mit einem Kopfsprung.
Meine Schwimmzüge waren damals schon kraulähnlich, den Kopf hielt ich allerdings stets über Wasser. Diese Technik hatte ich mir beim Ballspielen im Meer angeeignet. Um im Kampf um den nicht gefangenen Ball als Sieger hervorzugehen, beschleunigte ich, indem ich intuitiv die Arme rotieren ließ. Zum Schwimmen ganz ohne Ball konnte ich mich aber nicht aufraffen. Deshalb suchte ich nach einer Alternative. Und fand sie gleich hinter dem Haus.
Wir wohnten in Neuschönningstedt keine 150 Meter von den Oher Tannen entfernt, einem schönen, großen Waldstück, in dem ich schon häufig Jogger gesehen hatte. Vielleicht also laufen? Das war sicher nicht so rückenfreundlich wie Schwimmen – ich dachte an die Erschütterungen bei jedem Schritt – aber abrupt waren die Bewegungen nicht. Da mir nichts anderes einfiel, startete ich einen Testlauf und nahm mir vor, gut in mich hineinzuhören und zu stoppen, sollte die Wirbelsäule laut „Aua“ schreien. Die ersten Schritte ertrug sie ohne Murren. Ein kleiner Schlenker um den Friedhof am Rande des Waldes und schon war ich am Beginn des langen Hauptwegs mitten durch die dichten Baumreihen. Der Duft von Tannennadeln flutete meine Nase, dazu gesellten sich der Geruch von Erde und Moder. Diesen Pfad war ich bisher nur mit dem Rad gefahren auf dem Weg zum Training. Manchmal hatte ich hier einen Ball kickend unsere Sonntagsspaziergänge absolviert.
Ich blieb zunächst auf den großen Pfaden, denn die kleineren, so fürchtete ich, waren zu uneben und zu gefährlich für mich. Ich wollte nicht wegen einer Wurzel oder eine Kuhle stolpern und meinen Rücken einer ruckartigen Ausgleichsbewegung aussetzen. Ich joggte 20 Minuten lang und war mächtig stolz. So lange ununterbrochen die Beine rotieren zu lassen, fühlte sich für mich nach einer großen Leistung an. Ich kehrte nach Hause zurück und wartete ab, ob sich die Ameisen in den Beinen melden würden. Nichts geschah – und ich war erleichtert. Mit Joggen konnte ich in Bewegung bleiben. Auch, wenn der Unterhaltungsfaktor beim Herumrennen auf irgendwelchen Waldwegen für meinen Geschmack ausbaufähig war. Ich betrachtete Laufen als notwendiges Übel, um den Speckröllchen beizukommen und fit zu sein, wenn ich irgendwann wieder Fußball spielen durfte.
Die Freude am Joggen hielt sich auch deshalb in Grenzen, weil ich überhaupt kein Talent dafür hatte. Schon vor der Korsettphase war ich in der Schule fast immer der langsamste Junge gewesen und den anderen hinterhergelaufen. Die Aschenbahn unter meinen Füßen hatte stets einem Laufband geglichen: Ich hatte mich abgestrampelt wie ein Irrer, war aber nie vorangekommen. Ich war über 50 Meter lahm, ich war über 400 Meter lahm. Und hatte es einfach nur anstrengend gefunden. Eines war klar: Der deutsche Carl Lewis würde ich nicht werden. Nicht einmal der ungedopte Carl Lewis.
Schlimmer als Sprinten war nur Turnen. Das stand in meiner immerwährenden Hitliste der langweiligsten Sportarten gleich hinter Synchronschwimmen (allein schon, weil es Schwimmen beinhaltete) und Dressurreiten. Aber mein sportlicher Ehrgeiz hatte es mir geboten, sowohl bei den Sommer-, als auch bei den Winterbundesjugendspielen zumindest eine Siegerurkunde zu erkämpfen. Also hatte ich an der Teppichstange im Garten den Hüftaufschwung und Handstandabrollen geübt – was ziemlich oft eher ein Handstandrunterknallen war, wenn ich ungebremst auf den Boden rumste. Ich gab diesen Turnübungen eine erhebliche Mitschuld an meinem Rückenproblem. Welcher Wirbel war schon für so etwas gemacht? Der Bundespräsident hatte auch Schuld, denn die Urkunden trugen seine Unterschrift. Er hatte sich dieses Sportfest sicher ausgedacht.
Immerhin hatte ich es meist zur angestrebten Siegerurkunde gebracht, die ich in meinem Kinderzimmer neben all meine Fußballposter an die Wand hängte. Vielleicht ließ sich ja jemand durch das Wort „Sieger“ blenden.
Weder Laufen noch Schwimmen konnten bei mir also auch nur im Ansatz eine Begeisterung entfachen wie der Fußball. Was hatte mir der Doc als dritte Sportart zum Fitwerden empfohlen? Radfahren? Auch das erschien mir höchst überflüssig, solange man nicht von A nach B musste. Aufs Rad gestiegen war ich bislang nur, wenn ich zur Schule fuhr, zu Oma und Opa, zu einem Freund, zum Fußballtraining oder eine Zeitlang auch in die Straße meiner Flamme Iris. Weil ich hoffte, dass sie vielleicht genau dann aus dem Haus kommen würde, wenn ich dort entlangrollte. Zum Glück geschah das nie, denn ich wäre knallrot geworden, hätte kein vernünftiges Wort rausgebracht und höchstwahrscheinlich Reißaus genommen. Nach Iris kam Eva, Radstalking und Flirterfolg blieben unverändert.
Manchmal hatte ich mich auch notgedrungen aufs Rad geschwungen, wenn Vater und Mutter zur „gemütlichen“ Familienradtour am Wochenende riefen. Jetzt aber gab ich, gezwungenermaßen, dem Radfahren ohne (Mädchen-)Ziel eine zweite Chance. Zumindest einen gravierenden Vorteil hatte es ja: Ich musste meinen Eltern nicht erklären, wo ich mit dem Rad hinwollte und wo ich gewesen war. „Bewegung ist das A und O“ lautete das Totschlagargument.
Tatsächlich setzte ich mich nun öfter auf mein Herrenrad und strampelte los. Acht bis zehn Kilometer ziellos durch die Gegend. Mal nach Ohe, mal nach Glinde, wo als sportliche Herausforderung der „Glinder Berg“ zu bezwingen war, der auf einer Länge von etwa 500 Metern um zehn Meter in die Höhe schnellte. Für mich damals eine Bergetappe der höchsten Kategorie. Wenn Edeka Meier in Sichtweite kam, wusste ich, dass die Strapazen bald vorbei waren. Nur noch wenige Meter bis zum „Gipfel“, dem „Col de Glinde“, wie ich ihn später nannte. Mindestens 35 Meter über Null. Dass dort im Sommer kein Schnee lag, verstehe ich bis heute nicht.
In der Holsteinischen Schweiz ist es übrigens tatsächlich sehr hügelig. Wenn ich einen richtig guten Tag hatte und mich traute, dann … fuhr ich allerdings nicht dorthin, sondern in die Straße meiner neuesten Flamme Yvonne und hoffte, dass sie vielleicht jetzt gerade … Sie wissen schon.
Immerhin besaß ich mittlerweile ein Fahrrad, mit dem ich mich sehen lassen konnte. Das war nicht immer so. Als Siebenjähriger hatte ich mir zu Weihnachten ein schönes, neues Fahrrad gewünscht. Eines, wie echte Kerle es fahren, auch wenn sie noch kleine Kerle waren.
Als an Weihnachten die Stunde der Bescherung geschlagen hatte, war mein Herz vor Freude auf und ab gesprungen. Vor dem erleuchteten Tannenbaum war eines der Geschenke mit einem weißen Laken verhüllt, mehr breit als hoch, hatte es mir bis zum Bauchnabel gereicht und genau dort Ausstülpungen aufgewiesen, wo ein Fahrrad seine Lenker und Pedale hat. Das musste das heiß ersehnte Geschenk sein! Meine Klassenkameraden würden staunen und große Augen machen. Die Jungs würden neidisch sein. „Hoffentlich schneit es in den nächsten Stunden nicht“, hatte ich gedacht, weil ich am nächsten Morgen gleich losradeln wollte.
Langsam und vorsichtig hatte ich mich dem großen Geschenk genähert und über beide Backen gestrahlt, weil ich meinem Traum ganz nah war. Voller Ehrfurcht hatte ich das Laken mit Zeigefinger und Daumen behutsam zurückgezogen. Ich hatte ein Vorderrad mit glänzender Stahlfelge und nigelnagelneuer Bereifung gesehen; dann einen leicht geschwungenen Lenker mit – oh weh – roten Griffen. Nicht schön, aber da konnte ich drüber hinwegsehen. Ich hatte eine runde Klingel entdeckt. Die machte bestimmt ganz schön Alarm, wenn ich die anderen überholen wollte. Ich hatte noch weiter am Laken gezogen, den Rahmen gesehen – und war schockiert: das ganze Fahrrad war rot. Wieso um alles in der Welt schenkten mir meine Eltern ein Fahrrad für Mädchen? Ich wollte eines in Blau. Oder grau, schwarz, silbern, von mir aus gelb, zur Not grün, egal, aber doch kein Rot! Hatte ich das denn nicht gesagt? Nein, das hatte ich nicht, stimmt. Aber musste man den Eltern denn alles erklären? Oder gab es den Weihnachtsmann doch? Dessen Lieblingsfarbe schien ja rot zu sein ...
Wäre ich drei Jahre jünger gewesen, ich hätte bitterlich geweint, mich aus Verzweiflung auf den Boden geworfen und mit Fäusten und Füßen um mich geschlagen und getreten. Aber ich war schon groß, hatte einmal geschluckt und mich zusammengerissen, um meine entgleisten Gesichtszüge wiederherzustellen. Innerlich war ich tieftraurig, hatte aber die Contenance bewahrt, hatte mir alles genau angeschaut und scheinbar glückselig die rote Enttäuschung getätschelt. Dieses Weihnachten war gegessen, egal, was ich sonst noch geschenkt bekommen würde. Hoffentlich schneite es doch noch. Am besten die ganzen kommenden Tage.
Als ich die Wirbelsäulen-OP und das Korsett überstanden hatte, war das rote Rad natürlich längst Geschichte. Das Herumradeln um des Herumradelns willen mit meinem inzwischen blauen Herrenrad war mir damals aber trotzdem schon bald zu doof. So kam ich auf die Idee, dass ich mir die Radrennfahrer Dietrich Thurau und Bernard Hinault zum Vorbild nehmen könnte, die bei der Tour de France brillierten. Karl-Heinz Rummenigge und Lothar Matthäus konnte ich ja vorerst nicht mehr nacheifern. Die landschaftlichen Voraussetzungen dafür waren gegeben: Hinter unserer Siedlung war es eher ländlich, es gab Radwege zwischen den Feldern und nur ein paar kleine Ortschaften mit ruhigen Straßen Richtung Sachsenwald. Sollte sich herausstellen, dass ich wie gemacht war für eine Karriere als Träger des Bergtrikots, konnte ich am Glinder Berg üben – oder doch noch in die Holsteinische Schweiz fahren. Zuerst einmal musste aber ein Rennrad her. Ich testete zunächst, ob mein Rücken die dynamisch gebeugte Haltung auf einer solchen Tempomaschine mitmachen würde. Ich stellte den Lenker meines Herrenrades so tief wie möglich – mein Rücken murrte nicht. Die nächste Herausforderung: meinen Vater überzeugen. Doch auch der murrte nicht, als ich ihm meinen Wunsch mitteilte. Er fand die Idee mit dem Rennrad sogar gut. Vielleicht, weil er insgeheim fürchtete, dass er, der immer Probleme mit dem Rücken gehabt hatte, mir seine Wirbelprobleme vererbt habe? Jedenfalls schien er sich für mein Wohlergehen besonders verantwortlich zu fühlen.
Das Rennrad zu besteigen, erforderte allerdings einiges an Mut. Zwei Jahre zuvor hatte ich damit schlechte Erfahrungen gemacht, als ich bei meinem Cousin in England dessen Flitzer ausprobieren durfte.
Die Körperhaltung auf dessen Rad war gewöhnungsbedürftig, ich musste mich sehr weit nach vorne und unten beugen, um die Hände an die Griffe zu bekommen. Die Füße kamen in Schlaufen an den Pedalen. Wenn ich absteigen wollte, musste ich unbedingt daran denken, nicht seitlich von den Pedalen zu gleiten, sondern die Füße erst einmal nach hinten zu ziehen. Ich stürzte mich wagemutig in den Linksverkehr auf den Straßen der Kleinstadt Swindon. Der war verwirrender als ich gedacht hatte. Galt hier rechts vor links oder links vor rechts? Ich rollte auf eine Kreuzung zu, und intuitiv kurbelte ich mit den Beinen rückwärts, um anzuhalten und mich in Ruhe zu orientieren, wo ich mich einzuordnen hatte. Doch ich trat ins Leere und geriet in Panik. Was war das denn? Hatte ein Rennrad etwa keinen Rücktritt? Mist, warum sagt mir das keiner? Ich streckte meine Finger aus, um die Handbremsen am Lenker zu ziehen, doch es war zu spät. Ich schlingerte schon über die Straße. Hektisch versuchte ich, vom Rad zu steigen, um einen Sturz zu vermeiden, doch die Schlaufen hielten meine Füße auf den Pedalen. Der Vorderreifen knallte gegen den Bordstein und ich auf den Boden. Das Rad segelte hinterher und auf mich drauf. Zum Glück kamen wir beide mit ein paar Kratzern davon, und mein Cousin gehörte nicht zu der Gattung Rennradbesitzer, die jede Schramme ihres Bikes selbst miterleiden. Er lachte und ließ mich am nächsten Tag wieder in den Sattel seines Renners. Jetzt wusste ich ja, wie es ging. Dachte ich. Leider fand ich mich nach dem diesmal erfolgreichen Abbiegen als Geisterfahrer auf der falschen Fahrspur wieder. Ach ja, Linksverkehr. Also schnell bremsen und raus aus der Gefahrenzone. Bremsen, br… – erneut hatte ich vergeblich mit dem Rücktritt zu stoppen versucht. Erneut fand ich mich auf dem Boden wieder. Wieder war nichts weiter passiert, doch ich beschloss, mich nie wieder auf eine so lebensgefährliche Höllenmaschine zu setzen. Mein Cousin war nach meinem neuen Crash aber sowieso not amused und hätte das mit seinem Gefährt nicht mehr erlaubt. Jetzt reichte es sogar ihm. Das Rennrad und ich – in England war das nicht wirklich der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Jetzt aber, bei der Probefahrt mit dem roten Flitzer, in den der Ladenbesitzer meinen Vater und mich mehr oder weniger reingequatscht hatte (ich wollte eigentlich das blaue Rad im Schaufenster, aber damit hätte er 150 Mark weniger verdient), fühlte es sich kein bisschen komisch an. Hervorragende Gangschaltung, hochwertige Bremsen – die ich diesmal auch auf Anhieb fand – und ein erstaunlich komfortabler Sattel, der Fahrradhändler hatte beim Aufzählen der Vorteile dieses zweirädrigen Ferraris nicht übertrieben. Ich fand das Rad todschick, mit seinem weißen Sattel, der weißen Trinkwasserflasche, den weißen Hüllen über den Bowdenzügen und dem weißen Lenkerband. Außerdem verband ich mittlerweile mit Rot etwas völlig anderes als noch als Kind. War Rot nicht die Farbe der Kraft, der Willensstärke, der Leidenschaft – und des Oher Fußballtrikots? Es könnte was werden mit uns. Wenn nur die Bremsen nicht so grausam gequietscht hätten. Als würde man mit hundert Schraubenziehern an einem Autoblech entlangkratzen. Oder mit 200 Kreidestücken an einer Schultafel. Diese Radaubremse bremste zwar, machte aber auch ohrenbetäubenden Lärm, der durch Mark und Bein ging. Die ungeteilte Aufmerksamkeit meiner Mitmenschen wäre mir jedes Mal sicher. Ein Manko, das sich nicht nennenswert besserte, als der Fahrradhändler zweimal daran herumschraubte. Aber ich war trotzdem schon verliebt – und heißt es nicht ohnehin „wer später bremst, ist länger schnell“? So wurde ich stolzer Besitzer eines Rennrades. Der Beginn einer Freundschaft, die bis heute anhält. Auch wenn inzwischen der Rahmen meines Renners aus Carbon ist statt aus Stahl und die Schlaufen Klickpedalen gewichen sind.
Mit dem roten Flitzer fuhr ich ins grüne Umland. Glinde war passé, trotz der fordernden Bergetappe. Ich fühlte mich zu schnell und zu dynamisch für den Trubel auf den Bürgersteigen des Städtchens. Viel zu gefährlich. Für die Fußgänger. Überhaupt: Radrennfahrer dümpelten nicht auf Bürgersteigen herum, ihnen gehörte die Straße! Also eroberte ich mir die Landstraßen der Gegend, worin ich deutlich erfolgreicher war, als bei der Eroberung meiner „Radfahr-Flammen“. Fast 30 Kilometer lang war meine Hausrunde, und ich brauchte dafür keine 75 Minuten. Das waren 24 Kilometer pro Stunde – für mich, der sich joggend ja eher langsam fortbewegte, eine beeindruckende Geschwindigkeit. Und ich erreichte sie aus eigener Kraft!
Auf diese Weise schlich sich in zwei von drei Triathlondisziplinen eine Art Routine ein – ohne dass ich zu diesem Zeitpunkt an Triathlon dachte: Bei gutem Wetter im Frühjahr und Sommer stieg ich auf meinen zweirädrigen Ferrari und, wenn ich etwas Abwechslung brauchte, ging ich auch Laufen. Allerdings nie, wenn es regnete oder kalt war. Der Bewegungsdrang des ehemaligen Zappelphilipps war auf ein Normalmaß geschrumpft. Das Korsett hatte mich heruntergefahren. Ich joggte und radelte, um fit zu bleiben und weil ich gerne draußen war. Die Rückkehr zum aktiven Fußballspielen war nicht mehr die treibende Kraft hinter jedem Laufschritt und jeder Kurbelumdrehung.
Doch genau dieses Comeback erlaubte mir mein Arzt fünf Jahre nach der Operation. Ich war mittlerweile erwachsen geworden und studierte in Hamburg. Bei einer Nachuntersuchung ermunterte er mich: „Versuchen Sie doch mal, wieder Fußball zu spielen.“ Wahnsinn! Noch Stunden danach schwebte ich einen gefühlten Meter über dem Boden.
Mein Comeback stieg auf einem Bolzplatz in Hamburg-Horn. Um die Ecke wohnte mein bester Freund Stevie. Wir schleppten noch ein paar Freunde ran, sodass wir auf dem kleinen, hoch umzäunten Aschenplatz mit den Stahltoren fünf gegen fünf spielen konnten. Ich hatte trotz der jahrelangen Zwangspause nicht alles verlernt. Natürlich, anfangs war ich noch vorsichtig. Nur nicht zu plötzlich abstoppen, nicht zu heftig drehen. Es dauerte allerdings nur ein paar Minuten, bis ich voll und ganz im Spiel aufging und einzig damit beschäftigt war, wie der Ball nach gekonnten Spielzügen am besten im Tor der Gegner landete. Allerdings war es für mich völlig zweitrangig, ob meine Mannschaft bei diesem Just-for-fun-Kick gewann oder verlor. Ich schüttelte den Kopf, wenn irgendjemand meckerte, weil ein Teamkamerad eine große Chance vergeben hatte, oder schlechte Laune bekam, weil ein Pass fehlschlug. Meine Güte, dachte ich, wir kicken hier zum Spaß. Und den habe ich am ehesten, wenn wir mit Doppel- und Dreifachpässen und Hacke, Spitze, eins, zwei, drei, den Ball laufen lassen. Vielleicht geht er ins Tor. Dann jubeln wir, als wären wir Weltmeister geworden. Und wenn nicht, dann eben nicht.
Nach meinem Premieren-Match horchte ich besorgt in mich hinein: Was machte die Wirbelsäule, die operierte Stelle? Wagen sich die blöden Ameisen aus ihrem Loch? Doch es geschah nichts dergleichen, auch nicht am Abend, und nicht am nächsten Morgen. Der Arzt hatte recht gehabt: Ich konnte wieder Fußball spielen. Ob das mit dem Gewichtheben auch funktioniert hätte, habe ich allerdings nicht ausprobiert.
Doch anders als damals das Kettcar, legte ich das Rennrad nicht still, nur weil ich den Fußball (wieder-)entdeckt hatte. Darauf meine Runden zu drehen, war zur liebgewonnenen Gewohnheit geworden. Es verbesserte meine Kondition, was mir auch auf dem Platz zugutekam. Und das Radfahren bekam bald darauf noch auf andere Weise einen ordentlichen Schub. Stevie suchte Begleitung für einen größeren Fahrradtrip im Sommer.
Er war im Jahr zuvor auf zwei Reifen durch Schottland getourt und hatte an dieser Art des Reisens Gefallen gefunden. Nun schlug er vor, mit der Bahn über Budapest bis in den Südosten Ungarns nach Szeged zu fahren. Dort könnten wir auf unsere Räder steigen, dann zunächst nach Rumänien rollen, weiter nach Bulgarien, nach Jugoslawien, Griechenland, anschließend mit der Fähre in die Türkei und die Reise in Istanbul beenden. Nie wäre ich von allein auf eine solche Reiseroute gekommen. Wir schrieben das Jahr 1990, und gerade erst war der Eiserne Vorhang gefallen. Der sozialistische Osten hatte mich bisher eher auf schaurige Art fasziniert. Eine unheimliche Parallelwelt, die ich nicht recht fassen konnte. Und jetzt sollte ich Urlaub dort machen? Die Strände und Berge mochten schön sein, aber Komfort durfte der Reisende sicher nicht erwarten. Dennoch sagte ich Stevie, dass ich es mir überlegen würde.
Denn es klang für mich auch überaus reizvoll, sich einen Teil der Welt anzuschauen, der 40 Jahre lang abgeschottet war. Zumal mir im Jahr zuvor im Frankreichurlaub mit einem Freund klar geworden war, dass es so gar nicht mein Ding war, nichts anderes zu tun, als nach dem Frühstück ans Meer zu gehen, am Strand in der Sonne zu liegen und Mädchen hinterherzugucken, die ich eh nie ansprechen würde. Nach anderthalb Wochen an der Atlantikküste hatte ich die Nase voll. Geplant waren vier.
Eine Radreise könnte die Lösung meiner Urlaubstristesse sein. Bewegung, frische Luft und jeden Tag etwas Neues erleben. Zweieinhalbtausend Kilometer auf dem Fahrrad in fünf Wochen waren zwar viel, und ich kannte die zwei Freunde von Stevie, die ebenfalls mitradeln wollten, kaum. Aber ich wollte dieses Wagnis versuchen. Ich überwand mich also, das langweilige Bekannte gegen etwas Radabenteuer einzutauschen.