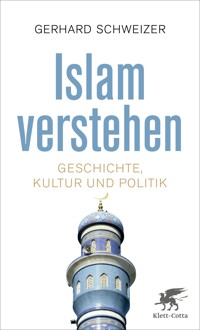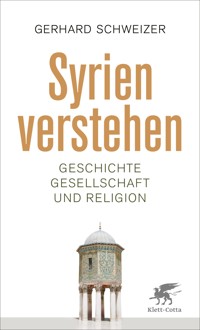17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
In der Fremde lernen wir nicht nur unbekannte Kulturen kennen, sondern auch unsere eigene. Gerhard Schweizer hat Europa und den Westen immer wieder hinter sich gelassen. Er ist nach Nordafrika, in dien Arabische Welt und nach Asien aufgebrochen, um unbekannte Welten zu erkunden. Eindrucksvoll schildert er Länder, Menschen und Abenteuer, die sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt haben. Durch die weltweite Globalisierung und Vernetzung sind die Menschen immer näher zusammengerückt. Aber gleichzeitig fehlen uns ein tieferes Verständnis und die Akzeptanz für andere Kulturen. Nationalismus, Populismus und Rassismus sind auf dem Vormarsch. Und Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit sind in vielen Ländern Fremdwörter geblieben. Um die gegenwärtigen Entwicklungen, Veränderungen und Konflikte zu verstehen, brauchen wir eine breitere Kenntnis unseres eigenen und der fremden Kulturräume. Schlüsselbegriffe wie Individuum, Familie, Gesellschaft, Staat, Glaube und Freiheit haben von Land zu Land völlig andere Bedeutungen. Oft endet die Verständigung an deren Grenzen. Gerhard Schweizer plädiert für einen offenen Blick gegenüber dem Fremden, aber auch für eine reflektierte Wertschätzung der eigenen Kultur. Dies ist der Schlüssel zu einem friedlichen Miteinander in den kommenden Jahrzehnten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Ähnliche
Gerhard Schweizer
Mit offenem Blick
Begegnungen mit fremden Kulturen
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2020 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung eines Fotos von © iStock, zodebala
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96377-9
E-Book: ISBN 978-3-608-12040-0
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Einleitung Über die eigene Kultur hinaus
Faszination und Irritation
Begegnungen mit dem touristischen Ich
Eine schwierige Konfrontation
»Orient« und andere Träume
Eine erste Ernüchterung in Marokko
»Ich merke, Sie sind Tourist«
Eine zweite Ernüchterung in Tunesien
Ein Fremder in einer Oase
»Unberührte« Insel in Tunesien
Reisen wollen oder reisen müssen?
Unterwegs mit türkischen »Gastarbeitern«
Grenz-Erfahrungen
Erste Spannungen mit »Gastarbeitern«
Aus der Zeit gefallen
Begegnungen in einem abgeschotteten Afghanistan
Die Vorboten einer problematischen Globalisierung
Ein anderes Afghanistan
Als das »ganz Fremde« noch weit entfernt war …
Erfahrungen in Indien vor mehr als fünfzig Jahren
Ist das Globalisierung?
Offene Fragen in Indien
Begegnungen mit Gauguin und Robinson
Sehnsucht nach Inseln in Thailand
Zerstört der Tourismus, was er sucht?
Verlustängste in Thailand
Wo ist Asien noch »Asien«?
Begegnungen in einem abgeschotteten Nepal
Touristen – und nur negative Folgen?
Die ganz andere Überraschung in Nepal
Reisen im globalisierten Zeitalter
Aktuelle Fragen in China
Wir werden »besichtigt«
Asiatische Touristen in Europa
Beginn einer Völkerwanderung
Folgenschwerer Nebeneffekt der Globalisierung
»Unsere Vorfahren sind nie gereist«
Unterwegs in überfüllten Zügen
Der erste Anstoß zur globalen Migration
Es begann in Europa
Wachsender Reichtum, wachsende Armut
Türkische Migranten
»Wie viele Einwohner? Das weiß nur Allah«
Ägyptische Migranten
Reichtum – für wen?
Indische Migranten
Rasantes Wirtschaftswachstum
Chinesische Migranten
Droht der Kollaps?
Offene Fragen angesichts der weltweiten Völkerwanderung
Soziale und religiöse Krisen
Marokko – ein Beispiel unter vielen
Entwurzelte Muslime
Ein sozialer Konflikt – noch ohne religiöse Dimension
Frustration und Fremdenfeindlichkeit
Wie sich ein Konflikt hochschaukelt
Verwestlichung? Islamisierung?
Die gespaltene Gesellschaft
Entwurzelte Muslime und »Heiliger Krieg«
Strukturen weit über Nordafrika hinaus
Abschied von Tausendundeiner Nacht
Ein anderes Bewusstsein des Reisens
Zusammenprall der Kulturen
Die Vielschichtigkeit der Migration
Wie fremd sind Zuwanderer?
Verblüffende Gespräche in der Türkei
Das Problem der Parallelgesellschaften
Muslimische Zuwanderer in Europa
Migration und Heimat
Wachsende Spannungen im Zeichen der Globalisierung
Epilog Ich bin ein Europäer
Auf Umwegen zurück zur eigenen Kultur
Anhang
Anmerkungen
Ausgewählte Literatur
Personen-, Orts- und Sachregister
Für Brigitte
Einleitung Über die eigene Kultur hinaus
Faszination und Irritation
Kamele und Dattelpalmen … Frauen in leuchtend bunten Saris, Männer mit Turban(1) … Pagoden inmitten von Reisterrassen … Es sind stereotype Sehnsuchtsbilder für Reisende, die einen starken Kontrast zum eigenen Kulturraum(1) suchen. Aber eine meiner ersten grundlegenden Erfahrungen unterwegs war, dass ich die größten Überraschungen nicht dann erlebte, wenn ich mich erwartungsvoll auf die Oberflächenexotik konzentrierte, die jeder Reiseprospekt anbietet. Die verblüffendsten Einsichten stellten sich vielmehr bei meinen zahlreichen, oft beiläufig erscheinenden Gesprächen mit Einheimischen ein.
So wurde ich anfangs meist gefragt, ob ich verheiratet sei, welchen Beruf ich ausübe, welcher Religion(1) ich angehöre. Und solche Gespräche mündeten immer wieder in Diskussionen darüber, was die Unterschiede zwischen Menschen in westlichen Industriegesellschaften und denen in anderen Kulturen(1) seien. Im Detail ging es um Differenzen im Verständnis von sozialem Leben, von Politik(1), von Religion(2), von Toleranz(1), von Freiheit, von Individualität. Gerade die Diskussionen, die sich meist zufällig in Eisenbahnabteilen, in Autobussen, in Teestuben, in Basaren, in religiösen(3) Kultstätten ergaben, führten mich immer wieder über bisher vertraute Denkmuster hinaus.
Fremde(1) Kulturen(2) verstehen … Mit offenem Blick reisen, die Welt erfahren …
Im vorliegenden Buch schildere ich am Beispiel meiner Reisen(1), wie schwierig es ist, nun tatsächlich über die festgefügten Strukturen unseres eigenen Kulturraums(2) hinauszudenken. Mögen auch die Städte weltweit in ihrem Erscheinungsbild mit Betonwohnblocks und Hochhäusern nach dem Vorbild westlicher Zivilisation immer gleichförmiger werden, mag auch die Kleidung im westlichen Stil global immer uniformer erscheinen, mag auch der Gebrauch einer international genormten Technik in die letzten Winkel der Welt vordringen – unter dem Firnis einer solchen Globalisierung(1) überdauern trotzdem tiefgehende Unterschiede zwischen den einzelnen Kulturen(3). Diese Problemlage werde ich anhand zahlreicher Begegnungen während meiner Reisen veranschaulichen. Hierbei lege ich besonderes Gewicht auf Beobachtungen, wie sie jeder Reisende(2) mit Lust am Entdecken, mit Neugier auf fremde Kulturen(4) machen kann.
Je intensiver sich westliche Reisende(3) – wie auch westliche Leser – auf die Begegnung mit fremden Kulturen(5) einlassen, desto deutlicher wird für sie, dass die eigenen Maßstäbe ihre scheinbar objektive, scheinbar universale Allgemeingültigkeit verlieren. Ich versuche, die vorhandenen Vorurteile und Missverständnisse zu veranschaulichen, die sich bei dem Blick auf das Fremde(2) ergeben, und beschreibe die Begegnung mit dem »ganz Anderen« als eine Selbsterfahrung mit vielen Entwicklungsstufen. In diesem Zusammenhang gehe ich auf den Grundgedanken ein, dass das Reisen in die Ferne auf erstaunlich verschlungenen Umwegen zu einer intensiven Begegnung mit der eigenen Kultur(6) zurückführen kann. Der Umweg über die Ferne hilft, Europa(1) und den »Westen« aus einer neuen Perspektive, von außen zu sehen und gerade auf diese Weise verändert wahrzunehmen.
Was bedeutet es, unverwechselbar ein Europäer(2) zu sein – im Kontrast zu fremden Kulturen(7)? Ich schildere Schauplätze von Nordafrika über Vorderasien(1) und Indien(1) bis in den Fernen Osten(1), weil ich diese seit nahezu sechzig Jahren aus eigener Erfahrung kenne – und dabei Europa(3) verstehen gelernt und mich selbst als Europäer(4) entdeckt habe.[1] Die Begegnung mit fremden Kulturen(8) bedeutet gerade auch eine Selbsterfahrung, eine Begegnung mit dem eigenen Ich, oder präziser ausgedrückt: mit dem touristisch(1) ausgeprägten Ich. Die Auseinandersetzung mit diesem Aspekt soll aber nicht das Subjektive in den Vordergrund rücken, sondern soll verdeutlichen, dass der individuelle Blick auf das Fremdartige gar nicht so individuell ist, denn dieser Blick ist stark von gesellschaftlichen Prägungen abhängig.
Diese Erfahrungen schildere ich vor dem Hintergrund, dass das Phänomen des Reisens(4) in den vergangenen zwei Jahrhunderten epochalen Veränderungen ausgesetzt war. Über viele Jahrhunderte waren nur Diplomaten, Kaufleute und Pilger auf weiten Reisen(5) unterwegs, ansonsten Notleidende auf Arbeitssuche und politisch(2) Verfolgte; die touristische Neugier auf fremde Welten ist folglich eine relativ junge Erscheinung. Diese neue Form des Reisens(6) hat Mitte des 18. Jahrhunderts in Westeuropa(1) begonnen und Mitte des 19. Jahrhunderts breitere Schichten des wohlhabenden Bürgertums erfasst. Eine große Dynamik hat diese Entwicklung allerdings erst in den 1960er- und 1970er-Jahren erfahren, als nun in westlichen Industriestaaten auch das Kleinbürgertum und die Arbeiterschaft sich zunehmend die touristische Mobilität leisten konnten. Nach Angaben der »World Tourism Organization« wurden 1950 erst rund 25 Millionen Reisende(7) gezählt, die von einem Land in ein anderes unterwegs waren. Im Jahr 2018 waren es bereits 1,4 Milliarden Touristen, Tendenz weiter steigend.[2] Das Bedürfnis des touristischen(2) Reisens(8) hat aber inzwischen auch Völker uns fremder Kulturen(9) erfasst. All das sind Entwicklungen, deren Ursachen und Konsequenzen zu hinterfragen sind.
Meine eigene Biographie fügt sich in diesen globalen Umbruch ein. Ich wurde 1940 geboren und reiste 1960 erstmals außerhalb der Grenzen Europas(5). Damals konnte ich noch eindringlich erleben, was es bedeutet, in Ländern unterwegs zu sein, die bis dahin noch kaum von Touristen(3) bereist wurden – die aber Jahrzehnte später vom Massentourismus(4) überrollt worden sind. So gehörte etwa zu einer meiner ersten grundlegenden Erfahrungen, dass ich oft innerhalb weniger Stunden den Eindruck hatte, von einem Jahrhundert in ein anderes zu wechseln – so in Regionen, in denen noch immer das Kamel oder das Maultier und nicht das Auto für den Warenverkehr über weite Strecken zuständig war, in denen der Ochse noch immer als Zugtier für Karren diente und nicht der Traktor. Es waren Regionen, in denen die meisten Bewohner noch immer nur eine vage Vorstellung davon besaßen, was sich außerhalb ihrer kleinen überschaubaren Lebenswelt abspielte. Aber ebenso bedeutete es für mich eine grundlegende Erfahrung, dass sich solch völlig autonom existierende Kulturräume innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten drastisch veränderten, indem auch dort die westliche Zivilisation vordrang – und sich dort ein starkes Konfliktpotential entwickelte. Auf derartige kulturelle(10) Umbrüche werde ich mit eigenen Beobachtungen besonders eingehen. Es sind Erlebnisse von der »Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen«, wie der Philosoph Ernst Bloch(1) diese grundlegende Konfliktkonstellation unserer Moderne benannt hat. Und es sind Veränderungen, die wir vor dem Hintergrund der Globalisierung(2) sehen müssen. Gekoppelt daran sind die Fragen, ob nun die positiven oder negativen Auswirkungen überwiegen, ob sich durch die Umbrüche weltweit der Wohlstand vermehrt oder ob sich nicht die Kluft zwischen reichen und armen(1) Regionen vertieft.
Zu einer weiteren wichtigen Erfahrung gehört in diesem Zusammenhang gerade auch, mit einer harten sozialen Realität konfrontiert zu sein: mit ausgedehnten Elendsvierteln(2), die in den Ballungszentren großer Städte durch Zuwanderer(1) aus verelendeten Dörfern entstanden sind. Die Probleme von Armut(3) und sogenannter Unterentwicklung sind aber inzwischen nicht nur eine schmerzhafte Erfahrung, die man in »Entwicklungsländern« selbst machen kann. Die Situation hat sich spätestens seit den 1990er-Jahren dramatisch dahingehend verändert, dass die Wanderungsströme der Notleidenden keineswegs mehr allein in den Großstadtslums ihres Heimatstaats enden – inzwischen ist aus der Binnenmigration(1) eine globale Migration geworden, und sie wird in westlichen Medien häufig als der »Beginn einer Völkerwanderung« bezeichnet. Die Notleidenden der sogenannten Dritten Welt(1) gelangen aufgrund verbesserter Verkehrswege bis nach Europa(6) und brechen in dem Glauben auf, dort noch am ehesten soziale Sicherheit zu finden sowie finanziell überleben zu können. Hinzu kommen in immer größerer Zahl Flüchtlinge(1) aus Bürgerkriegsregionen in Vorderasien(2) und Afrika(1). Angesichts derartiger Umbrüche werden die Befürchtungen immer intensiver, dass eine solch massenhafte Zuwanderung(2) von Menschen aus fremden Kulturen(11) in Europa einen »Zusammenprall der Kulturen(12)« zur Folge haben könnte. Die Konsequenz wäre, dass die Europäer(7) in ihrer eigenen kulturellen »Identität(1)« nachhaltig erschüttert würden.
Der Begriff »fremde Kulturen(13)« verliert spätestens hier den Charme des Exotischen und bekommt eine völlig neue Bedeutung. Wir, die Bewohner saturierter westlicher Industriestaaten, waren es bisher gewohnt, die Einzigen zu sein, die in größerer Zahl in weit entfernte Länder reisten oder in sie eindrangen. Diese Entwicklung begann im Zeitalter des Kolonialismus(1), damals waren es Eroberer mit dem Gefühl einer zivilisatorischen Überlegenheit, und seit dem 20. Jahrhundert sind es zunehmend westliche Geschäftsreisende(9) und Touristen(5). Umso irritierter reagieren wir in westlichen Industriestaaten, wenn nun umgekehrt Menschen aus fremden Kulturen(14) in immer größerer Zahl nach Europa(8) und Nordamerika(1) kommen, also »bei uns eindringen«. Neben »Gastarbeitern« sowie Flüchtlingen(2) aus Elendsgebieten(4) der islamischen(1) Welt und Afrikas(2) sind es längst auch Geschäftsleute und Touristen(6) aus dem wirtschaftlich aufstrebenden Fernen Osten(2).
Eine solche Entwicklung kann hochinteressant erscheinen und die intellektuelle Neugier wecken, weil »unsere« Gesellschaft mehr als bisher »multi-kulturell(1)« sein wird. Eine solche Entwicklung kann aber auch beträchtliche Ängste auslösen. Das Letztere gilt besonders dann, wenn arbeitssuchende(1) Zuwanderer(3) die ungelösten politischen(3), sozialen und religiösen(4) Konflikte ihrer Heimat(1) mitbringen und es schwer haben, sich in die westliche Gesellschaft zu integrieren.
In diesem Zusammenhang ergeben sich weitere Fragen: Weshalb sind viele der westlichen Industriestaaten relativ wohlhabend, weshalb »entwickelt«? Und weshalb bleiben ausgerechnet viele Länder der islamischen(2) Welt sowie auch im südlichen Asien(1) »unterentwickelt«? Es handelt sich doch um Kulturräume, die einige Jahrhunderte früher in mancher Hinsicht jenen des Abendlands an Errungenschaften voraus waren.
Andererseits treffen wir heute in Ostasien(1) auf Staaten(1), die noch vor nahezu sechs bis sieben Jahrzehnten ebenfalls als »Entwicklungsländer« oder bestenfalls als »Schwellenländer« galten, inzwischen sind sie aber wirtschaftlich, politisch(4) sowie kulturell(15) zu Konkurrenten für westliche Industriestaaten geworden. Die Welt des Fernen Ostens(3) ist durch diesen Wandel nicht mehr so fern, aber auffällig nah rückt sie uns erst dadurch, dass ihre Menschen nun immer mehr auch in Europa(9) präsent sind, ob als Geschäftsleute oder als Touristen(7). Diese so gegensätzlichen Entwicklungstendenzen lassen es umso dringlicher erscheinen, dass wir uns mit fremden Kulturen(16) auseinandersetzen.
Das Jahr 2020 bringt allerdings durch die globale Ausbreitung des Corona(1)-Virus noch weitere sehr ambivalente Signale einer Veränderung. Wir erleben, dass durch eine Seuche mit bisher nicht gekannten Ausmaßen soziale, wirtschaftliche sowie politische Strukturen in der ganzen Welt einer Zerreißprobe ausgesetzt sind. Über nachhaltige Folgen sind seriöse Analysen allerdings erst nach vielen Monaten oder gar erst in einem Jahr möglich. Daher werde ich im vorliegenden Buch auf diesen Aspekt nur am Rand eingehen. Doch Begegnungen mit fremden Kulturen sind auch schon lange vor der Corona(2)-Krise mit einer Fülle von Problemen aufgeladen gewesen, die noch Jahrzehnte aktuell bleiben werden.
Ich beginne aber mit Schilderungen aus den Anfängen meiner »Entdeckungsreisen(10)«, als ich noch Schwierigkeiten hatte, über das subjektive Erleben – meine eigenen touristischen(8) Befangenheiten – hinaus das Fremde(3) wahrzunehmen.
Begegnungen mit dem touristischen Ich
Eine schwierige Konfrontation
»Orient« und andere Träume
Eine erste Ernüchterung in Marokko(1)
»Aladin lebt noch in Marokko(2). Tausend und eine Nacht und viele schöne Ferientage gilt es zu erleben.« So las ich in einem Ferienkatalog der Tourist-Reisen(11) im Sommer 1984. »Tetuan(1) ist schon von weitem sichtbar mit seinen Türmen und schneeweiß schimmernden Häusern, das begeisternde Traumbild einer morgenländischen Stadt.« Diese Hymne stammt aus einer Werbebroschüre für eine Marokko(3)-Rundreise von Ikarus-Tours 1990.
Fast drei Jahrzehnte zuvor, im Oktober 1960, war ich zum ersten Mal über die Grenzen Europas hinausgekommen. Ich war über Frankreich(1), Spanien(1) und die Meerenge von Gibraltar nach Marokko(4) gereist – ein Flug war damals noch zu teuer. In Tetuan(2) hatte ich das erste Mal »orientalische« Atmosphäre erlebt. Allerdings gab es 1960 nur wenige Reiseprospekte; der Tourismus(9) in außereuropäische Länder befand sich noch in seinen Anfängen. Aber hätte ich solche Prospekte damals zu sehen bekommen, hätte ich diesen Texten voll und ganz zugestimmt. Eine solch psychologisch effektvolle Werbung entsprach exakt meinen Bedürfnissen.
Tetuan(3), die als märchenhaft angepriesene Stadt, war mein erstes größeres Ziel im äußersten Norden Marokkos(5). Als sich der Bus Tetuan(4) näherte, genoss ich diesen ersten Blick genauso, wie er im Reiseprospekt beschrieben wurde: eine Stadt mit einer Vielfalt an Minaretten und Kuppeln. Orient? Aber vom Balkon meines Hotelzimmers blickte ich auf einen Platz, auf dem westlich gekleidete Marokkaner(6) überwogen, ein Platz, auf dem Autos und Motorräder parkten. Ein solcher Platz bedeutete für mich noch Europa(10), ein südländisches Europa(1) zwar, aber eben doch Europa – deutlich geprägt von der spanischen(2) Kolonialherrschaft(2) in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja, hier zeichnete sich für mich bereits in ersten Ansätzen eine Art Einheitszivilisation der Zukunft ab: überall auf der Welt ähnliche Häuser, die gleiche westliche Bekleidung, Autos und Motorräder, Shops und Restaurants.
In jenem Oktober 1960 suchte ich, ein zwanzigjähriger Student, den »Orient« als Kontrast zur eigenen Lebenswelt. Ich fand den »Orient« – nur wenige Gehminuten von meinem Hotel entfernt. Abrupt endete die linealgerade Neustadtstraße bei einem rotgetünchten Stadttor mit maurisch geformtem Bogen. Dahinter betrat ich ein Labyrinth gewundener Gassen, zu eng für jedes Auto, wimmelnd von Menschen in bunter Kleidung, Kapuzenmänteln, Turbanen. Fast alle Frauen waren mit Gesichtsschleiern und Kopftüchern verhüllt … Zwischen die flirrenden Farben schoben sich als weitere Farbtupfer Reiter auf Eseln, Männer mit Handkarren, beladen mit Obst oder Stoffballen. Dazwischen immer wieder völlig unerwartete Ausblicke auf Kuppeln, Minarette, Torbögen und Dachfirste, alle kunstvoll ornamentiert – eine Architektur, deren Verfeinerung und Charme mir jedem historisch gewachsenen Viertel abendländischer Städte gleichrangig erschienen.
In dieser Altstadt von Tetuan(5) erfuhr ich 1960 jenes einmalige, unwiederholbare Überraschungsmoment, abrupt nicht nur in eine völlig andere Kultur(17), sondern auch in eine weit zurückliegende Epoche katapultiert zu sein. Das sei eine Welt, die um vieles farbiger und um vieles sinnenfreudiger wirke als die unserer westlichen Zivilisation. So schrieb ich 1960 in mein Reisetagebuch. Zwar biete auch schon eine historisch gewachsene Altstadt in Europa(11) ein kontrastreiches Flair zu einer gleichförmigen Allerweltsarchitektur – aber das Orientalische sei eine Steigerung, sei in seiner Andersartigkeit nicht zu übertreffen. Mehr noch: Hier sei man mit einer Kultur konfrontiert, die sich viel langsamer verändere als die unsere. Nicht diese Hektik, bei der man sich ständig auf neue Veränderungen einstellen müsse, nicht diese Hektik, durch die das Gewohnte und Vertraute allzu rasch verschwinde, nicht diese Hektik, die doch nur dazu diene, alle kulturelle(18) Vielfalt zu vernichten.
Orient … Ich habe einleitend bereits darauf hingewiesen, dass die Begegnung mit fremden Kulturen(19) auch eine Selbsterfahrung, eine Begegnung mit dem eigenen Ich, bedeutet. Eine solch immer wieder neu gewonnene Einsicht rückt mir besonders die Anfänge meiner Entdeckungsreisen in ein neues Licht. Gerade mit Blick auf die 1960er-Jahre werde ich mir selber fremd. Und vergleiche ich die Erwartungshaltung von damals mit meinem späteren Verhalten, so wird mir nachdrücklich klar, wie vielschichtig, ja wie widersprüchlich die Begegnung mit dem »ganz Anderen« sein kann.
Die Neustadt von Tetuan(6) … Außer dem Weg vom Hotel zum Tor der Altstadt durchstreifte ich nur flüchtig die linealgeraden Straßen mit ihren Bauten im spanischen(3) Kolonialstil(3). Aber gerade am Rand der Neustadt erlebte ich eine weitere Überraschung, die zu den prägenden Eindrücken meiner ersten Reise in den Orient gehören sollte.
Nahe dem Stadttor sprach mich ein junger Marokkaner(7) auf Französisch(1) an. Er, in Bluejeans und Poloshirt, war Student der Ingenieurswissenschaften, wohnte in Casablanca(1) und war jetzt für ein paar Tage hier zu Besuch bei seinen Eltern. Er interessierte sich für die beruflichen Chancen in »Allemagne(1)«. Er wolle unbedingt im Ausland arbeiten, vielleicht auch auf Dauer im Ausland leben. Warum das? Der junge Marokkaner(8) machte eine wegwerfende Handbewegung. Es gebe hier so wenig Chancen. Warum ich eigentlich nach Marokko(9) käme, fragte er. Ich erzählte ihm von meinen Eindrücken in den verwinkelten Gassen der Altstadt von Tetuan(7), dieser so »andersartigen Kultur(20)«. Kultur? Seine Augenbrauen schnellten hoch. Kultur befinde sich hauptsächlich in der Neustadt, ich müsse die neue Siedlung unbedingt sehen, welche am Westrand von Tetuan(8) entstehe, der moderne Standard dort unterscheide sich in nichts von Wohnvierteln in Frankreich(2). – Ich würde aber gerade den Unterschied suchen, mir käme es darauf an, das kennenzulernen, was die orientalische Kultur grundsätzlich von der westlichen unterscheide.
Orientalische Kultur(21) … Er dehnte die Vokale unwillig, indem er meinen Tonfall nachahmte. »Orient? Was ist das?« Er betonte jedes Wort bei dieser Frage und erklärte dann: Das sei ein Schlagwort, das von den Europäern(12) erfunden worden sei. Er wies mit einer kurzen Handbewegung auf einen vorbeigehenden Mann mit Turban(2) und Burnus. Ob ich so etwas mit orientalischer Kultur meine? So etwas würde in zwanzig bis dreißig Jahren völlig verschwunden sein. Er prophezeie mir schon heute, dass Marokko(10) sich in ein bis zwei Generationen völlig von den alten Traditionen gelöst haben werde. Alle Marokkaner(11) seien dann westlich gekleidet und nicht mehr von Europäern(13) zu unterscheiden. Auch die Frauen … Er wies mit einer vagen Kopfbewegung zu einer völlig verhüllten Gestalt hin. Solche verschleierten Frauen werde es auch bald nicht mehr geben.
Ich schwieg. Und ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass ich es schade fände, wenn dieses Flair völlig von Marokkos(12) Straßen verschwände. Schließlich sagte ich: Natürlich müsse sich einiges verändern, aber radikale Reformen würden die eigentlichen Probleme nicht lösen. Alles, was zu schnell gehe, provoziere Rückschläge, rufe Widerstand hervor. – Widerstand bei wem? Seine Frage kam in scharfem Ton. Bei einem Großteil der Bevölkerung, antwortete ich. Bei ungebildeten Leuten, widersprach er. Ob ich Sympathie für die reaktionäre Haltung ungebildeter Leute hätte?
Wieder schwieg ich. 1960 war ich auf solch eine Diskussion noch nicht vorbereitet, vor allem nicht, wenn der Gesprächspartner derart emotional reagierte. Noch am selben Tag stellte ich mir die Frage, ob ich auch dann noch die islamische Welt bereisen würde, wenn der äußere Reiz bunter Exotik an Intensität verlieren würde.
1960 war Marokko(13) gerade vier Jahre aus der Kolonialherrschaft(4) entlassen worden. Weder die spanischen(4) Kolonialherren(5) im Norden noch die französischen(3) im Süden hatten ihre Fremdherrschaft gegen den wachsenden Widerstand länger aufrechterhalten können. Unter den Marokkanern(14) herrschte damals großer Zukunftsoptimismus, zumal Sultan Mohammed V.(1) noch regierte, der als eine Symbolfigur der Unabhängigkeitsbewegung wie auch als Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft verehrt wurde. Irritierend erschien mir damals nur die Begegnung mit dem jungen Marokkaner(15) in Tetuan(9), der unbedingt im Ausland arbeiten wollte, weil er in der Heimat(2) keine Chance sah.
1960 konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich Marokko(16) nur zwei Jahrzehnte später als ein Land erleben würde, das von sozialen und religiösen(5) Spannungen zerrissen war. Und dass ich mir dann, während der Regierungszeit von Sultan Hassan II.(1) von 1961 bis 1999, rückblickend folgende Frage stellen sollte: War Marokko(17) bei meiner ersten Begegnung noch völlig anders gewesen – oder hatte mich nur mein anderer Blick auf das Fremde(4) an einer genaueren Wahrnehmung gehindert?
Diese Frage hat sich jedoch zu Beginn des 21. Jahrhunderts, seit Marokko(18) unter der Herrschaft des Sultans Mohammed VI.(1) steht, keineswegs erledigt. Im Gegenteil. Nun kam ein weiterer kritischer Punkt hinzu: Die international vernetzten Organisationen al-Qaida(1) und Islamischer Staat(1) (IS) konnten besonders in Marokko(19) sozial und kulturell(22) entwurzelte Muslime(3) für Terroranschläge im eigenen Land sowie weltweit anwerben. Ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit eingeprägt haben sich bis heute die Attentate(1) in Casablanca am 16. Mai 2003 mit 40 Toten und über 100 Verletzten, in Madrid am 11. März 2004 mit 192 Toten und rund 2050 Verletzten und in Marrakesch am 24. April 2011 mit 17 Toten. Laut einer Statistik des Jahres 2016 rangierten Marokkaner(20) an vorderster Stelle, die als Zuwanderer(4) im damaligen Herrschaftsgebiet der Terror(1)-Organisation Islamischer Staat(2) lebten.[1] Solche Muslime(4) schockieren mit ihrem tiefen Hass gegen den »Westen« (darüber mehr im Abschnitt Entwurzelte Muslime(5) und »Heiliger Krieg(1)«).
Wie diese Widersprüche auf einen Nenner bringen? Fragen wie diese sollten mich auf weiteren Reisen(12) begleiten.
»Ich merke, Sie sind Tourist«
Eine zweite Ernüchterung in Tunesien(1)
Hinter mir hörte ich auf Französisch(2) die Frage, aus welchem Land ich käme. Neben mir ging plötzlich ein etwa vierzigjähriger Mann, der sich mit seinem weißen Burnus(1) und dem roten Fez(1) äußerlich in keiner Weise von anderen Männern dieser traditionellen Umgebung unterschied. »Oh, Sie sind aus Deutschland(2)?« Zu meiner Verblüffung redete er mich nun auch noch in fließendem, beinahe akzentfreiem Deutsch(1) an. Er freue sich, einen Deutschen(3) in Tunis(1) zu treffen. Ob er mich zu einer Tasse Tee einladen(1) dürfe? Er habe schon seit Wochen mit keinem Deutschen(4) mehr gesprochen.
Es war im September 1962. Wir saßen in einer Teestube der Altstadt mit Blick auf eine Moscheekuppel. Wie mir Tunis(2), wie mir Tunesien(2) gefalle, lautete seine einleitende und wenig überraschende Frage. Ich antwortete, Tunis würde zu Recht als eine der interessantesten Städte des Landes gelten, Tunis(3) übertreffe alle meine Erwartungen, ich könne mich nicht sattsehen an der orientalischen Architektur, den bunt gekleideten Menschen, dem Flair …
Der Tunesier(3) hörte mir lächelnd – und, wie mir schien, mit skeptisch hochgezogenen Augenbrauen – zu. Dann kam eine für mich verblüffende Frage: Ob ich es nicht hier sehr schmutzig fände? Er wies mit einer weitausholenden Handbewegung von der Moscheekuppel über die Hauswände hin zur Gasse.
Schmutzig? Ich entdeckte bei näherem Hinsehen Risse und bröckelnden Verputz an den Mauern, allerlei Abfall in den Rinnsteinen der Gasse. Ich tat die Entdeckung mit einem Kopfschütteln ab. So etwas störe mich nicht. – Aber in Deutschland(5) sei doch alles sauber und sehr geordnet, sagte er. – Zu sauber, zu geordnet, sei in Deutschland(6) alles, antwortete ich und erschrak über meinen Affekt. Er registrierte meine Antwort sichtlich irritiert. Diese Gasse hier, sagte ich und suchte nach Worten, habe eine ungewöhnliche Atmosphäre, sie sei sehr exotisch …
Er lachte. »Ich merke, Sie sind Tourist«, sagte er.
Es schmerzte mich, dass er mich als Touristen(10) bezeichnete. Für einen Moment entstand eine quälende Pause.
Woher er so gut Deutsch(2) spreche, wollte ich wissen. Ob er es in Deutschland(7) gelernt habe? – Nein, dort sei er bis jetzt nicht gewesen. In Tunis(4) habe er Deutsch(3) gelernt. – Was er beruflich mache? – Er sei ein Tourist Guide. – Ob es hier in Tunis schon viele Touristen(11) gebe, fragte ich überrascht. Er antwortete: Einzelreisende(13) gebe es eher selten, aber Reisegruppen seien öfter hier. Er führe Reisegruppen. Heute Abend käme eine französische(4) Reisegruppe, nächste Woche eine deutsche(8). Der Tourismus(12) habe in Tunesien(4) eine große Zukunft. Jawohl, die Gruppen würden mit dem Flugzeug anreisen, auch das sei die große Tendenz für die Zukunft. Er lächelte, als ich ihm erklärte, ich sei auf dem Landweg über Italien(1) bis nach Palermo(1) und von dort mit dem Schiff nach Tunis unterwegs gewesen. – Wie lange ich denn gebraucht hätte? – Drei Wochen habe das gedauert, ich hätte mir ja in Italien(2) manche Stadt angesehen. – Und der Rückweg wieder drei Wochen? – Ja, ich hätte Semesterferien, ich hätte Zeit dafür. Er zog wieder die Augenbrauen hoch. Bei diesem Punkt hatte er offenbar Schwierigkeiten, mich zu verstehen.
Nachdem wir Tee getrunken hatten, begleitete er mich noch plaudernd bei einem Bummel durch die Gassen. Plötzlich nahm er seinen Fez(2) ab und setzte ihn mir auf den Kopf, betrachtete mich amüsiert und führte mich zu einem Spiegel bei einer Basarbude. Ich war wenig begeistert bei dem Anblick, mein Gesicht erschien mir zu blass im Kontrast zu dem tiefroten Fez. Oh nein, oh nein, beschwichtigte er, das sehe sehr gut aus, ich solle jetzt auch noch seinen Burnus(2) anziehen. Ich zögerte. Er klopfte mir lachend auf die Schulter. »Das ist exotisch«, sagte er. Ich zögerte immer noch, war aber neugierig, welche Kleidung bei ihm unter dem traditionellen Umhang zum Vorschein kam.
Ich blickte auf eine westlich geschnittene Jacke, ein kariertes Hemd und Bluejeans. Der Tunesier(5) merkte mein Erstaunen und schien nun seinerseits irritiert. Er zog sich den Hemdkragen zurecht, als hätte ich dort eine Unregelmäßigkeit entdeckt. Dann sagte er: Er müsse mich unbedingt fotografieren. Ob er dürfe? Er klopfte mit der Hand an meine Fototasche, bevor er mich unter einen weißgetünchten Torbogen führte. Meine Kamera bediente er sehr routiniert, als habe er das schon oft gemacht. Dann klatschte er in die Hände und winkte einem Vorbeigehenden, den er zu kennen schien. Er bat ihn, ein Foto von uns beiden zu machen. Er stellte sich neben mich: ein westlich gekleideter Tunesier(6) und ein tunesisch gekleideter Westler auf einem gemeinsamen Bild. »Das ist exotisch«, sagte er nun noch einmal mit breitem Lächeln, wobei ich schwer einschätzen konnte, inwieweit er das ironisch meinte. Anscheinend verfuhr er in dieser Art mit seinen französischen(5) und deutschen(9) Reisegruppen.
Ob er in seiner Freizeit eher traditionelle oder westliche Kleidung bevorzuge, wollte ich wissen. – Mal dies, mal das. – Ob er in der Neustadt oder in der Altstadt wohne? – In der Neustadt. – Weshalb in der Neustadt? – Es sei dort modern. – Er bevorzuge also den Lebensstil dort? – Er schätze das eine, er schätze das andere. – Er sehe also zwischen beiden Verhaltensformen keinen Widerspruch? – Nein. Er schätze das eine, er schätze das andere, wiederholte er beharrlich.
»C’est moyen âge« … Plötzlich wies er mit einer schwungvollen Geste auf einen Mauleselreiter mit grellrotem Turban(3) und setzte auf Deutsch(4) hinzu: »Das ist Mittelalter«. Er sagte das in einem Ton, als ob er jetzt Fremdenführer sei und er genau wüsste, was sein Kunde von ihm an Erklärungen erwarte. Und wieder schien es mir so, als ob eine leichte Ironie in seiner Stimme läge. Wie dachte er über die Fremden? Ob er mich nicht durch die Altstadt führen könne, fragte er mit einem Mal. Er biete mir einen Spezialpreis. – Nein, danke, ich hätte schon alles gesehen. – Das sei unmöglich. Nur mit einem Guide könne man alles sehen. Er biete mir einen besonderen Preis. – Ich sei gewohnt, alles auf eigene Faust zu erkunden. – Er biete mir einen Spezialpreis, einen Spezialpreis, ja? Als es ums Geschäftliche ging, stellte er seine Beharrlichkeit nun erst recht unter Beweis. Er folgte mir noch durch mehrere Gassen, ununterbrochen auf mich einredend. »Ich bin kein Tourist«, betonte ich. »Einen Spezialpreis«, wiederholte er.
Wie ihm erklären, dass ich mich im Gegensatz zu einem Touristen(13) als einen Reisenden(14) betrachtete, der … ja, was eigentlich? Eine derartige Diskussion war schon mit Deutschen(10) ein Problem. Alle Touristen(14) seien bisher mit ihm zufrieden gewesen, erklärte er.
Es war eine schmerzliche Erfahrung, Tourist zu sein.
Ein Fremder in einer Oase
»Unberührte« Insel in Tunesien
Als »Tourist« – eine Einsicht, der ich mich auf Dauer nicht entziehen konnte – reiste ich weiter ins Landesinnere. Ich kam nach Sousse(1) und Kairouan, deren historisch gewachsene Altstädte ihren »orientalischen Charme« noch ganz bewahrt hatten. Von dem Tourist Guide in Tunis abgesehen konnte ich 1962 noch mit dem Gefühl reisen, dass die meisten Einheimischen mich nicht als »Touristen(15)« betrachteten, sondern als einen der eher seltenen Fremden, auf den man in den meisten Städten und erst recht in Oasen neugierig war. In den Neustadtvierteln sprach ich allerdings vorwiegend mit Tunesiern(7), die meist westlich gekleidet waren, eine Schule besucht hatten und Französisch(3) beherrschten. Charmant und großzügig wie sie waren, luden mich viele zu einer Tasse Tee(2) ein. Mich überraschte es, dass etliche fragten, wie denn die Arbeitsbedingungen in Deutschland(11) seien. Könne man als Tunesier(8) ein Arbeitsvisum für Deutschland(12) bekommen? Solche Fragen erinnerten mich an den jungen Marokkaner(21) in Tetuan(10). Ebenso wie er sahen sie nur geringe Chancen, sich beruflich im eigenen Land entfalten zu können.
Wie das? Tunesien(9) war 1956, im selben Jahr wie Marokko(22), aus der französischen(6) Kolonialherrschaft(6) in die Unabhängigkeit entlassen worden. In Tunesien regierte seit 1957 Habib Bourguiba(1), der in Paris(1) Jura und Politikwissenschaft(1) studiert hatte und mit einer Französin verheiratet war. Wie der marokkanische Sultan Mohammed V.(2) war auch er zu einer Ikone der Unabhängigkeitsbewegung geworden. Viele meiner tunesischen(10) Gesprächspartner sahen 1962 in Bourguiba(2) einen Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft, einen erfolgversprechenden Vertreter einer »arabischen(1) Moderne«. Bei meinen Rundgängen durch die Städte und die Dörfer spürte ich nichts auf, was diesem Zukunftsoptimismus fühlbar widersprochen hätte.
Im Süden des Landes, in den Randzonen der Sahara, traf ich aber auf eine Atmosphäre, die mir noch weitgehend unberührt von modernen Umbrüchen erschien. Ich kam in Oasen, die wie Inseln anmuteten.
Es begann in der Oase Gabès(1). Der Hauptort der Oase (mit gleichem Namen) war allerdings schon damals eine Kleinstadt mit linealgeraden Straßen und nüchternen Häusern, die typischerweise zum Erbe der französischen(7) Kolonialherrschaft(7) gehören. Meine Wanderungen durch die ausgedehnten Palmenhaine und die ockerfarbenen Lehmziegeldörfer führten mich jedoch in ein vergangenes Jahrhundert. Die Dörfer mit ihren sanften, den Hügeln angepassten Silhouetten schienen aus der Landschaft zu wachsen; sie waren nicht wie der Hauptort als eckige Fremdkörper in die Palmenhaine hineingeklotzt. Dazu die Stille. Vogelgezwitscher, hier und da das Trappeln von Maultierhufen, das Knarren einer Brunnenwinde, das Murmeln eines Baches. Die Menschen noch im Einklang mit der Natur? Ich zögerte, meine Eindrücke mit solch abgenutzten Formulierungen in meinem Reisetagebuch festzuhalten. Wie aber hätte ich mich stattdessen ausdrücken sollen?
Und dann fand eine Begegnung statt, für die ich fast keine passenden Worte fand. Am Rand eines der Lehmziegeldörfer traf ich auf Menschen, die einen Kreis gebildet hatten um tanzende Berberinnen, die in ihre bunte Tracht gekleidet waren. Man hatte sich zu einer Hochzeit eingefunden, wie mir ein junger Mann in gebrochenem Französisch(4) erklärte. Etwa eine Viertelstunde stand ich mitten unter den Zuschauern, als der junge Tunesier(11) mir einen älteren Mann als Vater des Bräutigams vorstellte. Ich sei eingeladen(3), an dem Hochzeitsessen teilzunehmen. Wenig später saß ich mit dem Vater, seinem Sohn und einigen Verwandten in einer der Lehmhütten. Auf dem Boden stand eine große Messingschüssel, gefüllt mit Reis und Hammelfleisch. Frauen jedoch waren nicht anwesend, auch die Braut bekam ich nicht zu sehen. Die Männer, in Burnus(3) und Turban(4), aßen mit der rechten Hand, indem sie Reis in die Soße tunkten, zu Bällchen formten und mit Fleischstücken zum Mund führten. Zum ersten Mal aß ich auf diese traditionelle Weise. In solchen Dörfern war es noch nicht wie in den städtischen Restaurants üblich, mit Messer und Gabel zu essen.
(4)Ich war verlegen. Weshalb war ich, ein völlig Fremder, noch dazu ein Ausländer mit anderer Kultur(23) und Religion(6), zum Hochzeitsessen eingeladen worden? Die vielen Gäste, die einen Kreis um die Tänzerinnen gebildet hatten, nahmen nicht am Festmahl teil; sie schauten uns von draußen durch die glaslosen Fensteröffnungen beim Essen zu. Die Lehmhütte war äußert karg ausgestattet; es musste sich um eine der ärmeren Familie handeln, für die eine Mahlzeit mit Fleisch fast unerschwinglich war und einen seltenen Luxus bedeutete.
Wie sollte ich mich für diese völlig überraschende Gastfreundschaft(5) bedanken? Auch bei späteren Einladungen in der Oase Gabès(2) und in anderen Oasen sollte mich diese Frage immer wieder aufs Neue bedrängen. Geld geben? Das hätte meine Gastgeber womöglich beleidigt – insoweit war ich schon durch Lektüre zum Thema fremde Kulturen(24) vorbereitet. Meine drei Kugelschreiber verschenken? Das erschien mir lächerlich. Ausgiebig plauderte ich mit dem jungen Mann, der als Einziger Französisch(5) verstand. Er dolmetschte den anderen Männern, was ich über meine Heimat(3) »Allemagne(13)« erzählte. Das war ein Land, das die meisten wohl vom Hörensagen kannten, das ihnen aber wohl wie ein ferner Stern vorkommen musste. Mein ausführlicher Bericht war offensichtlich die richtige Antwort auf die völlig unerwartete Gastfreundschaft(6). Denn noch bildeten Individualtouristen, die den Kontakt mit Einheimischen schätzten, eine willkommene Ausnahme. Noch schienen Fremde(5) die einzige Gelegenheit zu bieten, etwas über die Welt jenseits des eigenen engen Lebensraums erfahren zu können. Dieser Sachverhalt galt selbst noch für viele Tunesier(12) in bereits westlich geprägten Stadtvierteln, wenn auch abgeschwächt. Immer wieder hatte ich dort die Auskunft erhalten, Ausländer seien willkommen, allein von ihnen könne man wirklich interessante Informationen über das Ausland bekommen. In Tunesien(13) würden Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen massiv zensiert.
Ein Zeitsprung in die Gegenwart. Tunesien(14) zählt inzwischen wie Marokko(23) zu jenen Ländern des islamischen(6) Kulturraums(3), in denen die Bevölkerung tief gespalten ist in eine Minderheit wohlhabender und eine Mehrheit notleidender Menschen. Es sind Länder, in denen es immer wieder zu heftigen Unruhen wegen drastischer Erhöhung der Lebensmittelpreise kommt.
In Tunesien(15) war in den 1980er-Jahren, als ich zum zweiten Mal das Land bereiste, kaum noch etwas vom Elan der anfänglichen Reformpolitik(5) zu spüren. Zwar lernte ich etliche Männer wie auch Frauen der Bildungsschicht(1) kennen, die sehr interessiert mit mir über die Herausforderung der westlichen Moderne diskutierten (dies teilweise sogar auf Englisch(1) oder Deutsch(5)). Aber Bourguiba(3) war im Verlauf von zwei Jahrzehnten zu einem autokratisch regierenden Staatspräsidenten mutiert. Die Situation verschärfte sich 1987, als der damalige Ministerpräsident Ben Ali(1) putschte, das Amt des Staatspräsidenten übernahm und unverhohlen als Diktator regierte. Anfangs führte Ben Ali(2) zwar etliche Sozialreformen durch, aber unter ihm versumpfte Tunesien(16) binnen kurzem in Korruption(1) und Misswirtschaft. Je mehr sich danach die Kluft zwischen Arm(5) und Reich vertiefte, umso explosiver wurde die Lage. Ende Dezember 2010 kam es zu schweren Unruhen; im Januar 2011 musste Diktator Ben Ali(3) fliehen. Dieser historische Augenblick löste jene Unruhen gegen Ausbeutung und Despotie aus, die innerhalb weniger Monate die gesamte arabische(2) Welt erfassten und als »Arabischer Frühling« die Menschen begeisterten. Dann aber folgten neue Korruption und Misswirtschaft.
Von Tunesien(17) aus versuchten besonders viele sozial Entwurzelte, Europa(14) zu erreichen; allein dort hofften sie, wirtschaftlich überleben zu können. Die Entwicklung verlief auffallend ähnlich zu den Ereignissen in Marokko(24). Als die Hoffnung enttäuscht wurde, schlug die Stimmung um, und in Tunesien – wie auch schon in Marokko(25) – kam ein schreckliches Übel hinzu: Sozial entwurzelte Tunesier(18) ließen sich in immer größerer Zahl von radikal-islamischen(7) Organisationen wie der al-Qaida(2) oder dem Islamischen Staat(3) (IS) für Terroranschläge(2) anwerben. Weltweit haben sich besonders jene Attentate(2) eingeprägt, die sich gegen westliche Touristen(16) richteten: Der Anschlag im Bardo-Museum von Tunis(5) am 18. März 2015, bei dem 24 Menschen starben und 42 verletzt wurden, wie auch der mörderische Angriff am Strand von Sousse(2) am 26. Juni desselben Jahres mit 40 Toten und 36 Verletzten. Und in Europa gab es Attentäter(3) mit tunesischer Herkunft: so in Nizza(1) am 15. Juli 2016 mit 86 Toten und über 400 Verletzten, so auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin(1) am 19. Dezember desselben Jahres mit 11 Toten und 55 Verletzten. Die sozial entwurzelten Tunesier meinten, in solchen Organisationen die Anerkennung, die sie so sehnlichst und schmerzlich vermisst hatten, noch am ehesten zu erlangen. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts rangierten junge Marokkaner(26) und junge Tunesier(19) international an vorderster Stelle unter den radikal-islamischen(8) Terroristen(3).
Rückblickend musste ich mich fragen: Gab es in Marokko(27) und Tunesien(20) während meiner ersten Reise 1962 keine größeren sozialen Spannungen? Herrschte noch kein Affekt gegen den »Westen«? Oder hatte mich auch in Tunesien ein anderer Blick auf das Fremde(6) daran gehindert, genauer hinzusehen?
Reisen(15) wollen oder reisen müssen?
Unterwegs mit türkischen »Gastarbeitern«(1)
(2)Koffer, Kisten, verschnürte Kartons und Stoffballen waren zwischen den beiden Sitzreihen im Zugabteil gestapelt. Ich konnte nur mit angezogenen, stark abgewinkelten Beinen auf meinem Platz kauern. Zwei Tage, zwei Nächte saß ich so, ohne viel Schlaf, mit ständig überreizten Sinnen, während sich der Zug durch Serbien(1), Makedonien(1), Bulgarien(1) quälend langsam Richtung Türkei(1) bewegte. Alle saßen wir so, ich war der einzige Europäer(15) unter Türken. Meinen reservierten Platz hatte ich beim Zustieg in München(1) durch ein heftiges Wortgefecht erkämpfen müssen, weil sich schon sieben Männer, eingehüllt in beißendem Zigarettenqualm, auf sechs Sitze zusammendrängten. Wie einen Eindringling, der sich in der Tür geirrt haben musste, hatten sie mich angestarrt, bis mir einer der Männer schließlich doch geholfen hatte, meinen Rucksack zwischen den vielen Gepäckstücken zu verstauen.
Das war Mitte Oktober 1964. Ich war zu einer »Orientreise« aufgebrochen, die mich nicht nur in die Türkei(2), sondern weiter in den Iran(1) – und falls die Grenzen offen waren – über Afghanistan(1), Pakistan(1), Indien(2) und noch weiter nach Südostasien(1) führen sollte. Auch 1964 gab es noch keine preisgünstigen Charterflüge, mit denen sich mühelos große Entfernungen zurücklegen ließen. Noch immer benötigten neugierige Reisende(16) mit beschränkten finanziellen Mitteln viel Zeit, falls sie über die Grenzen Europas(16) hinauskommen wollten. Und so näherte ich mich der Türkei auf dem Landweg, nicht anders als damals die Türken. Es waren »Gastarbeiter«(3). Das Wort machte in den 1960er-Jahren noch Sinn, weil die meisten Türken(3) noch nicht an einen Daueraufenthalt in (2)westeuropäischen Ländern dachten. Die Männer, die mit mir im Abteil saßen, waren unterwegs zu einem Heimaturlaub. Sie gehörten zur ersten Generation jener »Gastarbeiter«(4), die seit 1961 von Deutschland(14) angeworben wurden.
Ich näherte mich jedoch einem Staat(2), der sich stark von Marokko(28) und Tunesien(21), den bisher von mir bereisten Ländern, unterschied. Ein Staat(3), in dem 1923 durch Atatürk(1) ein radikaler Bruch mit »orientalischen« Traditionen vollzogen worden war. Der Begründer der Republik Türkei(4) hatte traditionsbewusste Muslime(9) mit folgenden Worten abgekanzelt: »Es gibt verschiedene Länder, aber nur eine Zivilisation. Voraussetzung für den Fortschritt der Nation ist, an dieser einen Zivilisation teilzuhaben.«[2] Atatürk(2) hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass er mit dieser »einen Zivilisation« die westliche meinte. Entsprechend wies Atatürk(3) auch die uns so vertraute Vorstellung zurück, dass man einen tiefen Gegensatz zwischen »Orient« und »Okzident« zu sehen habe: »Es gibt keine Kontrastierung zwischen Orient und Okzident, sondern nur eine zwischen Rückständigkeit und Moderne.«[3] Und diese Überzeugung teilten auch viele seiner Nachfolger.
Die Türken(5) im Zugabteil entsprachen in ihrem Äußeren weitgehend solchen programmatischen Erklärungen Atatürks(4). Sie waren durchwegs westlich gekleidet, ja, sie hatten sich mit ihren Hemden, Jacken und Hosen anscheinend an der neuesten Konfektion deutscher(15) Kaufhäuser orientiert. Nur einer der Männer trug eine weiße, »orientalisch« anmutende Kappe, dazu hatte er einen grauen Kinnbart. Aber alle wirkten sie nervös. Das Reisen(17) mit der Eisenbahn, vor allem im Ausland, schien ihnen ungewohnt zu sein.
Diese erste Begegnung mit der Türkei(6) bescherte mir nicht die erwartete Erfahrung von der völligen Andersartigkeit einer fremden Kultur(25). Trotzdem führte mich das Jahr 1964 in eine andere Epoche – in eine Türkei, die sich von der Türkei des 21. Jahrhunderts beträchtlich unterschied.
»Warum reisen Sie?« Dies war die erste Frage der »Gastarbeiter«(5) im Zugabteil an mich. Ob ich Freunde in der Türkei(7) besuchen wolle? – Nein, ich wolle Istanbul(1) besichtigen, wolle dann weiter nach Bursa(1), dann ins Landesinnere, wolle dort unbedingt die Felsenkirchen von Göreme(1) besichtigen … »Besichtigen«, wiederholte schließlich einer der Männer zögernd dieses Wort, als buchstabiere er ein Fremdwort. Und in seinen Augen lag die stumme Frage: Warum besichtigen? – Ich wolle fremde Länder kennenlernen, erklärte ich. Der Mann schien mich nicht zu verstehen. Die anderen ebenfalls nicht. Ich sagte noch: Vielleicht würde ich auch ans Meer fahren, etwa nach Antalya(1), die Südküste solle ja recht schön sein. Die Männer wechselten rasche Blicke. Keiner dieser Dorfbewohner wusste von der Existenz dieses frühen Badeorts an der türkischen Südküste. Keiner hatte bisher das Meer gesehen.
Im weiteren Verlauf des Gesprächs erfuhr ich, dass diese Männer in der Türkei(8) bisher kaum eine Reise unternommen hatten – es sei denn, einen Besuch bei Verwandten und Freunden in einer nahegelegenen Stadt, es sei denn, auf der Suche nach Arbeit. Deshalb waren sie letztlich auch nach Deutschland(16) gekommen. Sie hatten aber selbst in Deutschland(17) kaum die Stadt verlassen, in der sie arbeiteten. Sie hatten dort überwiegend unter Türken(9) gelebt, ja, hatten möglichst den Kontakt zu Türken gesucht, die aus derselben Heimatstadt, demselben Dorf oder wenigstens derselben Region stammten.
Für mich waren dies 1964 sehr fremd anmutende Auskünfte. Umgekehrt musste ich aber auch für diese Männer ein exotisches Wesen sein. Derartige Verständnisbarrieren konnte es allerdings nur in den 1960er-Jahren geben. Noch reisten wenige Ausländer in die Türkei(10), noch waren die Strände nicht mit Hotelburgen verbaut. Eine solche Entwicklung setzte erst Mitte der 1980er-Jahre ein. Und erst recht existierte noch keine türkische(11) Mittelschicht, die sich vom Verhalten ausländischer Touristen(17) beeinflussen ließ und etwa zum Badeurlaub ans Meer fuhr oder kulturelle(26) Sehenswürdigkeiten in der Türkei besichtigen wollte. Eine Reise zu einem Wallfahrtszentrum war bis dahin für viele die einzige Möglichkeit gewesen, fremde Orte kennenzulernen.
Noch in den 1960er-Jahren lebte ein Großteil der Türken(12), vor allem die Kleinstädter und Bauern, weitgehend in einer abgekapselten, in sich geschlossenen sozialen Welt. Dies ließ sich schon an der Verwendung bestimmter Begriffe ablesen, wie ich Jahre später einer Studie entnahm. So sprachen etwa die meisten türkischen Bauern noch um 1960 von »gurbet«, von »der Fremde(7)«, wenn sie Gebiete außerhalb des eigenen Dorfes oder Kreisbezirks meinten. Pauschal reihten sie alle türkischen Städte unter dem Begriff »die Fremde(8)« ein. Erst nachdem die Bauern arbeitssuchend(2) nicht nur in die Städte des eigenen Staates(4) abwanderten, sondern als »Gastarbeiter«(6) bis nach Westeuropa(3) strömten, begannen sie die Türkei(13) insgesamt als »Heimat(4)« zu bezeichnen.[4]
Wie »orientalisch« aber war oder ist ein solches Verhalten? Wäre ich hundert oder zweihundert Jahre zuvor in Deutschland(18) unterwegs gewesen, hätte ich zur Genüge auf Deutsche treffen können, die nicht anders als die Türken(14) reagiert hätten. So verwendeten etwa deutsche(19) Bauern noch Anfang des 19. Jahrhunderts das Wort »Ausland« für die außerhalb der Hofmarkung gelegenen Felder, und den Begriff »Heimat(5)« bezogen sie in erster Linie auf die eigene Wohnstätte, das »Heim«.[5] Ein Reisender(18) zu sein mit Neugier auf das Fremde(9) oder mit dem Bedürfnis, sich außerhalb des Heimatorts zu erholen, war damals sogar in Westeuropa(4) nur die Angelegenheit einer schmalen Schicht gewesen – und für die Mehrheit der Bevölkerung nicht nachvollziehbar. Die meisten Deutschen(20), ja Westeuropäer(5) verließen ihren Heimatort nur, um Verwandte zu besuchen oder sich auf eine Pilgerreise zu begeben. Oder sie wollten der Not entkommen und suchten Arbeit in einer nahegelegenen Großstadt. Und wenn sich auch dort keine neue Existenz begründen ließ, reisten die Notleidenden weiter ins Ausland, wanderten sogar in ferne Kontinente aus, etwa nach Amerika(1) oder Australien(1). Es waren Menschen, die nicht reisen wollten, sondern reisen mussten.
Die erwachende Reiselust(19) des (6)westeuropäischen Bürgertums im 19. Jahrhundert ist aber nicht vom Prozess der rasch um sich greifenden Industrialisierung zu trennen. Denn die Industrialisierung schuf Wohlstand für eine ebenso rasch wachsende bürgerliche Mittelschicht, die nun reisen konnte wie einst nur der privilegierte Adel. Hinzu kam, dass der zunehmende Lärm und die Abgase von Fabriken sowie die Wanderungsströme arbeitssuchender Zuwanderer(5) die Städte immer hektischer machten. In der Folge sind die von Lärm und Hektik verschonten Kleinstädte und erst recht viele der Dörfer, vor allem aber eine »unberührte« Natur plötzlich zu Sehnsuchtsorten von Großstädtern geworden. Der religiös(7) geprägte Begriff »Paradies« bekam in diesem Zusammenhang eine verweltlichte, sentimental aufgeladene Bedeutung. Im 20. Jahrhundert sind dann in Westeuropa(7) auch immer mehr das Kleinbürgertum und schließlich Teile der Arbeiterschaft zu Touristen(18) geworden, angesteckt von der Reiselust(20) des Bürgertums. Dies alles war aber nur möglich geworden, weil auch in diesen Schichten der Bevölkerung der Wohlstand wuchs, die Verkehrsmittel technisch weiterentwickelt und erheblich billiger wurden.
Von diesem Bedürfnis nach freiwilligem Reisen(21) waren die Türken(15) im Eisenbahnabteil weit entfernt. Trotzdem erschienen sie mir nicht wirklich fremd, denn diese Männer hätten genauso europäische(17) Vergangenheit repräsentieren können. Ich sah mich Türken(16) gegenüber, die völlig der Einschätzung Atatürks(5) zu entsprechen schienen: weniger »orientalisch«, eher »rückständig«. Eine Rückständigkeit, die nach Meinung Atatürks(6) verschwinden würde, sobald solche Männer sich nicht nur im Äußeren, sondern auch geistig und seelisch den Standards des »Westens« angenähert hätten.
Oder waren sie doch nicht so »westlich«? Zwischendurch konnte ich beobachten, dass die Männer, einer nach dem anderen, eine Perlenschnur hervorholten und mit angespanntem Gesicht oder gar mit geschlossenen Augen einige Sätze murmelten. Waren es Gebete? Offensichtlich waren es Gebete. Den Anfang hatte jener Mann mit der »orientalisch« anmutenden Kappe und dem grauen Kinnbart gemacht, und die anderen folgten seinem Beispiel. Wie religiös(8), wie »islamisch(10)« waren die Männer? Wie sehr einem kleinstädtischen oder gar dörflichen Islam(11) verhaftet? Wie konservativ waren sie in ihren gesellschaftlichen Wertvorstellungen?
Einer der Türken(17) holte aus seiner Brieftasche ein Foto hervor, das an den Ecken schon reichlich abgegriffen war. »Familie«, erklärte er. Der Zeigefinger glitt über die porträtierte Gruppe, in deren Mitte mit patriarchalisch anmutender Würde ein alter Mann thronte, der Großvater. Neben ihm war er selbst, der Sohn, platziert, daneben zwei jüngere Brüder, der eine noch ein Halbwüchsiger. Im Hintergrund sah man drei Frauen mit Kopftüchern, über die er mich allerdings nicht aufklärte. Auf dem Boden lagerte ein Dutzend Kinder, die ich nicht zählte. »Familie«, wiederholte er mit offensichtlichem Stolz. »Heimat(6)«, setzte er hinzu und betonte dabei gerade dieses deutsche(6) Wort ganz besonders. Heimat? Er bezog dieses Wort nicht auf den eigenen Staat(5), wie es für viele Europäer(18) seit dem 19. Jahrhundert selbstverständlich geworden ist, ja, nicht einmal auf das eigene Dorf – vielmehr auf die eigene Familie, den engsten überschaubaren Lebensraum.
Zwei der Türken(18) beklagten sich, es sei schwer in einem fremden Land über Jahre ohne Familie zu leben. Die anderen nickten zustimmend. Sie wohnten in München(2), in einem Zimmer mit vier Männern, erklärten die einen. Die anderen lebten nahe Frankfurt(1) in Barackenlagern, sechs, sieben, acht Männer in einem Raum, Bett an Bett. Er hoffe, irgendwann seine Familie nach Deutschland(21) holen zu können, sagte einer. Alle nickten. Ja, ihre Familie nachzuholen, das sollten sie tun, stimmte ich zu. Dann fielen mir ihre starr werdenden Augen auf. Sie bekämen keine Genehmigung, um die Familie nachzuholen, antwortete einer.
Ich hatte Mühe, meine Verlegenheit zu verbergen. Dieser Kontrast zu meinen Lebensbedingungen: Ich hatte in einer saturierten Wohlstandsgesellschaft die freie Wahl, einige Monate mein Studium an der Universität zu unterbrechen und auf einer – wie sollte ich es nennen? – Abenteuerreise, einem Selbsterfahrungstrip, unterwegs zu sein. Hierbei konnte ich mit einem Höchstmaß an sozialen Absicherungen rechnen. Ich nannte meine Situation auch eine »fade«, »wattegepolsterte Sicherheit«, weil solche Absicherungen zugleich auch Einschnürungen und Einengungen durch allerlei Verpflichtungen nach sich zogen. Diese Leute dagegen sehnten sich genau nach dem Zustand, dem ich wenigstens für kurze Zeit entkommen wollte. Ihnen blieb gar keine andere Wahl, als sich vorbehaltlos nach dieser einschnürenden Sicherheit zu sehnen.
Ob sie große Probleme in Deutschland(22) hätten, fragte ich schließlich zögernd. »Deutschland(23) gut«, antwortete einer der Türken(19) rasch. Keiner widersprach. »Gutes Land«, sagte auch mein Sitznachbar. Die anderen schwiegen. Ich wusste nicht, ob ich aus ihren Gesichtern Zustimmung oder Ablehnung ablesen sollte. Ich dachte an die überfüllten Massenunterkünfte, über die man in deutschen(24) Medien 1964 schon zur Genüge hatte lesen können, an die überhöhten Mieten für miserable Zimmer, an das abweisende Gebaren vieler Deutscher(25). In Deutschland(26) seien die Politiker(6) nicht so korrupt(2) wie in der Türkei(20), sagte mein Sitznachbar, in Deutschland(27) werde für die Arbeiter besser gesorgt.
(7)Beim Essen waren sie gesprächig geworden. Sie packten Brot, Oliven, Schafskäse, Tomaten aus ihren Bündeln aus. Dann boten sie mir von ihrem Essen an und gewährten mir eine Gastfreundschaft(8), die mich wieder einmal verlegen machte. Nun packte ich meinen Proviant ebenfalls aus. Mit nobler Geste lehnten sie meine Wurst und meinen Käse ab, um mir weiterhin beharrlich Schafskäse, Oliven und Tomaten zu reichen. Für die Dauer der Fahrt war ich anscheinend in ihre Gemeinschaft aufgenommen.