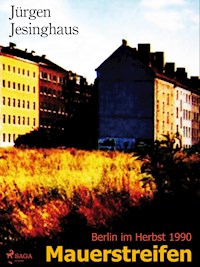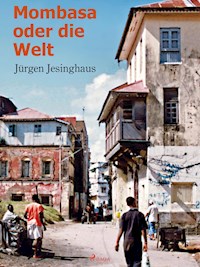
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jürgen Jesinghaus, der Autor des Romans "Nikolaus, der Mann aus Myra" und des Berlin-Romans "Mauerstreifen", befasst sich in seinem neuen Werk wiederum mit einem Menschen, der seine Stellung im Leben sucht – das Generalthema des Autors: Wie winde ich mich aus beengten Verhältnissen in einen Raum größerer Freiheit? Wie stehe ich der Welt gegenüber und wie sieht sie mich an? Welche Fesseln bleiben mir auferlegt und welche muss ich abschütteln? Und wer bin ich dann? Solche Fragen trägt der Protagonist Philipp Radebusch nicht auf der Zunge. Ja, er stellt sie nicht einmal, aber er handelt so, als wären sie im gestellt worden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 780
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Jesinghaus
Mombasa
SAGA Egmont
Mombasa
Copyright © 2010, 2018 Jürgen Jesinghaus und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9783905960693
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
„Mein Herz ist eine Weide für Gazellen, ein Klosterfür christliche Mönche, ein Tempel für Heiden,die Kaaba für muslimische Pilger,die Doppeltafel des jüdischen Gesetzes,die Buchrolle des Korans.Ich folge meiner Religion der Liebe– wohin auch immer sich ihre Kamele wenden.“
Aus: ‚Dolmetsch der Sehnsüchte‘
von Ibn Arab
Teil I
Kapitel 1
1.
Die Spielsteins wurden einmal als „Arembergische Hofjuden“ bezeichnet, und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Daniels Vorfahren tatsächlich im Arembergischen gelebt und vielleicht eine Stelle bei Hofe innehatten, wahrscheinlich in den Positionen von Inspektoren, die über praktische Fähigkeiten ebenso verfügten wie über solide Verwaltungskenntnisse. Die „Dernauer Verwandtschaft“ hingegen existierte nachgewiesenermaßen. Sie hatte sich, wie andere Juden auch, im Lauf der Jahrhunderte an der Grenze zwischen dem Kölner und Mainzer Erzbistum versammelt, in der trügerischen Sicherheit einer klerikalen Demarkationslinie, die ihnen das Hinüber- und Herüberwechseln in die Herrschaftsbereiche der konkurrierenden und zeitweise verfehdeten Bistümer erlaubte. Die Dernauer Verwandtschaft ist nach dem Französischen Krieg in die USA ausgewandert. Die überhitzte Konjunktur im Deutschen Reich und ihre nachteiligen Folgen mögen der Grund dafür gewesen sein.
Die zurückgebliebenen Spielsteins unterhielten stets eine lose Verbindung zur amerikanischen Koterie, die gestärkt wurde durch die Zuversicht einer Zusammenführung in den USA. Die Dernauer Verwandtschaft rühmte sich einer belesenen Tante, Eva Sophie, die den Ursprung der Spielsteins im Flandrischen vermutete. Daniel amüsierte sich später über die Ergebnisse ihrer Ahnenforschung, die eindeutig den Nicht-Arier-Nachweis stützten, da die Familie (Tante Sophie zufolge) aus dem israelitischen Stamme Dan herangewachsen war. Sie machte dafür den Gerechtigkeitssinn und den Hang zum Wasser geltend, der allen Spielsteins zu eigen gewesen seien, weswegen sie auch am Wasser gewohnt hätten, nicht weit von Antwerpen. Tante Sophies Denkschrift, die in der Familie kursierte, ist in einem Exemplar auf Daniel gekommen. Es befand sich in dem Nachlass seines Vaters Prosper.
Daniels Großvater jedenfalls lebte schon in Bonn, und um 1890 wurde Daniels Vater Prosper im Bonner Quartier Latin geboren, nicht weit vom jüdischen Friedhof entfernt, der heute in trauriger Verlassenheit daliegt (auf ihm ist der Großvater väterlicherseits begraben). Prosper hatte etwa um 1910 seine Meisterprüfung abgelegt und eine Stelle in einer Schuhfabrik erhalten. Diese Position befähigte ihn, in seinen eigenen Augen und in den Augen der Verwandtschaft, zu heiraten. In der Zeit, die man einem jungen Ehepaar zubilligte, wurde Daniel geboren - 1911.
Zu Beginn des ersten Weltkriegs wiegte sich die Familie in der Hoffnung, das protestantische Kaiserhaus könne auf Juden verzichten. Diese trügerische Annahme wurde 1915 zunichte, der Vater eingezogen. Ein Jahr später musste der Kaiser ihn entbehren, weil ein russisches Geschoss Prospers Dienst mit der Waffe beendete. Ein Streifschuss wäre zu wenig, ein Kopfschuss zu viel gesagt. Darum sprach er von seinem Heimatschuss. Fortan galt er als Invalide. Wie alle (oder die meisten) Frontsoldaten hat Prosper wenig über Kriegserlebnisse gesprochen, wahrscheinlich weil ihm die Worte fehlten, Angst und Fassungslosigkeit auszudrücken, und weil er nur einen kleinen Ausschnitt der Schlacht erlebt hatte, in einem Dreckloch, ohne Strategie, nur mit der Sorge, den Hintern flach zu halten. Die Stabsoffiziere mit ihren Karten hatten die Augen frei. Sie könnten mehr berichten. Sie haben vielleicht gewusst, wozu ein Befehl gut gewesen sein soll. Prosper erinnerte sich noch an die Etappe und nickte bei der Lektüre seiner eigenen Briefberichte verständig mit dem Kopf, aber die Brussilow-Offensive kannte er nur aus der Literatur, als wäre ihm genau das Stückchen Erinnerung daran weggeschossen worden. Er war dennoch imstande, sie so gut zu erklären wie jeder Stabsoffizier, weil er darüber gelesen hatte.
Seinen Vorgesetzten in der Schuhfabrik hatte es ärger erwischt. Er starb im letzten Kriegsjahr an einer verschleppten Blinddarmentzündung. Trotzdem wurde ihm das Epitheton „Held“ zuerkannt. Prosper durfte nach seiner Rückkehr aus dem Lazarett den Posten in der Schuhfabrik übernehmen. Die Witwe des den Heldentod gestorbenen Meisters, dessen Stelle Prosper angetreten hatte, beschloss 1918, nach Dresden zu ziehen, zurück zu ihrer Verwandtschaft, und ihr Wohnhaus in der Pfarrer-Gyssel-Straße, das ihr Mann 1913 gekauft hatte, wieder zu entäußern. Prosper wollte auch diesbezüglich in die Fußstapfen seines Vorgängers treten und dessen Immobilie in Besitz nehmen. Die Witwe zeigte sich geneigt. Der Ruf, dass Juden Geld besäßen oder dass im Laufe der Zeit Geld an ihnen kleben bliebe, vereitelte allerdings die Aussicht auf einen günstigen Kaufpreis. Außerdem stellte sie die Bedingung, dass der neue Eigentümer auch das Grab ihres Mannes in Pflege zu nehmen hätte, und zwar für so lange, wie er der Besitzer des Hauses bleiben würde. Danach, so sagte sie, werde Gott weiter sehen. Prosper übernahm dankbar schon vor Vertragsabschluss die Pflege. Und so kam es, dass man ihn einige Male auf dem städtischen Nordfriedhof beobachtete, wie er mit Hingabe die Kunststeinfigur einer Trauernden abwusch, die ihren Ellbogen auf eine gebrochene Säule stützte und ihren Kopf in eine Hand schmiegte. Deshalb hielten ihn manche auch für keinen Juden, sondern für einen Christen, von dem die Katholiken meinten, er sei Protestant, und die Protestanten, er sei Katholik oder Altkatholik. Stets wusch er die blicklosen Augen der Trauernden aus, wie um sie von den Tränen zu befreien und ihren umflorten Blick zu schärfen. Darum hieß er in der Familie „Tränenwischer“. Als die Inflation nahte, zerschlug sich das Kaufvorhaben. Die Witwe war klug genug, das Wohnhaus ihres Mannes einem täglich wachsenden nominellen Guthaben auf ihrem Konto vorzuziehen. Nach der Einführung der Rentenmark besaß sie noch ihre Immobilie, aber die Spielsteins hatten rein gar nichts außer dem Lebensnotwendigen. Nach der Währungsreform verkaufte die Witwe dann doch, um in ihr geliebtes Dresden zu ziehen. Dieses Mal verhandelte sie erfolgreich mit dem Kieswerkbesitzer Bernhard Hartkopf, der ein Verbindungsbüro in der Stadt benötigte und die Wohnungen vermieten wollte, vorzugsweise an seine Arbeiter, die sich zur Ruhe gesetzt hatten. Bei Gelegenheit des Hauskaufs mögen sich Prosper Spielstein und Bernhard Hartkopf begegnet sein, vielleicht auf dem Nordfriedhof, denn die Witwe bestand nach wie vor auf ihrer Forderung, der Besitzer des Hauses müsse das Grab ihres gefallenen Mannes pflegen, wofür sie einen Nachlass des Kaufpreises gewährte.
2.
1923 zogen die Spielsteins nach Oplyr zur Miete in ein Fachwerkhaus. Der Hauskauf in Bonn war nicht zustande gekommen. Prosper hatte die Stelle in der Schuhfabrik aufgegeben, weil die Ärzte ihm geraten hatten, in seinem Zustand (mit dem Streifschuss am Kopf) ein „vegetatives Leben“ zu führen, ein Leben an der frischen Luft, mit einem Gärtchen, ein wenig Landwirtschaft, ohne Überanstrengung. Der Tränenwischer pachtete also ein Stück Land und unterhielt im Keller seines Hauses eine kleine Schusterwerkstatt. Er hatte gelernt, Schuhe in Handarbeit herzustellen, und bezog aus dieser Kunstfertigkeit, zusätzlich zu seiner Kriegerrente, einen Verdienst, der zum Lebensunterhalt seiner Familie ausreichte.
Für seinen Sohn Daniel waren die folgenden Jahre die glücklichsten des Lebens, trotz der politischen und wirtschaftlichen Krisen, deren Auswirkungen er als normal empfand und die der Entfaltung seines Geistes beiläufig als Hintergrund dienten. Er musste zwar nach dem Umzug die Realschule aufgeben, in die er gerade aufgenommen worden war, denn es gab damals in Oplyr keine vergleichbare Schule. Das war für ihn keine Katastrophe. In der Volksschule Oplyrs galt er zwar als der Jude, weil er nicht am katholischen Gottesdienst teilnahm, aber die Bezeichnung „dä Jud“ hatte nur die Bedeutung von: der Fremde, der Andersgläubige, der Abessinier, der Zugewanderte, der von jenseits des Gebirges. Sie sollte nicht verletzen. Dan erfreute sich einiger Beliebtheit, denn er wurde als „Städter“ und bereits „Einjähriger“ angesehen, nur weil er die gebohnerten Flure einer höheren Schule gerochen hatte und weil man bei ihm mehr verwertbares Wissen vermutete als bei den Dörflern. Und weil Daniel nicht dumm war.
Er machte den Zeitabschnitt des Glücks gegen Ende seiner Kindheit an nur einem Tage fest, einem Tag, den er nicht zu datieren wüsste, der ihm aber für immer vor Augen stand. An jenem Tag, eigentlich an jenem Abend, durfte er später ins Bett gehen als üblich, weil die Erwachsenen in seltener Eintracht einen Gang über das Land machten, denn es war nichts vorgefallen, worüber sich zu streiten gelohnt hätte. Eine Laune, ein kostbarer Zufall: Kein Husten musste kuriert, keine Blutvergiftung ausgebadet, keine Warze besprochen werden. Keine Heimsuchung durch Migräne, keine Sütterlin-Briefe an Ämter. Darum lag die Brille im Futteral, der Tintenstift im Nähkorb. Keine Vorbereitung eines Festes. Kein Auftrag zum Schuhebesohlen. Darum blieben Prospers Hammer und Ahle in den Lederschlaufen am leimverklebten Schustertisch. Die Pumpe am Brunnen hatte nicht versagt. Keiner brauchte Eisenreifen über Holzräder zu ziehen. Die Kartoffeln waren ausgegraben, die Forken gerade gebogen, die Fahrräder geflickt. Kein Tier (außer der Katze) trächtig, das Unkraut gejätet, der Feuerwehrlöschteich umzäunt und der Garten gegen den Wald durch Maschendraht gesichert. Laune und Zufall. Nichts blieb zu tun übrig – außer dem Stopfen und Nähen, dem Nähen und Stopfen. Die Einsicht hatte sich durchgesetzt, dass diese ewige Arbeit auch noch in einem Stündchen gemacht werden könne, denn Stopfen und Nähen haben kein Ende, ob sie schnell oder langsam verrichtet werden. So zogen sie los, um die Krume zu prüfen, die Saat zu besichtigen, das Wetter zu ergründen, denn nichts ist zwecklos und Müßiggang aller Laster Anfang. Der Junge musste, ja er durfte wie auch der Hund, die Erwachsenen begleiten.
Daniel erlebt die anbrechende Sommernacht als Verheißung ewiger Zukunft. Die unzähligen Morgen hinter diesem Abend, wie viele Felder und Hügel und Höfe und Landstraßen und Dörfer und Städte und Kühe und Flüsse hinter diesem schönen Wald mit seiner Kühle am Abend! Der Junge kann nicht denken, ein wie großer Bruchteil seines Lebens schon verbraucht ist. Der Gang durch die warmen Felder, über einen ungepflügten Grasstreifen. Die Schemen der Erwachsenen. Ihre Unterhaltung, obwohl mit gewohnter Kraft geführt, ist kaum vernehmbar, berührt kaum das stille Wasser der Welt. Die Umrisse vor sich und die dunkle Ruhe, um die Sterne sichtbar zu machen, versetzen das Kind in eine Stimmung der Geborgenheit und Weltoffenheit zugleich. Es träumt von einer Zukunft, in der es behangen mit Waffen und Werkzeugen seine Taten verrichtet. Das Motorrad auf der Landstraße reißt die Stille auf längs einer vorgezeichneten Naht. Man kann es lange hören. Das ersterbende Geräusch zwingt Daniel, ihm nachzuhorchen, bis der Ton zu einer Spitze wird und nur die Haut der Stille eindrückt. Noch schreitet der Junge hinter seinen Eltern und fühlt sich festlich geborgen. In Gedanken aber sieht es sich auf dem Motorrad voll Mut und voll Angst an dem schwarzen Wald vorbei brausen, durch den Duft des Asphalts, den berauschenden Duft der Ferne, durch die nachleuchtenden Felder, zu dem weitesten Punkt, den er je mit dem Fahrrad erreicht hat, vorbei an der Ziegelei, in der es spukt, in der ein Mörder haust, in rasender Fahrt vorüber am Schatten des Mörders, der gestikulierend über den Weg zur Landstraße läuft, dem Kind aber nichts anhaben kann, denn es ist schneller und schon längst auf dem Weg zu einem Meer, das nur in den Büchern steht und wo das Kind noch nichts von seiner Zukunft verbraucht haben wird. Erst wenn es selber schaut, wovon die Bücher berichten, fängt das Leben an zu zählen.
Im Nachhinein sah er es so. Die Welt erschien ihm friedlich, trotz der Not, über die seine Eltern jammerten, trotz der Invalidität seines Vaters. Die Nachbarn, die Leute in Oplyr, sind zwar Bauern und Dörfler, aber von einer nachsichtigen Freundlichkeit, als hätte der Strom, an dem sich bedeutende Städte aufreihen, die giftige Beschränktheit hinweggespült. Noch heute kann man erleben, dass Kinder guten Tag entbieten, zwar mit fragendem Gesicht, wie wohl die Erwiderung ausfallen würde, aber ohne Affigkeit. Nein, diese Leute waren damals keine Bedrohung gewesen. Noch nicht. Die Bedrohung kam nicht von außen, sondern von seinem Vater, dem Tränenwischer, der gegen Ende der 1920er immer eigenbrödlerischer wurde und den die politische und wirtschaftliche Entwicklung zunehmend beunruhigte.
3.
Immer häufiger kam er auf die Dernauer Verwandtschaft zu sprechen, und eines Tages wusste er genau, was er wollte: nach Amerika auswandern, zunächst alleine, um seiner Familie den Boden zu bereiten. Um 1930 stand ihm dieser Entschluss klar vor Augen. Drei Jahre des Kampfes um Entschlüsse und Zukunftspläne waren für Daniel und seine Mutter eine schwere Zeit. Dan, der in den glücklichen Jahren der 1920er in der Familie einen festen Platz eingenommen hatte, fühlte sich vernachlässigt. Die Dernauer Verwandtschaft rückte zusehends in den Mittelpunkt der Familiengespräche, die sich nach Feierabend am Küchentisch entspannen. Die Mutter wollte nicht nach Amerika. Je mehr sie ihren Standpunkt verdeutlichte, desto mehr beharrte Prosper auf der seiner Ansicht nach einzigen Lösung, der deutschen Misere zu entfliehen und „drüben“ wohlhabend zu werden.
Die Spielsteins hungerten zwar nicht, aber sie lebten von der Hand in den Mund, und am Ende eines Monats war alles aufgebraucht bis auf ein paar Pfennige. Dieses kupferbraune Häufchen diente der Frau als schlagendes Argument gegen den Auswanderungsplan ihres Mannes, der umgekehrt im Geldmangel die Berechtigung zum Aufbruch in eine bessere Zukunft erkannte und in sich einen Abraham, einen Moses oder Josua erblickte, der allen Widerständen zum Trotz aufbrechen würde in ein gelobtes Land, wo er als Farmer ein patriarchalisches Leben zu führen gedachte. Seine Hoffnung war die Dernauer Verwandtschaft. Sie nahm (wenigstens für ihn) konkrete Konturen an, als er einen Brief aus den USA empfing, der eine allgemein gehaltene Einladung enthielt: Wenn er die Überfahrt würde finanzieren können, sei der Rest kein Problem. Mit einer großen Anstrengung gelang es der Familie, einen Betrag anzusparen, mit dem man die Passage auf einem Schiff bezahlte, an das der Reisende keine Ansprüche stellen durfte. Man bedauerte die Witwe und den jungen Mann, der, obwohl im heiratsfähigen Alter, nichts für die Gründung einer eigenen Familie hatte zurücklegen können. Welcher Art Flucht Prospers Auswanderung war, niemand weiß es genau. Später hieß es, er habe alles kommen sehen. Wenn dein Vater durchgekommen wäre, mit etwas mehr Glück, dann säßest du jetzt in Washington oder New York, und du könntest mir von Zeit zu Zeit eine Ansichtskarte vom Weißen Haus oder vom Empire State Building schicken. Das war so eine Redensart von Heinz Ollet, dem Müllkutscher, die er zu variieren pflegte, wenn Dan und er über sich sprachen (aber davon später mehr).
Der Abschied war auf einen Dienstag anberaumt worden. Die Familie wusste in ihrer Bekümmerung nicht, wie ein solcher Abschied vonstatten ginge. Aber schon am Montag war Prosper verschwunden und wurde nie wieder gesehen. Aus einem nicht mehr nachvollziehbaren Grund ist er aus Le Havre abgedampft. Er hat später nichts anderes darüber geschrieben, als eben die Wiedergabe dieser Tatsache. Vielleicht war sie für ihn so einleuchtend, dass er eine Erklärung nicht für erforderlich hielt, und vielleicht war es tatsächlich nur der niedrige Fahrpreis, der ihn dazu bewog, ein Schiff in Le Havre zu besteigen. Andererseits hielt sich das Gerücht, nachdem es einmal aufgekommen war, dass er unterwegs jemanden aufgelesen und mitgenommen hatte, den großen Unbekannten oder die unsterbliche Geliebte. Daniels Mutter hing der zweiten Deutung an und litt. Dan wiederholte ständig: Es war der Preis, Vater hat sich umgehört und erfahren, dass in Le Havre ein billiger Frachter in die Staaten fährt. Aber warum die vorzeitige Abreise? Warum sagte er nichts? Ja, warum. Prosper hat darüber kein Wort verloren, obwohl man ihm Schreibfaulheit nicht vorwerfen konnte. Er berichtete von erfolgreichen Unternehmungen, und eines Tages, dass er endlich eine Anstellung in Aussicht habe. Diese Mitteilung bedrückte die Familie, weil aus ihr hervorging, dass die erfolgreichen Unternehmungen geschwindelt waren, um die Daheimgebliebenen zu trösten. Die Aussicht, in irgendeinem Lagerverwaltungsbüro in New York (die Briefe kamen alle aus NY) zu arbeiten, hatte ihn so ergriffen, dass er unversehens in einen Ton aufrichtiger Berichterstattung gefallen war und so einen Schimmer der Wahrheit über seine tatsächliche Lage preisgab. In der Dernauer Verwandtschaft war er herumgereicht worden, aber er hatte nirgendwo einen sicheren Unterschlupf gefunden, er war dort der Fremde aus der Heimat, aus der fremden Heimat. Das reichte für freundliche Worte, auch für ein wenig Geld.
1933 traf der teuerste Brief von allen ein, ein dickes Luftpostschreiben aus New Jersey. Mehrere Seiten wurden darauf verwendet, die Empfänger auf die erschütternde Nachricht vorzubereiten und zu schildern, ein wie tapferer, ein wie fürsorglicher Mann Prosper gewesen sei, da er trotz seiner Behinderung versucht habe, für seine Familie und sich, in erster Linie aber für seine Familie, eine neue Existenz in dem demokratischsten Land der Erde aufzubauen, eine Aufgabe, die trotz der zahlreichen Unterstützung, die er in der neuen Welt erfahren habe, eines Samsons würdig gewesen wäre. Die Nachricht selbst: Der Tränenwischer ist im Hafen tot aufgefunden worden mit einer klaffenden Kopfwunde, so dass die Polizei Mord nicht ausschließt. Der Brief deutete an, dass er einige Male aufgelesen worden sei und einmal in ein Männerasyl („zusammen mit Negern“) gesteckt worden war. Monate später kam der amtliche Bescheid: in Yonkers gestorben vermutlich an den Folgen einer alten Verletzung. Der Tote hatte außer den Personalien, die ihn als „a certain Prosper Spielstein“ aus dem Deutschen Reich auswiesen, nichts bei sich. Seine Aufenthaltsgenehmigung war abgelaufen. Die Beisetzung habe in Paterson, NJ, stattgefunden, die Kosten seien von Verwandten beglichen worden.
Daniels Mutter hat ein Wochenende vor sich hin geweint und ist in Erinnerungen geschwommen. Ein paar Fotos wurden zusammengekratzt, Briefe geschrieben. Danach war sie eine alte Frau, von einer Woche zur anderen. Prosper hatte sich ein für allemal einer Erklärung entzogen. Die Kränkung war unheilbar. Daniels Mutter starb am gebrochenen Herzen, so sagt man (wie soll man es besser sagen). Dan lernte, alles der Kriegsverletzung zuzuschreiben, und kein Mensch weiß, ob dieser Glaube nicht sogar den Tatsachen entspricht.
Daniel durfte als Kalfaktor in der Schuhfabrik arbeiten, wo sein Vater einen wichtigen Posten bekleidet hatte. Aber 1933 wurde er entlassen. Man warf ihm vor, das ihm anvertraute Geld eines Kollegen veruntreut zu haben. Als die Firmenleitung nach langen rufschädigenden Untersuchungen die Sache auf sich beruhen lassen wollte, um die Justiz nicht zu bemühen, weil der Vorwurf des Kameradendiebstahls nicht erhärtet werden könne, willigte Daniel angewidert in die Kündigung ein, die trotz mangelnder Beweise ausgesprochen worden war und die er der Judenfeindlichkeit der neuen Regierung ankreidete. Im selben Jahr fing er bei Hartkopf an, vielleicht weil sich die Väter kannten und die Jungen, Daniel und Gustav (der Erbe) sich angefreundet hatten. Daniel selbst datierte seine große Liebe zu Gustavs Halbkusine in das Jahr 1934. In seiner Erinnerung hatte man sogar von einem Verlöbnis gesprochen. Und dann war plötzlich nicht mehr die Rede davon, und der alte Hartkopf pflegte nur noch einen förmlichen Umgang mit Daniel. Aber Dan durfte seine Stelle behalten. Damals war die große Zeit des Kirchgängers Bernhard Hartkopf, der seinen Bedarf an Ausübung religiöser Pflichten für den Rest seines Lebens deckte. Es wird überliefert, er habe mit seinem Kirchgang ein Zeichen dafür setzen wollen, dass mit der „neuen Zeit“ nicht alle Werte verloren gingen. Angeblich hat man ihn deswegen nach Bonn bestellt, wo er die Aussage näher erläutern sollte. Aber erst Gustav Hartkopf, der Erbe, war tatsächlich in einer „politischen“ Angelegenheit in der Gestapo-Zentrale am Kreuzbergweg.
Daniel Spielstein ging 1941 in die „Illegalität“. Er bezog eine Wohnung im Haus, das sein Vater, der Augenwischer, gerne gekauft hätte, aber Bernhard Hartkopf schließlich gekauft hatte. Er nannte sich Spielsin – Spiälsin (Betonung auf ‚äl‘). Das Versagen einer behördlichen Schreibmaschine, nämlich das am Typenhebel hochgerutschte ‚e‘ (der am häufigsten benutzte Vokal hatte den Fliehkräften nicht mehr standgehalten), die Schludrigkeit eines Beamten und die eigene genialisch-schwungvolle Unterschrift gestatteten eine Lesart in seinem Pass, die ihm die vielleicht lebenswichtige Namensänderung vom jüdischen ‚Spielstein‘ ins christlich-polnische ‚Spielsin‘ ermöglichte - Spiälsin („mein Name ist Spiälsin - das konnten Sie nicht wissen“).
4.
Daniel Spielstein wurde um fünf Uhr überfallen. Die Täter waren in Ledermäntel gekleidet und von einer Gelassenheit, die Kriminellen gewöhnlich nicht eignet. Sie schlugen gegen die Wohnungstür und forderten ihn auf mitzukommen. Sie brauchten nichts zu sagen, ein Ruck mit dem Kopf genügte. Daniel Spielstein, der sich Spiälsin nannte, fragte, was er mitnehmen dürfe. Der Anführer zuckte die Achseln. Er löste sich aus dem Türrahmen und folgte dem schlaftrunkenen Mann ins Zimmer. Die Hände behielt er in der Tasche, denn er hatte sich von der Harmlosigkeit des Opfers überzeugt. Widerstand hätte nur ein Pistolenschütze leisten können, der kaltblütig genug gewesen wäre, die beiden Männer über den Haufen zu schießen – und den dritten dazu, der bei laufendem Motor im Auto saß. Daniel packte seine sieben Sachen in eine verschlissene Aktentasche.
„Wertsachen?“
Er schüttelte den Kopf.
„Papiere?“
Die Papiere lagen im Küchenschrank. Der Ledermantel riss sie Daniel aus der Hand, als er sie geholt hatte.
„Wo ist das J?“
Er schwieg betreten, als hätte ihn die Polizei in einer Fälscherwerkstatt ertappt.
„Also dann.“ Der Ledermantel verließ energisch das Zimmer, ohne sich nach dem Wehrlosen umzuschauen, in der Gewissheit, dass er folgen würde. Flucht zwecklos. Also folgte Daniel. Die Männer stiegen hastig in den Wagen (jetzt musste es schnell gehen), so dass er Mühe hatte einzusteigen.
Die Opfer waren Juden, Kommunisten, Sozialdemokraten, sogar alte Zentrumsleute, Oppositionelle aller Art, aber auch persönliche Feinde derjenigen, die Macht hatten, Ledermäntel in die Nacht zu schicken und Leute aus ihren Wohnungen heraus zu verhaften. Die Ledermäntel taten, was man ihnen befohlen hatte. Sie würden sich nach dem Krieg darauf berufen und eine Tugend daraus machen („wo kommen wir hin, wenn jeder tut, was er will“). Keiner sprach mit dem Gefangenen. Die drei unterhielten sich über die nächsten Stationen und den kürzesten Weg, um das „Einsammeln“ schneller hinter sich zu bringen. Niemand solle glauben, betonte der Fahrer, ohne sich an das Opfer zu wenden, dass ihm der ganze Quatsch Spaß mache, die Herumfahrerei bei dieser Tageszeit, in diesem saukalten Wetter. Schuld daran seien die Juden und die anderen, die nicht in das neue Deutschland passten.
Daniel wurde an der „Sammelstelle“ der Gestapo abgeliefert und so behandelt wie einer, der 20 Reichsmark aus einer Ladenkasse gestohlen hatte, nicht freundlich, aber mit einer schmerzlosen Gleichgültigkeit. Das änderte sich am nächsten Tag, als er Rede und Antwort stehen sollte und die Herkunft des angeblich gefälschten Passes erklären musste. „Unverschämtheit!“ schrie der Verhör-Offizier ein um das andere Mal. Er stellte Fragen, wartete aber keine Antworten ab, sondern schlug dem Häftling jedesmal mit der flachen Hand auf die Ohren. Daniel stürzte. Er konzentrierte sich darauf, nicht in Ohnmacht zu fallen. Als er hochgerissen wurde, sah er, wie sich der Mund seines Peinigers bewegte, aber er hörte keine Stimme. Er war von Rauschen umgeben, als stünde er unter einem Wasserfall. Der Mann hob wieder seine Hand gegen ihn, Daniel deutete auf ein Ohr und sagte, ohne dass er es kontrollieren konnte: „Kann nicht hören.“ Man schlug ihn trotzdem. Er wachte in einer Zelle auf. Die Kälte hatte ihn geweckt. Um ihn herum drängten sich zehn, zwölf Personen. Seine Nachbarn redeten auf ihn ein, aber er hörte nichts, nur das Rauschen. Es rief das Bild eines schwarzen Meeres hervor, das kalte Wellen vor ihm auftürmt. Er schloss die Augen. Der Schmerz schoss durch seinen Kopf.
Tags darauf transportierte man sie in Wehrmachtautos zu einem stillgelegten Fabrikgelände, wo man sie hinter Stacheldraht in Baracken unterbrachte. Daniel fror. Er hatte vergessen, eine Jacke überzuziehen. Seine sieben Sachen waren auch verloren gegangen. Er wusste nicht, wie es weitergehen würde, er wusste nur, dass er es in diesem Zustand nicht lange aushalten konnte. Er stand in sich zurückgezogen, eingeigelt gegen den Schmerz und die Kälte, hinter seinen Armen versteckt, mit denen er sich selbst umklammerte. Nach der Helligkeit zu urteilen, war es ungefähr 9 Uhr. Kaffeezeit. Er dachte daran, dass jetzt im Büro von Gustav Hartkopf jemand Kaffee brühte.
Hartkopf mochte damals 40 Jahre alt gewesen sein. Jedenfalls sah er so aus, denn sein Gebaren ließ auf ein gesetztes Alter schließen. Der jahrelange Umgang mit Geschäftsleuten und Arbeitern, die alle etwas auf ihn gaben und ihm zuhörten, wenn er redete, hatte ihn zu einem selbstbewussten Mann gemacht, der sein Ego nicht hervorzukehren brauchte wie sonst die Männer an der Schwelle zu Amt und Würden. Er hatte gestern mit einem Bekannten telefoniert. Der kannte jemanden, der einen von der Gestapo kannte. Diesem schrieb Hartkopf einen förmlichen Heil-Hitler-Brief. Er hatte sein Anliegen so dringend vorgetragen, dass er sich schon für nächste Woche mit einem Funktionär der Sonderpolizei in Bonn verabreden konnte. Er war darauf aufmerksam gemacht worden, dass dieses Treffen rein außerdienstlich sei und er deshalb mit einem Mann zu rechnen habe, der nicht in Uniform, sondern im Straßenanzug erscheinen würde.
„Wenn ich Ihnen helfen kann, jederzeit gerne, nur stellen Sie bitte meine Loyalität nicht in Frage.“
„Mein Angestellter befindet sich in Ihrem Gewahrsam.“
Der Herr im Straßenanzug, am Revers ein rundes Abzeichen, das ihn als Angehörigen der herrschenden Kaste auswies, steckte sich eine Zigarette an.
„Ja wissen Sie, ‚befinden´ ist gut gesagt. Ich weiß zwar nicht, was im einzelnen mit ihm geschehen wird, aber ich möchte es so ausdrücken: Die Chancen, dass er wieder bei Ihnen arbeitet, sind ungefähr gleich Null.“
Hartkopf schwieg betreten. Zu gehen wäre ratsam, denn die Frage lag in der Luft: Haben Sie nicht gewusst, dass er beschnitten ist? Und wenn Sie es gewusst haben, warum setzen Sie sich dann für ihn ein?
„Zigarette?“ Das Gespräch sollte fortgeführt werden.
„Danke, gerne. Russische?“
„Der Führer wird keine Gegenoffensive wegen russischer Zigaretten machen.“
„Nein? Nein. Ihre Bemühungen sind natürlich nicht umsonst. Ich weiß, dass Sie persönlich keine Vergünstigungen annehmen, aber Ihrer Organisation könnte vielleicht an einem fairen Geschäft gelegen sein.“
Das Wort ‚fair‘ brachte Hartkopf widerwillig über die Lippen. Er ärgerte sich über seinen gestelzten Stil. Während er ihm nachhing, verlor er den Faden und schwieg. Nach einer Pause, in der er eine Zigarette entgegennahm und anzündete, sprach er weiter:
„Sie wissen vielleicht, dass ich einen kriegswichtigen Betrieb zu laufen habe: Sand, Zement, Beton, Pisten, Bunker. Der Betreffende könnte im Dienst Ihrer Organisation in meinem Betrieb weiterarbeiten. Ich brauche jede Hand für den Endsieg.“
„So haben Sie sich das also vorgestellt. Sind Sie in der Partei?“
„Nein, obwohl auch ich im Dienst der Sache stehe. Meine Produkte sind, wie ich schon sagte, kriegswichtig.“
„Es kann ja nicht jeder in der Partei sein. Was ich jetzt sage, bleibt hübsch unter uns: Der Krieg läuft nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Und nochmals unter uns: Mir ist nichts daran gelegen, überhaupt nichts, dass diese Menschen über den Jordan gehen. Ich bin sogar bereit, dem einen oder anderen aus der Patsche zu helfen. Ich hätte da meine Risiken und einige Spesen. Wie sollen wir uns näherkommen?“
„Ich bin bereit, Ihre Spesen zu übernehmen. Und was das andere angeht, so habe ich mir vorgestellt, dass ich den Lohn des Betreffenden bis auf eine Courtage an Ihre Organisation abführe.“
„Sagen wir mal so: Die Courtage beträgt 50% und dient zur Deckung meines Risikos, mit dem ich leben muss, eines Risikos, das sobald nicht aufhört.“
„Bei Kriegsende.“
„Was kann ich mir denn nach einem verlorenen Krieg dafür kaufen?“
„Einen Persilschein.“
„Es bleibt dabei. Sie haben mich verstanden! Was die Zahlungsmodalitäten angeht, setzt sich meine Organisation schon bald mit Ihnen in Verbindung. In Sachen Provision komme ich noch auf Sie zu. Und Persilschein, mein lieber, mein sehr lieber Herr Hartkopf, dazu würde ich Ihnen gerne noch einige Takte sagen!“
5.
Es hieß, sie führen nach Osten, um bei der Abschaffung der polnischen Wirtschaft und beim Aufbau des Generalgouvernements zu helfen, in Steinbrüchen und beim Straßenbau. Es hieß auch, sie sollten mal richtig arbeiten lernen. Daniel erinnerte sich, dass die Partei, die seine Inhaftierung betrieben hatte, einer nationalistischen, vulgär-sozialistischen Ideologie anhing und diese im Dunst missbrauchter Festsäle verkünden ließ. Also die Juden und Sozialdemokraten und besonders die jüdischen Sozialdemokraten sollen arbeiten lernen! Als hätte er nie gearbeitet, als hätten seine Eltern nicht gerackert! Wenn er schon arbeiten musste, warum wurde er dann so behandelt? Wer arbeitet, soll essen, darf nicht frieren. Daniel rechnete mit vielem, sogar mit einer besonderen Strafe für das fehlende J im Pass. Aber dass sein Leben auf dem Spiel stand (es gab Gerüchte), glaubte er nicht. Leute umbringen, weil sie keine Vorhaut haben, weil sie das Laubhüttenfest feiern? Absurd. Er war noch jung und glaubte an die Erklärbarkeit der Welt, dass sie im Prinzip verständlich sei, wenigstens bei einem tieferen Verständnis, als ihm jetzt gegeben war. Und wie zur Bestätigung seiner Theorie kam er aus dem Übergangslager, der alten Fabrik, in ein überheiztes Büro, wo er von zwei Ledermänteln empfangen wurde, die ihn zurück in die Stadt fuhren, aber nicht in seine Wohnung, sondern in das Polizeipräsidium.
„Ich erklär dir alles später, jetzt verschwinden wir, bevor die es sich anders überlegen.“
Hartkopf hatte ihn kurz begrüßt, ihm auf den Rücken geklopft. Er drängte zum Gehen und zerrte ihn fort, so dass Daniel beinahe gefallen wäre.
„Ich möchte wenigstens meine Sachen wiederhaben!“
„Bloß kein Aufsehen! Lass die Klamotten.“
Hartkopf zog ihn über das Laminat des Präsidiums. Sie stiegen rasch die Freitreppe hinab, nachdem sie das rechteckige Portal, ein Tor wie zu einer Grabkammer, verlassen hatten. Sie hasteten entlang einer Reihe Polizeiautos und bogen in die Seitenstraße. Dort stand der dreiräderige Lieferwagen, der T2, mit dem Hartkopf gekommen war, und davor ein Polizist, der sich die Nummer notierte. Es hatte keinen Zweck, weiterzugehen und so zu tun, als gehörte einem der Wagen nicht.
„Stimmt was nicht, Meister?“
„Ihre Papiere.“
„Für Dreiräder braucht man keinen Führerschein.“
„Die Personalien.“
Der Wachtmeister blickte streng unter seinem Tschako hervor. Hartkopf zeigte die Papiere, die er im Krieg immer bei sich trug.
„Sie stehen im Halteverbot.“
„Entschuldigung. Wir hatten dienstlich in Ihrer Behörde zu tun, eine Angelegenheit betreffend, die keinen Aufschub duldet.“
„Das nächste Mal denken Sie daran.“
Der Wachmann tippte an den Tschako und schritt davon.
„Freundlicher Kerl, war nur eine harmlose Sache, Dan, wirklich.“
Jetzt erst fiel Hartkopf auf, dass mit Spielstein etwas nicht stimmte.
„Was ist denn?“
Daniel las von Hartkopfs Gesicht und sagte in das Rauschen:
„Ich kann nicht hören, sie haben mir die Ohren kaputt geschlagen.“
Hartkopf schickte den Betriebselektriker Fritz Radebusch in die Pfarrer-Gyssel-Straße, um die Sachen von Daniel zu holen, so unauffällig wie möglich. Dans Zimmer war möbliert, so dass alles, was ihm gehörte, auf das Tempo-Dreirad passte. Zwei Hausbewohner, Zeugen der Verhaftung, drückten sich an Radebusch vorbei, im Glauben, er sei eine Art Gerichtsvollzieher der Gestapo. Nachdem Fritz alle Sachen herausgeholt und untergebracht hatte, verschloss er die Wohnung und lieferte den Schlüssel bei dem Hausmeister ab, der hinter seiner Tür die Räumung verfolgt hatte und bei der Entgegennahme des Schlüssels keine Fragen stellte, als wäre es selbstverständlich, dass Menschen in dieser Zeit plötzlich verschwinden und Fremde ihr Hab und Gut davontragen. Jeder hielt sich an die Regel: Wo die Geheimpolizei war, da stellt man keine Fragen mehr.
Radebusch, der selbst allen Grund hatte, unauffällig zu leben und wenig zu reden, war rechtzeitig fertig geworden, einen Raum, kaum vier mal vier Quadratmeter, neben der Schlosserei des Kieswerkes einzurichten. Dorthin stellte er die mitgebrachten Sachen. Ab diesem Tag lebte Daniel Spielstein in dem Raum, der „Löwengrube“, zurückgezogen von der Welt, versorgt von Hartkopf, Radebusch und deren Frauen. Die ‚Organisation‘ hatte strikte Zurückgezogenheit befohlen, obwohl Daniel jetzt ordentliche Papiere besaß. Nur im Notfall möge man sich bei Herrn von Grein melden, dem Verbindungsmann, mit dem Hartkopf die Bedingungen für das Überleben Daniels ausgehandelt hatte. Der Arzt, den Daniel konsultieren wollte, war unbestimmt verzogen. Die Eintönigkeit des Dahinlebens und die Angst vor Unbekannten zögerten den Besuch eines anderen Arztes hinaus. Das Brausen in Dans Kopf hatte zwar nachgelassen, aber das Gehör blieb beschädigt. Hartkopf und Radebusch gewöhnten sich an, mit Daniel laut und artikuliert zu sprechen.
Was Daniel Spielstein blieb, war das nackte Leben, die Löwengrube und der 9-Uhr-Kaffee. Manchmal fragte er sich, woher und wieso Hartkopf die Kontakte zur Organisation hatte. Wie auch immer, er hatte sie genutzt, ihn aus der Haft zu befreien und vor einem Lager im Osten zu retten. Wer Jude war, sprach sich schnell herum. Die Leute kramten in Erinnerungen und wussten, wer den Sabbat feiert und wer in die Kirche geht. Und es gab Frauen, die untrügliche Zeichen am Fleische hätten angeben können. Aber sie hüteten sich wohl, darüber zu sprechen. Wer also hatte ihn denunziert?
6.
Masrat war der jüngste Sohn des Hof- und Brennereibesitzers. Er hatte Pädagogik studiert, aber den Schuldienst früh quittiert, weil er in eine Affäre verwickelt gewesen sein soll, über die niemand offen sprach, denn es sei „Schnee vom letzten Jahr“. Trotzdem, einige munkelten von Bestechung und Verführung Minderjähriger. Er hatte sich früh der herrschenden Partei angeschlossen, weil sie seiner Auffassung von Zucht und Sitte, vom neuen Menschen, der sich höheren Zielen bedingungslos unterordnet, entgegenkam, und weil er hoffte, die Gerüchte über ihn würden dadurch endgültig verstummen. Er spürte „abartigen“ Zeitgenossen nach, Abweichlern und Zugereisten, die nicht, wie er sich ausdrückte, in „unseren Volkskörper“ gehörten. Seine Familie war alteingesessen, gut katholisch. Unter Seinesgleichen im Dorf, den Bauern, Ladenbesitzern, Kneipiers und einigen Beamten ließ er sich schon einmal gehen, warf Runden, verkündete die neue Zeit und gab zum Besten, wer nicht mehr in sie hineingehöre: alle die es „mit der internationalen Verschwörerbande halten und Schweinkram schreiben“. Dabei fielen auch Namen. Er machte gerne Andeutungen, weil er sich dann der besonderen Aufmerksamkeit sicher sein durfte. Hatte er anfangs nur Informationen aus seinem Parteizirkel durchsickern lassen, begriff er bald, dass er selbst Macht ausüben konnte, wenn er von sich aus durch erfundene Andeutungen Personen einkreiste, ohne sie zu benennen. Er beobachtete zu seiner Lust, wie solche Personen isoliert wurden, weil niemand etwas mit ihnen zu tun haben wollte. Das hatte Masrat gelernt: Man musste sich zum Apparat bekennen, je lauter, desto besser, dann durfte man ihn bedienen, und er tat, was man wollte, wenn nur die Wünsche nicht übertrieben waren, die Ziele nicht zu hoch gesteckt, nicht ins Politische, und nicht so, dass man anderen aus der Partei in die Quere kam. Er war auf dem besten Weg, sich diese Entdeckung im großen Stil nutzbar zu machen, nachdem er festgestellt hatte, dass sich selbst Behörden auf seinen Wink hin in Bewegung setzten, Menschen verhörten und verhafteten - aber ihm blieb keine Zeit dazu.
Seine Gewohnheit, an Samstagabenden in die Großstadt zu fahren, weil er, wie er tönte, am heiligen Sabbat noch Geschäfte erledigen müsse, nutzte Radebusch, um eine Rechnung zu begleichen. Er tat es mit dem Sendungsbewusstsein eines Widerstandskämpfers. Masrat ist ein kleines Würstchen, zwar ein Großkotz in Oplyr, aber in der Politik da draußen ein Niemand, er ist ein Arschloch, sagte sich Radebusch. Hat er mit seinem Gequatsche die Leute nicht ins Lager gebracht? Und was geschieht mit ihnen, wenn sie einmal dort sind? Ist je einer wiedergekommen, Jabotinsky und seine Familie, der alte Doktor Schön? Alle plötzlich abgereist, und keiner außer diesem Arsch wagt es, darüber zu sprechen. Radebusch war sich sicher, dass Masrat auch Spielstein ans Messer geliefert hatte – und zwar auf den bloßen Verdacht hin, dass Daniel Jude sei, weil er so heißt, wie er heißt, und nicht in die Kirche gehen mochte.
Fritz Radebusch kannte den Mercedes, den Masrat an den Samstagabenden eigenhändig chauffierte, einen schwarzen Dienstwagen von der Sorte, die in dieser Gegend sonst niemand fuhr. Fritz hatte die Strecke aus Oplyr hinaus Richtung Köln mehrmals mit dem Rad abgefahren, um sich die seinem Vorhaben günstige Stelle einzuprägen. Für ihn kamen zwei Punkte in Betracht, ein Heiligenhäuschen mit der schmerzensreichen Madonna unter einer Linde und eine verlassene ausgebeutete Kiesgrube, neben deren mit Stacheldraht verrammelten Zufahrt ein mannshoher Findling lag. Fritz erinnerte sich, wie die Arbeiter damals den Stein mit einem Raupenfahrzeug aus dem Sand gehoben, geschoben und an der Straße abgelegt hatten, denn die Aktion war in der Regionalpresse erörtert worden (man hatte deshalb in der Schule über Eiszeiten und schwedische Findlinge gesprochen). Dieser Stein – das war der Punkt. Die Brombeerbüsche würden ihre Schatten werfen und Fritz zusätzlich Deckung gewähren. Außerdem hatte er bei der Hand, was er zu dem Einsatz sonst noch benötigte: Baubretter und eine alte Straßensperre.
Generalprobe. Fritz versteckte das Rad und postierte sich hinter dem Findling. Noch hatte er ruhiges Blut, noch würde nichts passieren, noch lag es bei ihm, ob jemals etwas passieren würde. Scheinwerferlicht ließ sich von Weitem erkennen. Das erste stammte von einem Lieferwagen. Dann hörte er ein Motorrad noch bevor das Licht aufblitzte. Die Funzeln der Radfahrer waren kaum zu sehen, erst wenn man das Sirren der Dynamos hörte. Auf die Radfahrer musste er besonders achten. Sie sahen mehr als die Motorisierten. Fritz stand eine weitere halbe Stunde. Dann leuchtete die Madonnenlinde, ihr Wipfel erstrahlte. Es konnte kein Lastauto sein, denn der Wagen fuhr leise und war erst zu hören, als Fritz sich ducken musste, um nicht von den Scheinwerferkegeln erfasst zu werden. Fritz merkte sich die ausgeleuchteten Stellen, wo er sich keinesfalls würde aufhalten dürfen. Der schwarze Mercedes fuhr schnell, seine 80 Sachen. Fritz käme nicht darum herum, ein Hindernis auf die Straße zu werfen.
An dem Abend regnete es. Radebusch wusste nicht, ob das Wetter vorteilhaft war oder nicht, und redete sich ein, der Regen erleichtere sein Vorhaben. Fritz startete früh und wählte zunächst die entgegengesetzte Richtung, um am Rande des Vorbergs über ein wenig benutztes Sträßchen zu fahren, das am Wegekreuz in die Landstraße mündet. Dort stieg er ab und achtete darauf, dass weder seine Schuhe noch die Reifen Profilspuren hinterließen. Er betrat sorgfältig nur Weideland und stieß sein Rad in eine Hecke. Er löste seinen Brotbeutel von der Querstange und vergewisserte sich, dass sein Inhalt vollständig war. Fritz hielt sich ungefähr eine Minute an der Hecke auf und suchte mit den Augen die Felder ab. Er sah niemanden und entschloss sich deshalb loszumarschieren. Er schritt ruhig mit gesenktem Kopf und schaute sich nicht um. Wer ihn beobachtete, sollte den Eindruck eines unbekümmerten Fußgängers gewinnen, der bei diesem Wetter dafür sorgte, schnell und ohne Umwege nach Hause zu kommen.
Nach einer halben Stunde erreichte er den Findling und verschwand hinter einer Aufschüttung von Kies. Dort schlug er sein Wasser ab und nutzte die Gelegenheit zur eingehenden Prüfung des Umfeldes. Dann bezog er Posten. Er verstaute seinen Beutel am Fuß des Findlings in einer Nische, wo der Regen nicht hineinreichte. Fritz war bis auf die Haut durchnässt. Er hatte keine Vorkehrung dagegen getroffen. Es war jetzt auch seine Sorge nicht. Er beeilte sich, die Bretter und die Straßensperre heranzuschleifen, wiederum nach langem Absuchen der dunklen Ränder an Hecken und Wegen. Er war noch uneins mit sich, ob er das Brett und ein paar Steine nehmen sollte, um die Fahrt des Autos zu unterbrechen, oder die Straßensperre, die dazu diente, die Ausfahrt zu sichern, wenn die schweren Laster die Rampe vom Grund des Kieslochs heraufkeuchten und auf dem letzten Stück zur Straße beschleunigten. Die Sperre hatte er früher schon zwei- oder dreimal gesehen. Jetzt wurde ihm klar, dass er sie nicht verwenden durfte, denn sie sah nach Absicht aus und verriet etwas von der Vertrautheit mit dem Ort, den die Polizei bald vermessen würde. Er zerrte die Bretter zum Findling, dazu ein paar Steine, und schickte sich ins Warten. Wenn Masrat bei diesem Wetter nicht kommt? Dann bist du nur das Risiko eines Schnupfens eingegangen. Radebusch machte seinen Rücken krumm und ließ den Regen an sich hinablaufen. Als er hochsah, stachen ihm Scheinwerferfinger entgegen. Er konnte sich nicht entschließen, die Steine und das Brett auf die Fahrbahn zu werfen. Untätig hockte er hinter dem Findling. Er hatte Glück. Es war nicht der Mercedes. Radebusch schleppte nun die Hindernisse auf die Straße. Komme, wer wolle.
Der Mercedes hielt. Er war bei dem Regenwetter langsam gefahren und brauchte nicht scharf zu bremsen, als hätte sein Fahrer hier und an keiner anderen Stelle halten wollen. Fritz verharrte regungslos hinter dem Findling. Er schaute nicht einmal hinüber. Er wollte selbst ganz lebloser Gegenstand sein, um nicht aufzufallen. Der Fahrer stieg aus, stemmte die Hände in die Hüfte, schaute sich um, fluchte ungezwungen, etwa in der Art „verdammte Scheiße, das auch noch“. Er schob seinen Stiefel an das Brett und wollte es von der Straße schleudern, aber es gelang ihm nur, das Brett zu drehen, so dass er sich bücken musste. Er warf es mit beiden Händen auf die Seite, wo Radebusch wartete, atemlos, mit gesenkten halboffenen Augen. Fritz blickte erst auf, als die Fahrertür klappte. Kaum war der Wagen angefahren, blieb er wieder stehen. Masrat stieg aus, verbeugte sich vor dem Kühler, so schien es, griff einen von Radebuschs Steinen und reckte sich. Da endlich schoss Radebusch. Masrat stand lange suchend vor dem Auto. Die Scheinwerfer beschienen seine Hosenbeine und Schuhe. Er konnte nichts in der Richtung erkennen, aus der geschossen wurde, darum fragte er, gewissermaßen sich selbst: „Ist da jemand?“ Fast bittend. Es muss sich ja aufklären lassen, ich bitte um Aufklärung des Irrtums! Fritz feuerte ein zweites Mal. Es riss den Fahrer herum. Er griff an die Schulter, stolperte auf die Tür zu, die in Fahrtrichtung offen stand, und tauchte in die Fahrerkabine. Das Glas der Beifahrertür platzte, Splitter schossen nach innen und trafen den Fahrer am Gesicht. Radebusch hatte ein drittes Mal gefeuert. Nun glaubte das Opfer an keine erfolgreiche Flucht mehr. Er griff mit seinem linken Arm über den Schoß und fingerte nach dem Revolver, der zwischen den Sitzen klemmte. Als Masrat die Waffe in der linken Hand hielt, aus dem Wagen stieg und sich aufrichtete, um seinem unsichtbaren Gegner mit der Pistole zu trotzen, fiel der letzte Schuss. Radebusch schnappte den Beutel, verließ die Schatten der Büsche und des Findlings und stolperte in Fahrtrichtung davon. Er wurde von den Scheinwerferkegeln erfasst, bevor er rechts abbiegen konnte.
„Dich kenne ich doch. Ich kenne Sie!“
Masrat erschöpfte sich in der Empörung über den Anschlag. Er schoss nicht zurück, er staunte nur. Jetzt war Radebusch außer Sicht. Er lief hinter der alten Kiesgrube auf Gegenkurs, in die Richtung, aus der das Auto gekommen war und wo sein Fahrrad stand. Als er sein Rad gefunden hatte, überzeugte er sich davon, dass nichts fehlte.
7.
Am Sonntagmorgen beunruhigte Fritz Radebusch seine Frau damit, dass er sich nur in der Wohnung aufhielt und grübelte. Der Kerl ist verletzt, mehr nicht. Hat er nicht gerufen: Ich kenne Sie? Stimmt das vielleicht? Kennt er mich mit Namen oder nur vom Sehen? Seine Fresse war blutig. Es regnete. Ich habe mich lange genug im Dunkeln aufgehalten. Der konnte mich nicht erkennen. Als ich weglief, sah er noch lebendig aus. Warum hast du nicht weitergeschossen?
Es gab da nämlich den Augenblick, wo er gar nicht töten wollte, wo er Angst davor hatte, nicht vor Entdeckung und Strafe, sondern davor, ein Mörder zu werden. Nach dem vierten Schuss wollte er kein Mörder mehr sein. Radebusch irrte durch die Wohnung, war fahrig, nicht ansprechbar. Er wiederholte für sich: Den Daniel Spielstein hat der auf dem Gewissen, den alten Schön auch, Jabotinsky, die ganze Familie. Vielleicht sind sie tatsächlich nur in einem Arbeitslager, und das miese Schwein wäre wenigstens nicht an ihrem Tode schuld. Aber er hat sie aus ihren rechtmäßigen Lebensverhältnissen herausgerissen! Die Schramme, die ich ihm verpasst habe, lässt ihn künftig daran denken, dass er hier nicht der Herrgott ist, der Herr Masrat in seiner kackbraunen Uniform. Das durfte so nicht weitergehen! Aber mir geht es an den Kragen, wenn er wissen sollte, wer ich bin. Fallbeil oder Strick (Erschießungskommando wohl kaum). Vielleicht hat er nur geblöfft. Er kennt mich gar nicht. Meine Frau wäre auch dran. Und der Sohn käme in die Napola-Schule nach Bensberg! Ich hätte mit der Frau darüber sprechen müssen. Aber sie hat sich nicht einmal darüber gewundert, dass ich nass war bis auf die Knochen. Sie kennt das von mir. Sie weiß gar nichts, sie kann nichts verraten. Wo war Ihr Mann gestern? Wie immer mit dem Rad unterwegs, er fährt seine Runden bei jedem Wetter, auch im Winter.
Die Gerüchte von einem Mord kursierten schon am Sonntagnachmittag. Fritz Radebusch quälte sich mit der Frage, ob er etwas liegen gelassen hatte, ein Taschentuch beispielsweise. Nein, das nicht. Sogar die vier Hülsen, die mir der Auswerfer ins Gesicht gespuckt hatte, habe ich aufgehoben und in die Tasche gesteckt und alle vier am Brunnenhaus in den Waldsee geworfen, weit hinein, ich habe es platschen gehört. Am Montag brachten es die Zeitungen. Der Mercedes war in einen Graben gesteuert worden. Zur Erleichterung Radebuschs bezeichnete die Presse eine Stelle, die zwei Kilometer vom Tatort entfernt lag. Darauf würde die Polizei ihre Nachforschungen konzentrieren. Der Bursche hatte also noch seinen Wagen in Gang gesetzt, bevor er abkratzte! Es könnte wie ein Unfall aussehen - wenn die Schusswunden nicht wären.
Der alte Radebusch, Fritzens Vater, hatte in einem Feldbrief an seine Frau beschrieben, wie er an die Pistole, eine deutsche Armeewaffe aus dem ersten Weltkrieg, eine Luger P08, gekommen war, für ihn, den einfachen Feldgrauen, eine Rarität, eine zusätzliche Lebensversicherung, besser als ein geschliffener Spaten.
„Ich habe sie einem Poilu abgeknöpft, als sich sein Graben in ganzer Länge ergeben hatte, und der Poilu hatte sie zuvor einem deutschen Offizier abgenommen, nachdem sich dessen Kompanie geschlossen ergeben hatte. Der Franzose glaubte wohl, ich würde ihn deswegen umbringen, und zeigte auf das herausgezogene leere Stangenmagazin, als wäre das ein Beweis für seine Friedfertigkeit. Ich stieß es zurück und hielt ihm die Luger an den Schädel und sagte: ‚Du hast achtmal geschossen, jetzt erschieß ich dich, bümm!‘ Wir erschraken beide, ich mehr als er, weil man das, was ich getan hatte, auf gar keinen Fall tut (es hätte ja noch eine Kugel im Lauf stecken können). Darum entschuldigte ich mich: ‚Excusez moi, hier sind Zigaretten für die Lüger, ich kauf sie dir ab, obwohl sie naturellement uns gehört!‘“
Fritz hatte den Brief im Nachlass seiner Mutter gefunden. Es sprach einiges dafür, dass sich die Waffe im Gerümpel auf dem Trockenboden befand. Eines Tages stellte er den Speicher auf den Kopf, riss Schachteln auf, sprengte Kästen mit dem Schraubenzieher. In einem Werkzeugkasten lag die Luger in Ölpapier eingewickelt. Obwohl sein Vater geschrieben hatte, das Magazin sei leer gewesen, fand Fritz ein volles vor. Der Alte hatte also für Nachschub gesorgt. Fritz fuhr nie in eine Kiesgrube oder in den Wald, um probezuschießen, auch nicht, als in ihm die Absicht reifte, Masrat umzubringen. Er studierte sie auf dem Speicher, zog am Kniegelenkverschluss den Schlitten nach hinten, um die erste Patrone in den Lauf zu schieben. Die P08 würde sich nach einem Schuss durch einen Rückstoß-Mechanismus automatisch nachladen. Er brauchte dann nur in gemessenen Abständen zu feuern. Nach dem Studium der Funktionsweise legte er die Luger-Parabellum zurück, vorerst, überschüttete sie mit Schrauben und packte Hämmer und Zangen darauf.
Dass sein Vater, der Weltkrieg-I-Radebusch, die Waffe in einem Werkzeugkasten versteckt hatte, konnte bedeuten, dass er sie für ein Werkzeug hielt oder dass er sie in Gesellschaft ziviler Gegenstände, die dem Leben dienstbar sind, heiligen wollte. Wenn es für den Alten ein Werkzeug war, hatte er sie dann nicht benutzt, um den Nachkriegshunger zu bekämpfen, hatte er Hasen geschossen, Tauben, Hunde? Und wenn ja, dann würde sich ein alter Mensch aus dem Dorf vielleicht daran erinnern!
„Hast du jemals gehört, dass nach dem Krieg einer aus dem Dorf gewildert hätte?“ fragte Radebusch seine Frau Montag früh.
„Mit Pfeil und Bogen sind sie auf Ratten losgegangen.“
„Ein Gewehr hatte ja niemand, auch die Polizei nicht?“
„Vermutlich nicht, wieso?“
„Waren harte Zeiten im Krieg und danach. Die Franzosen hätten einen Schießprügel sicher nicht geduldet. Daher konnten die Leute draußen keine Kaninchen schießen. Sie mussten ihre eigenen fressen, wenn sie welche hielten. Ich hab mal gesehen, wie jemand einen Stallhasen an die Mauer schlägt. Es gibt immer Menschen, die das über sich bringen. Das ist genau so oder noch schlimmer als das da in der Zeitung.“
Radebusch legte die Zeitung aus der Hand. Er widerstand dem Impuls, einen Bericht über Masrats Tod auszuschneiden, obwohl es, überlegte er, nicht auffällig wäre, wenn jemand eine Seite, die über ein Ereignis berichtet, das vor der eigenen Haustür stattgefunden hat, herausreißt. Wäre es nicht vielmehr umgekehrt verdächtig, nähme er keinen Anteil an dem Vorfall? Seine Frau enthob ihn der Mühe, sich zu entscheiden. Sie riss den Artikel heraus, faltete ihn und legte ihn unter einen Stapel Teller im Küchenschrank. Das war eine natürliche Reaktion (hoffentlich würde die Polizei es auch dafür halten).
„Dass so etwas vorkommt“, sagte sie, „gibt Scherereien. Die verhören wer weiß wen, uns vielleicht auch.“
Radebusch erhob sich schwerfällig und zog seine Frau ins Schlafzimmer, als wären sie heute Morgen in der Küche nicht alleine unter sich gewesen. Was er zu beichten hatte, war so vertraulich, dass er es nur im Allerheiligsten, wo man sich schlafend der Welt hingibt, weitergeben mochte.
„Was ich dir jetzt sage, ist lebenswichtig. Lebenswichtig! Ich habe nämlich auch so eine Pistole wie in dem Bericht über Masrat. Die muss irgendwie verschwinden.“
Die bequemste Art, sie verschwinden zu lassen, hatte er versäumt und es nicht über sich bringen können, dem Andenken seines Vaters geschuldet, sie auch in den Waldsee zu werfen, obwohl es vermutlich das Klügste gewesen wäre. Aber weiß man es? Würde die Polizei nicht glauben, dass keiner so dumm ist, die Tatwaffe mit nach Hause zu nehmen, und sich deshalb erst recht in der Gegend umsehen? Wäre ein Weiher nicht das klassische Depot für eine Mordwaffe? Läge das nicht auf der Hand? Die Polizei würde Magneten durchs Wasser ziehen oder den See trockenlegen. Hülsen würden sie auch dann in dem Schlamm nicht finden, wenn schon, aber eine komplette Parabellum, mit drei Schuss im Magazin und einen im Lauf, mit vier Patronen, die wie eine Kopie der verschossenen wären, ein schicksalhafter Fingerzeig (vielleicht war Fritz Radebusch doch klüger als er selber meinte).
„Wie kommst du denn an eine solche Pistole!“
„Vielleicht kannst du noch lauter schreien!“
„Wie kommst du denn an eine solche Pistole? Die müssen glauben, du hättest …! Wär ja kein Wunder.“
„Die muss weg!“
„Wo hast du sie denn?“
„Wieder im Werkzeugkasten.“
„Wieso ´wieder´?“
„Ich hab sie da gefunden, nach Vaters Tod, beim Aufräumen seiner Sachen, und mal draufgeguckt und wieder zurückgelegt. Darum ‚wieder´.“
„Kannst du sie nicht draußen wegwerfen?“
Radebusch hielt es für keine gute Lösung, jetzt mit einer Pistole herumzulaufen.
8.
An diesem Montag kam Radebusch zu spät in die Hartkopfsche Firma. Er bewegte sich wie unter einem äußeren mechanischen Zwang, als er das Polizeiauto sah, das vor Hartkopfs Büro parkte. Was machen die schon hier? Er dachte überstürzt, wollte alles auf einmal wissen und alles richtig machen und konnte daher keinen klaren Gedanken fassen. Welchen Fehler hast du begangen, dass sogar die örtlichen Bullen schon dahinter gekommen sind? Ist deine Frau durchgedreht? Haben sie deine Frau mit der Pistole erwischt? So blöd ist die nicht. So blöd nicht. Die nicht. Andere ja, die nicht. Ihm wurde wohler, als er merkte, dass der Fahrer, der im Wagen sitzen geblieben war, keine Notiz von ihm nahm. Fritz ging an ihm vorüber und grüßte. Der Fahrer nickte und schloss die Augen, als wäre ihm alles zu viel, dieses ganze Theater. Fritz bedauerte, nicht danach gefragt zu haben, was die Polizei hier wolle, ob sie vielleicht in dem Mordfall ermittle, den ja jeder schon aus der Zeitung kennt. ‚War wohl ein Bolschewistenschwein‘, etwas in der Preisklasse hätte er sagen müssen. Aber gesagt ist gesagt, besser man hält die Schnauze. Gerade du solltest die Schnauze halten! Du wirfst sonst Dinge durcheinander, solche, die in der Zeitung stehen, mit denen, die du selbst erlebt hast. Nur nicht umschauen. Er grüßte einen Kies-Fahrer. Der schrie von Weitem: „Spät dran heute?“ Irgendetwas wie „tscha-ha“ brachte Fritz hervor und beschloss, diesem Idioten eins auszuwischen, wenn die Affäre bereinigt wäre und wenn er, Fritz Radebusch, dann noch leben sollte. Immerhin fing er an, darüber nachzudenken, was er sagen würde, wenn man ihn früge, warum er später als gewöhnlich kommt. Ausreden müssen nahe an der Wahrheit liegen. Aber zu nah darf es auch wieder nicht sein! Er würde sagen, dass ihn die „schreckliche Meldung“ heute Morgen aus der Bahn geworfen habe, Herr Masrat sei doch ein angesehener Bürger des Ortes, den kenne jeder (so tun, als lebte er noch, als wäre sein Tod nicht sicher). Hoffentlich erzählt meine Frau keine Märchen: ‚Mein Mann ist später von zu Hause weg, weil er fiebert, er hat sich vorgestern einen Schnupfen geholt.‘ Aber das macht die nicht. Die nicht. Radebusch beschloss, sich eine Zeitung geben zu lassen, möglichst eine andere als seine Hauspostille, und sich alle Einzelheiten einzuprägen, damit er wirklich nur das sagen würde, was er gelesen hatte, und nicht das, was er wusste. Du musst dich konzentrieren, reiß dich zusammen! Sie dürfen Daniel heute nicht sehen. Der darf ihnen nicht über den Weg laufen. Für den Fall, dass er in seiner Löwengrube hockt, muss ich ihn warnen. Radebusch wollte ins Büro hineingehen, als ihn zwei Beamte gegen die Türfüllung quetschten. Sie machten drei Sprünge auf den Hof, stiegen in das Auto, schreckten den Fahrer aus seiner Schläfrigkeit und spornten zur Eile.
Hartkopf stand in seinem Büro, kreidebleich. Er wartete keinen Gruß ab und sagte fast tonlos:
„Der Urbanski.“
„Was ist mit ihm?“
„Sie suchen ihn wegen vorgestern. Die haben doch den Masrat umgelegt.“
„Was heißt ‚die´?“
„Irgend jemand. Sie glauben, der Urbanski war´s, weil Masrat vor drei Monaten öffentlich die Frage gestellt hatte, ob wir sicher sein dürften, dass unter den Pollacken kein Untergrundkämpfer sei, zum Beispiel der Urbanski, der so abgefeimt glotze – nur weil er die Augendeckel nicht zugeklappt hatte, als der Herr Obergeschissrat an ihm vorbeizugehen geruhte.“
„Sie haben Urbanski aber nicht mitgenommen.“
„Er war nicht hier. Er ist auf der Baustelle.“
„Haben Sie das gesagt?“
„Ich habe gesagt, dass ich nicht weiß, wo er ist.“
„Ich muss ihn warnen.“
„Aber machen Sie das sehr vorsichtig. Sie nehmen den T2 und ich gebe Ihnen einen Auftrag für die Baustelle. Reparieren Sie den Mischer.“
„Ist er kaputt?“
„Herr Radebusch, dann machen Sie ihn eben kaputt! Beeilung. Ich habe in der Nase, dass sie wiederkommen.“
„Was sag ich denn dem armen Kerl? Ich kann ihn doch nicht hierher bringen?“
„Zu Ihnen?“
Der guckt mich an, als wüsste er alles. Wenn sie bei mir den Urbanski finden, dann auch die Parabellum. Radebusch kratzte sich die Hand und sah ratlos aus.
„Bringen Sie ihn vorsichtig hierher, wir stecken ihn in die Löwengrube.“
Radebusch nickte erleichtert, obwohl er keinen Grund hatte, erleichtert zu sein. Nicht nur Spielstein und Urbanski waren in Gefahr – er auch und seine Frau und Philipp, sein Söhnchen, und wer sonst noch.
Sie kamen wieder, in einem grünen Mannschaftswagen. Acht Mann sprangen hintereinander heraus, Gewehre in der Rechten. Sie stellten sich in Reih und Glied, hier geruckt und da gezuckt. Sie redeten leise und hielten ihre Karabiner wie andere Leute eine Brechstange. Ein Offizier verschwand im Bürogebäude. Er war kaum eine Minute drin gewesen, als er zusammen mit Hartkopf vor seine Polizisten trat und die Hausdurchsuchung des Kieswerks anordnete. Hartkopf verzichtete darauf, falsche Spuren zu legen. Er sagte gar nichts und trug ein ausdrucksloses Gesicht vor sich her. Der Polizeioffizier versuchte nicht, Hartkopf in ein Gespräch zu ziehen, und befahl ihn zurück ins Büro. Der befolgte freiwillig den Befehl, denn einen anderen Ort als sein Büro aufzusuchen, erschien ihm zu gefährlich, weil er glaubte, beobachtet zu werden. Wie leicht hätte er eine Spur legen können, indem er zu nah an das Versteck heranging oder zu weit in die entgegengesetzte Richtung!
Vor seinem Büro versammelten sich einige Arbeiter. Sie hofften, neue Informationen zu erhalten, und fragten ihn, was die Leute von der Polizei hier zu suchen hätten.
„Wegen vorgestern“, sagte Hartkopf.
Er blieb bei den Arbeitern stehen, versenkte seine Hände in den Hosentaschen, zog die Schultern hoch und streckte seine Arme steif.
„Was haben wir denn damit zu tun?“
„Nichts. Die suchen halt, glauben vermutlich, die Fremdarbeiter …“
„Die Pollacken, könnte doch sein!“
„Die Pollacken haben sich ja nicht selbst eingeladen und verbringen auch nicht ihren Urlaub hier!“ schnappte Hartkopf zurück.
„Drum.“
Ein Gewehrschuss ließ alle wie auf Kommando zusammenfahren. Ein scharfer Ruck fuhr durch die Gruppe vor dem Büro. Nichts war zu sehen, was auf einen Zusammenhang mit dem Knall deutete. Es war einen Augenblick lang ganz still. Dann erschien der Offizier auf der Bildfläche, katzenhaft gewandt, jederzeit bereit, sich zu ducken.
„Jemand hat auf uns geschossen!“
„Hier war alles ruhig, bis wir den Knall hörten. Er kam vom Baggerloch.“
„Gehen Sie weg vom Gelände, ins Büro! Wenn es derselbe Kerl von vorgestern ist: der scheint vor nichts Respekt zu haben.“
Der Offizier war sichtlich aufgeregt, immer zum Ducken bereit. Er drängte die Arbeiter und einige Polizeibeamte, die inzwischen eingetroffen waren, ins Haus. Bald erfuhren alle Polizisten, dass ihr Vorgesetzter nach dem Knall seinen Befehlsstand in Hartkopfs Büro verlegt hatte.
Pohlhaus war ein Mittvierziger, ein kleiner Mann mit immer rotem Kopf und wässrigen Augen zwischen leicht entzündlichen Lidern. Da stand er bierruhig am Rand des Baggerlochs und stierte in die Tiefe wie man ins Feuer starrt, mit derselben Gebanntheit. Die Suche nach dem Verbrecher regte ihn nicht auf. Irgend jemand fände ihn schon. Ich habe noch nie einen gefunden. Es ist zwecklos, dass ich mich an der Suche beteilige. Trotzdem wird er gefunden, alle werden gefunden. Ein feines trockenes Raschel-Rauschen störte ihn auf. Instinktiv drückte er seinen Karabiner fester und suchte die steile Flanke der Kiesgrube ab, gegenüber der Rampe für die Lastautos. Es rieselte, dann war alles still. Plötzlich schoss ein Etwas aus einem schwarzen Sandloch, das ein Bagger ausgebissen hatte, und sprang mehr als dass es lief die sandige Steilwand hinauf, bis zu der Stelle, wo der Ackerboden anfing. Dort überschlug es sich, der Abbruch war zu steil, und das Etwas, diese Blitzschlange, dieses Wiesel, rollte wieder hinab, eine Lawine aus Sand und Kieselsteinen hinterdrein. Das Kaninchen versuchte es immer wieder an derselben Stelle, mit einer verzweifelten Sturheit. Die Intelligenz des Menschen, der sich an diesen Kapriolen ergötzte, reichte aus, um den Augenblick abzupassen, wo sich das Tier wieder aufrappeln würde, um die Sandmauer abermals zu erstürmen. An diesem Punkt der Ruhe, am Tiefpunkt des Falls, drückte Pohlhaus ab. Das Kaninchen war wie verzaubert, hinweggehoben über sich hinaus. Zurückgelassen hatte es nur ein Stückchen Fell und ein paar Tropfen Blut.
Pohlhaus behauptete, wie alle anderen, niemand habe auf ihn geschossen. Er behauptete aber auch, dass er keinen Schuss gehört habe, aus dem er hätte folgern können, dass jemand auf ihn schieße.
„Sie haben nichts gehört, Mann? Wo waren Sie denn?“
Während Pohlhaus mit dem Arm in die Richtung des Baggerlochs wies, dämmerte ihm, dass er in der Scheiße saß. Seinen eigenen Schuss hatte er ja nicht mitgezählt! Aber selbst seinem trägen Verstand erschloss sich nun die bittere Erkenntnis, dass der Schuss auf das Kaninchen, dieser Meisterschuss, für die ganze Aufregung sorgte.
„Ich habe nämlich auch geschossen“, begann der Schütze kleinlaut.
„Er hat auch geschossen! Sie Rindvieh, Sie alleine haben geschossen, auf wen, wenn ich bitten darf!“
Der Offizier sah sich außer Lebensgefahr und spielte die Rolle des Mannes, der die Lage beherrscht.
„Es hat sich dort etwas bewegt.“
„Es hat sich was bewegt! Und da schießen Sie mir nichts dir nichts? Mann, sind Sie sicher, dass es nicht Ihre Mutter war, der Sie ein Loch in den Arsch gebrannt haben? Den Bericht über Ihre Munitionsverschwendung schreiben Sie selbst, haben Sie verstanden? Und zwar so, dass ich meine Unterschrift ruhigen Gewissens darunter setzen kann. Alle Mann raus hier und aufsitzen!“
Die Suchaktion wurde vorzeitig beendet. Der beschämende Zwischenfall hatte dem Offizier die Fortsetzung verleidet. So rettete ein Kaninchen durch das Opfer seines Lebens Urbanski und Spielstein. Denn bis in die Schlosserei war die Suchmannschaft schon gedrungen, als der Schuss sie hinaustrieb.
Es fanden keine weiteren Aktionen statt. Während der Beisetzung von Masrat hatte es zwar großes Getöse gegeben: Im Dienste der Sache, Opfer der Bewegung - alles ausführlich behandelt in einer Beilage der Regionalpresse. Aber bald geriet die Sache in Vergessenheit. Sie verschwand jedenfalls aus dem öffentlichen Bewusstsein. Hartkopf erfuhr allerdings, was zur raschen Einstellung der Suchaktion geführt hatte, als er zwecks Aufbesserung der „Courtage“ mit von Grein verhandeln musste.