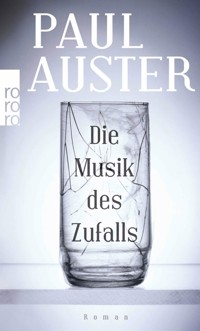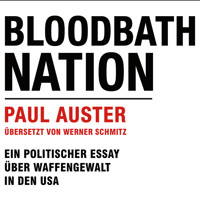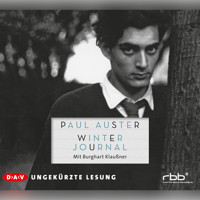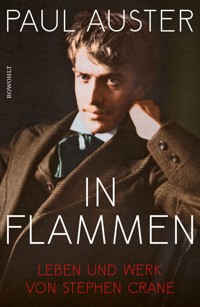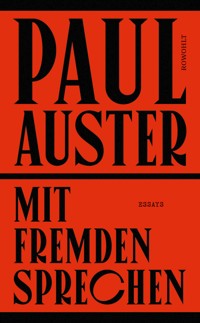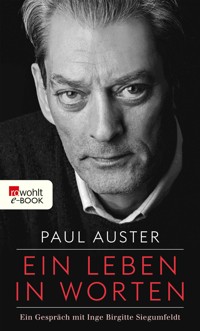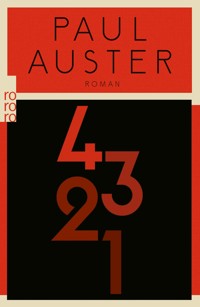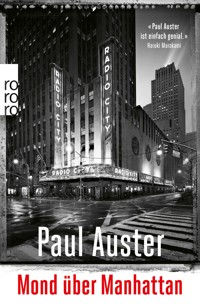
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Das Panorama einer Weltstadt Der Student Marco Stanley Fogg wohnt in einem leeren Apartment mit Ausblick auf einen Hinterhof und ein China-Restaurant. Seit sein Onkel und Ersatz-Vater gestorben ist, hat er die Wohnung nicht mehr verlassen. Einem Zusammenbruch nahe beginnt er, überall Zeichen zu sehen: Die Leuchtreklame «Moon Palace» scheint geheimnisvoll mit den Moon Men, der Jazzband seines Onkels, verbunden. Diese wieder mit der ersten Mondlandung. Marco macht sich auf, um das Rätsel zu lösen – vielleicht ist es auch das seiner Herkunft. «Paul Austers Roman handelt, höchst kunstvoll, von den Irrwegen der Selbstfindung. Er treibt mit seinem Helden ein Spiel, dessen Witz in der Regel liegt, dass man sich erst verlieren muss, bevor man sich finden kann ... Auster versteht sich darauf, mit erzählerischer Intelligenz Verwirrung zu stiften, um sie aufs pfiffigste wieder aufzulösen.» (Der Spiegel)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Ähnliche
Paul Auster
Mond über Manhattan
Roman
Aus dem Englischen von Werner Schmitz
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Für Norman Schiff — zum Andenken
Einen Amerikaner kann nichts in Erstaunen setzen.
Jules Verne
Erstes Kapitel
Es war der Sommer, in dem zum ersten Mal Menschen den Mond betraten. Ich war damals noch sehr jung, glaubte aber an keinerlei Zukunft. Ich wollte gefährlich leben, bis an meine Grenzen vordringen und sehen, was mich dort erwartete. Wie sich herausstellte, ging ich daran fast zugrunde. Nach und nach sah ich mein Geld schwinden; ich verlor meine Wohnung; am Ende lebte ich auf der Straße. Ohne ein Mädchen namens Kitty Wu wäre ich wohl verhungert. Ich hatte sie erst kurz vorher zufällig kennengelernt, doch sehe ich in diesem Zufall im Nachhinein eine Art Bereitschaft, mich durch den geistigen Einsatz anderer Leute retten zu lassen. Das war der erste Teil. Von da an stießen mir seltsame Dinge zu. Ich verdingte mich bei dem alten Mann im Rollstuhl. Ich fand heraus, wer mein Vater war. Ich wanderte durch die Wüste von Utah nach Kalifornien. Das ist natürlich lange her, aber ich erinnere mich gut an diese Zeit, sie ist der Anfang meines Lebens.
Nach New York kam ich im Herbst 1965. Da war ich achtzehn; während der ersten neun Monate lebte ich in einem Studentenwohnheim. Auswärtige Erstsemester an der Columbia mussten auf dem Campus wohnen, aber gleich nach Abschluss des Semesters zog ich in ein Apartment in der West 112th Street. Dort lebte ich die nächsten drei Jahre bis zu dem Tag, an dem ich am Ende war. In Anbetracht meiner üblen Lage war es ein Wunder, dass ich mich dort überhaupt so lange gehalten habe.
Ich teilte mir diese Wohnung mit über tausend Büchern. Sie hatten ursprünglich meinem Onkel Victor gehört, der sie im Lauf von etwa dreißig Jahren nach und nach gesammelt hatte. Kurz bevor ich aufs College ging, bot er sie mir spontan als Abschiedsgeschenk an. Ich sträubte mich nach Kräften, aber Onkel Victor war ein sentimentaler und großmütiger Mensch, er ließ sich nicht zurückweisen. «Geld kann ich dir nicht geben», sagte er, «und gute Ratschläge auch nicht. Nimm die Bücher, mir zuliebe.» Ich nahm sie, öffnete aber in den nächsten anderthalb Jahren keinen der Pappkartons, in die sie verpackt waren. Ich hatte vor, meinen Onkel zu überreden, die Bücher zurückzunehmen, und bis dahin sollten sie unversehrt bleiben.
Die Kartons erwiesen sich dann als recht nützlich. Die Wohnung in der 112th Street war unmöbliert, und anstatt mein Geld für Dinge zu verschwenden, die ich nicht wollte und mir auch nicht leisten konnte, machte ich aus den Kartons etliche «imaginäre Möbelstücke». Das Ganze glich ein wenig einem Puzzlespiel: die Kartons in verschiedenen Anordnungen zu gruppieren, in Reihen aufzustellen, aufeinanderzustapeln, sie so lange umzubauen, bis sie schließlich Haushaltsgegenständen zu ähneln begannen. Sechzehn dienten als Gestell für meine Matratze, zwölf wurden zu einem Tisch, sieben bildeten einen Sessel, zwei einen Nachttisch und so weiter. Dieses trübe Hellbraun allenthalben wirkte freilich recht monochrom, doch konnte ich nicht umhin, auf meine Findigkeit stolz zu sein. Meine Freunde fanden es ein wenig seltsam, hatten jedoch inzwischen gelernt, bei mir mit Seltsamem zu rechnen. Bedenkt, wie befriedigend es ist, erklärte ich ihnen, wenn man ins Bett kriecht und weiß, dass man auf der amerikanischen Literatur des neunzehnten Jahrhunderts träumen wird. Stellt euch das Vergnügen vor, sich zum Essen hinzusetzen, und unter dem Teller lauert die komplette Renaissance. In Wahrheit hatte ich keine Ahnung, welche Bücher in welchen Kisten waren, aber damals war ich ganz groß im Geschichtenerfinden, und mir gefiel der Klang solcher Sätze, auch wenn sie falsch waren.
Meine imaginären Möbel blieben fast ein Jahr lang unangetastet. Dann aber starb im Frühjahr 1967 Onkel Victor. Sein Tod war ein schrecklicher Schlag für mich; in mancher Hinsicht war es der schlimmste Schlag, den ich je einstecken musste. Onkel Victor war nicht nur der Mensch, den ich am meisten geliebt hatte, er war auch mein einziger Verwandter, meine einzige Verbindung zu etwas, das über mich selbst hinausging. Ohne ihn fühlte ich mich beraubt, vom Schicksal gezeichnet. Wäre ich auf seinen Tod irgendwie vorbereitet gewesen, hätte ich mich wohl leichter damit abfinden können. Doch wie bereitet man sich auf den Tod eines zweiundfünfzigjährigen Mannes vor, der zeitlebens bei guter Gesundheit gewesen ist? Mein Onkel fiel eines schönen Nachmittags Mitte April einfach tot um, und von da an änderte sich mein Leben, begann ich in eine andere Welt zu entgleiten.
Von meiner Familie gibt es nicht viel zu berichten. Das Personenverzeichnis war klein, und die meisten hatten nur kurze Auftritte. Bis zum elften Lebensjahr lebte ich bei meiner Mutter, dann wurde sie bei einem Verkehrsunfall getötet, in Boston von einem Bus überfahren, der bei Schneefall ins Schleudern geraten war. Ein Vater kam in dem Stück nie vor, es hatte immer nur uns beide gegeben, meine Mutter und mich. Dass sie ihren Mädchennamen benutzte, bewies, dass sie nie verheiratet gewesen war, doch erfuhr ich von meiner unehelichen Geburt erst nach ihrem Tod. Als kleiner Junge kam ich nie auf die Idee, derlei zu hinterfragen. Ich war Marco Fogg, meine Mutter war Emily Fogg, und mein Onkel in Chicago war Victor Fogg. Wir alle hießen Fogg, und es schien mir vollkommen logisch, dass Leute aus ein und derselben Familie denselben Namen trugen. Später erzählte mir Onkel Victor, sein Vater habe ursprünglich Fogelman geheißen; dieser Name sei aber von jemandem im Einwanderungsbüro auf Ellis Island zu Fog verstümmelt worden, Fog mit einem g, wie Nebel, und dies habe der Familie in Amerika als Name gedient, bis 1907 das zweite g hinzugefügt worden sei. Fogel bedeute Vogel, erklärte mir mein Onkel, und mir gefiel die Vorstellung, ein solches Wesen in meinem Innern aufgehoben zu wissen. Ich malte mir aus, irgendeiner meiner kühnen Vorfahren habe tatsächlich fliegen können. Ein Vogel, der durch Nebel fliegt, dachte ich mir, ein riesiger Vogel, der über den Ozean fliegt und erst in Amerika landet.
Ich besitze kein einziges Bild von meiner Mutter, und es fällt mir schwer, mich an ihr Aussehen zu erinnern. Wenn ich sie im Geiste vor mir sehe, erkenne ich eine kleine dunkelhaarige Frau mit kindlich schmalen Handgelenken und zartgliedrigen weißen Fingern, und manchmal fällt mir dann plötzlich wieder ein, wie gut es tat, von diesen Fingern berührt zu werden. Immer ist sie sehr jung und schön, wenn ich sie sehe, und darin täusche ich mich wohl nicht, denn sie war erst neunundzwanzig oder dreißig, als sie starb. Wir bewohnten in Boston und Cambridge nacheinander eine Reihe von kleinen Wohnungen, und ich glaube, sie arbeitete bei irgendeinem Lehrbuchverlag, doch war ich zu jung, um zu begreifen, was sie dort tat. Ganz deutlich erinnere ich mich daran, dass wir zusammen ins Kino gingen (Western von Randolph Scott, Krieg der Welten, Pinocchio), dass wir im Dunkel des Theaters saßen, uns bei den Händen hielten und eine Schachtel Popcorn leerten. Sie konnte Witze erzählen, über die ich in heiseres Kichern ausbrach, aber das geschah nur selten, wenn die Planeten in günstiger Konjunktion standen. Oft war sie verträumt, ein wenig griesgrämig, und zuweilen spürte ich, dass eine regelrechte Traurigkeit von ihr ausging, als kämpfte sie innerlich gegen eine ungeheure Verwirrung an. Als ich älter wurde, ließ sie mich immer öfter mit Babysittern allein zu Hause, doch begriff ich erst viel später, lange nach ihrem Tod, was es mit ihrem häufigen rätselhaften Verschwinden auf sich hatte. Was jedoch meinen Vater angeht, so herrschte dort eine einzige Leere, vorher wie nachher. Es war das einzige Thema, über das mit mir zu reden meine Mutter sich weigerte, und wann immer ich davon anfing, stellte sie sich taub. «Er starb vor sehr langer Zeit», sagte sie allenfalls, «noch vor deiner Geburt.» Nichts im Haus wies auf ihn hin. Kein Foto, nicht einmal ein Name. Da ich mich also an nichts halten konnte, stellte ich ihn mir als dunkelhaarige Version von Buck Rogers vor, als einen Raumfahrer, der in die vierte Dimension geraten war und nicht mehr zurückfand.
Meine Mutter wurde neben ihren Eltern auf dem Westlawn-Friedhof begraben, und danach zog ich zu meinem Onkel in den Norden von Chicago. Auf vieles aus dieser frühen Zeit kann ich mich nicht mehr besinnen, ich war aber anscheinend ziemlich trübsinnig und vergoss manche Träne, schluchzte mich abends in den Schlaf wie ein jämmerliches Waisenkind in einem Roman aus dem neunzehnten Jahrhundert. Einmal begegnete uns eine törichte Bekannte von Victor auf der Straße und begann zu weinen, als sie mir vorgestellt wurde, tupfte sich die Augen mit einem Taschentuch und plärrte unaufhörlich, ich sei also das Kind der Liebe der armen Emmie. Mir war dieser Ausdruck völlig neu, doch merkte ich, dass er auf grausige und unheilvolle Dinge anspielte. Als ich Onkel Victor bat, mir das zu erklären, legte er sich eine Antwort zurecht, die ich nie vergessen habe. «Alle Kinder sind Kinder der Liebe», sagte er, «aber nur die besten nennt man auch so.»
Der ältere Bruder meiner Mutter war ein dürrer, einundvierzigjähriger Junggeselle mit Hakennase, der seinen Lebensunterhalt als Klarinettist verdiente. Wie alle Foggs war er ein eher planloser und verträumter Mensch, sprunghaft und lethargisch. Eben diese Eigenschaften machten seiner verheißungsvoll angelaufenen Karriere beim Cleveland Orchestra schließlich ein Ende. Er verschlief Proben, tauchte ohne Krawatte zu Vorstellungen auf, und einmal besaß er die Frechheit, in Hörweite des bulgarischen Konzertmeisters einen schmutzigen Witz zu erzählen. Nach seinem Hinauswurf trieb er sich bei einer Reihe kleinerer Orchester herum, jedes ein bisschen schlechter als das vorangegangene, und als er 1953 nach Chicago zurückkam, hatte er sich mit der Mittelmäßigkeit seiner Leistungen abzufinden gelernt. Als ich im Februar 1958 bei ihm einzog, gab er Anfängern Klarinettenunterricht und spielte bei Howie Dunns Moonlight Moods, einer kleinen Combo, die bei Hochzeiten, Konfirmationen und Abschlussfeiern auftrat. Victor wusste, dass es ihm an Ehrgeiz fehlte, er wusste aber auch, dass es auf der Welt noch anderes gab als Musik. Ja, es gab so vieles, dass es ihn oft schier überwältigte. Er gehörte zu den Menschen, denen ständig etwas anderes einfällt, während sie gerade mit etwas beschäftigt sind; er konnte sich nicht hinsetzen und ein Stück üben, ohne zwischendurch ein Schachproblem zu durchdenken, er konnte nicht Schach spielen, ohne gleichzeitig über die Schwächen der Chicago Cubs nachzudenken, im Baseballstadion grübelte er über irgendeine Nebenfigur bei Shakespeare, und wenn er schließlich nach Hause kam, konnte er keine zwanzig Minuten mit dem Buch stillsitzen, weil es ihn nun wieder zur Klarinette hinzog. Wo immer er also war, und wohin auch immer er ging, stets hinterließ er eine chaotische Spur von schlechten Schachzügen, unbeendeten Spielberichten und halb gelesenen Büchern.
Es war jedoch nicht schwer, Onkel Victor zu lieben. Zwar war das Essen schlechter als bei meiner Mutter und unsere Wohnungen schäbiger und beengter, doch war derlei auf lange Sicht nebensächlich. Victor spielte sich nicht als jemand auf, der er nicht war. Er wusste, dass er kein Vater sein konnte, und behandelte mich daher weniger wie ein Kind als wie einen Freund, einen heiß geliebten Miniaturkumpel. Damit kamen wir beide gut zurecht. Binnen eines Monats nach meiner Ankunft hatten wir bereits ein Spiel entwickelt, in dem es darum ging, sich Länder auszudenken, imaginäre Welten, in denen die Naturgesetze auf den Kopf gestellt waren. Einige der besseren brauchten Wochen zu ihrer Fertigstellung, und die Karten, die ich davon zeichnete, hingen an einem Ehrenplatz über dem Küchentisch. Das Land des Sporadischen Lichts, zum Beispiel, und das Königreich der Einäugigen. Angesichts der Schwierigkeiten, vor die uns die reale Welt stellte, war es wohl ganz verständlich, dass wir ihr so oft es ging den Rücken kehrten.
Nicht lange nach meiner Ankunft in Chicago nahm Onkel Victor mich mit in eine Vorstellung des Films In achtzig Tagen um die Welt. Der Held dieser Geschichte hieß natürlich Fogg, und von diesem Tag an hatte ich bei Onkel Victor den Kosenamen Phileas – eine heimliche Anspielung auf jenen seltsamen Augenblick, «als wir uns auf der Leinwand begegneten», wie er sich ausdrückte. Onkel Victor liebte es, sich zu irgendwelchen Themen kunstvoll-unsinnige Theorien auszudenken, und er wurde nicht müde, mir die in meinem Namen verborgenen Herrlichkeiten auseinanderzusetzen. Marco Stanley Fogg. In seinen Augen bewies dieser Name, dass mir das Reisen im Blut steckte, dass das Leben mich an Orte führen würde, an die kein Mensch zuvor einen Fuß gesetzt hatte. Marco stand selbstredend für Marco Polo, den ersten Europäer, der China besucht hatte; Stanley stand für den amerikanischen Journalisten, der Dr. Livingstone «im Herzen des dunkelsten Afrikas» aufgespürt hatte; und Fogg stand für Phileas, den Mann, der in weniger als drei Monaten um den Globus gehetzt war. Es spielte keine Rolle, dass meine Mutter mich einfach deshalb Marco genannt hatte, weil ihr der Name gefiel, oder dass mein Großvater Stanley geheißen hatte, oder dass Fogg auf den Irrtum, die Laune eines schreibfaulen amerikanischen Beamten zurückzuführen war. Onkel Victor fand Bedeutungen, wo kein anderer welche gefunden hätte, und nutzte sie dann sehr geschickt, um mich unauffällig aufzurichten. In der Tat genoss ich es, dass er mich mit solcher Aufmerksamkeit bedachte, und obwohl ich wusste, dass all sein Reden leer und nichtig war, glaubte ein Teil von mir ihm jedes Wort. Anfangs halfen mir Victors Namensdeutungen, die schwierigen ersten Wochen auf meiner neuen Schule zu überstehen. Namen sind am leichtesten angreifbar, und «Fogg» eignete sich für eine Unmenge spontaner Verballhornungen: Fisch und Frosch zum Beispiel, und dazu unzählige meteorologische Anspielungen: Nebelhorn, Matschkopf, Triefmaul. Nachdem mein Nachname erschöpft war, machte man sich über den Vornamen her. Das o am Ende von «Marco» schrie ja förmlich nach Beinamen wie Dumbo, Beppo und Mumbo Jumbo, doch was danach alles kam, übertraf alle Erwartungen. Marco wurde zu Marco Polo; Marco Polo zu Polohemd; Polohemd zu bleiches Hemd; bleiches Hemd zu Bleichgesicht; und Bleichgesicht zu Arschgesicht – eine verblüffende Grausamkeit, die ich fassungslos zur Kenntnis nahm. Letztlich überstand ich diese Anfangsphase meiner Schulzeit, doch hinterließ sie bei mir eine Empfänglichkeit für die unendliche Anfälligkeit meines Namens. Dieser Name verband sich so sehr mit meinem Selbstwertgefühl, dass ich ihn vor weiterem Schaden bewahren wollte. Mit fünfzehn begann ich alle meine Arbeiten mit M. S. Fogg zu unterschreiben, wobei ich großspurig die Götter der modernen Literatur nachahmte, gleichzeitig aber Gefallen daran fand, dass diese Initialen auch «Manuskript» bedeuteten. Onkel Victor billigte diese Kehrtwendung von ganzem Herzen. «Jedermann ist der Autor seines Lebens», sagte er. «Du hast dein Buch noch nicht zu Ende geschrieben. Es ist also noch ein Manuskript. Was könnte passender sein als das?» Mit der Zeit schwand Marco aus dem allgemeinen Gebrauch. Für meinen Onkel war ich Phileas, und als ich aufs College kam, war ich für alle anderen M. S. Ein paar Witzbolde erklärten, diese Buchstaben seien auch die Abkürzung für eine Krankheit, doch inzwischen war mir jede zusätzliche Assoziation oder Ironie, mit der ich mich schmücken konnte, willkommen. Als ich Kitty Wu kennenlernte, gab sie mir etliche andere Namen, aber die waren gewissermaßen ihr persönliches Eigentum, und auch an ihnen erfreute ich mich: zum Beispiel Foggy, was nur bei besonderen Gelegenheiten benutzt wurde, und Cyrano, was mir aus Gründen zuwuchs, die später noch klar werden. Hätte Onkel Victor Kitty Wu noch kennengelernt, würde er es bestimmt zu schätzen gewusst haben, dass Marco auf seine bescheidene Weise endlich in China Fuß gefasst hatte.
Der Klarinettenunterricht kam nicht recht voran (mein Atem machte nicht mit, meine Lippen waren ungeduldig), und bald schon drückte ich mich davor. Baseball fand ich viel verlockender, und mit elf war ich eins von den dünnen amerikanischen Kindern, die überallhin ihren Handschuh mitnehmen und tausendmal am Tag die rechte Faust in die Fanghand stoßen. Baseball half mir an der Schule zweifellos über manche Hürde hinweg, und als ich in jenem ersten Frühjahr der örtlichen Little League beitrat, kam Onkel Victor zu fast allen Spielen, um mich anzufeuern. Im Juli 1958 zogen wir jedoch plötzlich nach Saint Paul, Minnesota («Eine seltene Gelegenheit», sagte Victor und meinte die Stelle als Musiklehrer, die ihm dort angeboten worden war), aber schon im Jahr darauf waren wir wieder in Chicago. Im Oktober kaufte Victor einen Fernseher und erlaubte mir, die Schule zu schwänzen, damit ich den White Sox zusehen konnte, wie sie in sechs Spielen die World Series verloren. Es war das Jahr von Early Wynn und den Go-Go-Sox, von Wally Moon und seinen himmelhohen Homeruns. Wir hielten natürlich zu Chicago, waren aber beide insgeheim froh, als der Mann mit den buschigen Augenbrauen im letzten Spiel einen aus dem Stadion schlug. Mit Beginn der nächsten Saison hielten wir dann wieder zu den Cubs – den lahmen, trotteligen Cubs, der Mannschaft, der unser Herz gehörte. Victor war felsenfest davon überzeugt, dass Baseball bei Tageslicht gespielt werden müsse, und er begrüßte es als moralische Leistung, dass der Kaugummikönig nicht der Perversion des Flutlichts erlegen war. «Wenn ich zu einem Spiel gehe», sagte er, «dann will ich nur das Können der Spieler aufleuchten sehen. Bei diesem Sport muss die Sonne scheinen und Schweiß fließen. Apollos Wagen schwebt im Zenit! Der große Ball leuchtet an Amerikas Himmel!» In diesen Jahren diskutierten wir ausführlich über Leute wie Ernie Banks, George Altman und Glen Hobbie. Hobbie mochte er ganz besonders, doch in Übereinstimmung mit seiner Sicht der Dinge erklärte mein Onkel, als Werfer werde der es nie zu etwas bringen, da sein Name nicht auf Professionalität schließen lasse. Derartige Kalauer waren typisch für Victors Humor. Inzwischen hatte ich richtig Gefallen an seinen Witzen gefunden und begriff, warum er dabei so ungerührt dreinschauen musste.
Kurz nach meinem vierzehnten Geburtstag bezog eine dritte Person unsere Wohnung. Dora Shamsky, geborene Katz, war eine füllige Witwe um die Mitte vierzig; ihre extravagante Frisur war blond gebleicht, ihr Unterleib fest in ein Mieder geschnürt. Seit dem Tod von Mr. Shamsky vor sechs Jahren hatte sie in der versicherungsstatistischen Abteilung von Mid-American Life als Sekretärin gearbeitet. Onkel Victor begegnete ihr im Tanzsaal des Featherstone Hotel, wo die Moonlight Moods auf der alljährlichen Silvesterfeier der Firma für musikalische Unterhaltung gesorgt hatten. Nach einer stürmischen Umwerbung knüpfte das Paar im März feste Bande. Ich sah an alldem durchaus nichts Kritikwürdiges und agierte bei der Hochzeit stolz als Trauzeuge. Doch als der Staub sich langsam legte, stellte ich bekümmert fest, dass meine neue Tante nicht gerade bereitwillig über Victors Witze lachte, und ich fragte mich, ob das nicht an einer gewissen Beschränktheit liegen könnte, einem Mangel an geistiger Beweglichkeit, der für die Zukunft der Verbindung nichts Gutes verhieß. Bald ging mir auf, dass es zwei Doras gab. Die eine war geschäftig und voller Elan, ein barscher, eher männlicher Charakter, der mit feldwebelhafter Tüchtigkeit durchs Haus stürmte, ein Bollwerk sprühend guter Laune, ein Besserwisser, ein Boss. Die andere Dora war eine versoffene Kokette, eine selbstmitleidige, genusssüchtige Heulsuse, die in einem rosa Bademantel herumschwankte und im Wohnzimmer auf den Boden kotzte. Die zweite war mir viel lieber, wenn auch nur, weil sie dann ein bisschen Zärtlichkeit für mich übrig zu haben schien. Andererseits stellte mich Dora, wenn sie betrunken war, vor ein Rätsel, das ich einfach nicht entwirren konnte, denn Victor wurde mürrisch und unglücklich, wenn sie sich so gehen ließ, und wenn ich etwas nicht ertragen konnte, dann war es, meinen Onkel leiden zu sehen. Mit der nüchternen, keifenden Dora konnte Victor sich abfinden; betrunken aber brachte sie bei ihm eine Strenge und Ungeduld zum Vorschein, die mir unnatürlich vorkam, wie eine Pervertierung seines wahren Ichs. So befanden sich das Gute und das Schlechte in permanentem Kriegszustand. Wenn es Dora gutging, ging es Victor schlecht; wenn es Dora schlechtging, ging es Victor gut. Die gute Dora schuf einen schlechten Victor, und der gute Victor zeigte sich nur, wenn Dora schlecht war. Über ein Jahr lang blieb ich in dieser Höllenmaschine gefangen.
Zum Glück hatte die Bostoner Busgesellschaft eine großzügige Abfindung gezahlt. Nach Victors Berechnungen reichte das Geld für vier Jahre College, plus bescheidenen Lebensunterhalt und ein wenig Taschengeld, um mich auf den sogenannten Ernst des Lebens vorzubereiten. In den ersten Jahren hielt er dieses kleine Vermögen gewissenhaft beisammen. Mein Leben finanzierte er aus seiner Tasche, und zwar gern, denn er war stolz auf seine Verantwortung und schien nicht geneigt, das Geld oder einen Teil davon anzugreifen. Das änderte sich jedoch, als Dora den Schauplatz betrat. Er hob die inzwischen aufgelaufenen Zinsen ab, dazu einen Teil des Taschengelds, und meldete mich auf einem privaten Internat in New Hampshire an, wodurch er die Auswirkungen seiner Fehlkalkulation auszugleichen glaubte. Denn obgleich sich Dora nicht als die Mutter erwies, die er sich für mich erhofft hatte, sah er keinen Grund, die Suche nach einer anderen Lösung aufzugeben. Es war natürlich sehr schade um das Taschengeld, aber da war nun einmal nichts zu machen. Vor die Wahl zwischen Jetzt und Später gestellt, entschied Victor sich immer für das Jetzt, und wenn man bedenkt, dass sein ganzes Leben an die Logik dieses Impulses geknüpft war, dann war es nur natürlich, dass er auch in diesem Fall dem Jetzt den Vorzug gab.
Drei Jahre verbrachte ich auf der Anselm’s Academy for Boys. Als ich nach dem zweiten Jahr nach Hause kam, hatten Victor und Dora sich bereits getrennt, doch welchen Sinn hätte es gehabt, schon wieder die Schule zu wechseln? Also fuhr ich nach den Sommerferien nach New Hampshire zurück. Victors Bericht über die Scheidung war ziemlich wirr, und ich erfuhr nie so ganz, was eigentlich passiert war. Die Rede war unter anderem von geplünderten Bankkonten und zerschlagenem Geschirr, aber dann wurde ein Mann namens George erwähnt, und ich fragte mich, ob der nicht auch damit zu tun haben könnte. Ich bohrte jedoch nicht nach Einzelheiten, denn nachdem die Sache einmal ausgemacht war, schien mein Onkel eher erleichtert als bekümmert darüber, wieder allein zu sein. Victor hatte den Ehekrieg überlebt, aber das bedeutete nicht, dass er keine Wunden zurückbehalten hatte. Sein Äußeres war beunruhigend verwahrlost (fehlende Knöpfe, schmutzige Kragen, ausgefranste Hosen), und selbst seine Witze hatten einen schwermütigen, fast bitteren Beiklang bekommen. Das waren schon schlechte Zeichen, aber noch größere Sorgen bereitete mir sein körperlicher Verfall. Es kam vor, dass er beim Gehen ins Stolpern geriet (ein rätselhaftes Wegknicken der Knie), im Haus an irgendwelche Sachen stieß oder plötzlich nicht mehr wusste, wo er war. Ich wusste, das Leben mit Dora hatte seinen Tribut gefordert, aber da muss noch mehr dahintergesteckt haben. Weil ich meine Besorgnis nicht noch steigern wollte, redete ich mir ein, seine Probleme hätten weniger mit seiner körperlichen als mit seiner geistigen Verfassung zu tun. Vielleicht hatte ich damit sogar recht, aber jetzt im Rückblick fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass die Symptome, die ich in jenem Sommer zum ersten Mal bemerkte, in keinem Zusammenhang mit dem Herzinfarkt gestanden haben sollen, dem er drei Jahre später erlag. Victor selbst sagte nichts, aber sein Körper teilte mir verschlüsselt etwas mit, und mir fehlten die Mittel oder das Gespür, diesen Code zu knacken.
Als ich in den Weihnachtsferien nach Chicago zurückkam, schien die Krise vorüber. Victor hatte viel von seinem Schwung wiedererlangt, und plötzlich war allerhand im Gange. Im September hatten er und Howie Dunn die Moonlight Moods aufgelöst und mit drei jüngeren Musikern – Schlagzeug, Piano und Saxophon – eine neue Band gegründet. Sie nannten sich jetzt The Moon Men und spielten fast nur Eigenkompositionen. Victor schrieb die Texte, Howie die Musik, und alle fünf sangen, gar nicht mal so schlecht. «Keine Evergreens mehr», erklärte mir Victor, als ich kam. «Keine Tanznummern. Keine feuchtfröhlichen Hochzeiten mehr. Schluss mit dem albernen Affentheater; diesmal wollen wir ganz groß rauskommen.» Keine Frage, sie hatten wirklich ein originelles Programm auf die Beine gestellt, und als ich am nächsten Abend eine ihrer Vorstellungen besuchte, kamen mir ihre Stücke wie eine Offenbarung vor – humorvoll und beseelt, ausgelassen und wild; von der Politik bis zur Liebe wurde alles verspottet. Victors Texte wirkten zunächst wie unbeschwerte Liedchen, doch verbarg sich dahinter ein nahezu swiftscher Witz. Spike Jones im Verein mit Schopenhauer, falls so etwas möglich ist. Howie hatte den Moon Men ein Engagement bei einem der Clubs in der Innenstadt von Chicago besorgt, wo sie von Thanksgiving bis zum Valentinstag jedes Wochenende auftraten. Als ich nach Beendigung der Highschool nach Chicago zurückkam, bereiteten sie sich gerade auf eine Tournee vor, und es war sogar die Rede von einer Schallplattenaufnahme bei einer Gesellschaft in Los Angeles. Und hier kam nun die Sache mit Onkel Victors Büchern. Mitte September begann die Tournee, und er wusste nicht, wann er zurück sein würde.
Es war spätabends, weniger als eine Woche vor meiner Abfahrt nach New York. Victor saß in seinem Sessel am Fenster, arbeitete sich durch ein Päckchen Raleighs und trank Schnaps aus einem billigen Wasserglas. Ich lümmelte auf der Couch, schwebte glücklich auf Wolken von Bourbon und Rauch. Drei oder vier Stunden lang hatten wir über alles Mögliche geredet, und jetzt war die Unterhaltung eingeschlafen; jeder von uns hing schweigend seinen Gedanken nach. Onkel Victor zog ein letztes Mal an seiner Zigarette, blinzelte, als der Rauch an seiner Wange emporkräuselte, und drückte die Kippe in seinem Lieblingsaschenbecher aus, einem Souvenir von der Weltausstellung 1939. Während er mich mit glasiger Zuneigung betrachtete, nahm er einen weiteren Schluck aus seinem Glas, leckte sich die Lippen und stieß einen tiefen Seufzer aus. «Jetzt kommen wir zum unangenehmen Teil», sagte er. «Zum Schluss, zum Abschied, zu den berühmten letzten Worten. Die Zelte abbrechen, sagt man wohl in den Westernfilmen dazu. Auch wenn du nicht oft von mir hören wirst, Phileas, denk immer daran, dass ich in Gedanken bei dir bin. Ich würde ja selbst gern wissen, wo ich landen werde, aber uns beiden winken jetzt plötzlich neue Welten, und ich bezweifle, dass wir viel Gelegenheit haben werden, Briefe zu schreiben.» Onkel Victor unterbrach sich, um sich eine neue Zigarette anzuzünden, und ich sah seine Hand mit dem Streichholz zittern. «Niemand weiß, wie lange das gehen wird», fuhr er fort, «aber Howie ist sehr optimistisch. Wir haben schon eine Menge Buchungen, und zweifellos werden noch mehr dazukommen. Colorado, Arizona, Nevada, Kalifornien. Wir schlagen uns Richtung Westen durch, stürzen uns in die Wildnis. Dürfte ganz interessant werden, egal was dabei rauskommt. Eine Bande Großstadtpinkel im Land der Cowboys und Indianer. Aber mir gefällt der Gedanke an dieses weite Land, der Gedanke, unterm Wüstenhimmel meine Musik zu spielen. Wer weiß, vielleicht enthüllt sich mir da draußen eine neue Wahrheit?»
Onkel Victor lachte, wie um diesem Gedanken ein Stück von seiner Ernsthaftigkeit zu nehmen. «Es geht darum», begann er wieder, «dass ich auf so großen Strecken nur mit leichtem Gepäck reisen kann. Ich muss alles Mögliche ausrangieren, weggeben, auf den Müll werfen. Aber die Vorstellung, dass all das für immer verschwindet, tut mir weh, und deshalb sollst du die ganzen Sachen haben. Wem kann ich denn sonst vertrauen? Wer sonst könnte die Tradition weiterführen? Mit den Büchern geht es los. Ja, ja, alle miteinander. Was mich betrifft, könnte der Augenblick dafür gar nicht günstiger sein. Als ich sie heute Nachmittag gezählt habe, kam ich auf eintausendvierhundertzweiundneunzig Bände. Eine vorteilhafte Zahl, finde ich, denn sie erinnert an die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, und dein ehemaliges College ist auch nach Kolumbus benannt. Manche dieser Bücher sind groß, manche klein, manche sind dick, andere dünn – doch alle enthalten sie Worte. Die Lektüre dieser Worte könnte dir bei deiner Ausbildung nützlich sein. Nein, nein, ich will nichts hören. Keinen Mucks. Wenn du erst mal in New York wohnst, werde ich sie dir schicken lassen. Das doppelte Exemplar von Dante behalte ich, aber alle anderen sollst du haben. Dann das hölzerne Schachspiel. Das magnetische behalte ich, aber das hölzerne nimmst du. Dann die Zigarrenkiste mit den Baseball-Autogrammen. Die Cub-Spieler der letzten zwei Jahrzehnte sind fast komplett, dazu ein paar Stars und jede Menge kleinere Lichter aus der ganzen Liga. Matt Batts, Memo Luna, Rip Repulski, Putsy Caballero, Dick Drott. Die Namen sind so obskur, dass sie schon deshalb unsterblich sein sollten. Sodann komme ich zu allerlei Krimskrams, Plunder, Kleinzeug. Meine Aschenbecher, Souvenirs aus New York und dem Alamo, die Haydn- und Mozartaufnahmen, die ich mit dem Cleveland Orchestra gemacht habe, das Familien-Fotoalbum, die Plakette, die ich als Junge für den Sieg beim landesweiten Musikwettbewerb bekommen habe. Das war 1924, falls du das glauben kannst – vor langer, langer Zeit. Und schließlich sollst du auch den Tweedanzug haben, den ich mir vor ein paar Wintern im Loop gekauft habe. Wo ich hinfahre, werde ich ihn nicht brauchen, und er ist aus feinster schottischer Wolle. Ich habe ihn nur zweimal getragen, und wenn ich ihn der Heilsarmee schenke, landet er doch nur auf dem Rücken irgendeines Trunkenbolds aus der Skid Row. Bei dir ist er viel besser aufgehoben. Du wirst vornehm darin aussehen, und es ist doch kein Verbrechen, wenn man einen guten Eindruck macht, oder? Morgen gehen wir als Erstes gleich zum Schneider und lassen ihn ändern.
Damit wäre für alles gesorgt, denke ich. Die Bücher, das Schachspiel, die Autogramme, der Kleinkram, der Anzug. So, nachdem ich mein Königreich abgetreten habe, fühle ich mich zufrieden. Du brauchst mich gar nicht so anzusehen. Ich weiß, was ich tue, und ich bin froh, es getan zu haben. Du bist ein guter Junge, Phileas, und du wirst immer bei mir sein, egal wo ich bin. Fürs Erste bewegen wir uns in entgegengesetzte Richtungen. Aber früher oder später werden wir uns wieder sehen, da bin ich ganz sicher. Am Ende gelingt alles, verstehst du, alles fügt sich zusammen. Die neun Kreise. Die neun Planeten. Die neun Innings. Unsere neun Leben. Denk nur mal drüber nach. Es gibt da unendlich viele Verbindungen. Aber für heute Abend habe ich genug gequasselt. Es wird spät, der Schlaf ruft nach uns beiden. Komm, gib mir deine Hand. Ja, so ist’s richtig, ein guter fester Griff. Genau so. Und jetzt schütteln. So ist’s recht, ein Abschiedsschütteln, das bis ans Ende der Zeiten vorhalten soll.»
Alle ein bis zwei Wochen schickte Victor mir eine Postkarte, meist knallbuntes Touristenzeug: die Rocky Mountains bei Sonnenuntergang, Werbefotos von Motels, Kakteen und Rodeos, Vergnügungsranches, Geisterstädte, Wüstenpanoramen. Manchmal standen die Grüße im Ring eines gemalten Lassos, und einmal sprach sogar ein Maultier mittels einer Sprechblase über seinem Kopf: Grüße aus Silver Gulch. Auf der anderen Seite knappe, kaum lesbar hingekritzelte Mitteilungen, aber ich gierte nicht nach Neuigkeiten von meinem Onkel, gelegentliche Lebenszeichen waren mir viel wichtiger. Das eigentliche Vergnügen aber lag in den Karten selbst, und je dämlicher und geschmackloser sie waren, desto glücklicher nahm ich sie in Empfang. Jede, die ich in meinem Briefkasten fand, sagte mir, dass unser gemeinsamer Spaß weiterging, und die allerbesten (ein Bild von einem leeren Restaurant in Reno, eine fette Frau zu Pferde in Cheyenne) heftete ich sogar an die Wand über meinem Bett. Das leere Restaurant leuchtete meinem Zimmergenossen noch ein, aber die Reiterin stellte ihn vor ein Rätsel. Ich erklärte, sie sei Dora, der Exfrau meines Onkels, geradezu unheimlich ähnlich. Und so, wie es auf der Welt zugehe, sagte ich, könne es durchaus sein, dass diese Frau tatsächlich Dora sei.
Da Victor nirgendwo allzu lange blieb, kam ich kaum dazu, ihm zu antworten. Ende Oktober schrieb ich ihm einen Neun-Seiten-Brief über den New Yorker Stromausfall (ich war mit zwei Freunden in einem Fahrstuhl hängen geblieben), den ich aber erst im Januar abschickte, als die Moon Men ihr dreiwöchiges Engagement in Tahoe antraten. Oft schreiben konnte ich also nicht, dennoch gelang es mir, geistig mit ihm in Kontakt zu bleiben, indem ich seinen Anzug trug. Anzüge waren damals bei Studenten nicht gerade in Mode, aber ich fühlte mich wohl darin, und da ich praktisch ohnehin nichts anderes hatte, trug ich ihn weiterhin Tag für Tag, das ganze Jahr hindurch. In angespannten und unglücklichen Momenten war es mir ein besonderer Trost, von den warmen Kleidern meines Onkels umhüllt zu sein, und manchmal stellte ich mir vor, der Anzug halte mich buchstäblich zusammen, wenn ich ihn nicht trüge, würde mein Körper auseinander fliegen. Er wirkte wie eine schützende Hülle, eine zweite Haut, die mir die Schläge des Lebens vom Leib hielt. Im Rückblick wird mir klar, was für eine seltsame Figur ich abgegeben haben muss: hager, unordentlich, ernst, ein junger Mann, der mit dem Rest der Welt offenbar nicht in Einklang war. Und in der Tat, ich wollte mich gar nicht anpassen. Wenn meine Kommilitonen mich für verschroben hielten, war das nicht mein Problem. Ich war der sublime Intellektuelle, das finstere und selbstherrliche zukünftige Genie, der feige Malvolio, der sich von der Menge fern hielt. Ich muss schier erröten bei der Erinnerung an die lächerlichen Posen, die ich damals einnahm. Ich war ein groteskes Gemisch aus Schüchternheit und Arroganz, hin- und hergerissen zwischen langem, verlegenem Schweigen und heftigen, ungestümen Ausbrüchen. Wenn es mich überkam, verbrachte ich ganze Nächte in Bars, trank und rauchte, als ob ich mich umbringen wollte, zitierte Verse von unbedeutenden Dichtern des sechzehnten Jahrhunderts, erging mich auf lateinisch in dunklen Anspielungen auf mittelalterliche Philosophen, tat alles Mögliche, um meine Freunde zu beeindrucken. Achtzehn ist ein schreckliches Alter, und während ich in der Überzeugung umherlief, erwachsener zu sein als meine Mitschüler, hatte ich mich in Wahrheit bloß auf eine andere Art des Jungseins verlegt. Mehr als alles andere war der Anzug das Kennzeichen meiner Identität, ein Sinnbild dessen, wie ich von anderen gesehen werden wollte. Objektiv betrachtet, war mit dem Anzug alles in Ordnung. Es war ein dunkler, grünlicher, kleinkarierter Tweed mit schmalen Aufschlägen – ein robustes, gutgearbeitetes Kleidungsstück –, doch nachdem ich ihn einige Monate ständig getragen hatte, machte er allmählich einen eher hinfälligen Eindruck, hing wie ein krauser Einfall, wie ein schlaffes Wollgewirr an meinem dünnen Körper. Natürlich wussten meine Freunde nicht, dass ich ihn aus Sentimentalität trug. Mit meinem nonkonformistischen Äußeren befriedigte ich nämlich auch das Verlangen, meinen Onkel bei mir zu haben, und dabei spielte der Schnitt dieses Kleidungsstücks kaum eine Rolle. Hätte Victor mir einen lila Laffenanzug geschenkt, würde ich ihn zweifellos im selben Geist getragen haben wie den Tweed.
Als im Frühjahr der Unterricht endete, schlug mein Mitbewohner vor, wir sollten uns im nächsten Jahr eine Wohnung teilen; ich lehnte ab. Ich mochte Zimmer durchaus (tatsächlich war er mein bester Freund), aber nach vier Jahren Wohnheim und Stubengenossen konnte ich der Versuchung, einmal allein zu leben, einfach nicht widerstehen. Ich fand dann die Wohnung an der West 112th Street, wo ich am 14. Juni mit meinen Koffern einzog, nur wenige Augenblicke bevor zwei kräftige Männer die sechsundsiebzig Kartons mit Onkel Victors Büchern ablieferten, die während der letzten neun Monate in einem Lager untergebracht gewesen waren. Es war eine Atelierwohnung im vierten Stock eines großen Gebäudes mit Aufzug: ein mittelgroßer Raum mit Kochnische in der Südostecke, einem Wandschrank, einem Badezimmer und zwei Fenstern mit Blick auf eine Gasse. Auf dem Sims gurrten Tauben und schlugen mit den Flügeln, unten auf der Straße standen sechs verbeulte Mülltonnen. Drinnen herrschten Grautöne vor und verbreiteten eine stets trübe Stimmung, die auch an den sonnigsten Tagen allenfalls dürftig aufhellte. Anfangs gab es mir manchen Stich, jagte mir manch ängstliche Beklemmung ein, so ganz allein zu leben, aber dann machte ich eine eigenartige Entdeckung, die mir half, mich mit der Wohnung anzufreunden und mich darin einzuleben. In der zweiten oder dritten Nacht stand ich einmal ganz zufällig zwischen den beiden Fenstern, ein wenig schräg dem linken zugewandt. Ich ließ meinen Blick leichthin in diese Richtung wandern, und plötzlich bemerkte ich zwischen den zwei Gebäuden im Hintergrund einen schmalen Durchlass. Ich sah auf den Broadway, einen sehr kleinen, stark verkürzten Teil des Broadway, und das Bemerkenswerte daran war, dass die gesamte Aussicht, die ich darauf hatte, von einem Neonlicht, einer leuchtenden Fackel aus rosa und blauen Buchstaben ausgefüllt wurde, die das Wort MOONPALACE bildeten. Ich erkannte darin die Reklame des chinesischen Restaurants am Ende des Blocks, aber die Gewalt, mit der dieses Wort mich bestürmte, verdrängte jegliche Verbindung oder Beziehung zur Realität. Es waren magische Buchstaben, die dort im Dunkel hingen wie eine Botschaft des Himmels. MOONPALACE. Ich musste sofort an Onkel Victor und seine Band denken, und in diesem ersten, irrationalen Augenblick verloren meine Ängste ihre Macht über mich. Etwas derart Plötzliches und Absolutes hatte ich noch nie erlebt. Ein kahler und schmuddeliger Raum hatte sich in eine Stätte der Innerlichkeit verwandelt, in einen Kreuzungspunkt seltsamer Vorzeichen und rätselhafter Zufälligkeiten. Noch lange starrte ich die Leuchtreklame des Moon Palace an, und allmählich begriff ich, dass ich am rechten Ort gelandet war, dass ich in genau dieser kleinen Wohnung leben wollte.
Den Sommer über arbeitete ich halbtags in einem Buchladen, ging oft ins Kino und liierte und entzweite mich mit einem Mädchen namens Cynthia, dessen Gesicht schon längst aus meiner Erinnerung verschwunden ist. In meiner neuen Wohnung fühlte ich mich mehr und mehr zu Hause, und als im Herbst wieder der Unterricht begann, stürzte ich mich in hektische Vergnügungen, trank nächtelang mit Zimmer und meinen Freunden, jagte nach Liebesabenteuern und feierte lange, vollkommen stumme Lern- und Leseorgien. Viel später, als ich aus der Distanz der Jahre auf all das zurückblickte, wurde mir klar, wie fruchtbar diese Zeit für mich gewesen war.
Dann wurde ich zwanzig, und nur wenige Wochen danach erhielt ich einen langen, nahezu unverständlichen Brief von Onkel Victor, mit Bleistift auf die Rückseite gelber Bestellscheine für die Humboldt Encyclopedia geschrieben. Soweit ich daraus schlau werden konnte, waren die Moon Men in arge Schwierigkeiten geraten und nach einer ausgedehnten Pechsträhne (geplatzte Engagements, Reifenpannen, ein Betrunkener, der dem Saxophonisten die Nase eingeschlagen hatte) schließlich auseinandergegangen. Seit November lebte Onkel Victor in Boise, Idaho, wo er als Vertreter für Lexika eine vorübergehende Arbeit gefunden hatte. Aber das brachte nicht viel ein, und zum ersten Mal in all den Jahren, die ich ihn kannte, vernahm ich so etwas wie Mutlosigkeit in Victors Worten. «Meine Klarinette ist im Pfandhaus», hieß es in dem Brief, «mein Bankkonto steht auf null, und die Einwohner von Boise sind an Enzyklopädien nicht interessiert.»
Ich kabelte meinem Onkel Geld, dann drängte ich ihn in einem Telegramm, nach New York zu kommen. Einige Tage später dankte Victor mir für die Einladung. Ende der Woche werde er seine Geschäfte abschließen, schrieb er, und dann den nächsten Bus nehmen. Ich rechnete mir aus, dass er Dienstag, spätestens Mittwoch eintreffen würde. Aber der Mittwoch kam und ging, ohne dass Victor auftauchte. Ich schickte ein weiteres Telegramm, erhielt aber keine Antwort. Ich stellte mir Katastrophen in Hülle und Fülle vor. Ich malte mir aus, was einem Mann zwischen Boise und New York alles zustoßen konnte, und mit einem Mal war der ganze amerikanische Kontinent eine riesige Gefahrenzone, ein böser Albtraum aus Fallen und Labyrinthen. Ich versuchte den Inhaber von Victors Pension ausfindig zu machen, jedoch vergeblich; und dann blieb mir nur noch, die Polizei in Boise anzurufen. Sorgfältig erklärte ich mein Problem dem Sergeant am anderen Ende, einem Mann namens Neil Armstrong. Tags darauf rief Sergeant Armstrong zurück. Onkel Victor war in seinem Zimmer an der North 12th Street tot aufgefunden worden – zusammengesunken auf einem Stuhl, im Mantel, die Finger der rechten Hand hielten eine halb zusammengesetzte Klarinette umklammert. Neben der Tür hatten zwei gepackte Koffer gestanden. Der Raum wurde untersucht, doch konnten die Beamten keinen Hinweis auf ein Verbrechen entdecken. Dem Vorbericht des Leichenbeschauers zufolge war die wahrscheinliche Todesursache ein Herzinfarkt. «Pech, mein Junge», sagte der Sergeant noch, «tut mir wirklich leid.»
Am nächsten Morgen flog ich nach Westen, um das Nötige zu veranlassen. Ich identifizierte Victor im Leichenschauhaus, beglich seine Schulden, unterschrieb Papiere und Formulare, traf Vorbereitungen für den Transport der Leiche nach Chicago. Der Bestattungsunternehmer von Boise war über den Zustand der Leiche verzweifelt. Nachdem sie fast eine Woche lang in dem Zimmer gelegen hatte, war nicht mehr viel damit zu machen. «An Ihrer Stelle», sagte er zu mir, «würde ich keine Wunder erwarten.»
Telefonisch arrangierte ich die Beerdigung, nahm Verbindung mit einigen Freunden Victors auf (Howie Dunn, dem Saxophonisten mit der gebrochenen Nase, einer Reihe seiner ehemaligen Schüler), unternahm einen halbherzigen Versuch, Dora zu erreichen (sie war nicht aufzufinden), und begleitete schließlich den Sarg nach Chicago zurück. Victor wurde neben meiner Mutter bestattet, es goss in Strömen, als wir dort standen und unseren Freund in der Erde verschwinden sahen. Danach fuhren wir zu Dunns Haus an der North Side, wo Mrs. Dunn ein bescheidenes Mahl aus kaltem Aufschnitt und heißer Suppe vorbereitet hatte. Ich hatte die letzten vier Stunden ununterbrochen geweint und kippte jetzt beim Essen fünf oder sechs doppelte Bourbons in mich hinein. Dies hellte meine Laune beträchtlich auf, und nach etwa einer Stunde begann ich mit lauter Stimme zu singen. Howie begleitete mich auf dem Piano, und eine Weile ging es ziemlich wüst her auf der Versammlung. Als ich mich dann auf den Boden erbrach, war der Zauber gebrochen. Um sechs Uhr verabschiedete ich mich und taumelte in den Regen hinaus. Zwei Stunden lang irrte ich blindlings umher, erbrach mich noch einmal vor einer Haustür und traf dann in einer neonhellen Straße unter einem Schirm eine dünne grauäugige Prostituierte namens Agnes. Ich begleitete sie auf ihr Zimmer im Eldorado Hotel, hielt ihr einen kurzen Vortrag über die Gedichte von Sir Walter Raleigh und sang ihr Schlaflieder vor, während sie sich auszog und die Beine spreizte. Sie sagte, ich sei wahnsinnig, doch als ich ihr hundert Dollar gab, hatte sie nichts mehr dagegen, die Nacht mit mir zu verbringen. Ich schlief freilich schlecht, und um vier Uhr morgens schlüpfte ich aus dem Bett, stieg in meine feuchten Kleider und nahm ein Taxi zum Flughafen. Um zehn Uhr war ich wieder in New York.
Trauer war am Ende nicht das Problem. Sie war vielleicht die erste Ursache, wich jedoch bald etwas anderem – etwas Greifbarerem, in seinen Auswirkungen besser Berechenbarem, heftiger Zersetzendem. Eine ganze Kette von Gewalten war in Gang gesetzt worden, und irgendwann geriet ich ins Taumeln, flog in immer größeren Kreisen um mich selbst, bis ich am Ende aus der Umlaufbahn trudelte.
Mit einem Wort, meine finanzielle Situation verschlechterte sich. Mir war das schon seit einiger Zeit bewusst gewesen, doch bis dahin hatte die Gefahr nur in weiter Ferne gelauert, und ich hatte keinen ernsthaften Gedanken daran verschwendet. In den schrecklichen Tagen nach Onkel Victors Tod hatte ich jedoch Tausende von Dollars ausgegeben, sodass der Vorrat, der mich durch die Collegezeit begleiten sollte, arg zusammengeschrumpft war. Falls ich nicht irgendetwas unternahm, die Summe zu ersetzen, würde es nicht bis zum Ende reichen. Wenn ich das Geld weiter im gegenwärtigen Tempo ausgäbe, rechnete ich mir aus, wären meine Mittel im November meines letzten Studienjahres erschöpft. Und zwar vollständig, bis auf den allerletzten Penny.
Mein erster Gedanke war, das College zu verlassen, aber nachdem ich ein paar Tage mit diesem Gedanken gespielt hatte, besann ich mich eines Besseren. Ich hatte meinem Onkel versprochen, das Examen zu machen, und da er nun nicht mehr da war, um irgendeine Änderung meiner Pläne gutheißen zu können, glaubte ich mein Wort nicht einfach brechen zu dürfen. Dazu kam das Problem der Einberufung. Wenn ich jetzt vom College abginge, würde meine studienbedingte Zurückstellung aufgehoben, und die Vorstellung, einem frühen Tod in den Dschungeln Asiens entgegenzumarschieren, gefiel mir überhaupt nicht. Also würde ich in New York bleiben und weiter auf die Columbia University gehen. Eine vernünftige Entscheidung, das einzig Richtige. Nach einem so verheißungsvollen Beginn hätte es mir eigentlich nicht schwer fallen sollen, vernünftig weiterzumachen. Leuten in meiner Lage boten sich allerhand Möglichkeiten – Stipendien, Darlehen, kombinierte Studien- und Arbeitsprogramme –, doch als ich darüber nachzudenken begann, fühlte ich mich ziemlich angewidert. Es handelte sich um eine jähe, unwillkürliche Reaktion, einen heftigen Anfall von Ekel. Ich wollte an alldem nicht teilhaben, erkannte ich, und wies es daher in Bausch und Bogen von mir – stur, verächtlich, im klaren Bewusstsein der Tatsache, dass ich soeben meine einzige Hoffnung, die Krise zu überstehen, zunichtegemacht hatte. Von da an unternahm ich nichts mehr, um mir selbst zu helfen, weigerte mich, auch nur einen Finger zu rühren. Weiß der Himmel, warum ich mich so angestellt habe. Damals ersann ich zahllose Rechtfertigungen, aber am Ende war es doch wohl nichts anderes als Verzweiflung. Ich war verzweifelt, zutiefst aufgewühlt, und hielt irgendein drastisches Vorgehen für angebracht. Ich wollte der Welt ins Gesicht spucken, etwas so Ausgefallenes wie nur möglich machen. Und mit dem ganzen Eifer und Idealismus eines jungen Mannes, der zu viel nachgedacht und zu viele Bücher gelesen hatte, beschloss ich dann, gar nichts zu unternehmen: Meine Tat würde ein militantes Verweigern jeglicher Tat sein. Das war ein zur ästhetischen Lehre verklärter Nihilismus. Ich wollte mein Leben zu einem Kunstwerk machen, mich selbst solch hochgradigen Widersprüchen aussetzen, dass jeder Atemzug mich lehren würde, mein Verhängnis auszukosten. Die Zeichen wiesen auf totale Finsternis, und sosehr ich nach einer anderen Interpretation tastete, so sehr lockte mich die Vorstellung dieser Finsternis und verführte mich allmählich durch die Schlichtheit ihres Gefüges. Ich wollte nichts tun, um dem Unausweichlichen zu entrinnen, wollte mich aber auch nicht hineinstürzen. Wenn das Leben fürs Erste so weiterginge wie früher, dann umso besser. Ich würde geduldig sein und unerschütterlich durchhalten. Ich wusste eben einfach, was mich erwartete, und ob es nun heute passierte oder morgen, war egal; passieren würde es jedenfalls. Totale Finsternis. Das Opfertier war geschlachtet, seine Eingeweide gedeutet. Der Mond würde sich vor die Sonne schieben, und genau da würde ich verschwinden. Ich wäre vollkommen pleite, ein Stück Treibgut aus Fleisch und Knochen ohne einen einzigen Cent.
Damals begann ich, Onkel Victors Bücher zu lesen. Zwei Wochen nach der Beerdigung nahm ich mir wahllos einen der Kartons vor, schlitzte mit einem Messer vorsichtig das Klebeband auf und las alles, was ich darin fand. Es war eine seltsame Mischung, anscheinend ohne bestimmte Ordnung oder Absicht zusammengepackt. Romane und Schauspiele, Geschichtsbücher und Reisebücher, Schachlehrbücher und Krimis, Science-Fiction und philosophische Werke – ein vollkommenes Durcheinander von Gedrucktem. Mir war das einerlei. Ich las jedes Buch bis zum Ende und weigerte mich, ein Urteil darüber zu fällen. Für mich war jedes Buch jedem anderen Buch gleichwertig, bestand jeder Satz aus genau der richtigen Anzahl von Wörtern und stand jedes Wort genau an seinem Platz. So also wollte ich um meinen Onkel Victor trauern. Eine Kiste nach der anderen öffnen und jedes einzelne Buch darin lesen. Das war die Aufgabe, die ich mir stellte, und ich hielt durch bis zum bitteren Ende.
Jede neue Kiste enthielt ein ähnliches Durcheinander wie die erste, einen Mischmasch aus nieder und erhaben, massenhaft Eintagsfliegen neben Klassikern, zerfetzte Paperbacks zwischen gebundenen Ausgaben, Kommerz dicht an dicht mit Donne und Tolstoi. Onkel Victor hatte seine Bibliothek auf systematische Weise geordnet. Jedes neuerworbene Buch hatte er neben das zuletzt gekaufte ins Regal gestellt, und nach und nach waren die Reihen angewachsen, hatten im Lauf der Jahre immer mehr Platz eingenommen. Und genauso waren die Bücher in die Kisten gewandert. Wenn auch sonst nichts stimmte, die Chronologie war intakt, die Reihenfolge durch Saumseligkeit erhalten geblieben. Ich hielt das für eine ideale Anordnung. Jedes Mal, wenn ich eine Kiste aufmachte, konnte ich einen anderen Abschnitt von Onkel Victors Leben besichtigen, einen bestimmten Zeitraum von Tagen, Wochen oder Monaten; mich tröstete das Gefühl, dass ich denselben geistigen Raum betrat, den Victor auch schon einmal betreten hatte – ich las dieselben Worte, lebte in denselben Geschichten, dachte womöglich sogar dieselben Gedanken. Fast war es, als folgte ich der Route eines Forschers aus längst vergangenen Tagen, als wiederholte ich seine entschlossenen Schritte in unberührtes Gebiet, westwärts mit der Sonne, dem Licht hinterher, bis es schließlich erlosch. Da die Kisten weder nummeriert noch beschriftet waren, konnte ich nie im Voraus wissen, in welchen Abschnitt ich mich begeben würde. Die Reise war daher eine Folge von einzelnen, unzusammenhängenden Spritztouren. Von Boston nach Lenox etwa. Von Minneapolis nach Sioux Falls. Von Kenosha nach Salt Lake City. Es kümmerte mich nicht, dass ich gezwungen war, auf der Landkarte herumzuspringen. Am Ende würden alle weißen Flecke ausgefüllt und alle Fernen durchmessen sein.
Viele der Bücher kannte ich bereits, einige waren mir von Victor vorgelesen worden: Robinson Crusoe, Doktor Jekyll und Mr. Hyde, Unsichtbar. Davon ließ ich mich aber nicht abhalten. Ich ackerte mich durch alles mit gleich bleibender Leidenschaft, verschlang alte Werke ebenso gierig wie neue. In den Ecken meines Zimmers wuchsen Stapel ausgelesener Bücher, und wann immer einer dieser Türme umzustürzen drohte, packte ich die gefährdeten Bände in zwei Einkaufstüten und nahm sie auf meinem nächsten Gang zur Columbia mit. Gleich gegenüber dem Campus lag am Broadway Chandler’s Bookstore, ein vollgestopftes, staubiges Rattenloch, das schwunghaften Handel mit alten Büchern trieb. Zwischen dem Sommer 1967 und dem Sommer 1969 erschien ich dort Dutzende Male, um nach und nach mein Erbe zu veräußern. Es war die einzige Tat, die ich mir zugestand – Gebrauch zu machen von dem, was mir ohnehin gehörte. Es bereitete mir Kummer, mich von Onkel Victors ehemaligen Besitztümern zu trennen, doch war mir dabei klar, dass er es mir nicht übel genommen hätte. Durch das Lesen der Bücher hatte ich meine Schuld bei ihm gewissermaßen beglichen, und bei meiner akuten Geldknappheit schien es mir nur logisch, den nächsten Schritt zu unternehmen und die Bücher zu Geld zu machen.
Das Problem war, dass ich nicht genug daran verdiente. Chandler war nur auf seinen Vorteil aus, und er dachte von Büchern so ganz anders als ich, dass ich kaum wusste, was ich zu ihm sagen sollte. Für mich waren Bücher keine Behälter für Wörter, sondern eher die Worte selbst, und der Wert eines bestimmten Buchs ergab sich mehr aus seinem geistigen Rang als aus seinem äußerlichen Zustand. So war etwa ein eselsohriger Homer wertvoller als ein bildschöner Vergil; drei Bände Descartes waren nicht so viel wert wie einer von Pascal. Für mich waren das fundamentale Unterschiede, aber für Chandler gab es sie einfach nicht. Ein Buch war für ihn lediglich ein Gegenstand, ein Ding, das der Welt der Dinge angehörte, und als solches unterschied es sich nicht wesentlich von einem Schuhkarton, einer Saugglocke oder einer Kaffeekanne. Jedes Mal, wenn ich einen Teil von Onkel Victors Bibliothek zu ihm brachte, begann der alte Mann mit der gleichen Prozedur. Er befingerte die Bücher voller Verachtung, prüfte die Rücken, suchte nach Flecken und Schäden und vermittelte stets den Eindruck eines Menschen, der in einem Haufen Unrat wühlt. Das waren die Spielregeln. Tiefstpreise konnte Chandler nur bieten, wenn er die Ware schlecht machte. Nach dreißig Jahren Übung beherrschte er die Sache aus dem Effeff, hatte ein Repertoire von Gemurmel und beiläufigen Bemerkungen, schmerzlichen Grimassen, Zungenschnalzern und traurigem Kopfschütteln parat. Dieses Theater sollte mir die Belanglosigkeit meines Urteils vor Augen führen, sollte mich beschämt die Dreistigkeit erkennen lassen, mit der ich ihm diese Bücher überhaupt anzubieten wagte. Wollen Sie allen Ernstes Geld für diese Sachen haben? Erwarten Sie etwa auch Geld vom Müllmann, wenn er Ihren Abfall wegbringt?
Ich wusste, dass ich betrogen wurde, protestierte aber nur selten. Was hätte ich denn machen sollen? Chandler war der Stärkere, und daran ließ sich nichts ändern – denn ich wollte immer unbedingt verkaufen, und ihm lag nie etwas am Kaufen. Es hatte auch gar keinen Sinn, ihm meinerseits Gleichgültigkeit vorzuspielen. Dann wäre der Handel einfach nicht zustande gekommen, und das wäre am Ende noch schlimmer gewesen, als betrogen zu werden. Ich fand heraus, dass ich gewöhnlich besser fuhr, wenn ich ihm kleinere Mengen Bücher brachte, also höchstens zwölf bis fünfzehn auf einmal. Dann schien der Durchschnittspreis pro Buch ein wenig zu steigen. Aber je geringer der Erlös, desto öfter musste ich wiederkommen, und mir war klar, dass ich ihn so selten wie möglich aufsuchen durfte – denn je mehr ich mit Chandler zu tun hatte, desto schwächer wurde meine Position. Ich konnte also tun, was ich wollte, Chandler musste immer gewinnen. In all diesen Monaten machte der Alte sich nicht die Mühe, mit mir zu reden. Er grüßte nicht, er lächelte nicht, er gab mir nicht einmal die Hand. Er tat so interesselos, dass ich mich manchmal fragte, ob er sich von einem Besuch zum anderen überhaupt an mich erinnerte. Was Chandler anging, hätte ich jedes Mal ein neuer Kunde sein können – einer von einer Reihe diverser Fremder, einer beliebigen Masse.
Während ich nach und nach die Bücher verkaufte, machte meine Wohnung viele Veränderungen durch. Das war unvermeidlich, denn mit jedem weiteren Karton, den ich öffnete, wurde zugleich ein weiteres Möbelstück zerstört. Mein Bett wurde abgebaut, meine Stühle schrumpften und verschwanden, mein Schreibtisch zerstob in den leeren Raum. Mein Leben war zu einem anwachsenden Nichts geworden; ich sah es buchstäblich vor mir: eine fühlbare, sich aufblähende Leere. Jedes Mal, wenn ich mich in die Vergangenheit meines Onkels wagte, hatte das ein greifbares Ergebnis, eine Auswirkung in der realen Welt. Folglich standen mir die Konsequenzen immer vor Augen, und es gab keine Möglichkeit, ihnen zu entrinnen. So viele Kisten waren noch übrig, so viele Kisten waren schon fort. Ich brauchte nur mein Zimmer anzusehen, um zu wissen, was geschah. Das Zimmer war ein Messgerät für meinen Zustand: wie viel von mir noch da war, wie viel schon weg. Ich war Täter und Zeuge zugleich, Schauspieler und Publikum in einem Einmanntheater. Ich konnte meiner fortschreitenden Zergliederung zusehen. Stück für Stück konnte ich mich verschwinden sehen.
Es waren freilich schwere Zeiten für jedermann. In meiner Erinnerung bilden sie ein Chaos aus Politik und Aufmärschen, Empörung, Megaphonen und Gewalt. Im Frühjahr 1968 schien jeder Tag einen neuen Umsturz hervorzuwürgen. Wenn nicht in Prag, dann in Berlin; wenn nicht in Paris, dann in New York. In Vietnam waren eine halbe Million Soldaten. Der Präsident verzichtete auf eine zweite Kandidatur. Leute wurden ermordet. Nach jahrelangen Kämpfen war der Krieg so wichtig geworden, dass nun auch die banalsten Gedanken davon infiziert waren, und ich wusste, dass ich, egal was ich tat oder nicht tat, ebenso daran teilhatte wie jeder andere. Als ich eines Abends auf einer Bank im Riverside Park saß und auf das Wasser hinausschaute, sah ich am anderen Ufer einen Öltank explodieren. Plötzlich stand der Himmel in Flammen, und als ich brennende Trümmerstücke über den Hudson treiben und zu meinen Füßen landen sah, kam mir der Gedanke, dass man der Wahrheit schwere Gewalt antun müsste, wollte man Inneres und Äußeres voneinander trennen. Im selben Monat noch wurde der Columbia-Campus zu einem Schlachtfeld, Hunderte von Studenten wurden verhaftet, darunter Tagträumer wie Zimmer und ich selbst. Ich gedenke nicht, das hier in irgendeiner Weise zu erörtern. Jedermann ist mit der Geschichte jener Tage vertraut, und es hätte gar keinen Sinn, noch einmal davon anzufangen. Womit ich aber nicht sagen will, dass man sie vergessen sollte. Meine eigene Geschichte fußt auf den Trümmern jener Tage, und solange das nicht klar ist, wird sie ganz und gar sinnlos erscheinen.
Als ich (im September 1967) das dritte Studienjahr antrat, war mein Anzug schon lange hinüber. Ramponiert von dem Wasserschwall bei den Unruhen in Chicago, war der Hosenboden durchgewetzt und das Jackett an Taschen und Schlitz eingerissen, und schließlich hatte ich ihn verloren gegeben. Ich hängte ihn als Andenken an glücklichere Tage in meinen Wandschrank, zog los und kaufte mir die billigsten und haltbarsten Kleider, die ich finden konnte: Arbeitsstiefel, Bluejeans, Flanellhemden und eine gebrauchte Lederjacke aus einem Army-Laden. Meine Freunde waren entsetzt über diese Verwandlung, aber ich sagte kein Wort dazu, denn was sie dachten, war noch meine geringste Sorge. Dasselbe galt für das Telefon. Nicht, um mich von der Welt zu isolieren, ließ ich es abstellen, sondern schlicht deshalb, weil es Ausgaben bedeutete, die ich mir nicht mehr leisten konnte. Als Zimmer mir deswegen eines Tages vor der Bücherei Vorhaltungen machte (er schimpfte, wie schwer ich jetzt zu erreichen sei), wich ich meinen Finanzproblemen aus und redete lang und breit über Drähte, Stimmen und den Tod der menschlichen Kommunikation. «Eine elektrisch übermittelte Stimme ist keine wirkliche», sagte ich. «Wir haben uns alle an diese Phantome unserer selbst gewöhnt, aber wenn man mal darüber nachdenkt, ist das Telefon ein Instrument der Verzerrungen und Hirngespinste. Verkehr zwischen Gespenstern, verbale Absonderungen von körperlosen Geistern. Ich will den Menschen, mit dem ich spreche, sehen können. Wenn das nicht geht, möchte ich lieber überhaupt nicht sprechen.» Solches Gerede wurde nun typisch für mich – Ausflüchte, Zweideutigkeiten, verrückte Theorien, mit denen ich auf ganz vernünftige Fragen reagierte. Da ich nicht wollte, dass jemand erfuhr, wie schlecht es mir ging, glaubte ich mir nur mit Lügen aus solchen Verlegenheiten helfen zu können. Je schlechter es mir ging, desto bizarrer und verdrehter wurden meine Erfindungen. Warum ich das Rauchen aufgegeben hatte, warum das Trinken, warum ich es aufgegeben hatte, in Restaurants zu essen – nie war ich um eine absurd rationale Erklärung verlegen. Am Ende redete ich wie ein anarchistischer Einsiedler, ein Endzeit-Spinner, ein Maschinenstürmer. Doch meine Freunde amüsierten sich, und so gelang es mir, mein Geheimnis zu bewahren. Stolz spielte bei diesen Faxen zweifellos eine Rolle, entscheidend aber war, dass niemand mir in den Weg treten sollte, den ich mir selbst bestimmt hatte. Darüber zu reden hätte nichts als Mitleid und womöglich sogar Hilfsangebote eingebracht, und das hätte mir die ganze Tour vermasselt. Lieber verschanzte ich mich hinter dem Wahnsinn meines Plans, blödelte bei jeder sich bietenden Gelegenheit herum und wartete darauf, dass meine Zeit ablief.
Das letzte Jahr war das Schlimmste. Im November hörte ich auf, meine Stromrechnungen zu bezahlen, und im Januar kam jemand von Con Edison und stellte mir den Zähler ab. Danach experimentierte ich mehrere Wochen lang mit verschiedenen Kerzen und beschäftigte mich eingehend mit Preis, Leuchtkraft und Lebensdauer der einzelnen Sorten. Zu meiner Überraschung erwiesen sich jüdische Gedenkkerzen als die günstigsten. Ich empfand das Flackern von Licht und Schatten als außerordentlich schön, und da nun auch der Kühlschrank (mit seinem sporadischen, unerwarteten Geschütter) zum Schweigen gebracht war, glaubte ich ohne Strom auf jeden Fall besser dran zu sein. Was man sonst auch über mich hätte sagen können, unterzukriegen war ich jedenfalls nicht. Ich fand die verborgenen Vorteile heraus, die jeder Mangel mit sich brachte, und hatte ich erst einmal gelernt, ohne eine bestimmte Sache auszukommen, schlug ich sie mir für immer aus dem Kopf. Dass es nicht ewig so weitergehen konnte, war mir klar (am Ende würden Dinge übrig bleiben, auf die ich nicht verzichten konnte), doch vorläufig staunte ich darüber, wie wenig ich den verlorenen Dingen nachtrauerte. Langsam, aber sicher merkte ich, dass ich fähig war, sehr weit zu gehen, viel weiter, als ich für möglich gehalten hätte.
Nachdem ich die Studiengebühren für mein letztes Semester bezahlt hatte, blieben mir nur noch knapp sechshundert Dollar; dazu ein Dutzend Kisten, die Autogrammsammlung und die Klarinette. Zu meiner Unterhaltung setzte ich das Instrument bisweilen zusammen und blies hinein, erfüllte die Wohnung mit unheimlichen Klangkaskaden, einem wilden Quietschen und Stöhnen, Lachen und klagendem Knurren. Im März verkaufte ich die Autogramme an einen Sammler namens Milo Flax, einen seltsamen kleinen Mann mit lockig-blondem Haarkranz, der auf den letzten Seiten der Sporting News annonciert hatte. Der Anblick der Kollektion von Cub-Unterschriften machte Flax sprachlos. Ehrfürchtig studierte er die Blätter, sah mich mit Tränen in den Augen an und machte die kühne Voraussage, die Cubs würden 1969 die Meisterschaft gewinnen. Beinahe behielt er ja recht, und wenn sie am Ende der Saison nicht eingebrochen wären und die abgewrackten Mets nicht gleichzeitig ihren plötzlichen Höhenflug angetreten hätten, wäre es bestimmt so gekommen. Die Autogramme brachten hundertfünfzig Dollar, mehr als eine ganze Monatsmiete. Die Bücher versorgten mich mit Essen, und so gelang es mir, mich den April und Mai hindurch über Wasser zu halten; bei flackerndem Kerzenlicht beendete ich meine Seminararbeit, paukte und tippte, bis ich für sechsundzwanzig Dollar meine Schreibmaschine verkaufte, was mich in die Lage versetzte, mir Mütze und Talar auszuleihen und an der Gegenveranstaltung zur Examensfeier teilzunehmen, die von den Studenten aus Protest gegen die offiziellen Feierlichkeiten der Universität organisiert worden war.
Ich hatte getan, was ich mir vorgenommen hatte, doch sollte ich meinen Triumph nicht genießen können. Ich war bei meinen letzten hundert Dollar angelangt, und der Büchervorrat war auf drei Kisten geschrumpft. Ans Bezahlen der Miete war gar nicht mehr zu denken; die Kaution garantierte mir zwar noch einen weiteren Monat, aber danach würde man mich zur Räumung zwingen. Falls im Juli die ersten Mahnungen kämen, würde es im August hart auf hart gehen, und im September säße ich auf der Straße. Vom sicheren 1