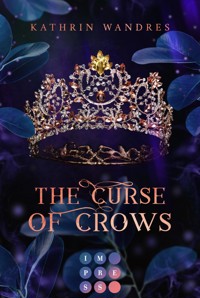3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Es war immer klar, wer die Bösen sind. Aber was, wenn das eine Lüge ist? Nacht für Nacht bangt die 17-jährige Thy um ihr Leben. Denn dann streifen Halbwesen durch das Sumpfgebiet, in dem ihre Familie Zuflucht gefunden hat. Niemand ist grausamer, niemand ist erbarmungsloser als diese allmächtigen Wesen. Töten ist ihr Leben. Doch nach Sonnenaufgang zerfallen sie zu Staub - bis zum Einbruch der nächsten Nacht. Thys Welt gerät aus den Fugen, als sie Koraj trifft: ein Halbwesen. Mitten am Tag. Und er lässt sie am Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Impressum
Namensregister
Die Sage vom Licht des Mondes
Prolog
I. Heute – Eine Woche vor Vollmond
II. – Wenige Tage vor Vollmond
III. – 4 Tage und 12 Stunden bis Vollmond
IV. – 4 Tage und 11 Stunden bis Vollmond
V. – 3 Tage und 12 Stunden bis Vollmond
VI. – 72 Stunden bis Vollmond
VII. – 2 Tage und 13 Stunden bis Vollmond
VIII. – 2 Tage und 11 Stunden bis Vollmond
IX. – 2 Tage und wenige Stunden bis Vollmond
X. – 2 Tage und wenige Stunden bis Vollmond
XI. – Vorletzte Nacht vor Vollmond
XII. – 30 Stunden bis Vollmond
XIII. – 25 Stunden bis zum Beginn der Vollmondnacht
XIV. – 24 Stunden bis zum Beginn der Vollmondnacht
XV. – 23 Stunden bis zum Beginn der Vollmondnacht
XVI. – 22 Stunden bis zum Beginn der Vollmondnacht
XVII. – Wenige Stunden vor Aufgang des Vollmondes
XVIII. – Kurz vor Sonnenuntergang
XIX. – Beginn der Mondfinsternis
XX. – Wenige Minuten vor Ende der Mondfinsternis
XXI. – Wenige Minuten nach der Mondfinsternis – Vollmond
XXII. – Der Morgen danach
Epilog - Bald
Über die Autorin
Leseprobe In Between
Kathrin Wandres
MONDFLUCH
Band 1
Herrschaft der Halbwesen
www.kathrin-wandres.de
www.facebook.com/KathrinWandresAutorin
www.instagram.com/kathrin.wandres
© 2019 Kathrin Wandres
Zeisigweg 6
73035 Göppingen
www.kathrin-wandres.de
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat und Korrektorat: Katharina Areti Dargel
Cover: Pintado | www.pintado.weebly.com
Schlussredaktion: Mira Valentin
Alle Bestandteile dieses Buches sind geistiges Eigentum der Autorin. Die Verwendung der Texte und Bild – auch auszugsweise – ist ohne vorherige Zustimmung der Autorin urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Verarbeitung mit elektronischen Medien. Die unautorisierte Nutzung und Verwertung von Texten, Namen oder Sachverhalten für oder zu Spielen und Spielsystemen aller Art ist nicht erlaubt.
Namensregister
DIE SIEDLUNG
THY, 17, mit vollem Namen Thynessa
LAIA, Mitte 30, Schwester von Thy
JASO, Ende 20, jüngerer Bruder von Serbo, bewohnt eine Hütte für sich allein
SERBO, Mitte 30, älterer Bruder von Jaso, wohnt in der Hütte der wirren Mo und versorgt sie
ORI, Oberster der Siedlung
UNINA, genannt »Mutter Una«, weil sie neben ihrem leiblichen Kind Ohnename auch einigen Waisenkindern ein Zuhause gibt
OHNENAME, wenige Wochen alt, Kind von Mutter Una
DEA, Anfang 20, Schwester von Pek, Waisenkind, wohnt bei Mutter Una
PEK, 15, Bruder von Dea, Waisenkind, wohnt bei Mutter Una
BLITZ und DONNER, 13, Waisenkinder, genannt die stummen Zwillinge, obwohl nur Blitz aufgrund eines traumatischen Erlebnisses von seiner Kindheit an stumm ist
DIE WIRRE MO, Mitte 80, älteste Bewohnerin der Siedlung
RUNE, Großvater von Thy, wohnt außerhalb der Siedlung in einer hohlen Sumpfeiche und ist seit einer Sonnenfinsternis blind
HALBWESEN
KORAJ, 20, Zugehöriger der 363. Erdengeneration
BERBAT, Oberster Kommandant der Halbwesen, Zugehöriger der 361. Erdengeneration
AYAH, abtrünniges Halbwesen, Zugehöriger der 362. Erdengeneration
Die Sage vom Licht des Mondes
Es war einmal zu einer Zeit, als der Mond noch sein eigenes Licht besaß. Es war ein wunderschönes rotglühendes Licht und viele Jahrmillionen herrschte Frieden auf dem Mond.
Doch eines Tages begannen die Wesen, die den Himmelskörper bevölkerten, sich zu bekriegen. Dabei erlosch das Licht des Mondes und stürzte zur Erde hinab.
Aus Wut über das Volk verbannte der Mond es auf die Erde mit dem Auftrag, das Licht zu suchen und zurückzubringen.
Der Mond schenkte ihnen Kräfte, die ihnen bei der Suche und beim Überleben helfen sollten. Er gab ihnen Schnelligkeit, Stärke und die Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen.
Und es kam, dass die Wesen das Licht fanden. Doch anstatt es dem Mond zurückzugeben, behielten sie es für sich. Sie missbrauchten es und benutzten die Macht des Lichts.
Seitdem herrschen sie über die Erde.
Unerbittlich.
Prolog
Damals - 17 Jahre zuvor
Sie rannte.
Seit Stunden war sie bereits auf der Flucht. Schilf peitschte ihr ins Gesicht, bremste ihren Lauf und schwächte sie zunehmend. Die Orientierung hatte sie schon lange verloren und mit ihr die Hoffnung, diesen Tag zu überleben. Jede Stelle in diesem Meer aus hohem Röhricht unterschied sich in Nichts von den Hunderten zuvor und bot so wenige Anhaltspunkte wie ein strahlend blauer Himmel an einem wolkenlosen Sommertag.
Den Himmel hatte sie bereits seit dem späten Nachmittag aus den Augen verloren. Und auch wenn ihr der Blick auf den Stand der Sonne verwehrt blieb, so spürte sie doch die aufkommende Panik, die jeder nahende Sonnenuntergang mit sich brachte. Ihr lief die Zeit davon und mit ihr eine Träne über die vor Anstrengung glühenden Wangen.
Die Verzweiflung ließ sich nicht mehr niederdrücken, ebenso wenig wie die Wut über ihre Unachtsamkeit. Sie hatte die Anzeichen ignoriert, als eine Flucht noch möglich gewesen wäre. Die ersten Staubkörnchen waren zaghaft gekommen, fast schon friedfertig, jedoch mit dem Ziel, sie zu umgarnen und unmerklich von der Außenwelt abzuschotten. Nun befand sie sich so tief im Inneren dieses Staubsturms, dass sie keinen Meter weit blicken konnte. Alles um sie herum wurde verschluckt von herumwirbelnden kleinsten Staubpartikeln, die ihr das Gefühl gaben, als würde sie lebendig begraben werden. Freiheit und Licht waren ihr inzwischen fast vollständig geraubt worden und sie spürte, wie ihr nun zunehmend das Lebensnotwendigste entrissen wurde. Ein weiterer Hustenanfall schüttelte ihren zierlichen Körper und machte ihr deutlich, dass sie bald auch des letzten Rests Atemluft bestohlen sein würde. Und dennoch rannte sie keuchend weiter. Irgendwo musste es doch einen Ausweg geben. Raus aus diesem endlos langen Schilffeld, zurück in ihren vertrauten Sumpf. Sie verdrängte den Gedanken, dass die Wenigsten aus einem Staubsturm wieder herausgefunden hatten. Denn der Staub hatte nur ein Ziel: zu umgarnen und in die Irre zu führen – bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Sonne unterging.
Plötzlich geschah etwas Merkwürdiges: Einzelne Lichtstrahlen drangen in ihr Tal aus Staub und Todesangst – wie aus einer fernen Welt, unnatürlich und fremd. Und doch war es die gleiche, ihr vertraute Sonne, die sie noch an diesem Morgen gesehen hatte, bevor die Begegnung mit dem Staubsturm ihr Leben in so dramatische Bahnen gelenkt hatte. Aber sie erkannte schnell, dass diese Strahlen, auch wenn sie Licht waren, nichts Gutes verhießen. Denn es waren die letzten des Tages. Eben jene, mit denen sich die Sonne für eine ganze Nacht verabschiedete und dem Mond die Herrschaft überließ. Genau das würde ihr Tod sein. Und er begann hier und jetzt.
Mit schockgeweiteten Augen stolperte sie vorwärts, dann verlor sie den Halt. Sie rollte einen Hang hinunter und landete im Morast. Doch die Freude über das heimatliche Sumpfgebiet, das sie nun nach so vielen Stunden im Schilfgürtel wieder erreicht hatte, währte nicht lange. Mit Schrecken stellte sie fest, dass sich der Staub um sie herum verzog. Oder besser gesagt: zusammenzog zu dem, was er war.
Denn dies war die Abenddämmerung, der Herrschaftswechsel von Sonne und Mond. Der Moment des Tages, vor dem sich alle Sumpfbewohner Bedawis noch mehr fürchteten als vor einem Staubsturm. Denn diese Tageshälfte gehörte ihnen: den Halbwesen. Erst unter der Macht des Mondes nahmen sie ihre richtige Gestalt an. Tagsüber Staub, nachts allmächtige Wesen. Das war die Herrschaft der Halbwesen, unter der die Menschen seit Jahrtausenden litten.
Drohend thronte das makellose Rund des Mondes tief über dem Horizont, um seine Herrschaft für die nächsten zwölf Stunden anzutreten und denen Allmacht zu verleihen, die sie nicht verdient hatten. Wut und Panik erfüllten ihren ausgebrannten Körper, der sehnlichst nach einem Moment der Ruhe verlangte.
Während die Sonne ihren letzten sterbenden Strahl hinter sich herzog und den verbliebenen Rest an Helligkeit begrub, wanderten alle Milliarden Staubkörnchen, die sie soeben noch ausweglos umgeben hatten, aufeinander zu und begannen sich vor ihren Augen zu formieren. Als würde der Wind selbst sich einen Gefährten erschaffen, entstand vor ihr eine Gestalt, ein Wesen, wie man es nur selten zu Gesicht bekam. Denn alle, die es zu sehen bekamen, waren unweigerlich dem Tod geweiht. Kaum einer überlebte die Begegnung mit ihnen. Macht, Stärke und Schnelligkeit dieser Wesen waren grenzenlos und sie hungerten danach zu töten.
Der Staub strebte aufeinander zu, als würden sich die Körnchen gegenseitig anziehen, verdichtete sich und baute nur wenige Schritte vor ihr einen Mann zusammen, der in seiner Größe zwei Meter deutlich überschritt. Ein solches Wesen hatte sie noch nie mit eigenen Augen gesehen, kannte nur die Erzählungen, eine schrecklicher als die andere. Nachtschwarze Haare reichten ihm bis zu den Ellbogen. Tiefdunkel, als wäre ihnen jegliche Helligkeit entzogen worden, wirkten seine Augen wie bodenlose Löcher. Sobald sein Gesicht begann Konturen anzunehmen, Sekunde für Sekunde mehr, wusste sie augenblicklich, dass es keine Chance gab, lebend zu entkommen. Denn dieses Monster kannte unendlich viele Möglichkeiten, einen Menschen zu töten. Dessen war sie sich sicher. In seinen Augen sah sie nichts anderes als den Tod. Die Hässlichkeit, die sein Gesicht so völlig entstellte, erschreckte sie zutiefst. Tiefe Narben bedeckten seine Haut so vollständig und gründlich, dass von seinem ursprünglichen Äußeren nichts übrig zu bleiben schien. Es wirkte, als hätte sich jede neue Narbe um die bereits vorhandenen herum gewunden. Eine widerwärtiger und ausgefranster als die andere.
Ihr Herzschlag setzte aus vor Entsetzen und sie schnappte mit vor Angst zugeschnürter Kehle nach Luft, nicht sicher, ob es ihr letzter Atemzug sein würde. Sie wusste, jetzt war der Moment zu fliehen. Der Vorgang der Verwandlung war der einzige Zeitpunkt, diesem Monster lebend zu entkommen. Doch sie stand wie versteinert, einzig erfüllt von reinster Panik, die sie zur Tatenlosigkeit zwang.
Nachdem sich das Wesen vollständig aus den Staubkörnchen des Sturms zusammengesetzt hatte – der Vorgang hatte nicht mehr als ein halbes Dutzend schauderhafter Sekunden gedauert –, formten sich seine vernarbten Lippen zu dem abscheulichsten Lächeln, das sie je gesehen hatte, und spätestens jetzt war sie sich sicher: Dies war das hässlichste Wesen, das es auf Erden geben könnte.
»Ein Menschlein, sieh an.« Der Schwarzhaarige ließ sie nicht aus den Augen, während er langsam auf sie zuschritt wie eine rollende Monsterwelle, der niemand auszuweichen vermochte. Steifgefroren im Bewusstsein des nahenden Todes, verweigerten ihr jegliche Glieder den Dienst und sie war der Musterung des dunklen Riesen hilflos ausgeliefert. Er umrundete sie, süffisant lächelnd, als würde er abwägen, welche Todesart für sie die Beste wäre. Schließlich meinte sie an der Erkenntnis in seinem Blick deuten zu können, dass er fündig geworden war.
»Du bist ein Halbwesen.« Es war eine überflüssige Feststellung von ihr und doch musste sie es selbst hören, um es glauben zu können. Aber die Wahrheit war zu hart, zu grausam, um sie fassen zu können.
Das Wesen verfiel in heiseres Gelächter, bei dem es sein Gesicht gen Himmel streckte, so dass die letzten dunkelroten Schatten sein Antlitz wie blutüberströmt wirken ließen. »Ich sehe, mein Ruf ist mir vorausgeeilt. Ich kann deine Angst riechen.« Mit diesen Worten trat er an sie heran, was ihn noch größer, stärker, bedrohlicher wirken ließ.
»Tu mir nichts!«, jammerte sie und hasste sich für ihr erbärmliches Betteln, was sinnloser nicht sein könnte. Diese Monster hatten weder Mitgefühl noch Bedauern übrig für schwache Menschen wie sie.
Sein widerwärtiges Lachen schallte laut durch die nächtliche Sumpflandschaft. Kälte und Grauen gleichermaßen krochen ihr in die Knochen und ließen sie erstarren.
»Dein Herz schlägt viel zu schnell. Wie könnte ich da widerstehen?« Beinahe liebevoll griff er ihr mit seiner breiten Hand, die mehr der eines Bären als eines Menschen glich, an die Kehle und hob sie mit einer Leichtigkeit hoch, als sei sie ein Schmetterling, den er zwischen seinen Handflächen zerreiben würde.
Ein panisches Röcheln bahnte sich den Weg in ihrem Hals nach oben, doch es erreichte sein Ziel nicht, blieb irgendwo an der Stelle stecken, wo seine Pranke ihr die Luft abdrückte.
Sie sah in sein abscheuliches Gesicht, wenige Zentimeter vor ihrem, und wusste in diesem Moment, dass sie sterben würde. Und dass er das Letzte sein würde, was sie zu sehen bekäme, bevor sie diese Welt verließ. Also schloss sie die Augen und dachte mit aller Kraft an die wenigen schönen Dinge, die ihr kurzes Leben ihr beschert hatte.
Einen nicht vorhandenen Atemzug später schoss ein unerwartetes Stechen durch ihren rechten Fußknöchel und sie landete hart auf ihrer Seite. Benommen vor Schmerz versuchte sie, die Augen aufzureißen, um zu ergründen, was geschehen war. Ihre Hände rutschten durch den Matsch, während sie sich vom Boden hochzustemmen bemühte.
»Flieh!«, krächzte da eine viel zu vertraute Stimme. Und ehe sie endlich wieder auf ihren wackligen Beinen stand, brach das Grauen über sie herein, unbarmherzig, endgültig und ohne Ankündigung.
»Vater!«, schrie sie vor Verzweiflung, doch er hatte sein letztes Wort bereits gesprochen. Denn als sich ihr Vater hinterrücks auf das Halbwesen geworfen hatte, in blankem Schrecken, um das Leben seiner Tochter zu retten, hatte er sein eigenes Todesurteil gesprochen. Fassungslos musste sie mitansehen, wie das Halbwesen ihrem Vater mit vor Zorn funkelnden Augen die Kehle zupresste, so dass nicht mehr der geringste Lufthauch hindurch passen konnte. Sie wusste sofort, dass es mit ihm vorbei war.
Also begann sie zu rennen. Sie rannte, auch wenn sie das Gefühl hatte, rein gar nichts mehr sehen zu können als allein die mordlüsternen Augen dieses Monsters, das gerade ihren Vater tötete. Aber dies war der letzte Gefallen, den sie ihm tun konnte: so schnell fliehen, dass sein Opfer nicht umsonst gewesen war.
Und während sie fast blind vor Trauer und nahender Dunkelheit durch die Moorlandschaft stolperte, hörte sie, wie das grässliche Halbwesen noch hinter ihr her schrie: »Lauf nur, kleines Menschlein. Lauf, so schnell du kannst! Ich werde dich dennoch töten. Eines Tages, wenn du es nicht erwartest, werde ich kommen und dich töten.«
I. Heute – Eine Woche vor Vollmond
Der Mond ist lediglich ein lebloser Himmelskörper, behauptest du. Vielleicht siehst du in ihm auch eine Muse, eine Art Inspiration. Etwas, das zum Träumen anregt. Doch ich sage dir: Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ich sehe etwas völlig anderes. Wenn ich zum Mond hinaufblicke, dann sehe ich ... Gefahr.
(Thy, Bewohnerin einer Siedlung im Sumpfgebiet Bedawi)
Silbern wie die Klinge eines Dolchs zwingt uns der Mond sein gestohlenes Licht auf. Jede Nacht aufs Neue ertrinkt die Welt in seinem faden Schein. Und dennoch hat er nicht die Macht, die Dunkelheit zu durchbrechen.
Die Kälte dieser Nacht kriecht mir bis in die Knochen. Frustriert ziehe ich die Kapuze meines schwarzen Umhangs noch mehr in mein Gesicht, versuche vergebens, meine weißblonden Haare darunter zu verbergen. Es ist beinahe wie ein Hohn, dass die Natur mir solch helle Haare geschenkt hat, die beinahe so silbern glänzen wie der Mond, wenn Licht auf sie fällt.
Ruhig und konzentriert, wie es sich für einen Nachtwächter gehört, lasse ich meinen Blick langsam über die Umgebung streifen, darauf trainiert, die kleinste Bewegung oder Veränderung sofort zu erkennen. Ich presse mich eng an den brusthohen Baumstumpf, der den östlichen der vier Grenzposten unserer Siedlung markiert. Stetig schwarzer Rauch steigt aus der ehernen Räucherschale empor, die die ganze Breite des Baumstumpfes ausfüllt. Ein Blick auf Zehenspitzen in das Innere der Schale zeigt mir, dass die Kohle bis zum Morgengrauen reichen wird.
Die Anspannung in meinem Inneren hat ihren Zenit bereits überschritten, genau wie der Mond in seiner Umlaufbahn. Das Ende der Nacht ist am Himmel noch nicht ersichtlich, doch ich kann es förmlich riechen – das Fliehen der Dunkelheit.
Es gibt nichts, das man im Lande Ay mehr herbeisehnt als den Aufgang der Sonne. Den Moment, der dafür sorgt, dass unsere Feinde uns nichts mehr tun können und zu Staub zerfallen – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Nacht gehört ihnen: den Halbwesen. Wir nennen sie Halbwesen, denn nur in der dunklen Hälfte des Tages ist ihre wahre Gestalt durch die Macht des Mondes sichtbar. Dann kommen sie aus ihrer Festung. Düster und unheilvoll und noch finsterer als die Nacht selbst. Machtvolle Wesen mit der Seele des Mondes im Inneren. Denn sie sind sein Volk. Genau wie er selbst sind sie tagsüber durch die Gegenwart der Sonne nur noch ein Schatten ihrer selbst. Das Licht lässt sie für das menschliche Auge zu Staub zerfallen, schwächt sie, verwehrt ihnen den Zugriff auf uns – und bildet eine unüberwindbare Hürde zwischen ihnen und uns. Aber nur, bis der nächste Sonnenuntergang naht.
Mit einem tiefen Atemzug lasse ich die kalte Luft in meine Lungen, die mir erneut das Bewusstsein dafür schenkt, dass ich am Leben bin. Noch.
Es gibt immer wieder Nächte, in denen die Stille unangekündigt durch Schreie zerrissen wird. Todesschreie. Wie oft trägt der Wind, der die Sümpfe auf seinem nächtlichen Streifzug durchweht, die letzten sterbenden Reste dieser Schreie bis zu uns und mit ihnen die Frage, wann diese Wesen bei uns sein werden. Denn im Grunde genommen ist es nur eine Frage der Zeit.
Heute ist der Todesschrei ausgeblieben. Es ist ein mulmiges Gefühl, so weiß man doch nicht, ob es ein gutes oder schlechtes Zeichen bedeutet. Ein gutes, weil heute keiner gestorben ist, oder aber ein schlechtes, weil wir als Nächste dran sein könnten.
Bisher wurde unsere Siedlung nicht von ihnen gefunden. Doch keiner kann wissen, wie lange das so bleibt. Vorsichtshalber überprüfe ich ein weiteres Mal den Inhalt der Räucherschale, aber der schwarze Rauch steigt noch immer stetig daraus hervor, um sich über unsere kleine Siedlung zu legen – genauso wie es die drei anderen Räucherschalen rund um unseren kleinen Ort tun.
Kopfschüttelnd denke ich an Jasos Worte kurz vor Sonnenuntergang, als er auf seinem Rundgang alle vier Räucherschalen auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüfte. »Es ist von äußerster Wichtigkeit«, erläuterte er mir in nasalem, wichtigtuerischem Tonfall vor wenigen Stunden, »dass alles reibungslos funktioniert. Es ist ein Ritual, das uns das Leben rettet, jede Nacht aufs Neue. Denn das Kräutergemisch, das wir hier auf die Räucherkohle geben, erzeugt eine hochkonzentrierte Dunkelheit, die alles Leben, alle Geräusche förmlich verschluckt. Eine so trügerische Finsternis, die einen glauben lässt, es gäbe hier nichts außer leblosem Sumpf und Dunkelheit.« Seine Segelohren zuckten bei diesen Worten vor Begeisterung. »Es macht uns nicht unsichtbar«, setzte er seine euphorische Rede fort, »aber es ist nahe dran. Diese unnatürliche Dunkelheit ist den Erzählungen nach so dicht, dass es selbst Halbwesen schwer fällt, sie zu durchdringen.« Triumphierend schaute er mich daraufhin an, als wären dies neue Informationen für mich und keine altbekannten Tatsachen.
»Deine Begeisterung für den Dunkelzauber ist so groß«, gab ich ihm nur genervt zurück, »dass man meinen könnte, du wärst an seiner Entstehung maßgeblich beteiligt gewesen.«
Daraufhin funkelte er mich nur wütend an. »Willst du etwa behaupten, ich sei eine von ihnen? Nur Dunkelseelen mit ihren seltsamen Fähigkeiten«, er betonte das Wort so abschätzig, wie er nur konnte, »sind zu solchen Zaubern imstande.« Augenrollend ignorierte ich seine Bemerkung, aber wenn Jaso einmal in Fahrt ist, schweigt er nicht so schnell wieder. Natürlich musste er noch eins oben draufsetzen. »Auch wenn ich dankbar für dieses lebensrettende Geheimnis der Dunkelseele bin, die vor Jahren in unserer Siedlung lebte, kann ich keine Dunkelseele sein. Denn ich wurde mitten am Tag bei helllichtem Sonnenschein geboren und nicht etwa bei einer Sonnenfinsternis, die eine solch finstere Seele entstehen lässt. Sag mal, Thynessa«, setzte er dann noch süffisant lächelnd hinzu, »bist du nicht in der Zeit geboren, als vor siebzehn Jahren die große Sonnenfinsternis stattfand?« Zu meinem Glück fiel ihm genau zu diesem Zeitpunkt auf, dass eben jene Sonne gerade untergegangen war, so dass er sich schleunigst in seine Hütte verzog und ich ihm die Antwort schuldig blieb. Das ist auch kein Thema, über das ich gerne reden möchte. Gestern Abend nicht, jetzt nicht und überhaupt nie. Erst recht nicht mit Jaso.
Wütend blicke ich nun zum unvollständigen Mond hinauf, der irgendwo in der Phase zwischen Neumond und Vollmond feststeckt. Ich frage mich, wieso er den brutalsten Kreaturen auf Erden diese Macht gibt und uns dazu zwingt, jede Nacht um unser Leben zu bangen. Wieso verleiht er ihnen unbändige Kräfte, die Schnelligkeit eines Schneeleoparden, die Größe einer jungen Schwarzfichte und die scharfen Augen einer Eule?
Seit Tausenden von Jahren sind sie die Herrscher über das Land Ay. Sie unterdrücken uns Menschen. Mit der simplen, aber überaus wirkungsvollen Methode des Tötens. Kaltblütig. Ohne Gewissen. Wahllos. Zur Demonstration ihrer Macht tun sie es des Nachts, fallen in unsere Gebiete ein, zerstören Siedlungen, nehmen Leben auf brutalste Weise. Wir können nie wissen, wann sie das nächste Mal kommen. Nie sind wir sicher vor der drohenden Gefahr. Mit dieser Furcht leben wir. Jede einzelne verdammte Nacht. Sie wollen die Welt für sich und manchmal glaube ich, dass sie kurz davor sind, dieses Ziel zu erreichen. Uns restlichen Menschen, die wir noch am Leben sind, bleibt nur, uns in möglichst kleinen Siedlungen zu verstecken. Die Erfahrung der Vergangenheit hat gezeigt, dass die Gefahr, von ihnen gefunden zu werden, bei größeren Menschenansammlungen zu hoch ist. Je weniger, desto besser die Chancen zu überleben.
Das beste Versteck gewinnt, so ist es doch immer. Und in unserem Fall bedeutet gewinnen, einen weiteren Tag leben zu dürfen. Das Einzige, was wir der Natur zugutehalten können, ist, dass sie uns die wahrlich beste Landschaft dafür gegeben hat.
Nichts könnte mehr Unterschlupf bieten als das Sumpfgebiet Bedawi, in dem wir Menschen leben. Es hat scheinbar endlose Ausmaße und laut meinem Großvater hat noch keiner sein Ende gesehen. Sicherlich ist das weit übertrieben, denn mal ehrlich, alles hat ein Ende – oder? Aber eines macht es deutlich: Es gibt mit Sicherheit kein unübersichtlicheres, undurchschaubareres und unberechenbareres Gebiet als den Sumpf Bedawi. Den einzigen Pluspunkt, den die Natur uns Menschen zugestanden hat. Leider ist nur ein Bruchteil des Sumpfes sicher genug, um darin zu leben. Je weiter man in den Süden kommt, desto gefährlicher wird es. Nur ein schmaler nördlicher Streifen von Bedawi ist bewohnbar. Obwohl wir von einigen Siedlungen in unserem Gebiet wissen, so halten wir uns doch bewusst voneinander fern. Vertrauen in neue Menschen zu setzen und sich durch größere Dörfer der Gefahr auszusetzen, schneller gefunden zu werden, wagt hier draußen kaum jemand. Lediglich sporadischer Handel treibt uns dazu, mit anderen Siedlungen Kontakt zu haben. Ansonsten meiden wir einander, so gut es geht.
Der Süden hält lediglich endlose Gewässer, Scharen an gefährlichen Tieren und gigantische Sumpftäler bereit, die dich erbarmungslos in die Tiefe ziehen. Wenn der Sumpf einmal seine schmierigen Finger nach dir ausgestreckt hat, kannst du seinem Sog nichts mehr entgegensetzen. Wie oft haben wir versucht, in den Süden zu fliehen, weiter weg von den Halbwesen, weg von ihrer Herrschaft. Ihrem Töten. Doch wie viele von uns haben wir bereits verloren und wie viele Kundschafter sind nie zurückgekehrt.
Also verstecken wir uns, vertrauen jede Nacht aufs Neue der Schutz-Räucherung, die uns in leblose Dunkelheit hüllt, und üben uns im Kampf, in jeder freien Minute, die uns bleibt. Denn obwohl jeder von uns weiß, dass keiner in einem richtigen Kampf mit einem Halbwesen bestehen könnte, ist doch in einer Begegnung mit einem solchen der gezielte Stich ins Herz oder in den Hals unsere einzige Überlebenschance. Wir trainieren, um zu töten. Dazu verdammen sie uns. Sie machen uns zu Mördern.
Das zaghafte Gezwitscher einzelner Rotschwänze durchbricht die Stille, beinahe flüsternd, als koste es sie jeden Morgen aufs Neue große Überwindung, das Ende der Nacht einzuläuten. Denn sie sind die Ersten, die eben jenes bemerken, auch wenn der Himmel noch nicht bereit ist, sich seine Schwärze entreißen zu lassen. Immerhin sind es noch fast eineinhalb Stunden, bis die Sonne tatsächlich die Herrschaft zurückerobern wird.
Mir entweicht ein unkontrolliertes Gähnen. Ein weiteres Zeichen dafür, wie viele Stunden ich bereits hier wache, die Schale am Rauchen halte und die Landschaft beobachte. Im nächsten Moment vernehme ich ein Rascheln. Nah, viel zu nah.
Sofort bin ich wieder hellwach. Mein Herz pocht wie ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Kälte und Müdigkeit sind von einem Atemzug zum nächsten vergessen und während mein Körper in Bewegungslosigkeit erstarrt, sind meine Augen konzentriert damit beschäftigt, die vom fahlen Mond spärlich erhellte Umgebung abzusuchen.
Von dem Geräusch ist nichts mehr zu hören. Alles in meiner Nähe liegt ruhig und verlassen da. Nichts deutet darauf hin, dass irgendwer außer mir sich hier befindet. Doch das Rascheln war da gewesen, ich habe es ganz deutlich gehört. Mein Herzschlag beruhigt sich nur wenig, obwohl ich auch nach etlichen Minuten kein weiteres verdächtiges Geräusch vernommen habe.
In dieser Nacht sehne ich den Morgen herbei, wie sonst bei keiner meiner bisherigen Wachen und – beim großen Ay – ich saß hier bereits unzählige Male. Denn es macht mir nichts aus. Nicht, dass ich keine Angst hätte – oh doch, die habe ich –, aber lieber bin ich an der Front, wenn ich sterbe, als ängstlich kauernd in einem Loch auf den Tod zu warten. Und wahrlich, eins sollen sie wissen, die Halbwesen, diese Monster des Todes: Ich werde mit Sicherheit nicht kampflos sterben.
So zumindest meine ehrbare Theorie, die ich seit klein auf in meinem Kopf zurecht gesponnen habe. Doch in dieser Nacht verfluche ich mich dafür.
Die Zeit vergeht schleichend langsam, aber endlich ist es für alle Welt sichtbar: Der Tag naht!
Dichter Morgennebel durchdringt den Sumpf, wabert über den feuchten Boden hinweg, um alles zu vereinnahmen – eine lautlose Armee, ähnlich wie die Halbwesen es sind. Mittlerweile ist es so dämmrig, dass ich es wage, meinen Posten kurz zu verlassen und auf den nächstgelegenen Baum zu klettern. Die Zeit, wenn der Sonnenaufgang naht, ist die schönste des Tages. Die triumphierendste. Denn für die nächsten zwölf Stunden wird ihnen die Macht genommen, uns zu töten. Im Licht der Sonne sind sie für das menschliche Augen nicht mehr in ihrer normalen Gestalt sichtbar. Das Licht schwächt sie, lässt sie zu Staub zerfallen und schafft uns so eine natürliche Barriere, die weder sie noch wir imstande sind zu überschreiten. Die Sonne treibt sie zurück in ihr Gebiet, in ihre Festung.
Die Dämmerung ist bereits so weit fortgeschritten, dass ich in der Ferne die Spitzen der endlosen Schilfhalme im Vur erkennen kann. Der Vur ist ein sich kilometerweit erstreckendes Schilffeld, das die nördliche Begrenzung von Bedawi darstellt. Eine Grauzone, die Grenze zwischen Gut und Böse. Beinahe muss ich laut auflachen. Nichts könnte näher an der Wahrheit sein. Denn das, was sich nördlich des Vur befindet, ist nicht nur ein bisschen böse, nein, es ist das personifizierte Böse. Nördlich des Schilffeldes befindet sich die Zone Hamog. Eine zerrüttete, tote Zone, die ausschließlich aus scheinbar bodenlosen Kratern, tödlichen Schluchten und zerklüfteten Rillen besteht. Man erzählt sich, dass vor vielen Tausenden von Jahren auch dort ein blühendes Sumpfland vorherrschend war, bis eines Tages ein Steinhagel oder irgendwas dergleichen dort einschlug und alles Leben im Umkreis von vielen Kilometern zerstörte. Und mit der Zerstörung hinterließ der Steinhagel die Saat des Bösen. Damals entstand der Ay, behaupten die Überlieferungen. Inmitten von Hamog thront er nun: der Vulkanberg, der unserem Land seinen Namen gab. Der Ay. Er ist landesweit zu sehen und mein Großvater pflegt zu sagen, dass man, selbst wenn man das Ende des Sumpfes Bedawi finden würde, von dort aus den Ay noch sehen könnte. Jedoch liegt das nicht allein an seiner imposanten Größe und gigantischen Breite, sondern vielmehr an der Tatsache, dass eine immer gegenwärtige Rauchwolke auf ihm thront und ihn so umhüllt, dass seine Spitze nicht zu sehen, ja, nicht einmal zu erahnen ist. Jeder von uns weiß es, doch die Wenigsten trauen sich, es beim Namen zu nennen. Das, was damals vom Himmel kam, waren nicht nur Steine. Es waren die Halbwesen. Denn mit dem Ay kamen auch diese Monster, die seitdem in ihrer riesigen Festung, dem Vulkan, ihr Zuhause haben. Dieses tote Land, die Zone Hamog, ist feindliches Gebiet, das ich noch nie betreten habe: die Heimat der Halbwesen.
Auch jetzt erkenne ich die allgegenwärtige Rauchwolke des Ay. Wut macht sich in meinem Inneren breit, brodelt in mir wie kochende Lava kurz vor ihrem Ausbruch. Ich bin wütend auf ihre Macht und dass sie sich das nehmen, was ihnen nicht zusteht: unser Leben. Sie töten aus reiner Willkür. Jeder kann der Nächste sein. Jedes um Hilfe Flehen stößt bei ihnen auf taube Ohren, sie haben kein Erbarmen. Ich habe noch nie davon gehört, dass sie jemanden lediglich in Gefangenschaft genommen oder gar verschont hätten. Sie sind gewissenlose Monster, die ihre Überlegenheit immer wieder aufs Neue zur Schau stellen.
Ich merke zu spät, dass ich mich von meinen Gedanken habe einnehmen lassen und die Bewegung unterhalb von mir nicht wahrgenommen habe. Erst als ich Schritte höre, wird mir bewusst, dass ich mich gerade in Lebensgefahr gebracht habe. Ich habe meine Konzentration vernachlässigt und stattdessen meinen Hass über sie gefüttert, über unsere Mörder, von denen vermutlich nun einer unter mir steht. Das frühe Morgenlicht ist noch zu zaghaft und das Strahlen der Sonne zu weit unter dem Horizont entfernt, als dass es mir helfen könnte. Der Moment, in dem sie zu Staub zerfallen, ist noch viel zu viele Minuten entfernt. Minuten, die mich vermutlich das Leben kosten werden. Wahrscheinlich habe ich mich in meiner Gedankenversunkenheit unbewusst bewegt oder einmal zu heftig geatmet. Es war dumm von mir, den Posten zu verlassen, um meinen Blick schweifen zu lassen, anstatt die nähere Umgebung unter Beobachtung zu halten. Doch nun ist es zu spät.
Angestrengt versuche ich, die Gegend abzusuchen, ohne mich zu bewegen. Beinahe will ich schon erleichtert aufatmen, als ich ihn sehe. Tiefschwarze lange Haare fallen auf breite Schultern einer großen Gestalt. Ein Halbwesen! Es muss sich um ein männliches Halbwesen handeln, wie seine Konturen mich erahnen lassen. Aber die Schatten der Dämmerung verbergen sein Gesicht, so dass ich nicht erkennen kann, wo er hinsieht. Er wendet sich gen Norden, Richtung Vur, doch dann verharrt er auf der Stelle, als hätte er etwas gehört. Abrupt blickt er sich in meine Richtung um. Mein Herz erstarrt, ich halte die Luft an und bete zu wem auch immer, er möge mich vor dessen Augen verbergen. Es dauert viel zu lang und doch sind es sicher nicht mehr als eine Handvoll banger Sekunden, die er in meine Richtung blickt. Plötzlich streift ein kalter Luftzug mein Gesicht und in diesem Augenblick weiß ich es einfach: Er sieht mich!
Dann dreht er sich um und rennt in unmenschlicher Geschwindigkeit davon.
Auch wenn ich mich noch so sehr anstrenge, verliere ich ihn aus den Augen, sobald er in den Vur eingetaucht ist. Der Vur verschlingt alles und jeden.
Im nächsten Moment geht die Sonne auf. Die Nacht ist vorbei.
II. – Wenige Tage vor Vollmond
Jede große Revolte beginnt mit den Ersten, die bereit sind, dafür zu sterben, mit den Ersten, die sich opfern.
Denn die Ersten sterben immer.
(Rune, Großvater von Thy, Bewohner einer Sumpfeiche nahe Thys Siedlung)
Schweißgebadet schrecke ich hoch. Ich reiße die Augen auf, atme die feuchte Mittagsluft tief in meine Lungen ein, als könnte sie die letzten Traumfetzen aus meinen Gedanken vertreiben.
Es ist immer das Gleiche, tagaus, tagein. Seit ich denken kann, verfolgen mich diese Träume. Träume von Halbwesen.
»Das ist deine Angst, die du im Schlaf verarbeitest«, hat meine Schwester Laia mir einmal versucht zu erklären, doch das glaube ich ihr schon lange nicht mehr. Ihr ist die Angst am ganzen Körper anzusehen: ihre gekrümmte Haltung, ihre vorsichtigen Bewegungen, ihre angstgeweiteten, umherhuschenden Pupillen. Dass sich ihre Angst auch in ihre Träume schleicht, ist nicht schwer zu erraten.
Bei mir ist es anders, doch das erzähle ich ihr nicht, davon erzähle ich niemandem. Sonst tauchen wieder die Unterstellungen auf, ich könnte dunkle Fähigkeiten haben – zu nah war die damalige Sonnenfinsternis dem Augenblick meiner Geburt. Denn ich träume nicht von mordenden Halbwesen, die mir und den Meinen das Leben nehmen. Normale Träume, wie sie jeder Mensch hat, weil diese Art Realität unser Leben prägt. Nein, ich träume nur von ihm. Denn es ist immer dasselbe Halbwesen, das in meinen Träumen auftaucht, und ich fühle mich, als würde ich ihn beobachten, Tag für Tag aufs Neue. Ich sehe ihn umherstreifen, durch den Vur, durch Bedawi, durch Hamog, er ist immer alleine. Ich höre ihn nie reden und doch ist er mir so vertraut, als würde ich ihn mein Leben lang kennen. Genau genommen tue ich das ja auch. Dennoch habe ich noch nie sein Gesicht erkennen können.
Nur heute war es anders. Ich habe zwar nach wie vor keine Einzelheit erkannt, doch ich wusste, dass er mich ansieht. Das erste Mal. So direkt und nah und düster, dass ich selbst im Traum fürchtete, er würde über mich herfallen und mich töten. Aber er tat es nicht.
Ich war von meiner nächtlichen Wacht am östlichen Grenzposten nach Sonnenaufgang zurückgekehrt und in der Hütte meiner Schwester und mir in Sekundenschnelle eingeschlafen. Als ich jetzt erwache, ist es wie immer fast Mittag. Die Bilder des Traum-Halbwesens, das mich so direkt anblickt, hängen noch vor meinem inneren Auge wie ein Schleier, der mir den Blick auf die Wirklichkeit versperren will. Irritiert reibe ich mir die Augen und hoffe, mit der Müdigkeit auch meine wirren Gedanken verscheuchen zu können. Die Gedanken, dass mein Erlebnis von letzter Nacht irgendwie mit meinem Traum zusammenhängt. Aber wahrscheinlich hat Laia recht: Mein Unterbewusstsein hat mehr Macht über meine Träume, als ich mir eingestehen mag.
Wütend über mein Unterbewusstsein, das mir solch irre Träume beschert, erhebe ich mich von meinem Bett. Die Sonne steht bereits hoch über dem Sumpf und so wundert es mich nicht weiter, dass von draußen Stimmen zu hören sind. Seufzend fahre ich mir durch die Haare, die so eigenwillig sind, dass sie sich von nichts bändigen lassen. Also trage ich sie immer offen. Tagsüber ist es kein Problem, sie über meine Schultern bis zur Brust fallen zu lassen, nachts jedoch muss ich sie unter dunklen Kapuzen verstecken. Dennoch befürchte ich, dass mir ihr heller Glanz nochmal zum Verhängnis werden wird. Nachdem ich meine dunkle Kleidung der Nacht durch ebenso schlichte frische ausgetauscht und den Gürtel mit meinem Dolch umgeschnallt habe, bin ich endlich wach genug, um zu bemerken, dass der Tumult draußen eine bedenkliche Lautstärke angenommen hat.
Ich ahne es schon, bevor ich die erste Stufe aus der Hüttentür mache.
»Das reicht vorne und hinten nicht. Wie stellt ihr euch das vor?«, höre ich Laia schimpfen, während ich die Stufen unserer Hütte hinabsteige. Gerade als ich mich ihnen nähere, setzt Pek zum Gegenschlag an. »Als ob es mehr zu essen gäbe, wenn du zur Jagd gehen würdest. Dann müssten wir sicher alle verhungern!« Beleidigt verschränkt Pek die Arme vor der Brust und pustet sich erfolglos die zotteligen Haare aus dem Gesicht, die ihm bis zum Kinn reichen. Dadurch wirkt er für einen Moment deutlich jünger als fünfzehn.
Ehe Laia ihren empörten Gesichtsausdruck mit Worten untermauern kann, mischt sich Unina ein, die alle nur »Mutter Una« nennen, obwohl von den vielen Kindern, die bei ihr leben, nur eines tatsächlich ihr leibliches ist. »Nun reiß dich zusammen, Pek! Was Laia für uns leistet, ist unersetzlich. Sie ...« Ihre folgenden Worte gehen unter in dem Babygeschrei, das nun wieder einsetzt. Sie bricht ab und schaukelt das Baby auf ihrem Arm konzentriert hin und her, so dass mir schon vom Hinschauen übel wird. Der Kleine ist erst wenige Wochen alt, bisher hat sie sich aber noch auf keinen Namen festlegen können, obwohl sie bereits unzählige Vorschläge von allen erhalten hat. Ich habe es inzwischen aufgegeben, sie dazu bewegen zu wollen. Es scheint, als hätte sie zu viel Angst, ihr Baby wieder zu verlieren, und versucht es deswegen auf Abstand zu halten, indem sie ihm einen Namen verweigert. Insgeheim verstehe ich sie. Das Leben im Land Ay ist unberechenbar. Ohnename beruhigt sich unter ihrem Geschaukel nur langsam wieder, aber Una scheint ohnehin den Faden verloren zu haben. Sie schaut genauso verstört drein wie die wirre Mo, die mit ihren weit über achtzig Jahren eine absolute Rarität in unserer Gruppe darstellt. Wie aufs Stichwort humpelt ebendiese, auf ihren Gehstock gestützt, hinter ihrer Hütte hervor und umrundet die aufgebracht Streitenden, als würde sie diese gar nicht bemerken. Das weiße, krause Haar flattert hinter ihr her wie ein Schleier und hebt sich von der aschfahlen, grauen Haut ab, die so faltig ist, dass es wirkt, als wären Zeichen in diese eingeritzt worden, welche nun längst verblasst sind. Dabei murmelt sie unablässig unverständliche Worte, ihren Blick starr auf den Boden gerichtet. Wir nennen sie die wirre Mo, weil ... na ja, aus den offensichtlichen Gründen eben. Keiner schenkt ihr Beachtung, während sie ihre Kreise um uns zieht. Auch mich scheint keiner zu bemerken, als ich den Versammlungsplatz erreiche. Versammlungsplatz ist schon zu viel gesagt. Es ist lediglich der Mittelpunkt unserer fünf Hütten, die unsere Siedlung bilden, und er besteht aus einer kleinen Feuerstelle und einigen Holzbänken. Einzig Serbo scheint meine Anwesenheit wahrzunehmen, denn er begrüßt mich mit einem übertriebenen Lächeln. Serbo wohnt in der winzigen Abstellkammer in der Hütte der wirren Mo. Warum, ist mir bis heute schleierhaft, aber er scheint sich auf gewisse Weise für sie verantwortlich zu fühlen. Ich glaube, die wirre Mo hat als junge Frau ihr einziges Kind verloren. In Serbo hat sie so etwas wie einen Ersatz gefunden. Und gutmütig, wie er ist, lässt er es zu. Er hat seit einiger Zeit ein Auge auf meine Schwester Laia geworfen, doch bisher hat sie sich seinem Werben standhaft verweigert. Seitdem ist er überfreundlich zu mir. Als ob Einschleimen irgendetwas bringen würde! Genervt rolle ich mit den Augen.
Laia scheint sich immer noch nicht beruhigt zu haben. Unruhig hantiert sie mit einem Kochlöffel in der Luft, als würde sie eine unsichtbare Mahlzeit zubereiten. Wahrscheinlich tut sie das in Gedanken gerade auch.
»Es war gestern schon zu wenig. Und vorgestern war es ein Desaster! Ihr müsst euch einfach mehr anstrengen.« Die letzten Worte klingen bereits leicht hysterisch und sie gibt sich keine Mühe, den Vorwurf darin zu verbergen. Wütend dreht sich Pek um und stürmt mit einem lauten »Ich geh nie wieder für euch jagen!« zurück in Unas Hütte. Una folgt ihm mit einem zerknirschten »Er meint es nicht so!«, während Ohnename wieder lauthals zu schreien anfängt.
»Davon werden wir auch nicht satt«, murrt Laia und ich nehme ihr vorsichtshalber den Kochlöffel aus der Hand, bevor sie noch unsere Köpfe mit einer Gans verwechselt, die erlegt werden muss. Erst da scheint sie mich zu bemerken.
»Ach, Thynessa, endlich lässt du dich auch mal blicken. Dass du so lange schlafen kannst, obwohl hier draußen die Welt zugrunde geht.«
Die wirre Mo zieht weiterhin ihre Kreise um unseren Platz, humpelnd auf ihren Gehstock gestützt und unermüdlich vor sich hin murmelnd. Doch bei dem Wort »zugrunde« hält sie kurz inne und blickt nach oben. Ihre weißen Haare flattern um ihre Schultern, obwohl kaum ein Lüftchen weht zu dieser Mittagsstunde. Es ist schon wieder viel zu heiß.
»Ich freue mich auch, dich zu sehen, Laia«, entgegne ich, obwohl ich mir sicher bin, dass sie es ohnehin nicht wahrnimmt.
Serbo scheint die Situation für sich nutzen zu wollen und hat sich langsam genähert. Jetzt legt er vorsichtig seinen Arm auf Laias Rücken und streichelt beruhigend darüber.
»Du hast vollkommen recht, Laia. Am besten schicken wir sofort einen zweiten Jägertrupp aus.«
Für einen Moment hellt sich Laias Gesicht auf. Ich meine fast, ein Lächeln auf ihren Lippen zu sehen, und hoffe für Serbo, dass sie ihm aus Dankbarkeit um den Hals fallen wird. Doch sie wäre nicht Laia, wenn es so passieren würde.
Sie fängt sich sofort wieder, schüttelt Serbos Hand von ihrem Rücken und setzt sich abweisend auf eine der kleinen Holzbänke. »Das ist ja wohl das Mindeste.«
Das Babygeschrei von Ohnename hat inzwischen nachgelassen, doch Una und Pek lassen sich nicht wieder blicken. Ich bezweifle ohnehin, dass Pek nach einer erfolglosen Jagd ein zweites Mal losziehen möchte. Schon gar nicht, nachdem er von Laia so runtergemacht wurde.
Stattdessen kommen aus dem Haus der Una zwei rothaarige Jungen gelaufen, die beinahe die wirre Mo über den Haufen rennen, als sie in einer wilden Verfolgungsjagd übereinander herfallen.
Auch das noch! Wenn die stummen Zwillinge erst einmal angefangen haben zu rennen, hören sie meistens so schnell nicht mehr damit auf. Genau genommen ist nur einer von ihnen stumm. Der andere redet allerdings auch nur, wenn es unbedingt nötig ist. Sie selbst scheinen sich ohne Worte zu verstehen. Wieso der eine von ihnen nicht spricht, haben wir bis heute nicht herausgefunden. Mutter Una hat sie vor acht Jahren völlig unterkühlt in einer kleinen Sumpfhöhle gefunden und die damals Fünfjährigen mitgenommen. Ihre frühere Siedlung wurde von Halbwesen überrannt. Nur die beiden Zwillinge haben es lebend hinausgeschafft. Una vermutet, dass sie deshalb so in sich gekehrt sind und der eine von ihnen stumm ist. Seitdem leben »Blitz« und »Donner«, wie sie sich selbst nennen, bei uns in der Siedlung. Unterscheiden lassen sie sich tatsächlich nur sehr schwer. Erst wenn sie anfangen zu reden – oder eben nicht. Nun rasen die Rotschöpfe durch unsere überschaubare Siedlung und rauben mir damit den letzten Nerv.
»Schon gut, Laia«, sage ich seufzend. »Ich werde gehen.«
Diesmal ist ihr keinerlei Reaktion anzumerken. Wahrscheinlich hat sie damit ohnehin gerechnet. Stattdessen erhebt sie sich und beginnt das dürre Birkhuhn zu rupfen, das Pek von seiner wenig erfolgreichen Jagd mitgebracht hat.
»Ich werde mitgehen!« Plötzlich steht eine gedrungene Gestalt vor mir und sieht mich herausfordernd an. Jaso. Seine Haare in der Farbe von Stroh hängen ihm strähnig über die abstehenden Ohren und seine übertriebenen Lachfalten, die sich in Halbkreisen um seine Mundwinkel winden, wirken irgendwie unecht. Als hätte er sein künstliches Lächeln zu oft in seiner stillen Kammer geübt.
Jaso ist Ende zwanzig und Serbos jüngerer Bruder. Er ist der Einzige in unserer Siedlung, der eine Hütte – wenn auch eine sehr kleine – für sich alleine hat. Ihre Eltern haben wir vor einigen Jahren verloren, als ein erneuter Spähtrupp nach Süden ausgerückt ist, um eine Möglichkeit für eine Siedlung weiter weg von hier zu finden. Weiter weg von den Halbwesen. Sie sind nie zurückgekehrt.
»Danke, das wird nicht nötig sein«, bemühe ich mich freundlich zu bleiben, obwohl mir das bei Jaso immer schwer fällt.
»Irgendjemand sollte auf dich aufpassen«, entgegnet er übertrieben laut, als würde ich das erste Mal in den Vur ziehen, um zu jagen.
Ich will gerade zu einem empörten »Und das kann ich selbst wohl am besten!« ansetzen, als Ori aus dem Schatten einer Weide tritt. Es wundert mich nicht, dass er auftaucht und vermutlich bereits das gesamte Gespräch mitangehört hat. Kurz erhebt er seine Hand. Mehr braucht er nicht, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen und für Ruhe zu sorgen. Ori ist so etwas wie unser Oberhaupt. Nicht weil er sich selbst dazu gemacht oder jemand von uns ihn dazu ernannt hätte, nein, er ist es einfach. Er strahlt das aus, was ein geborener Anführer haben muss: Ruhe, Autorität, Weisheit, Entschlossenheit – und den absoluten Willen, alles für diejenigen zu tun, für die er die Verantwortung trägt.
Während er nun auf uns zukommt, fährt er sich mit seiner Hand über seinen beinahe haarlosen Schädel. Die wenigen Haare, die ihm noch geblieben sind, ähneln in der Farbe einem trüben Herbsthimmel.
»Das Jagen ist schwer in diesen Tagen«, beginnt er, während er zuerst Blitz und dann Donner seine Hände auf die roten Haarschöpfe legt, die zu meiner Freude ihr Rennen unterbrochen haben, um sich an Ori zu schmiegen. »Tier und Mensch leiden gleichermaßen unter der Hitze. Unsere Chancen auf eine ausreichende Mahlzeit sind höher, wenn ihr gemeinsam geht. Aber der Tag ist schon zu weit fortgeschritten. Ihr geht bei Tagesanbruch.«
Damit ist das letzte Wort gesprochen und weder ich und erst recht nicht Jaso wagen einen Widerspruch. Und auch wenn mir Jasos Gesellschaft alles andere als lieb ist, hat Ori recht: Das Jagen ist schwer geworden.
»Und Dea wird euch begleiten!« Strahlend vor Freude weiten sich die Augen von Dea, die gerade mit Ohnename auf dem Arm Unas Hütte verlässt. Dea ist nur wenige Jahre älter als ich und mit ihren blonden Locken, der kleinen Stupsnase und dem Strahlen einer Sommersonne mit Sicherheit das Schönste, was unser Sumpf je gesehen hat. Als eine von Unas »Kindern« bewohnt sie gemeinsam mit Pek, Ohnename und den stummen Zwillingen deren Hütte. Sie ist Peks leibliche Schwester. Die Mutter der beiden habe ich nie kennengelernt. Ihren Vater verloren wir letztes Jahr, als die Halbwesen uns so nahegekommen waren, dass sie beinahe unseren Dunkelzauber durchbrochen und somit unsere Siedlung entdeckt hätten. Peks und Deas Vater hatte Wache in dieser Nacht und obwohl es kurz vor Sonnenaufgang war, entdeckte er sie rechtzeitig und lockte sie fort. Führte sie von uns weg. Gab ihnen das, wonach sie lechzten: ein Opfer zum Töten. Ein Opfer, mit dem er uns alle rettete.
Wortlos übergibt Dea nun Ohnename an Ori, während sie weiterhin mit der Sonne um die Wette strahlt und dabei nur Augen für Jaso hat.
Das kann ja heiter werden, wenn ich ihr Geflirte auch noch aushalten muss.
Das quengelige Baby beruhigt sich in Oris Armen augenblicklich, was meine Vermutung, dass er Ohnenames Vater ist, nur bestätigt. Doch bis heute wollte Una nicht preisgeben, wem sie dieses namenlose Schreipaket zu verdanken hat. Die Zwillinge widmen sich sofort wieder ihrem Wettrennen um den Feuerplatz, sobald sie merken, dass Oris Aufmerksamkeit nicht mehr ihnen gilt.
In dem Moment klatscht Serbo laut in die Hände. Der nächste Tagesordnungspunkt ruft: das tägliche Kampftraining.
»Auf zum Messerwerfen!«, ruft er in die Runde. Die Zwillinge reagieren als Erste und laufen begeistert zu Serbo. Pek tritt mit einem mürrischen »Schon wieder Messer?« aus Unas Hütte. Ich kann seinen Unmut verstehen. Auch mir hängt das tägliche Training zum Hals heraus. Und dennoch bin ich Serbo dankbar für seine Unermüdlichkeit. Vielleicht wird uns das einmal das Leben retten. Andererseits: zu welchem Preis? Trainieren, um zu töten? Um zu werden wie sie? Das ist die Regel unserer Welt, die einzige Regel: Das größte Monster überlebt! Und dabei sträubt sich alles in mir dagegen. Ich will nicht so werden wie sie. Ich will kein Mörder werden! Egal, wie hoch der Preis ist! Aber das spreche ich nicht aus, denn das würde keiner der Anwesenden verstehen. Sie würden denken, dass ich anders bin und wahrscheinlich haben sie damit auch recht. Denn wenn ich ehrlich bin, verstehe ich es selbst nicht. Weshalb ich zwar diese Wut auf alle Halbwesen in mir trage, nicht aber die angeborene Bereitschaft, eines von ihnen zu töten.
Seufzend wende ich den Blick von Dea ab, die nicht aufhört, an Jaso ihren schönsten Augenaufschlag zu üben, und ergebe mich in mein Schicksal.
Und morgen werde ich im Vur jagen!
III. – 4 Tage und 12 Stunden bis Vollmond
Keine Revolte entsteht aus dem Nichts.
Wenn du den Punkt erreicht hast, an dem du nichts mehr verlieren kannst ... glaub mir, dann ist der Zeitpunkt gekommen, sich zu wehren.
(Ori, Mensch, Oberster von Thys Siedlung)
Nichts.
Kein einziger Laut ist zu hören.
Die Zeit kurz vor Sonnenaufgang ist ein Niemandsland. Eine Zeitspanne, die niemandem gehört, die niemand wagt, für sich zu beanspruchen, weil sie weder vollkommen Nacht noch ganz Tag ist. Es sind diese wenigen Minuten am Tag, in denen wir uns bis in den Vur, den Schilfgürtel, vorwagen, genau wie viele Tiere der Sumpfgebiete. Die einzigen Minuten am Tag, die eine Chance bieten, hier draußen zu überleben. Weil es der Moment ist, da die Halbwesen wieder zu Staub zerfallen. Die Zeit um den Sonnenaufgang herum ist die Spanne, in der sie nichts sind: weder tötende Monster noch in die Irre führender Staubsturm.
Aber heute ist es anders. Die Stille ist anders. Angefüllt mit etwas, das ich nicht in der Lage bin, zu greifen.
Regungslos verharre ich in meinem Versteck zwischen den hohen Schilfrohren, versuche zu ergründen, woher meine Unruhe rührt.
Eine gelbbraune Rohrdommel durchbricht die Ruhe mit ihren dumpfen Klagelauten und stößt aus dem schützenden Schilffeld in die Lüfte. Ich zucke erschrocken zusammen und starre in die schwindende Nacht hinaus. Fade lila-graue Vorboten der Morgendämmerung zeichnen den Himmel, verleihen ihm den traurigen Ausdruck längst verlorener Tränen.
Angestrengt bemühe ich mich, meinen hochgeschnellten Puls wieder zu beruhigen, nachdem ich auch nach einigen Augenblicken keine Veränderungen der Umgebung erkennen kann.
Sie sind noch nicht da.
Ich ducke mich in meinen Unterschlupf, verschmelze mit dem Meer an hohem Schilf um mich herum und spähe konzentriert durch das Röhricht in den heranschleichenden Tag, der sich in dieser Welt genauso unerwünscht zu fühlen scheint wie ich. Denn dieses Land gehört nicht uns. Es gehört ihnen. Den Halbwesen.
Es dauert viel zu lang an diesem Morgen. Sie sollten längst zurück sein. Die Warterei macht mich nervös.
Zwei Birkhühner und sogar ein Sumpfkaninchen konnte ich mit meinen Fallen erbeuten.
Die frühen Morgenstrahlen durchstechen die flüchtende Dunkelheit. Ein ewiger Kampf zwischen Licht und Finsternis, Gut und Böse.
Da! Mein umherhuschender Blick erwischt eine Bewegung. Erst denke ich, dass mir die ständig wechselnden Lichtverhältnisse in der Dämmerung einen Streich spielen. Doch dann erkenne ich es deutlich. Zwei geduckte Gestalten jagen schnell und nahezu lautlos durch die Weite des Schilffeldes. Zielstrebig halten sie auf die südlichen Sumpfgebiete zu.
Ich lasse sie nicht aus den Augen, was gar nicht so einfach ist, denn sie sind darauf trainiert, unbemerkt in diesen flachen Gewässern des Schilfmeeres zu jagen: Jaso und Dea. Plötzlich bleibt einer der beiden stehen. Jasos Blick fliegt gezielt in meine Richtung, verfängt sich ungeachtet der Entfernung beinahe sekundenschnell mit meinem. Dann hält er ein Schilfrohr in die Höhe und deutet damit zu den Sümpfen. Erleichtert atme ich auf, als er nickt und ohne noch mehr Zeit zu verlieren, erneut zu seinem Lauf durch das Röhricht ansetzt.
Das ist mein Zeichen zum Aufbruch. Auch wenn das morgendliche Jagen im Schilffeld bereits Routine und eine willkommene Abwechslung von meinen nächtlichen Wachen ist, fällt doch jedes Mal eine gewisse Anspannung von mir ab, wenn ich sehe, dass die Jäger mit unserer Beute wieder auf dem Rückweg ins Sumpfgebiet Bedawi sind und somit außerhalb der akuten Gefahrenzone. Falls das möglich ist im Lande Ay.
Zu meinem Glück bin ich gerade so groß wie die dicht an dicht stehenden Schilfrohre und flink wie eine Mooreidechse, wie mein Großvater zu sagen pflegt, so dass ich nahezu unbemerkt durch den Vur streifen kann.
Für einen winzigen Moment erlaube ich mir den Blick gen Osten, über das erhabene Schilffeld hinweg, dessen Spitzen nun im Licht der nahenden Sonne einen leuchtenden Glanz erhalten, bis hin zu den klaren Seen jenseits des Feldes. Vielleicht, so denke ich mir, würde die Dunkelheit eines Tages aus Eifersucht verschwinden, wenn ich nur lange genug ins Licht schaue.
Aber nein, das wird niemals geschehen. Kopfschüttelnd wende ich den Blick ab, empört über meine naiven Gedanken. Ich sollte mich nicht mit Dingen aufhalten, die in unserer Welt keinen Platz haben. Mein Rückweg aus dem Schilfgürtel Vur nach Bedawi ist noch weit.
Ich realisiere den Grund für die Stille zu spät, die heute so anders ist – angefüllt mit Unheil, das alles verschluckt und weniger als nichts hinterlässt.
Denn gerade, weil ich kein einziges Geräusch vernehmen kann, weiß ich, dass ich nicht mehr alleine bin.
Der anbrechende Tag schenkt mir mehr Schatten als Licht und egal wie konzentriert ich meinen Blick auch über das Schilf gleiten lasse, ich kann nichts Verdächtiges entdecken.
Für einen Moment durchzuckt mich der Gedanke, dass die Tiere schlauer sind als ich, die sich bereits zurückgezogen haben ob der Gefahr, die dort draußen lauert.
Der Sonnenaufgang hat gerade begonnen. Ich spüre die Macht, die die Sonne mit sich bringt. Licht ist das Einzige, was unsere Feinde davon abhalten kann, uns zu töten. Und diesen Triumph verspüre ich auch jetzt. Denn was immer da draußen im Verborgenen ist und mich beobachtet: Ein Halbwesen kann es nicht sein und wenn doch – dann zerfällt es gerade zu Staub.
Großvater warnte mich, seit ich ein kleines Kind war, davor, mehr Respekt vor diesen machtvollen Wesen zu zeigen. Er fürchtete wohl schon immer meinen Leichtsinn. Denn auch bei Tage können uns die Halbwesen gefährlich werden. Zwar werden im Sumpfgebiet selbst nur selten Staubstürme gesichtet, doch im dichten Vur ziehen sie immer öfter umher, demonstrieren auf diese Weise die Grenzen zu ihrem Territorium. Zwar haben sie keine Möglichkeit, uns direkt zu töten, aber wenn sie einen Menschen mit ihrem Staub umgeben, so nehmen sie diesem jegliche Orientierung. Wer einmal in einen Staubsturm gerät, wird in die Irre geführt und auch das kann ihn das Leben kosten.
»Hüte dich vor dem Auge des Sturms!«, pflegte Großvater mir beinahe täglich zu sagen. »Was ist im Auge des Sturms?«, fragte ich ihn als junges Mädchen. Wehmütig sah er mich an, fixierte mich förmlich, obwohl das natürlich unmöglich ist, denn Großvater ist blind. Vielleicht machte es ihn traurig, davon zu reden, dass der Sturm ein Auge besaß – und ihm das Augenlicht verwehrt war. »Im Auge des Sturms, kleine Thy«, sein Blick verlor sich wieder im Nichts bei diesen Worten, »lauert der Tod. Das Auge gehört ihnen.« Mir war schon damals klar, dass er damit die Halbwesen meinte. Seitdem habe ich umso mehr auf jegliches Anzeichen eines Staubsturms geachtet. Und auch wenn ich beinahe täglich bis in den Vur vordringe, bin ich noch nie einem begegnet. Im Gegensatz zu Großvater. Dutzende Male hat er in seinen jungen, noch nicht blinden Jahren einen solchen in der Ferne beobachten können, seine Unscheinbarkeit aus sicherer Entfernung betrachtet, und seine feinen Schattierungen, die so minimal dunkler werden, je näher man ihm kommt, dass man kaum in der Lage ist, es wahrzunehmen. So berichtete mir mein Großvater. Der schleichende Feind. Und auch wenn ich ihn hasse, so bin ich in Wahrheit doch fasziniert von der Perfektion seines Angriffs.
So sind auch jetzt alle meine Sinne bis aufs Äußerste geschärft, darauf getrimmt, die kleinste Veränderung sofort zu erkennen.
Doch außer der Abwesenheit jeglicher Geräusche kann ich nichts wahrnehmen. Ich rechne damit, jede Sekunde die ersten zaghaften der gefürchteten Staubkörnchen zu entdecken, aber nichts ist zu sehen. Die Luft an diesem Morgen ist rein und klar. Zu klar.
Das Gefühl, beobachtet zu werden, lässt sich jedoch nicht mehr abschütteln. Es hängt an mir, wie der penetrante Herbstnebel, der nicht bereit ist, sich zu verziehen.
Also tue ich das Einzige, was mir bleibt. Ich drehe mich um und beginne meinen Slalomlauf durch das hohe Röhricht. Setze all meine Konzentration in diesen Lauf, weg von dem Gefühl, beobachtet zu werden, aber auch immer weiter weg von meinem Zuhause. In meinen Gedanken höre ich die Stimme meines Großvaters. »Merk dir eines, Thy: Für den Schutze aller musst du von Zeit zu Zeit dein Alles aufs Spiel setzen.« Das war seine umständliche Art, mir mitzuteilen, dass es Momente im Leben gibt, in denen man sich für den schweren Weg entscheiden muss. Und genau das beherzige ich jetzt. Denn wenn ich etwas nicht tun darf, dann einem Halbwesen – auch wenn es nur in seiner Staubgestalt ist – den Weg zu unserer Siedlung weisen. Also renne ich genau in die entgegengesetzte Richtung.
Als meine Seiten schmerzhaft zu stechen beginnen und ich gerade einen Blick hinter mich werfen will, verliere ich den Halt. Der sumpfige Boden unter mir gibt nach und ich schlittere einen kleinen Hang hinunter. Fluchend lande ich in seichtem Wasser. Obwohl ich bereits mein ganzes Leben in Bedawi, dem Sumpfgebiet des Landes Ay, lebe, so werde ich mich doch niemals an die Heimtücken hierzulande gewöhnen. Überall lauern unerwartete Fallen, Hänge, sumpfige Löcher, die scheinbar endlos in die Tiefe führen. Ich schüttele den Kopf über meine eigene Achtlosigkeit, aber stelle erleichtert fest, dass die Luft um mich herum rein und klar ist. Es ist nach wie vor kein Staubsturm da.
Doch noch bevor ich mich wieder erhebe, merke ich, dass ich nicht mehr alleine bin. Jemand ist ganz in meiner Nähe. Lauernd suche ich die Umgebung ab, regungslos in meiner Position verharrend, aber außer Sträuchern und schattigen Sümpfen kann ich nichts erkennen. Die Strahlen der frisch aufgegangenen Sonne haben ihren Weg in dieses Gebiet noch nicht gefunden. Langsam und ohne hektische Bewegungen greift meine Hand an meinen Gürtel, öffnet lautlos die Lederscheide, in der mein Dolch steckt – mein wertvollster Besitz. Waffen sind rar und werden von Generation zu Generation weitergeben, gut behütet. Der Dolch gehörte einst meiner Mutter. Doch die braucht ihn nun nicht mehr.
Gegen einen Staubsturm wird er mir allerdings kaum eine Hilfe sein.
Dennoch halte ich nun geübt den Dolch vor meinen Oberkörper, so wie es uns Serbo nicht müde wird zu erläutern, lauernd und jederzeit bereit zum Angriff.
In diesem Gebiet war ich noch nie. Ich habe den Schilfgürtel an einer mir völlig unbekannten Stelle verlassen. Hier ist es besonders verwildert, viele kleine Sumpflöcher zieren die Oberfläche und es ist viel unebener als in meinem Bereich des Sumpfes. Der Bedawi hat viele Gesichter, wird schon den Allerjüngsten eingetrichtert, doch es hat nichts Bewunderndes an sich. Es ist nichts weiter als rohe Warnung, Angst, nüchterne Gewissheit.
Die Konzentration beginnt in meinen Schläfen zu pochen und meine Hand, die den Dolch hält, fängt unangenehm zu kribbeln an. Meine Augen brennen, weil ich nicht wage, sie zu schließen, um auch nicht die kleinste Bewegung zu verpassen, falls sie sich zeigt. Denn jede noch so kleine Unachtsamkeit hier draußen fordert den Tod.
Ein leises Rascheln wenige Schritte vor mir lässt meinen Puls hochschnellen, so dass ich unwillkürlich die Luft anhalte. Erkennen kann ich noch immer nichts, doch jetzt weiß ich, dass ich mich nicht getäuscht habe. Jemand ist hier! Ob der Andere meine Anwesenheit bereits bemerkt hat, lässt sich kaum erahnen. Lautlos wie ein Staubsturm und genauso unmerklich fortbewegend, schiebe ich mich in die Richtung des Geräusches, das inzwischen wieder der unendlichen Stille gewichen ist. Schritt für Schritt schleiche ich vorwärts, prüfe mit der Fußspitze jede Stelle im Boden vor mir, bevor ich mein ganzes Gewicht Stück für Stück darauf verlagere. Die Gefahr ist zu groß, in eines dieser bodenlosen Sumpflöcher zu treten, das einen langsam in seine endlose Tiefe hinab zieht, förmlich hinein saugt und nie wieder freigibt. Die Stelle, von der das Rascheln herrührte, lasse ich währenddessen keine einzige Sekunde aus den Augen. Es sind nur wenige Schritte und doch fühlt es sich wie ein endloser Marsch an, ehe ich endlich hinter das Buschwerk spähen kann, welches der Ursprung des verdächtigen Raschelns gewesen sein muss. Doch was ich vorfinde, ist nur weiterer Sumpf, durchbrochen von mannshohen Farnen, wucherndem Wollgras und unberechenbaren Wasserlöchern.
Beinahe hätte ich es übersehen, als mein Blick auf etwas fällt, das mich stutzig macht: Fußspuren. Und da der Sumpf die Eigenschaft hat, Spuren jeglicher Art sofort zu verschlucken und zu vernichten, weiß ich es genau. Diese Abdrücke im matschigen Boden sind frisch. Spätestens jetzt spüre ich, dass es höchste Zeit wäre, sich zurückzuziehen, lautlos kehrtzumachen und dorthin zurückzukehren, wo ich hingehöre. Aber Vernunft ist noch nie meine Stärke gewesen. Mit zusammengekniffenen Augen lasse ich meinen Blick den Fußabdrücken folgen, was gar nicht so leicht ist, bei dem unebenen, ständig wechselnden Untergrund. Ich unterdrücke das Zittern meiner Hand und umschließe stattdessen meinen Dolch noch fester, stelle mir vor, dass er mit meiner Haut verschmilzt und somit ein Teil meiner Hand wird. Die Spuren führen zu einer riesigen Esche – und verschwinden dahinter. Das ist meine Gelegenheit zum Rückzug – und ich lasse sie verstreichen, ignoriere die Stimme in mir, die mir zuschreit, ich könne mich genauso gut gleich in den Ay stürzen, wenn ich hier weiterginge.
Ich bin nur noch wenige Schritte von dem dicken Stamm der Esche entfernt, als ich eine Bewegung wahrnehme.
Dann geht alles rasend schnell.
Mit einem Satz überbrücke ich die letzte Entfernung zur Esche, springe an den Ursprungsort der Bewegung, meinen Dolch so fest umkrampft, dass ich mir nicht sicher bin, ob sich meine Finger je wieder von ihm lösen lassen. Ehe ich recht weiß, was geschieht, falle ich über die Gestalt her, die völlig überrumpelt mich nicht hat kommen sehen, drücke sie zu Boden, bis ich sie unter Kontrolle habe, ein Knie auf ihrer Brust, den Dolch an den Hals gepresst.
Ich blicke in ein Paar hasserfüllter tiefschwarzer Augen. Augen wie Krater, ohne die Ahnung, ob sie ein Ende haben oder ob man bei einem Sturz in sie hinein auf ewig weiter fallen würde. Fallen für den Rest der Zeit. Irgendetwas daran stellt eine Verlockung dar, ohne dass ich in der Lage bin, es zu greifen. Und noch während ich darüber nachdenke, wird mir bewusst, dass ich bereits falle, dass meine Seele in seine Augen fällt ...
Entschlossen schüttele ich den Kopf, reiße mich los von seinem Bann, über den er sich gar nicht bewusst zu sein scheint, denn aus seinen Augen blitzt noch etwas anderes hervor: Verblüffung.