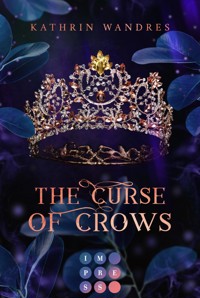
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
**Ein dunkler Fluch** Naru wächst im prunkvollen Schloss eines mächtigen Königreichs auf. Es wäre ein beneidenswertes Dasein, wenn nicht ihre immer häufiger auftretenden unheilvollen Visionen wären. Derweil wird die Idylle des Königreichs durch mysteriöse Angriffe überschattet und es ist fast zu spät, als Naru begreift, wie ihre Visionen mit den Anschlägen zusammenhängen. Das Reich schwebt in größter Gefahr und um es zu retten, muss sie ihren vorherbestimmten Seelenverwandten finden … Das Erwachen einer vom Schicksal gewobenen Liebe, die die Reiche retten oder zu ihrem Untergang führen wird. //Alle Bände der märchenhaften »Broken Crown«-Trilogie: -- Band 1: The Secret of Kingdoms -- Band 2: The Curse of Crows -- Band 3: The Mystery of Shadows// Alle Bände der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden und haben ein abgeschlossenes Ende. Dies ist die Wiederauflage der »In Between«-Trilogie von Kathrin Wandres.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Kathrin Wandres
The Curse of Crows (Broken Crown 2)
**Ein dunkler Fluch**
Naru wächst im prunkvollen Schloss eines mächtigen Königreichs auf. Es wäre ein beneidenswertes Dasein, wenn nicht ihre immer häufiger auftretenden unheilvollen Visionen wären. Derweil wird die Idylle des Königreichs durch mysteriöse Angriffe überschattet und es ist fast zu spät, als Naru begreift, wie ihre Visionen mit den Anschlägen zusammenhängen. Das Reich schwebt in größter Gefahr und um es zu retten, muss sie ihren vorherbestimmten Seelenverwandten finden …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
© Tina Laser Fotografie
Kathrin Wandres, geboren 1981, machte 2001 ihr Abitur in Tübingen und studierte bis 2003 in Stuttgart an der Fachhochschule für Technik Mathematik und Informatik. Von 2004 bis 2006 besuchte sie das Theologische Seminar Beröa, nahe Frankfurt. Mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt sie in Göppingen. Seit ihrer Kindheit liebt sie es, sich fremde Welten zu erdenken und in ihnen zu versinken.
Prolog
5000 Jahre zuvor.
Es war ein rabenschwarzer Tag, als es geschah. Er konnte sich nicht erinnern, je einen so kalten Winter erlebt zu haben. Doch es war die Art Winter ohne das Schöne dieser Jahreszeit. Ein Winter ohne Schnee, ohne Eisblumen und ohne die glänzenden Eiszapfen, die die Dächer der Hütten schmückten. In diesem Jahr zeigte er sich von seiner schlechtesten Seite, mit viel Düsternis, unbändiger Kälte und mit Nächten so lang, dass sie dem Tag keinen Raum mehr ließen.
Schwankend und zitternd vor Kälte suchten sich seine Füße den Weg. Seine Muskeln waren schwach, zu lange schon hatten seine Beine nicht mehr das tun können, wozu sie bestimmt waren. Zu lange hatten sie ihn festgehalten, gefangen gehalten. Eingekerkert wie ein Monster hatten sie ihn. Dabei war er das genaue Gegenteil davon. Ein Genie war er. Nicht so einfältig und treuselig wie diese Wesen. Er war zu Großem berufen, das spürte er. Doch sie hatten es nicht erkennen wollen, sie hatten sich seiner bemächtigt, ihn eingesperrt wie ein Tier. Hatten ihm seine Seele genommen. Alles hatten sie ihm genommen. Nun würde er auch ihnen alles nehmen. Mehr als ein Jahrhundert in Gefangenschaft waren mehr Zeit als genug gewesen, um den perfekten Plan zu ersinnen. Niemals wieder würden sie über ihn gebieten können. Lachend schüttelte er seine langen schneeweißen Haare, die ihm beinahe bis zur Hüfte reichten. Er würde den perfekten Verrat inszenieren. Den höchsten Verrat. Er würde sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Und sie für immer zerstören.
1. Kapitel
»Wenn eine einzelne Krähe deinen Weg kreuzt, wird Unheil dich heimsuchen.«(Altes Sprichwort aus den dunklen Zeiten.)
Während ich an diesem Abend aus meinem Versteck heraus das Krähenpärchen auf dem Feld beobachtete, musste ich daran denken. Es stimmte. Noch nie zuvor war ich einer einzelnen Krähe begegnet, sie waren immer mindestens zu zweit, und noch nie hatte ich mich darüber gewundert. Bis heute. Doch ich schob den Gedanken beiseite und so sollte ich erst Jahre später verstehen, dass das Leben manchmal Warnungen schickte vor kommendem Unheil. Doch diese Warnung heute war zu leise. Oder ich nicht wachsam genug, um sie zu verstehen.
Es war verboten, über Krähen zu sprechen. Sie waren die Vögel des Todes, die schon vor vielen tausenden von Jahren großes Unglück über das Land gebracht hatten. Unglück, über das keiner wagte zu sprechen, aus Angst, es könnte sich wiederholen. Seitdem wurden die Krähen verbannt, mehr noch, sie wurden totgeschwiegen – als könnte man so tatsächlich ihre endgültige Vernichtung herbeiführen. Es war verboten, alleine ihren Namen auszusprechen. Geschweige denn, sie zu beobachten.
Ich aber liebte es, sie zu beobachten.
Meine blonden Locken fielen mir ins Gesicht, als mein Fuß beim Aufstehen an einer Wurzel hängen blieb. Ich fluchte und die Krähe, die mir näher war, blickte sich um, zögerte den Bruchteil eines Flügelschlags und erhob sich dann in die Lüfte. Mein Blick flog zu der zweiten Krähe etwas weiter entfernt. Ich zählte instinktiv die Sekunden. Laut krächzend stieß auch dieser tiefschwarze Vogel in die Luft und folgte seinem Partner. Sie ließen sich niemals alleine. Meine Augen folgten ihnen, bis ich sie nicht mehr ausmachen konnte und ein wohlbekanntes Gefühl überkam mich. Eine undefinierbare Sehnsucht, ein Stechen in meinem Herzen, etwas, das ich seit je her kannte und doch nicht einsortieren konnte. Es war ein Teil von mir. Ich nahm an, dass solche Gefühle normal waren, wenn man seit siebzehn Jahren an ein und demselben Ort lebte und keine Vorstellung davon hatte, wie es draußen in der Welt aussah.
Für einen kurzen Moment schloss ich die Augen und meine Gedanken flogen davon …
Benommen schüttelte ich den Kopf, als könnte ich dadurch das nagende Gefühl in mir verjagen. Ich fasste mir an die Stirn, ehe ich die Augen wieder öffnete und versuchte, den leichten Schwindel in den Griff zu bekommen, der mich in den letzten Wochen immer wieder aus heiterem Himmel überfiel. Ich beschloss, es zu ignorieren und machte mich auf den Rückweg. Ich rannte – nicht, weil ich musste, sondern weil ich es liebte. Ich liebte den Wind, der meine Haare hinter mir her wehen ließ und mir sanft über das Gesicht strich, und ich liebte das Gefühl, dass die Welt an mir vorbeiflog. Manchmal kam mir der Gedanke, dass, wenn ich nur schnell genug rennen würde, ich abheben und in den Himmel fliegen könnte, in andere Länder, weg von hier – dahin, wo das schmerzende Gefühl in mir nicht mehr zu spüren war – falls es diesen Ort gäbe. Vorbei an den kahlen Maisfeldern, die noch vor wenigen Wochen hohe Stauden getragen hatten, suchte ich mir meinen Weg nach Hause. Viel zu schnell kam es in Sicht, mein Zuhause. Das Schloss von Kadosch.
Es war ein gigantischer Anblick: weiße hohe Mauern, aus denen sich ebenso weiße runde Türme vor einem durchdringend blauen Himmel erhoben. Das Licht in Kadosch war atemberaubend. Und das strahlende Weiß des Schlosses reflektierte es auf ganz besondere Weise und ließ es fast unnatürlich perfekt erscheinen. Seit ich denken konnte, lebte ich hier. Meine Familie bewohnte einen der Ostflügel, zu dem auch meine privaten Räume gehörten. Jeden Morgen sah ich von meinem Bett aus die Sonne über dem Meer aufgehen. Ich hatte alles, was man brauchte. Ein besseres Leben hätte man sich nicht wünschen können. Es war perfekt. Der Traum eines jeden siebzehnjährigen Mädchens.
Nur nicht meiner. Ich wollte fort von hier. Doch ich konnte nicht einmal beschreiben wieso. Es war diese Sehnsucht in mir, die mich fortreißen wollte. Eine Sehnsucht, die nicht sein durfte. Eine Sehnsucht, von der kein Mensch wusste. Und auch nicht wissen durfte.
»Du bist so zu beneiden«, war ein Satz, den ich täglich hörte. »Was würde ich dafür geben, mit dir tauschen zu können«, hatte beinahe jedes Mädchen, das ich kannte, schon hunderte Male in meiner Gegenwart benutzt. Auch meine Eltern ließen es mich immer wieder wissen: »Du kannst dankbar sein. Du hast alles, was man sich im Leben wünschen kann.« Aber tief in mir wusste ich, dass es eine Lüge war. Etwas fehlte. Etwas Wichtiges …
»Hey, Schnepfe«, wurde ich jäh aus meinen Gedanken gerissen. Ich rollte mit den Augen beim Klang seiner krächzend hohen Kinderstimme und beschleunigte mit gesenktem Kopf meine Schritte. Wenn ich Glück hatte, erreichte ich die Eingangstür des Ostflügels, bevor er mich eingeholt hätte. Sie lag nur noch wenige Schritte von mir entfernt …
Ich hatte kein Glück.
»Jetzt bleib schon stehen! Ich weiß, dass du mich gehört hast.« Er baute sich vor mir auf – dabei war er sehr klein für seine neun Jahre – und versperrte mir den letzten Ausweg, ihm zu entkommen.
»Mir egal, Koby. Vielleicht will ich dich gar nicht hören«, mit einem aufgesetzten Lächeln schaute ich zu ihm hinunter, »schon mal darüber nachgedacht?«
Koby kniff die Augen zusammen und nickte wissend, fast schuldbewusst. Doch im nächsten Moment schüttelte er eifrig den Kopf, so dass seine feuerroten Haare wie loderndes Feuer wirkten. »Interessiert mich nicht, Schnepfe.«
»Hör auf mich so zu nennen, Koby.« Ich schob ihn unsanft beiseite und marschierte schnellen Schrittes an ihm vorbei.
»Hey, lass das!« Wie nicht anders zu erwarten, rannte er hinter mir her. »Ich weiß was und ich muss es dir erzählen.«
»Hast du keine Schule?«, fragte ich genervt, »oder Freunde, denen du das erzählen könntest?«
Koby fuhr sich mit der flachen Hand über seinen roten Haarschopf, wie immer, wenn er nachdachte, als könnte er durch das Ordnen seiner Haare das Gleiche mit seinen Gedanken erreichen. »Es ist kurz vor Sonnenuntergang. Da hat man keine Schule.« Wegen seiner Zahnlücke lispelte er, was es mir zusätzlich erschwerte, ihn ernst zu nehmen.
Leichtfüßig nahm ich die Stufen der Wendeltreppe, die mich zu meinem Turm hinaufführten. Auch ohne mich umzudrehen, wusste ich, dass Koby mir folgte. Selbst ein Tauber hätte sein Stampfen, wenn nicht hören, so doch spüren können.
Oben angekommen, warf ich mich aufs Bett und schloss die Augen, in der Hoffnung, ich könnte ihm so begreiflich machen, dass ich meine Ruhe wollte. Doch Koby war so einfühlsam wie ein Adler, der seine Jungen zum Fliegen lernen aus dem Nest schmiss. Keine Handbreit von meinem Kopf entfernt ließ er sich auf das Bett plumpsen und tippte mir mit seinem spitzen Finger unaufhörlich an die Schulter.
»Ich bin müde«, murmelte ich und drehte ihm den Rücken zu. Doch hartnäckig, wie Neunjährige sein können, beeindruckte ihn das wenig.
»Du bist dauernd müde zurzeit. Vielleicht hast du irgendeine schlimme Krankheit.«
Mit einem Stöhnen vergrub ich meinen Kopf unter einem Kissen. Vielleicht hörte er dann auf zu schmerzen. Und Koby auf zu reden.
Doch er hatte recht. Die Müdigkeit quälte mich sehr in den letzten Wochen. Oder waren es schon Monate? Ich überlegte, wann es angefangen hatte. Es musste zeitgleich mit dem Schwindel begonnen haben. Und den Kopfschmerzen.
»Bevor du stirbst, muss ich dir aber noch was erzählen.«
»Ich sterbe nicht, Nervensäge.« Mühsam setzte ich mich wieder auf. An Schlaf war ohnehin nicht zu denken.
»Da wäre ich mir nicht so sicher, Schnepfe.«
»Du nervst wie hundert Möwen.« Gähnend rieb ich mir die Augen.
»Ich bin der zukünftige König.« Triumphierend baute er sich vor mir auf.
»Du wirst mit Sicherheit der nervigste König, den Kadosch je gesehen hat, Koby.«
»Nenn mich Kobelany, den Zweiten«, entgegnete er und reckte seine kleine Nase so weit es ging nach oben.
»Das macht dich nicht weniger nervig.«
»Aber es klingt gleich viel königlicher, oder?«
»Koby …«
»Für dich immer noch Kobela…«
Ich packte ihn an den Schultern und schaute ihm eindringlich in die Augen. »Nun erzähl, was du loswerden willst und dann verschwinde von hier.«
»Schon gut.« Er befreite sich aus meinem Griff und murmelte leise: »Schnepfe.«
Warum konnte er mich nicht einfach in Frieden lassen? Bestimmt würde mein Kopf weniger schmerzen, wenn seine Stimme nicht ohne Pause auf mich einhämmern würde. Und vielleicht wäre ich dann in der Lage darüber nachzudenken, was genau mit mir nicht stimmte.
»Es ist etwas passiert«, begann er eifrig und seine roten Haare vibrierten vor Aufregung, »schon wieder.« Geheimnisvoll kniff er seine Augen zusammen und schaute sich nach allen Seiten um, als könnten wir belauscht werden. Lächerlich. Aus welchem Grund sollte uns jemand belauschen? Bis hier in meinen Turm verirrte sich niemand. Und meine Eltern waren auf einer längeren Erkundungstour, vor Ende des Monats würden sie nicht zurück sein. Ich war allein, wie so oft.
Er kam ein paar Schritte näher und senkte seine Stimme, während er weitersprach. »Es gab einen erneuten Angriff. Ein Typ namens Hircan aus dem Westflügel. Er war alleine, während es passierte. Wie die anderen auch berichtet er von den Schatten, bevor er von hinten angegriffen wurde.« Nun stand Koby ganz dicht vor mir. »Es ist bereits die fünfte Attacke diesen Monat. Alle nach dem gleichen Schema.«
Mit dem breitesten Grinsen im Gesicht trat er wieder zurück und verschränkte die Arme vor der Brust, als wenn er Applaus für besondere Leistungen erwarten würde.
Die Müdigkeit ließ die Informationen nur stückweise zu mir vordringen. Wie Nebel, der das Bild nur Stück für Stück offenbart, je mehr man sich nähert. So sehr er auch nervte, Koby hatte recht. Die Häufigkeit dieser Angriffe hatte in den letzten Wochen deutlich zugenommen. Auch wenn ich anfangs versucht hatte, es zu ignorieren, jetzt kam auch ich nicht mehr an ihnen vorbei.
»Ich kenne Hircan. Er saß in Naturkunde eine Reihe hinter mir«, murmelte ich benommen und sah in Erinnerung den großen breitschultrigen Jungen, der ständig die Nase rümpfte, als müsste er niesen, und dessen Lachen klang, als verschluckte er sich an seiner eigenen Spucke.
»Das ist ja elegantastisch«, rief Koby aus und seine Augen schienen einen Moment lang das Rot seiner Haare widerzuspiegeln.
»Koby, dieses Wort existiert gar nicht …«, ermahnte ich ihn.
»Ich bin der zukünftige König, ich darf reden, wie ich will.« Er erhob nicht nur seine Stimme, sondern auch seine Arme. Als ob ihn das größer werden ließe. »Außerdem hast du früher auch Wörter benutzt, die es gar nicht gibt. Hat meine Mama erzählt. Mir fällt nur nicht mehr ein, welche …« Er blickte kurz angestrengt in die Zimmerecke, wie wenn dort Wörter herumliegen würden, die niemand brauchte.
»Aber, um zum Thema zurück zu kommen«, setzte er wieder an, offenbar ohne fündig geworden zu sein, »wir müssen etwas tun.«
Ich spürte, dass ich kurz davor war, die letzten dünnen Fäden zu verlieren, an denen meine Geduld hing. »Wir, Koby?« Unruhe stieg in mir auf und meine Finger begannen nervös zu zucken. »Wir sollten jetzt schleunigst dafür sorgen, dass du nach Hause gehst, damit ich schlafe.«
Eine erneute Schwindelwelle ergriff mich und ich fasste mir an den Kopf. Sie kamen immer häufiger, unkontrollierter, unerwarteter.
Koby packte meinen Arm, führte mich zum Bett und gab mir einen unsanften Stoß. Dann kam er mir mit seinem Gesicht so nahe, dass sich beinahe unsere Nasenspitzen berührten. »Doch. Wir werden etwas tun. Denn wenn du mir nicht hilfst«, er grinste hämisch und ließ keinen Zweifel daran zu, dass er es ernst meinte, »werde ich meiner Mama von deinen Schwindelanfällen erzählen, deinen Kopfschmerzen und dass du dauernd müde bist.« Koby unterbrach für keine Sekunde den Blickkontakt und man hätte kaum glauben können, dass er erst neun Jahre alt war. »Und du weißt genau, was das heißt.«
Die Stille, die nun folgte, wurde erfüllt von meinem schnellen Atem und seinem stechenden Blick, der das Unausgesprochene unheilvoll in der Luft hängen ließ. Der unangenehme Druck in meiner Magengegend bestätigte mir, dass er mich in der Hand hatte. Denn, wenn etwas nicht passieren durfte, dann, dass seine Mutter von meinen gesundheitlichen Schwierigkeiten erfahren würde. Das würde das Ende all meiner Freiheiten bedeuteten, meiner Ausflüge durch die Felder und das alleinige Bewohnen meines Turmes. Und das durfte auf gar keinen Fall passieren. Das Letzte, was ich jetzt brauchen konnte, war verordnete Bettruhe und Ausgangsverbot.
Ich funkelte Koby böse an. In seinen Augen sah ich den Triumph darüber, dass seine Botschaft angekommen war.
»Ich werde natürlich alles für mich behalten«, er lachte gackernd über seine List, »ich bin ja der zukünftige König.« Seine roten Haare schienen für einen Moment aufzuflackern bei diesen Worten. »Sofern du das tust, was ich dir sage.«
»Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es viel schöner sein könnte, Freunde zu haben, die sich freiwillig in deiner Nähe aufhalten und nicht aus Zwang?« Müdigkeit und Frustration schlichen sich in meine Stimme.
»Mir scheint, das Ergebnis wäre das Gleiche«, erwiderte Koby hochnäsig, »und so macht es viel mehr Spaß. Schnepfe.«
»Ich mache nur mit, wenn du endlich aufhörst mich so zu nennen. Und nun sag mir, was du vorhast.«
»Ich nenne dich, wie ich will. Schließlich bin ich der …«
»Koby!« Jeden Moment würde meine Geduld mit einem lauten Knall auf dem Boden aufschlagen.
»Schon gut«, er hob beschwichtigend die Hände, doch dann nickte er verschwörerisch. »Wir werden Hircan einen kleinen Besuch abstatten.«
Ich wollte gerade zu einem theatralischen »Das kann nicht dein Ernst sein?« ansetzen, als ein durchdringender, schriller Schrei in den Turm heraufdrang. Mir blieb das Herz stehen und ich befürchtete das Schlimmste. Doch dann folgte das lautstarke wütende »Koby!« einer Frauenstimme und ein Blick auf Kobys schuldbewusstes Gesicht, der grinsend »Ups« murmelte, ließ mich den Kopf schütteln.
»Was hast du nun wieder angestellt?«, seufzte ich.
»Ich kann alles erklären«, kicherte er, während die Frauenstimme von unten ein noch lauteres »Komm sofort nach Hause!« hinterher schob. Im Gehen wandte er sich noch einmal um. »Mir ist das Wort wieder eingefallen, das du als Kind erfunden hast. Es war«, er blickte mich belustigt an, »schauergruselig. Erinnerst du dich noch, Naru?«
2. Kapitel
»Erinnerungen verfolgen dich wie Schatten. Wenn du versuchst sie zu greifen, entweichen sie dir. Nur ihre dunkle Gestalt bleibt dir vor Augen.«(aus: »Großes Handbuch der Psychologie, Bd. 5 – Erinnerungen. Funktion und Umgang.«)
Es war genau diese Art von schattenartigen Erinnerungen, die mich in den letzten Wochen immer wieder heimgesucht hatte. Ich konnte sie weder greifen noch festhalten, und sobald ich die Augen schloss, überkam mich das Gefühl, sie würden im Schlaf über mich herfallen. Ich kämpfte mit ihnen, doch war es ein ungleicher Kampf, hatte ich doch nicht den Windhauch einer Ahnung, womit ich es hier zu tun hatte. In dieser Nacht hatten sie mich wieder heimgesucht: Visionen, Träume, Schatten an Erinnerungen. Seit Wochen verfolgten sie mich in meinen Träumen, doch morgens blieb kaum mehr als ein nagendes Gefühl. Ein Gefühl, das irgendwas ganz und gar nicht stimmte …
Andere Erinnerungen jedoch standen mir deutlich und klar vor Augen, wie jene, die Koby mit dem Wort schauergruselig hervorgerufen hatte. Ich dachte gerne daran zurück, an diesen Moment, an dem ich sie das erste Mal gesehen und sie so desorientiert und geschwächt vor mir gelegen hatte. Ich hatte mich bedeutend gefühlt, und frei, alles zu werden, was ich mir wünschte. Aber vielleicht fühlte man sich als Fünfjährige eben so. Jetzt – zwölf Jahre später – blieb mir davon kaum mehr als der flüchtige Schatten dieses Gefühls.
Ich machte mich an den Abstieg aus meinem Turm und schirmte meine Augen gegen das gleißende Sonnenlicht ab, das mich umfing. Ich blickte über den Schlosshof und lächelte, sobald ich sie erkannte. Sie wirkte weder schwach noch desorientiert. Von dem verwirrten Mädchen von damals war nichts mehr übriggeblieben. Nun war sie das genaue Gegenteil. Es war zu spüren, dass sie ihr Leben im Griff hatte, dass sie einen Plan hatte. Dass sie stark war. Aber das musste man auch, wenn man ein ganzes Land regierte. Wenn man Königin war von Kadosch.
Sie erwiderte mein Lächeln und winkte mich zu sich herüber.
»Naru, guten Morgen, ich war gerade auf dem Weg zu dir.«
Erstaunt blickte ich sie an. »Zu mir, aber wies…«
»Was bei allen Himmeln …?«, unterbrach sie mich und ihre dunklen Haare fielen ihr von der Schulter, während sie wild den Kopf schüttelte. »Was hat er nun schon wieder angestellt?«
Eine Lehrerin der Unterstufe eilte mit hochrotem Kopf und zusammengepressten Lippen schnellen Schrittes auf uns zu. An der Hand zog sie einen kleinen hämisch grinsenden Jungen hinter sich her. Einen Jungen mit roten Haaren.
»Eure Hoheit, bitte sehen Sie mir die erneute Störung nach«, begann die zerknirschte Lehrerin. Sie war sichtlich bemüht ihre Fassung zu bewahren. Immer wieder wischte sie sich mit der freien Hand den Schweiß von der Stirn und sie konnte nicht aufhören mit den Augen zu zwinkern. Koby sah ihr amüsiert dabei zu.
»Verzeihen Sie, Eure Hoheit, es ist mir äußerst unangenehm, Sie damit belasten zu müssen«, stammelte sie und blickte nervös zwischen Koby und der Königin hin und her, »aber in diesem Zustand ist es mir nicht weiter möglich, Ihren Sohn zu unterrichten. Er …«, stotterte die Lehrerin, die sich sichtlich unwohl in ihrer Haut fühlte, »missachtet sämtliche Regeln unserer Schule.«
»Mir war nicht bewusst, dass es verboten ist, sich mit Kobelany, der Zweite anreden zu lassen und seinen Mitschülern Ihren Unterrichtsstoff zum besseren Verständnis erneut zu erklären«, verteidigte sich Koby schulterzuckend. Und auch wenn er seinen unschuldigsten Blick aufsetzte, erkannte ich immer noch das berechnende Blitzen in seinen Augen.
Die Lehrerin lief hochrot an und kniff ihre Augen immer wieder angestrengt zusammen, so dass ihre Augenbrauen und die Falten ihrer Stirn eine wilde Hügellandschaft bildeten. Vielleicht hoffte sie auf diese Weise das Bild klarer sehen zu können.
»Ja, also nein, aber es ist sehr wohl unerwünscht«, sie betonte das Wort in einer Weise, als wäre es ihr unangenehm, es in ihrem Mund zu spüren, »dies während meines Unterrichts stehend auf meinem Lehrerpult zu tun und dabei zu verlangen, dass sich seine Mitschüler auf Knien liegend vor dem zukünftigen König verneigen.«
Koby nickte langsam mit ernstem Gesicht. »Ich wollte bloß wissen, wie es sich anfühlt.« Er zuckte mit den Schultern und ein Grinsen stahl sich in seine Mundwinkel.
»Koby!« Kopfschüttelnd packte ihn seine Mutter bestimmt, aber dennoch liebevoll am Arm, zog ihn zu sich und strich ihm seufzend durch seine wuscheligen Haare. Ich fragte mich, woher sie diese Geduld und Liebe für ihn hernahm. Doch wahrscheinlich gebar man mit dem eigenen Kind auch die Liebe zu diesem.
»Vielen Dank, ich werde mich der Sache annehmen«, nickte die Königin der Lehrerin zu, wonach diese mit einem Knicks und einem deutlich erleichterten Gesichtsausdruck wieder in Richtung Schule verschwand.
Mir war es ein wenig unangenehm, dieser Szene beigewohnt zu haben und ich überlegte, ob ich mich unauffällig davonschleichen sollte. Musste es nicht extrem unangenehm sein, als Königin einen Sohn zu haben, der sich so konsequent danebenbenahm und den keiner ausstehen konnte? Ehrlich, ich kannte niemanden, der Koby wirklich mochte. Er war ein Einzelgänger, und wo er auftauchte, gab es Ärger. So jemand sollte der Prinz sein? Der zukünftige König von Kadosch? Ich nahm mir fest vor auszuwandern, bevor er den Thron bestiege.
»Naru, ich bin froh, dass du gerade jetzt hier bist«, wandte sich die Königin nun wieder an mich. »Das ist genau der Grund, warum ich mit dir reden wollte.«
Ein ungutes Gefühl machte sich in meiner Magengegend breit, ein Würgereiz, der sich seinen Weg nach oben suchen wollte. Das konnte nichts Gutes bedeuten.
»Koby hat erzählt«, fuhr sie fort, »wie gern du Zeit mit ihm verbringst, dass er jederzeit zu dir kommen kann und du gerne auch mal für längere Zeit seine Aufsicht übernehmen möchtest.«
»Hat? Er? Das?« Langsam und wie im Schockzustand weiteten sich meine Augen und wanderten zu Koby. Mit aller Macht unterdrückte ich den Drang, ihn an Ort und Stelle eigenhändig zu strangulieren. Dieser hatte seinen treuesten Blick aufgesetzt und hinter vorgehaltener Hand formte er mit seinen Lippen betont langsam das Wort »Schwindelanfälle«.
Es kostete mich alle Mühe, das Würgegefühl wieder hinunterzuschlucken.
»Ja, Naru, und ich bin so froh darüber. Er hat ja sonst niemanden. Und jetzt, wo er noch von der Schule suspendiert wurde, wäre es mir eine große Hilfe, wenn du die Aufsicht über ihn übernehmen könntest. Über die Zeiten können wir noch reden und es versteht sich von selbst, dass du dafür nicht leer ausgehen sollst.« Ihr Blick sagte mehr als ihre Worte. In ihren Augen konnte man die Liebe und Sorge für ihren Sohn sehen und in diesem Moment sprach nicht die Königin des Landes, sondern eine sich sorgende Mutter mit mir. Ich seufzte tief. Eine Wahl hatte ich sowieso nicht. Koby hatte mich in der Hand. Die Königin durfte auf keinen Fall von meinen Schwindelanfällen erfahren.
»Klar, mach ich gerne«, quetschte ich mit zusammengebissenen Zähnen hervor und ich spürte, wie mir mein Lächeln kläglich misslang. Was konnte der Tag noch bringen, wenn er auf diese Weise begann? Aber wenn es etwas gab, das ich in den kommenden Wochen lernen sollte, dann das: »Wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, wird dir das Leben das Gegenteil beweisen.«
Dankbar drückte die Königin ihrem Sohn einen Kuss auf die Stirn. »Bis heute Abend, Koby«, sie zog ihre Augenbrauen zusammen, »und versuch bitte nicht, jeden Ärger mitzunehmen.«
»Du kennst mich doch, Mum«, strahlte er sie an.
»Eben«, murmelte sie im Gehen und nickte mir zu. Ob es nur Abschied oder gleichzeitig Warnung war, konnte ich nicht deuten.
»Auf Wiedersehen, Eure Hoheit«, verabschiedete ich mich mit einer angedeuteten Verbeugung. Sie wandte sich mir ein letztes Mal zu und legte mir eine Hand auf die Schulter. »Bei allen Himmeln, Naru.« Kopfschüttelnd sah sie mich an. »Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du Keylah zu mir sagen darfst?«
3. Kapitel
»Träume der Nacht bedeuten nichts, wenn sie dir einmal begegnen. Besuchen sie dich ein zweites Mal, so wappne dich. Eine dritte Wiederholung jedoch besiegelt dein Schicksal.«(Aus: »Weisheiten der Krähen – Wahrheiten über Träume.«)
Die Rabenkrähe war tiefschwarz. Ihr Gefieder war glänzend und gleichzeitig anziehend und abstoßend. Ihr durchdringender Blick war auf mich gerichtet. Stechende dunkle Augen, die wie leere Gräber mich zu verschlucken drohten. Die gefährliche Ruhe dieses Moments war erdrückend und wieder einmal aufs Neue fragte ich mich, was sie mir mit ihren Augen zu sagen versuchte. Ich verstand sie nicht. »Geh nicht«, flüsterte ich, »bleib, dieses eine Mal.« Doch ich wusste, dass es unvermeidbar war. Ihren nachtschwarzen Schnabel Richtung Himmel streckend gab sie ein durchdringendes »Garrrr« von sich, bevor sie sich einsam in die Lüfte erhob.
***
Zitternd öffnete ich die Augen. Es war nicht nur das dritte Mal, dass sich dieser Traum bereits wiederholte, nein: Es war das dritte Mal in dieser Woche, ganz zu schweigen von den vielen Wochen zuvor. Ich wusste, was die Legenden über das Auftauchen einzelner Krähen besagten. Und die Häufigkeit dieser Träume ließ mich nichts Gutes hoffen.
»Du bist schon wieder eingeschlafen«, krächzte er mir mit seiner hohen Stimme ins Ohr. »Du musst mir meine Schulaufgaben machen.«
Ich räkelte mich und rieb mir die Müdigkeit aus den Augen – vergebens.
»Nein, Koby, du hast das falsch verstanden«, antwortete ich bemüht freundlich. »Nicht ich soll deine Schulaufgaben machen. Sondern du machst sie und ich sorge nur dafür, dass du es tust.«
»Das andere wäre besser«, murmelte er. »Du musst aufhören zu schlafen, sonst sage ich meiner Mama, dass du das dunkle Leiden hast.«
»Und du musst aufhören zu motzen, sonst gehe ich nicht mit dir zu Hircan, du Möchtegern-Detektiv«, zischte ich ihm wütend zu, bemüht, ihn nicht meine Sorge spüren zu lassen, dass er vielleicht recht hatte.
Es wurde nie offen darüber gesprochen. Ich wusste nicht, ob es verboten war oder die Angst der Menschen, dass wenn man es laut ausspräche, es wahr würde. Es wurde nur flüsternd und unter der Hand darüber getuschelt und ein Schleier aus Sorge und Beklemmung umhüllte jedes dieser Worte. Das dunkle Leiden gehörte zu den zahlreichen Legenden aus den alten Zeiten. Offiziell kannte sie keiner, daher waren meine Kenntnisse darüber schwammig und widersprachen sich teilweise. Doch in einem waren sich die Überlieferungen einig, denn alle berichteten von den gleichen Symptomen. Müdigkeit, Kopfschmerzen und plötzlich einsetzender Schwindel. Das dunkle Leiden wurde gefürchtet und bei dem leisesten Verdacht darauf wurde die höchste Quarantänestufe ausgerufen. Man erzählte sich, dass alle, die daran erkrankten, sich nie wieder davon erholt hätten und kein Mensch sie je wieder zu Gesicht bekommen hätte. Ich versuchte, das ungute Gefühl zu verdrängen, das mich zu überwältigen drohte, doch ich spürte, dass es sich von Mal zu Mal schwerer abschütteln ließ. Als ob jedes Mal ein Stück davon an mir hängen bliebe, um sich auszubreiten, still und leise wie ein Virus, der alle gesunden Zellen um sich herum auffrisst.
»Ich bin fertig, lass uns gehen«, riss mich Koby aus meinen Gedanken und rüttelte kräftig an meinen Schultern. Gab es denn keinen Benimm-Unterricht für angehende Könige?
Er zog mich hinter sich her und ich war so sehr mit Augenrollen beschäftigt über diesen ungezogenen Bengel, dass ich die Krähe, die neben uns gelandet war und uns mit schräg gelegtem Kopf hinterher sah, nicht bemerkte.
Der Westflügel war weniger strahlend und glänzend als der Rest des Schlosses und wirkte irgendwie heruntergekommen. Ich war recht selten hier. Im Westflügel wohnten hauptsächlich die Dienstboten und andere Angestellte des Schlosses mit ihren Familien. Zögernd betrat ich hinter Koby den Seiteneingang, um Hircan einen Besuch abzustatten. Zielstrebig eilte Koby voran und manövrierte uns zielsicher durch die Gänge des Westflügels, bis er schließlich vor einer schäbigen Tür stehen blieb. Die Farbe blätterte bereits vom Türrahmen und an der Deckenbeleuchtung hatten sie in diesem Gang wohl gespart. Koby hob seine kleine Faust, doch bevor er anklopfte, funkelte er mich mit seinen giftgrünen Augen hinterhältig an und zischte mir zu: »Vergiss nicht, wer hier das Kommando hat.« Bei seinen Worten schienen seine Haare kurz aufzuleuchten wie Feuer, das alles verzehren wollte, aber im nächsten Moment war ich mir sicher, dass es nur Einbildung gewesen war.
Sobald wir die Wohnung von Hircan betraten, überfiel uns eine drückende Atmosphäre. Eine undefinierbare Dunkelheit beherrschte den Raum. Das Atmen fiel mir plötzlich schwer, finstere Schatten schienen mir die Kehle zuzuschnüren. Eine Schwere lag in dem Raum, die sich sofort auf meine Schultern legte. Unauffällig schielte ich zu Koby, doch der schien von alledem nichts zu bemerken.
Hircan zuckte zusammen. Er wirkte kleiner, als ich ihn in Erinnerung hatte. Mit einer nervösen Bewegung fuhr er sich mit dem Handrücken unter der Nase entlang und kniff die Augen zusammen, als wenn er niesen müsste. Er blickte uns nicht an und seine Augen wanderten unruhig hin und her. Als würde er unsichtbare Punkte zählen, die in der Luft herumschwirrten und uns verborgen blieben.
Mir war alles andere als wohl in dieser Situation und ein Teil in mir schrie mir zu, schnellstens von hier zu verschwinden. Koby jedoch wirkte entschlossen und geschäftig. Er hatte sich einen schwarzen Hut aufgesetzt, unter dem seine roten Haare wild hervorlugten und das Rot noch leuchtender erscheinen ließ. Seine rechte Hand umklammerte einen ganzen Satz diverser Schreibutensilien Immer wieder hielt er kurz inne, um sich scheinbar wichtige Dinge zu notieren, als könnte er sonst etwas Entscheidendes vergessen. Innerlich seufzte ich. Wie lang würde ich diese nervende Göre wohl noch ertragen müssen?
»Mein Name ist Sir Koby«, begann er mit wichtigtuerischem Tonfall, »und das da ist …«, er zeigte auf mich, kniff seine Augen zusammen und schüttelte dann abfällig den Kopf, »ach, unwichtig. Wir kommen wegen des …«, er beugte sich leicht in Hircans Richtung und senkte verschwörerisch seine Stimme, »… Vorfalls.« Die Art, wie er das Wort betonte, gefiel mir ganz und gar nicht.
Hircan zuckte zusammen, als würde selbst der Klang des Wortes böse Erinnerungen heraufbeschwören, und auf einmal wirkte er noch zusammengesunkener.
»Aber ich habe doch bereits alles berichtet«, entgegnete er mit weinerlicher Stimme.
»Ja, natürlich.« Herablassend lachte Koby auf, um deutlich zu machen, dass er der Einzige war, der den Durchblick hatte. »Wir sind hier, um zu überprüfen, ob unsere Kollegen«, theatralisch malte er mit seinen spitzen Kinderfingern Gänsefüßchen in die Luft, »auch nichts übersehen haben. Sie können manchmal ein wenig – wie soll ich sagen? – unfähig sein. Und das ist wirklich noch freundlich ausgedrückt.«
Er lachte sein lautes, unsympathisches Kobylachen. Mit offenem Mund starrte ich ihn an. Wie viel Dreistigkeit steckte noch in diesem Jungen?
»Also würden Sie bitte? Unsere Zeit ist kostbar und knapp bemessen.« Mit einer auffordernden Handbewegung baute er sich vor Hircan auf und sah ihn erwartungsvoll an.
»Ich … also … es war dunkel«, begann Hircan stotternd. »Ich war alleine. Dann geschah es. Ein Geräusch. Ich drehte mich um. Nichts. Ein weiteres Geräusch rechts. Dann plötzlich links. Ich wurde hektisch.« Seine Stimme klang nach der gesamten Angst dieser Situation, die ihm noch in seiner Kehle steckte und ihn daran zu hindern suchte, Informationen preiszugeben. Panik stand ihm in den Augen, während er weitersprach. »Dann sah ich sie. Schatten. Dunkle Schatten. Nur aus dem Augenwinkel heraus. Sie waren schnell. Zu schnell. Ich konnte sie nicht erkennen. Sie waren überall.«
Er keuchte schwer und das ständige Blinzeln seiner Augenlider machte mich nervös.
»Lass uns gehen, Koby«, flüsterte ich, doch ich erntete nur einen vernichtenden Blick.
»Ich bin hier noch nicht fertig!«, herrschte er mich an. »Fahren Sie fort, Hircan.«
»Dann waren die Schatten verschwunden. Für einen Moment dachte ich, es wäre vorbei.« Hircans Stimme zitterte. »Bis der Schmerz kam. Mein ganzer Rücken schmerzte. Wie wenn man mir die Haut abzöge. Immer und immer wieder.« Er atmete nun so schnell, dass ich fürchtete, er würde im nächsten Moment umkippen. Schnell reichte ich ihm das Glas Wasser von seinem Tisch. Ohne aufzusehen, nahm er es entgegen und kippte den Inhalt hinunter.
»Dann weiß ich nichts mehr. Als ich erwachte, war alles ruhig. Die Schatten waren weg. Die Schmerzen blieben.« Seine Augen verloren sich im Nichts, durchbohrten die Luft, versuchten Dinge aus der Vergangenheit zurückzuholen, die er dort verloren hatte.
Ich nahm Koby am Arm. »Wir sollten jetzt wirklich hier weg.« Ich hielt die drückende Stimmung nicht mehr aus. Es lag etwas in diesem Raum, das nach mir greifen wollte, mich halten wollte – und deswegen musste ich schleunigst hier raus.
Doch Koby befreite sich aus meinem Griff, stellte sich neben Hircan und legte ihm mitfühlend die Hand auf die Schulter. »Gibt es sonst noch was, das wir wissen sollten?«
Meine Unruhe nahm überhand und schob mich instinktiv rückwärts Richtung Ausgang. Ich hatte nie Angst gehabt vor geschlossenen Räumen, doch hier schien eine unsichtbare Schwere mir alle Luft zum Atmen zu nehmen. Beim Rückwärtslaufen stieß ich gegen einen Stuhl und fiel polternd mit ihm zu Boden.
»Autsch«, entfuhr es mir, als wäre das Ganze nicht schon peinlich genug.





























