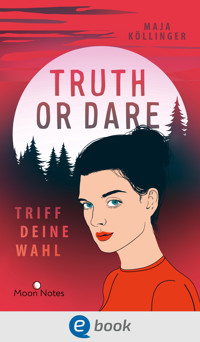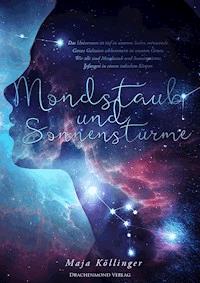
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Stell dir vor, du siehst in die Augen deines Gegenübers und erblickst sein Universum. Du erkennst Gedanken, die wie Planeten in seinem Kopf umherkreisen. Gefühle, die sich in Sternenbildern auf seinen dunklen Pupillen abzeichnen. Geheimnisse, die sich in der schimmernden Nebula am Rande seiner Augen sammeln. Stella ist eine Sternenseele. Sie verfügt über die Gabe, den Kosmos in unseren Köpfen zu ergründen. Denn wir alle bestehen aus Sternenglanz, Mondstaub und Sonnenstürmen. Wir alle tragen die kleinsten Teile des Universums in uns. Wir haben nur verlernt, hinzusehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mondstaub und Sonnenstürme
Maja Köllinger
Copyright © 2018 by
Lektorat: Pia Euteneuer
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Illustrationen: Maja Köllinger
Umschlagdesign: Marie Graßhoff
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-157-3
Alle Rechte vorbehalten
Für alle Sternschnuppenzähler,
Nachteulen und Mondmenschen.
Dieses Buch ist für euch.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Epilog
Danksagung
Bücher von Maja Köllinger
»Die Sterne lügen nicht.«
Friedrich von Schiller
Prolog
Wir tragen das Universum in uns. Es ist Teil von uns und
tief in unseren unwissenden Seelen verwurzelt.
Ganze Galaxien schlummern in unseren Genen.
Sterne strahlen im Licht unserer Augen.
Planeten kreisen in unseren Köpfen umher wie ziellose Gedanken.
Eigentlich müsste mir beim Anblick des Nachthimmels mulmig zumute werden. Ich sollte mich klein und unbedeutend fühlen.
Stattdessen versetzt mich das Aufblitzen der Sterne in Euphorie. Meine Haut kribbelt und meine Finger tasten nach dem Himmel. Die Sterne sind Abertausend Lichtjahre entfernt, doch das hält ihr Licht nicht davon ab, auf meiner Haut zu tanzen. Mondschimmer fließt über die Arme und taucht mich in silbrigen Schein. In diesen Momenten strahlen meine Augen sicherlich im Licht fremder Galaxien.
Ich fühle mich mit allem verbunden. Mit dem Sternenschimmer, dem Mondlicht und der samtenen Schwärze des Universums. Die unersetzlichen Gegebenheiten des Kosmos sind aus demselben Stoff, den gleichen Atomen und Teilchen gesponnen wie ich. Wie wir alle.
Jeder Mensch trägt einen Teil des Universums in sich, ohne es zu wissen. Der Kosmos in unseren Köpfen leitet uns. Manche nennen es Zufall oder Schicksal. Ich weiß, dass es viel mehr ist. Die Universumsfragmente in unseren Körpern sind Naturgewalten, Überbleibsel fremder Welten, die stärker an uns zerren als die Anziehungskraft der Erde. Materie zerfällt niemals. Sie setzt sich immer wieder, ebenso wie die Fragmente, neu zusammen.
In uns vereinen sich die Milchstraße, die Sterne, alle toten Sonnen und der Urknall. Wir sind der Kosmos.
Mit der Geburt des Universums sind auch wir entstanden. Mir gefällt der Gedanke, dass wir Menschen die Funken sind, die der große Knall bei der Entstehung unseres Universums gesprüht hat, und dass der Kosmos seitdem unsere Wege lenkt.
Schließlich wird sich niemand jemals seinem inneren Universum widersetzen. Vermutlich, weil niemand weiß, dass es existiert.
Niemand, außer mir …
Denn ich sehe das Miniaturuniversum in euren Augen strahlen und könnte innerhalb von Sekunden bis auf den Grund eurer Seele hinabschauen, um eure dunkelsten Geheimnisse zu ergründen.
Fremde Seelen werden auf meinen Befehl hin in ihre kleinsten Teilchen zerlegt. Meistens zeigt sich mir das Universum in einer Ahnung, dem Gefühl von gut und böse. Bezeichnet es ruhig als Bauchgefühl, doch an solche Dinge, die einem Zufall gleichkommen, glaube ich nicht, wie ihr wisst. Die Pläne des Universums sind zu durchdacht, um Zufälle zuzulassen.
Allerdings grenzt mein Wissen mich aus. Einmal auf den Seelengrund geschaut, bin ich kaum in der Lage, mich ihm zu entziehen. Neugierde wird durch Gewissheit ersetzt und Nähe kommt nicht zustande. Menschen sind kompliziert und verwirren mich. Ständig widersprechen sie sich, lügen oder verschleiern die Wahrheit. Dabei lese ich die Realität in ihrem Blick ab.
Deshalb bevorzuge ich die Sterne und den Nachthimmel gegenüber anderen Menschen. Sie sind ehrlich zu mir. Ihr Schein hat mich noch nie fehlgeleitet. Wenn ich zu ihnen spreche, dann spüre ich, dass sie zuhören. Sie leiten mich selbst durch die dunkelsten Stunden meines Lebens.
Seltsam, dass ich mich der Unendlichkeit des Weltalls verbundener fühle als Nachbarn oder meinen eigenen Eltern. Niemand versteht mich und im Gegenzug erwarte ich auch von niemandem Verständnis.
Das bedeutet nicht, dass ich mir nichts für meine Mitmenschen wünschen darf. Ich habe nur einen Wunsch. Jede Nacht flüstere ich ihn den Sternen zu, in der Hoffnung, dass mir eines Tages vielleicht einer von ihnen antwortet und ihn erfüllt.
Ich wünsche mir, dass die Menschen dem Universum lauschen werden, wenn es seine Stimme erhebt und meine Geschichte erzählt …
Kapitel Eins
Haltlos
Farblose Nebelschwaden krochen über den Asphaltboden, als ich von der Schule nach Hause ging. Sie verschleierten meine Sicht und ich musste darauf achten, wohin ich trat. Die Gurte des Rucksacks schnitten mir schmerzhaft in die Schultern, da das Gewicht der Lehrbücher ihn zu Boden drückte. Lautlos schlich ich voran. Die dichten Schlieren verschluckten jegliche Geräusche, sodass ich in meinem schwarzen Hoodie und der tief ins Gesicht gezogenen Kapuze nichts weiter als einen wandelnden Schatten darstellte.
Ich wich keinen Zentimeter vom Weg ab. Keine Ablenkungen, keine Abkürzungen, keine Umstimmung, keine Diskussion. Meine Eltern hatten mir diese Lektion mehr als einmal eingeflößt. Ich sollte mich von fremden Dingen fernhalten.
Das beinhaltete nicht nur den Heimweg, sondern auch den Einfluss unbekannter Menschen.
Ich schaute hoch, als mir ein Mann auf dem Bürgersteig entgegenkam. Für jeden anderen wäre er bloß ein weiterer Schatten, der durch den Nebel streifte. Für mich war er eine potenzielle Bedrohung. Mein Rücken versteifte sich bei seinem Anblick und ich zog die Kapuze noch ein Stückchen tiefer, damit unsere Augen in keinen Kontakt miteinander kamen.
Meine Eltern hatten mir oft genug eingebläut, dass ich mich von jedem, dessen Absichten ich nicht auf Anhieb durchschauen konnte, fernhalten sollte.
Jede Bekanntschaft, die sich zwischen mir und einem anderen Menschen anbahnte, wurde von meinen überfürsorglichen Eltern im Keim erstickt. Besonders während meiner frühen Schulzeit war das ein Problem gewesen. Ich wurde ausgeschlossen und gemieden. Falls sich trotzdem Gleichaltrige in meine Nähe wagten, bemerkten sie schnell, wie eigenartig ich war. Es kam mehr als einmal vor, dass ich in den Universen anderer Menschen versunken war. Intensiver Augenkontakt mit einem anderen Schüler reichte aus, dass ich in einen Strudel aus Sternenwirbeln hinabgesogen wurde. Wie ein Komet schoss ich über das fremde Firmament und beobachtete, wie sich die Welt meines Gegenübers zusammensetzte. Ich gewann schnell ein Gefühl dafür, wie sie tickten. Doch immer wenn ich einen kurzen Blick auf die neue Galaxie erhaschte, zog sich mein Gegenüber zurück.
Es dauerte nicht lange, bis mir der »Außenseiter«-Stempel förmlich auf die Stirn gedrückt wurde. Offenbar mochte es niemand, wenn das Gegenüber einen in Grund und Boden starrte. Natürlich wussten sie nichts von meiner Gabe; das Unbehagen, das ich durch mein Starren und Schweigen auslöste, reichte völlig aus. Die meisten Gleichaltrigen hielten sich schnell fern von mir. Niemand wollte sich länger als unbedingt nötig mit mir befassen. Tatsächlich machte mir das wenig aus. Ich war geradezu unbegabt im Umgang mit Menschen. Zwar entschlüsselte ich ihre inneren Universen, allerdings bescherte das einem nicht gerade viele Freundschaften. Doch das war mir egal. Immerhin hatte ich meine Sterne. Meine ständigen Begleiter.
Manchmal war meine Gabe wie eine Sucht. Zum Beispiel in Momenten wie diesen, in denen ich den unmittelbaren Drang verspürte, die Seele dieses fremden Menschen zu berühren, zu fühlen, zu sehen …
Der Mann rauschte an mir vorbei, seine Schritte echoten in meinem Kopf. Sein flüchtiger Blick strich über meine Gestalt hinweg und schien meine Gabe geradezu hervorkitzeln zu wollen. Ich blieb stark und starrte auf den Betonboden. Erst als er mehrere Meter hinter mir war, atmete ich durch.
Leise seufzte ich auf. Heimlich wünschte ich mir ein normales Leben, normale Eltern, normale Mitschüler. Wäre es so viel verlangt, nur einen einzigen Tag lang normal zu sein?
Das Wissen, niemals gewöhnlich, sondern immer anders zu sein, zerfetzte mein Herz und meinen Verstand. Es fühlte sich an, als würde man ein Blatt Papier in kleine Stücke zerreißen. In meinen Gedanken hallte das ratschende Geräusch endlos nach.
Vehement verdrängte ich dieses Bild an den Rand meines Bewusstseins. Ich wollte jetzt nicht darüber nachdenken.
Als ich an unserem Bungalow ankam, stand der Wagen meiner Eltern unverändert in der Auffahrt. Normalerweise müssten sie längst zum Labor aufgebrochen sein. Meine Eltern waren zwei Wissenschaftnerds, die zwischen Reagenzgläsern und Destillatoren ihre wahre Liebe gefunden hatten … wie romantisch.
Vermutlich hatten sie sich einen Tag freigenommen und mir nichts erzählt. Auf diese Art und Weise beruhigte ich mein Gewissen ein wenig. Eigentlich wusste ich, dass meine Eltern nur in Extremfällen Urlaub nahmen oder sich krankschreiben ließen. Gänsehaut überzog meine Haut, trotz des warmen Kapuzenpullovers.
Ich schüttelte die seltsame Empfindung ab. Währenddessen marschierte ich auf die Haustür zu, die zu meinem Erschrecken lediglich angelehnt war.
Wie konnte das sein? Heute Morgen hatte ich sicher abgeschlossen.
Ich beugte mich vor. Am Türrahmen war das Holz gesplittert und sofort schlug mir das Herz bis zum Hals. Das Schloss musste gewaltsam ausgehebelt worden sein. Ein gigantischer Kloß verschloss meine Kehle, weshalb ich nur gepresst atmen konnte.
War jemand bei uns eingebrochen?
Und viel wichtiger: War dieser Jemand noch im Haus?
So ein Quatsch! Mach dich nicht wahnsinnig. In einer verschlafenen Vorstadt wie dieser hier passiert nie etwas.
Ohne lange darüber nachzudenken, schob ich die Tür ein wenig weiter auf.
»Hey! Wer von euch hat schon wieder seinen Schlüssel vergessen?« Ich lachte über meinen eigenen Witz und versuchte so die Anspannung von meinen Schultern zu schütteln. Bestimmt würde meine Mutter gleich um die Ecke schießen und mich begrüßen. Dann konnte sie mir auch gleich die Sache mit der Tür erklären.
Das Geräusch meines Lachens verklang in der Stille des Hauses. Anscheinend war tatsächlich niemand da. Aber der Wagen stand doch in der Einfahrt.
Allein der Gedanke daran, dass jemand uns berauben würde, wirkte weiterhin so absurd, dass ich mich dazu entschloss, durch den entstandenen Spalt zwischen Tür und Rahmen ins Haus zu schlüpfen. Der Teppichboden, auf dem ich Spuren aus Pfützenwasser und zusammengeklumpten Dreck hinterließ, dämpfte meine Schritte. Meine Mutter würde mir den Hals umdrehen, wenn sie das sähe. Das war gerade meine geringste Sorge.
Die Stille des Hauses umfing mich wie eine erstickende Decke. Es wirkte geradezu ausgestorben. Das war ungewöhnlich.
Ganz ruhig bleiben, Stella.
Sieh dich erst einmal um und sobald du merkst, dass hier etwas schiefläuft, rennst du los und holst die Polizei.
Wieso kam ich mir wie ein Einbrecher vor, während ich durch den Eingangsbereich schlich?
Langsam ließ ich den Rucksack auf den Boden gleiten, da mich seine Last in meinen Bewegungen einschränkte. Zudem schlug ich mit bebenden Händen die Kapuze des Hoodies zurück, um besser zu hören, falls sich ein ungebetener Besucher näherte. Die ganze Situation wirkte so unrealistisch und fremd, dabei stand ich in meinem eigenen Zuhause. Was, wenn doch mehr hinter der offenen Tür steckte, als zunächst gedacht?
Ich benötigte eine Waffe, irgendetwas, um mich im Notfall verteidigen zu können! Lediglich das Schüreisen für unseren Kamin entdeckte ich. Das Feuer war längst erloschen und die Glut zu Asche zerfallen. Ein kalter Windzug streifte über meinen Rücken.
Ich ergriff den schweren Gegenstand und drückte ihn fest an meinen Oberkörper. Nun war ich nicht gänzlich unvorbereitet auf die Gefahren, die auf mich lauerten.
Als ich langsam auf die verschlossene Wohnzimmertür zuging, atmete ich tief ein und aus. Sie ragte wie ein böses Omen vor mir auf. Was würde mich dahinter erwarten? Ich presste mich an den Rahmen, zählte bis fünf und langte zur Klinke, die ich hastig hinunterdrückte.
Die Tür schwang auf und knallte gegen die dahinter liegende Wand. Mein Herz sprang mir beinahe aus der Brust. Das Pochen musste durch den gesamten Flur zu hören sein. Fast glitt mir das Schüreisen aus der schweißnassen Hand. Ich festigte meinen Griff und zwang mich zur Ruhe.
Atemlos zählte ich in meinem Kopf erneut einen Countdown hinunter, während ich abwartete, ob sich irgendwo im Haus etwas regte. Das plötzliche Geräusch würde jeden Einbrecher verschrecken oder zumindest aus seiner Deckung locken.
Als ich die Null erreichte und sich immer noch nichts geregt hatte, kam ich mir ein bisschen peinlich vor. Wie sollte ich das bloß meinen Eltern erklären, wenn sie jetzt nach Hause kommen würden?
Weitere zehn Sekunden verharrte ich in vollkommener Stille, dann spähte ich um die Ecke des Türrahmens, hinein ins Wohnzimmer.
Ich stolperte in den Raum hinein und ließ jegliche Deckung fallen. Das Schüreisen rutschte mir aus der Hand und fiel mit einem lauten Klirren zu Boden. Meine Beine schienen in Beton gegossen worden zu sein. Ich konnte sie keinen Zentimeter weiterbewegen. Meine Glieder begannen unangenehm zu kribbeln, als würden unzählige Ameisen über die Haut wandern. Obwohl mein Gehirn wie leer gefegt war, schlug der Anblick des Raumes wie ein Tsunami über mir ein. Mit einer steifen Bewegung meines Kopfes versuchte ich das gesamte Bild zu erfassen.
Die Couch sah aus, als wäre darauf eingestochen worden. Die weiche Füllung ergoss sich in einer Masse aus flauschigen Wolken über den Fußboden. Das groteske Bild einer ausgebluteten Couch schlich sich in meinen Kopf.
Oh, verdammte …!
Der Glastisch, der vor der Couch gestanden hatte, hatte sich in einen Haufen Scherben verwandelt. An einigen scharfen Kanten haftete rote Flüssigkeit. Auf dem Boden hatte sich bereits eine kleine Pfütze gebildet.
Mein Körper versteifte sich bei diesem Anblick. Die Zeit stand still. Ich wagte es nicht, meine Augen von der Szenerie abzuwenden.
Die Sekunden flossen träge dahin, während meine Gedanken rasten. Ich konnte mir nichts mehr vormachen. In diesem Haus war etwas Grauenhaftes passiert. Jemand war verletzt worden. Vielleicht meine Mutter oder mein Vater? Möglicherweise auch der Eindringling.
Ich blinzelte diese grauenhaften Gedanken hinfort und versuchte, das Bild vor mir irgendwie einzuordnen. Natürlich scheiterte ich kläglich.
Was ist hier vorgefallen?
Mein hektischer Blick tigerte umher und erfasste blutige Handabdrücke an der Wand des Wohnzimmers. Mit zittrigen Knien trat ich näher heran. Plötzlich zogen Bilder an meinem inneren Auge vorbei, die ich unmöglich ausblenden konnte. Matter Nebel umwirbelte die Szene. Alles wirkte blasser, farbloser als in der Realität.
Ich sah, wie mein Vater keuchend gegen genau diese Stelle stolperte und sich abstützte. Es wirkte so real …
Mein Arm schnellte nach vorn, doch er griff ins Leere. Der Gedankennebel hatte sich genauso schnell verzogen, wie er aufgetaucht war, und hinterließ nichts als ein Echo der Vergangenheit.
Ein Schrei bahnte sich in meiner Kehle an, steckte mir im Hals und verschloss meine Luftröhre. Ich ließ die Hand sinken und versuchte meine Atmung zu beruhigen, indem ich mehrmals tief ein- und ausatmete.
So etwas ist noch nie passiert.
Hat das etwas mit meiner Gabe zu tun?
Will mir das Universum etwas mitteilen?
Falls dem so war, so entschloss ich mich, nicht auf das Universum zu hören. Ich taumelte von einer Blutspur zur nächsten. Mit jedem weiteren Tropfen, den ich entdeckte, verstärkte sich der Druck auf meinem Brustkorb. Währenddessen fand ich weitere zerstückelte Teile unserer Möblierung. Selbst die Lampen waren zerschlagen worden und baumelten an offen gelegten Kabeln von der Decke.
Ich schlich an diesem Abbild fremden Hasses vorbei. In meinem Kopf war kein Platz mehr, um die Eindrücke zu verarbeiten. Meine Gedanken wurden ausgefüllt von dem Blut, das schmatzend unter meinen Fußsohlen klebte und jeden weiteren Schritt erschwerte.
Bitte. Bitte nicht!
Tränen rannen an meinen Wangen hinunter und gruben tiefe Furchen in meine Seele. Ich wischte sie eilig fort, da mein überfordertes Gehirn das Bild erzeugte, dass Blut über mein Gesicht lief und keine Tränen. Alles war so absurd und anormal. Meine Gedanken kamen nicht hinterher.
Ich weinte fast nie. Früher, in meiner Kindheit einige Male, aber diese Zeiten waren längst vorbei. Ich hatte gelernt, meine Gefühle zu verdrängen und eine Mauer zu errichten, die mich von allen abschottete. Meine Andersartigkeit hatte mich in der Hinsicht gestärkt. Wenn man Tag für Tag schief angeglotzt wurde und sich dumme Sprüche anhören musste, härtete das einen ab. Schon seit Jahren hatte ich keine Träne mehr vergossen.
Ein Mädchen, das nicht weint?
Ein Mädchen, das in die Seele anderer Menschen schaut, indem es ihr Universum, ihre innersten Bestandteile entschlüsselt?
Ich gebe zu, das klingt verrückt. Doch ich habe nie das Gegenteil behauptet.
Meine Eltern hatten mich immer geliebt, so wie ich war. Sie hatten meine Tränen getrocknet, als ich noch wegen der Gemeinheiten der anderen Kinder geweint hatte. Sie hatten mich vor der Welt zu beschützen versucht, und als sie gemerkt hatten, dass das nicht für immer gehen würde, hatten sie mich gewappnet. Durch ihre aufbauenden Worte und ihre Unterstützung hatte ich mir ein dickes Fell zugelegt. Und ich wusste, dass sie mich genauso verehrt hätten, wenn ich nicht über eine seltene Gabe verfügt hätte. Sobald meine seltsame Begabung aufgetaucht war, hatten sie dafür gesorgt, dass ich mir keine Sorgen um meine Andersartigkeit machen musste. Ich war kein Problem, sondern ein Geschenk. Und ich verdankte ihnen alles …
Allein der Gedanke daran, dass ihnen etwas Schlimmes zugestoßen sein könnte, drehte mir den Magen um.
Meine Hände ballten sich zu Fäusten, während die Tränen unaufhörlich flossen. Das interessierte mich nicht im Geringsten. Ich wollte sie nicht stoppen. Sie waren die Zeugen meiner Hilflosigkeit.
Wie Sand zerrann die Hoffnung zwischen meinen Fingern. Die Zuversicht, die beiden lebendig zu finden, schwand von Sekunde zu Sekunde mehr. Jeder Blutstropfen war ein weiterer Hinweis dafür, dass hier Leben verschüttet worden war.
Kopflos stolperte ich umher. Auf der Suche nach den einzigen Personen auf dieser Welt, die mir etwas bedeuteten. Schließlich rannte ich in die angrenzende Küche und blieb stocksteif im Türrahmen stehen.
Nein, nein, nein!
Auf den polierten Fliesen lagen sie, längs über den Boden gestreckt. Ihre Finger waren ineinander verschränkt, als wollten sie sich selbst im Moment des Todes nicht voneinander lossagen. Ihre trüben Augen begegneten sich in einem ewig andauernden Blick voll Trauer.
Meine ohnehin schon wackeligen Knie versagten nun vollends ihren Dienst, sodass ich neben meiner Mutter zusammensackte. Ich konnte mich nicht von ihrem Gesicht losreißen. Überall war Blut. Gänsehaut überfiel meinen ganzen Körper, als ich realisierte, dass ich mich nicht traute, meine eigene Mutter zu berühren. Ihre Haare waren verkrustet und die blasse Haut zierten dunkelrote Sprenkel. Ihre Bluse hing, vollgesogen vom Blut, in Fetzen von ihrem Leib. Ich musste schlucken.
Das Bild meiner Mom konnte ich nicht mit dieser Frau vereinbaren. Heute Morgen hatte sie mir noch einen Kuss auf die Stirn gedrückt, bevor sie mich, ein Lächeln auf den Lippen, zur Schule geschickt hatte. Nun waren dieselben Lippen zu einem Todesschrei verzerrt.
Zögernd streckte ich die Hand aus und strich ihr über das weiche Haar. Meine Knie ragten in die Blutlache hinein. Kalt. Nass. Ich erschauerte, doch ich schreckte nicht zurück. Es zählte nur, meiner Mutter nahe zu sein.
Obwohl ich wusste, dass sie mich nicht mehr hören würde, flüchtete ein erstickter Laut aus meinem Mund und die ungesagten Worte hingen wie eine Gewitterwolke über mir. Meine Tränen waren der Regen, der auf die Wangen meiner Mutter prasselte. Sie zersprangen auf ihrer Haut in winzige Rinnsale.
Verzweifelt starrte ich in ihre Augen, die sonst so lebendig gewirkt und in einem hellen Blau gestrahlt hatten. Immer wenn ich sie ansah, machte ich hinter der Regenbogenhaut das Glitzern weit entfernter Sterne und Kometen aus. Ich allein bildete die Sonne ihrer Galaxie. Ihre Planeten, ihre Monde und ihre Asteroidengürtel hielten ihre Umlaufbahn zuverlässig ein und umkreisten mich. Kontinuierlich. Immerwährend. Ihr inneres Licht hatte mich stets gewärmt. Nun war es erloschen.
Ihr trüber Blick verwandelte sich in ein Schwarzes Loch. Jegliche Wärme, Liebe, jedes noch so kleine Anzeichen von Licht wurde absorbiert und verschwand für immer. Nichts war mir von ihr geblieben. Ihr Mörder hatte das Fundament ihres Universums zerstört, sodass jeder Funke Hoffnung erbarmungslos von der Finsternis erstickt wurde.
Eine eiserne Faust umschloss mein Herz und drückte zu. Es krampfte sich zusammen, schüttelte meinen Körper, während ich nicht in der Lage war, mich von meiner Mutter abzuwenden. Einen Wimpernschlag lang dachte ich, dass ich noch an Ort und Stelle sterben würde. So unerträglich war der Gedanke an eine Welt ohne Mom und Dad.
Mein tränenverschleierter Blick folgte den Krümmungen und Windungen des Körpers meiner Mutter. Bei jeder der dreizehn Stichwunden spürte ich ein Brennen in meiner Brust, als wäre ich selbst niedergestreckt worden. Ich prägte mir alles genau ein und brannte die Erinnerung in mein Gedächtnis. Als Warnung.
Schließlich betrachtete ich die ineinander verschränkten Hände meiner Eltern. Weitere Schluchzer erschütterten mich, sobald sich meine Aufmerksamkeit auf Dad richtete. Er lag so still und stumm dort.
Mein Dad hatte stets ein Lächeln auf den Lippen getragen und ein offenes Ohr für all meine Geheimnisse und Blödeleien gehabt. Und er hatte mich nie, niemals für das verurteilt, was ich war. Für ihn blieb ich immer seine geliebte Tochter. Stella.
Er hatte mir geholfen, meine Gabe zu verstehen. Indem er mir von den Sternen und den Universen erzählt hatte, hatte ich begonnen zu verstehen. Ich wusste plötzlich, was ich in den Köpfen der Menschen suchte. Dad wusste vermutlich selbst nicht einmal, wie gravierend er mich mit seiner Sternenkunde beeinflusst hatte, doch ich würde es niemals vergessen. Mein Vater hatte mir die Welt erklärt, obwohl er sie nie so wie ich gesehen hatte.
Trotzdem war er immer an meiner Seite gewesen, um mich zu trösten, wenn mir alles über den Kopf wuchs und meine Gedanken in den Wolken festhingen.
Das Universum hinter seinen Augen hatte in jedem erdenklichen Rotton gestrahlt. Seine Sonne hatte ebenso hell geglüht wie die meiner Mutter. Doch seine Abgründe waren tiefer gewesen als die ihren.
Wo besonders viel Licht herrscht, werden auch die Schatten immer länger.
Er hatte einiges durchgemacht. Bis heute wusste ich nicht, was genau. Gedanken las ich schließlich nicht. Meistens offenbarte sich mir ein Universum in einer Ahnung. Ich war dazu fähig, einzuschätzen, was für ein Mensch mein Gegenüber war, mehr nicht. Ich sah, dass jemanden böse Absichten antrieben, jedoch nicht, welche Ereignisse ihn dazu gebracht hatten.
Hatte ein Mensch die Kontrolle über seine Gedanken und Gefühle, war es für mich unsagbar schwer, ihn zu durchschauen. Erwachsene bauten im Laufe ihres Lebens Schutzmauern auf, die anscheinend selbst die eigene Tochter nie in der Lage war, zu durchdringen.
Kinder oder Jugendliche besaßen keine Schutzmechanismen. Stattdessen spazierten sie blind und naiv durch die Welt und trugen ihre seelischen Narben auf der Haut. Für jeden sichtbar, besonders für mich.
Glücklicherweise waren die meisten in meinem Alter relativ reif. Selbst mit siebzehn Jahren hatte die Welt einen bereits gelehrt, nicht jedem zu vertrauen, sodass die Narben verschleiert wurden:
Verdrängung, Vergessen, Überlagerung.
Die Menschen waren herzlose Wesen.
Das hatte die Welt mir an dem heutigen Tag beigebracht und ich würde die Folgen dieser Lektion von nun an immer in meinem Geist tragen.
Sobald mein Blick wieder das leblose Gesicht meines Vaters fokussierte, erstarrten meine zuvor rasenden Gedanken. Keine meiner Erinnerungen spielte eine Rolle, da meine Eltern nie wieder bei mir sein würden.
Wieso habe ich es nicht gesehen?
Warum hat mir das Universum kein Zeichen gesendet?
Ich hatte nicht erwartet, dass der Tod an uns vorbeizog wie ein ungebetener Besucher. Allerdings hatte ich immer geglaubt, es zu spüren, wenn meinen Eltern oder mir tatsächlich eines Tages etwas passieren sollte. Doch das Universum hatte geschwiegen.
Ich fühlte mich wie eine Versagerin. Ich hatte alles verloren. In meiner Brust brannte der Verrat, denn mehr als jeder andere wusste ich, dass der Kosmos unseren Weg vorherbestimmt hatte. Obwohl ich immer auf seine Worte lauschte, hatte er mich nicht gewarnt. Vielleicht war der Fremde auf der Straße der Mörder meiner Eltern gewesen. Mit einem Blick in seine Augen hätte ich es herausfinden können.
Das Schicksal war unergründlich. Der Weg des Lebens war nicht immer richtig oder gar leicht. Warum sollte es für mich eine Ausnahme machen?
Hätte ich das Schicksal aufhalten können?
Wäre ich dazu fähig gewesen, den Plan des Universums zu vereiteln?
Nein, unsere Lebenspfade sind verworren, ineinander verschlungen, sie überkreuzen sich und verlangen von einem, wieder rückwärts zu laufen. Und manchmal steht man in einer Sackgasse und weiß sich nicht mehr zu helfen.
Ich verharrte eine Ewigkeit im Schweigen, bevor ich überhaupt bemerkte, dass meine Lippen sich gespalten hatten und ein sterbender Laut aus meinem Mund drang. Mein eigener Schrei, so schrill und kreischend wie splitterndes Glas, zerfetzte die Realität und riss mein Universum endgültig aus den Fugen.
Kapitel Zwei
Mondlichttränen
Der Schrei riss mich in ein Loch, aus dem ich eigenhändig nicht entkam. Für mich existierte nur noch das Zimmer, in dem meine toten Eltern und ich mich befanden. Die Welt außerhalb der vier Wände war mir gleichgültig. Nichts hätte mir in diesem Moment weniger bedeuten können.
Ich wollte ihnen nahe sein. Ihre Wärme und Nähe auf meiner Haut spüren und das Bild ihrer leblosen Leiber aus meinem Gedächtnis verbannen.
Mein Körper wurde immer schwerer, als würde ihn die Last des Funds zugrunde reißen. Ich ließ mich fallen und schlug neben meiner Mutter auf dem Boden auf, sah ihr direkt in die trüben Augen. Ihr Blut klebte an meinen Haaren, auf meinen Armen und meiner Kleidung. Es ätzte sich in meine Haut und meine Erinnerungen hinein.
Der Aufprall drang kaum zu meinem Bewusstsein durch. Ich spürte keinen Schmerz, nur diese alles verzehrende Leere, die von innen an mir nagte, als ich meine blutbesudelten Finger anstarrte.
»Es tut mir so leid, so leid«, schluchzte ich immer und immer wieder. Meine Mutter blinzelte nicht. Ihre Augen fokussierten einen Punkt in weiter Ferne. Eine andere Welt.
Sie ist tot, Stella.
Begreif es endlich!
Ein Beben durchzuckte mein Rückgrat bei diesem Gedanken und ließ jedes meiner Glieder vor Furcht erzittern. Meine Hände ballten sich zu Fäusten und umschlangen meinen Bauch, bevor ich mich zu einer Kugel zusammenrollte und meine Lider schloss. Eine Welt ohne meine Mutter und meinen Vater wollte ich nicht sehen. Das Universum wurde in tintenschwarze Stille getaucht.
Zwei Monate später
Wie schnell die Zeit vorbeizieht, wenn man in einem Trauma gefangen ist. Während man selbst das Gefühl hat, nicht eine Sekunde wäre vergangen, rasen die Tage und Wochen nur so dahin.
Ich hatte keinen Fuß mehr in mein Haus gesetzt, mich vor der Außenwelt verbarrikadiert und wurde mit meinen Gedanken und Emotionen vollkommen allein gelassen. Wer hätte mir beistehen sollen? Ich hatte niemanden.
Stattdessen war ich gefangen – in meinem eigenen Körper, meinem eigenen Kopf.
Nach dem Einbruch und meiner Entdeckung wurde ich kurzzeitig im Krankenhaus versorgt, wo geprüft wurde, ob ich in irgendeiner Art und Weise verletzt worden war. Offenbar hatte mich ein Nachbar gefunden. Es spielte keine Rolle für mich.
Die Ärzte behielten mich eine Woche lang unter Aufsicht, bis sie mich aufgrund der Diagnose »Traumapatientin« in eine Nervenheilanstalt verlegten.
Nach meinem Schreien folgte das Schweigen. Ich sprach kein Wort. Zu niemandem. Selbst im Krankenhaus nicht. Auch als die Polizeibeamten mich mit Fragen löcherten, schwieg ich. Es war nicht so, dass ich nichts sagen wollte. Ich konnte es nicht.
Meine Lippen verweilten die meiste Zeit lang fest zusammengepresst, als hätte jemand meinen Mund zugenäht. Eine unbeschreibliche Angst schnürte mir die Kehle zu. Die Furcht, wieder zu schreien. Die Panik, mich an die vergessenen Minuten oder Stunden zu erinnern, die ich bei den Leichen meiner Eltern verbracht hatte, sorgte dafür, dass ich mit den Zähnen knirschte. Manchmal schmeckte ich Krümel in meinem Mund. Abgebrochene Zahnstückchen.
Ich vermied jeglichen Augenkontakt mit den Polizeibeamten und Ärzten, da ich auf keinen Fall die Galaxien hinter ihren Pupillen entdecken wollte.
Keine Sterne, keine Sonne, keine Planeten mehr …
Die toten Blicke meiner Eltern hatten meine Seele gebrandmarkt. Es wäre ein Verrat gewesen, wenn ich weiterhin das Antlitz der Universen bei fremden Menschen zu ergründen versuchte.
Und so wurde ich weggebracht. In ein Gebäude bestehend aus weißen Wänden, weißen Böden und weißen Kitteln. Ich lag in meinem weißen Bett und starrte stundenlang an die weiße Decke. Die helle Farbe an den Wänden löste in mir einen Brechreiz aus. Saure Galle wanderte meinen Rachen hinauf, jedoch drängte ich sie zurück. Mein Mund blieb geschlossen. Selbst in diesen Momenten der Schwäche.
Immer wenn ich eine weiße Fläche sah, erzeugte mein geschädigter Verstand das Bild von tiefroten Blutspritzern, die mich unweigerlich an jenen Tag erinnerten. An das Ereignis, das verantwortlich war, dass ich mich hier befand. Unweigerlich musste ich auch an den Menschen denken, der mir das alles angetan hatte. Hass glühte in meinem Inneren wie ein stetig schwelendes Feuer, als ich an den gesichtslosen Täter dachte. Ich hatte keinen Namen, keinen Anhaltspunkt. Doch ich schwor mir, dass ich denjenigen, der meine Familie zerstört hatte, auffinden und für seine Taten büßen lassen würde. Rachegelüste strömten durch meinen Kopf und betäubten jedes andere Gefühl für einen kurzen Moment.
Nachts fand ich deswegen keine Ruhe und erst recht keinen Schlaf. Mein Kiefer malmte, mein Magen knurrte und meine Gedanken schrien durcheinander, bis sie sich mit der Geräuschkulisse der Klinik vermischten. Falls mich der Schlaf trotz allem für ein paar Stunden heimsuchte und Albträume an meine geschlossenen Lider projizierte, so wachte ich jedes Mal mit tränennassen Wangen auf. Ich sah ihre Gesichter, während ich träumte, und hörte ihre Stimmen. Sie sagten, sie liebten mich. Das Schlimmste an meinen Träumen war das Erwachen. Sobald ich die Augen öffnete, empfing mich Leere. Einsamkeit. Die Illusion, dass meine Eltern bei mir waren, verpuffte. Das war schlimmer als jeder erdenkliche Albtraum.
Nach den Polizisten folgte der Psychiater, der ebenfalls mit mir reden wollte. Mein Schweigen wies ihn jede Sitzung aufs Neue ab. Er hoffte, dass ich mich ihm öffnete, dass ich meine Geheimnisse preisgab, um die Suche nach dem Mörder meiner Eltern zu erleichtern. Vor allen Dingen sollte er natürlich mir helfen. Der armen, traumatisierten Stella.
So ein Heuchler!
Als ob er meine Lage verstehen oder wissen kann, wie es mir geht. Das tut er nicht. Niemand tut das.
Ich schaute ihm nicht ein einziges Mal in die Augen. Der Seelenklempner bemerkte meinen Widerstand und war tatsächlich hartnäckiger, als ich dachte. Offensichtlich war ich nicht der erste und letzte Härtefall dieser Klinik. Man war auf so eine Situation vorbereitet. Auf eine zerbrochene Seele.
Anstatt mich in dem See aus Einsamkeit ertrinken zu lassen, arrangierte der Mann doppelte Sprechzeiten und zeigte auffällig viel Interesse an einer traumatisierten Jugendlichen, dafür dass ich nur stumm und steif vor ihm saß.
Es dauerte fast drei Wochen, bis ich in seiner Gegenwart auftaute. Es fing an, dass ich ihn für wenige Sekunden in Augenschein nahm. Sein darauffolgendes Lächeln entging mir nicht. Nach fünf weiteren Sitzungen hielt ich den Blickkontakt und wagte es schließlich sogar, sein Universum zu ergründen, wenn auch nur für einen flüchtigen Moment.
In der Mitte seiner Pupille glühte eine Sonne, die drei Planeten umkreisten. Ein größerer und zwei kleine. Sie besaßen eine feste Umlaufbahn. Routiniert. Planbar. Der Mann vor mir war die Verkörperung von Stabilität. Ich runzelte die Stirn über diesen Gedanken. Er war geschaffen für den Job als Psychiater und hatte mir schon jetzt bewiesen, dass er Durchhaltevermögen und Verständnis hatte.
Jeden Tag fühlte ich mich ein bisschen besser. Nein, nicht besser, sondern … menschlicher. Ich gewöhnte mir eine Routine an, die ich jeden Tag ohne Ausnahme befolgte. Nach einer Weile kümmerte ich mich wieder um meinen Körper. Ich wusch mich und versuchte mehr zu essen als nur eine trockene Scheibe Brot am Tag. Ich füllte die Hülle, die nach dem Mord meiner Eltern von der alten Stella zurückgeblieben war, langsam mit Leben. Bloßes Existieren war nicht mehr genug, denn ich wollte leben.
So entschloss ich mich dazu, endlich zu reden. Meine Stimme war rau und kratzig nach dem monatelangen Schweigen. Es fühlte sich ungewohnt an, die Lippen zu bewegen. Die Gesichtsmuskulatur schmerzte beinahe. »Ich möchte nicht mehr so sein. Bitte helfen Sie mir.«
Ich senkte den Kopf. Mir einzugestehen, dass ich mich in einer Sackgasse befand und ohne Hilfe nicht mehr zurechtfand, war schwerer als gedacht. Trotzdem tat es gut. Ich hatte mir die Wahrheit eingestanden und war bereit, an mir zu arbeiten. Es war ein kleiner Schritt und der erste in eine neue Richtung. Ich verspürte ein sanftes Kribbeln am ganzen Körper. Das hier war ein Erfolg. Ich konnte das schaffen. Ich wollte keine weißen Wände mehr sehen.
Und so begannen der Psychiater, Doktor Brown, und ich Schritt für Schritt mit meiner Rehabilitation.
»Wir starten heute mit Phase eins der Traumabewältigung. Der Stabilisierungsphase«, erklärte er, nachdem ich mich ihm gegenüber niedergelassen hatte.
»Was bedeutet das?«, fragte ich nach.
»Wir werden dir die Angst nehmen.«
»Ich habe keine Angst«, behauptete ich, obwohl das natürlich völliger Quatsch war.
Doktor Brown zog lediglich seine Augenbraue in die Höhe, als hätte er mich längst durchschaut. Statt eine Anmerkung zu machen, deutete er auf das blaue Sofa, dem einzigen Farbklecks in seinem sterilen Behandlungszimmer. Ich setzte mich und beobachtete den Arzt, der sich auf einem Stuhl vor mir platzierte.
»Hast du oft Albträume, Stella?«, fragte er.
Jede Nacht.
Keine Antwort verließ meinen Mund und Doktor Brown nickte wissend. Ich wurde unruhig und begann, meine Finger miteinander zu verknoten.
»Würdest du mir von ihnen erzählen?« Seine Stimme war sanft und drängte nicht. Er würde warten, bis ich bereit war zu reden. Das wusste ich.
Ich atmete tief durch und schloss die Augen. Die Traumbilder verfolgten mich jederzeit, sodass ich sie selbst jetzt rekonstruieren konnte.
»Ich träume von ihnen. Meinen Eltern. Ich höre ihre Stimmen aus weiter Ferne und sehe ihre Gesichter an mir vorbeiziehen. Doch ich kann sie nicht festhalten. Jedes Mal verliere ich sie und jedes Mal fühlt es sich an wie an jenem Tag. Als würde man mir das Herz aus der Brust schneiden.« Ich holte zitternd Luft. »Es tut so unfassbar weh. Und es hört nie auf. Es passiert immer und immer wieder. Ich kann es nicht stoppen, die Stimmen, ihre Blicke, ihre Schreie.« Ich verlor mich in der Schwärze meiner Albträume, während ich verzweifelt versuchte, sie in Worte zu fassen.
Plötzlich spürte ich eine fremde Berührung an meinem Arm. Sanft. Bestimmend. Ich hielt inne und vernahm eine Stimme, die beruhigend auf mich einredete. Doktor Brown. »Öffne die Augen, Stella. Die Träume haben keine Macht über dich. Du kannst ihnen entkommen. Sie sind nicht echt.«
Er hat recht.
Das hier ist nicht die Wirklichkeit.
Das Gedankenkarussell in meinem Kopf verlangsamte sich. Schließlich wurde es so lahm, dass ich aussteigen und meine Lider heben konnte.
»Was ist passiert?« Meine Frage verlor sich in einem Schluchzen. Hilflosigkeit ummantelte meine Gedanken, sodass ich keinen klaren Entschluss fassen konnte.
»Das war eine Flut an Traumabildern. Sie haben dich in einen Angstzustand versetzt, der beinahe an eine Panikattacke herangereicht hat.«
»Es hat sich angefühlt, als wäre ich von einem Sog erfasst worden. Ein Strudel, der mich immer weiter in die Tiefe spülte.«
Doktor Brown nickte verständnisvoll und reichte mir ein Glas Wasser, das ich mit zitternden Händen ergriff. Ich klammerte mich daran, als wäre es mein einziger Halt in dieser Welt. Trinken tat ich nichts.
»Ich werde dir beibringen, wie du den Albträumen entkommst, auch wenn sie dich im wachen Zustand heimsuchen. Du bist ihnen nicht schutzlos ausgeliefert, Stella. Wir schaffen das zusammen.« Die Sonne in seinen Augen strahlte voller Zuversicht. Ich glaubte ihm.
Über Wochen hinweg brachte mir Doktor Brown Techniken bei, wie ich meine Gedanken fokussieren und bündeln konnte, um sie von den »Problemzonen« meines Geistes wegzulenken. Mit verschiedenen Entspannungsübungen zeigte er mir, wie ich eine Panikattacke unter Kontrolle brachte.
Jede Sitzung sprachen wir über die Albträume und die Angstzustände, die mich heimsuchten. Dank der Techniken bewahrte ich nun die Ruhe und schaffte es, die Realität von meiner verkorksten Traumwelt zu unterscheiden.
Zwischendurch führten wir Gespräche über oberflächliche Themen, damit ich meine Komfortzone verließ. Von Mal zu Mal fiel mir das Reden leichter, bis ich Doktor Brown von selbst grüßte, sobald ich das Zimmer betrat. Um meine Therapie zu unterstützen, wurden mir Tabletten verschrieben, die mich in Sekundenschnelle in einen komatösen Schlaf versetzten. Sie halfen. Nach einiger Zeit träumte ich nicht mehr von meinen Eltern.
Doktor Brown verzeichnete die Erfolge mit großem Enthusiasmus, sodass er bald die erste Phase für abgeschlossen erklärte. Ich war seiner Meinung nach stabil genug, um mit der Aufarbeitung meines Traumas zu beginnen. Im Klartext bedeutete das die Konfrontation mit dem Ereignis und seinen Folgen.
Verunsicherung trieb mir den Schweiß auf die Stirn, als ich mich zu meiner ersten Sitzung der zweiten Phase bei meinem Arzt einfand. Ich wusste nicht, was mich erwartete, und diese neue Art des Kontrollverlustes gefiel mir nicht. Mit einer Atemübung vertrieb ich mir die Wartezeit und versuchte, meine innere Ruhe zurückzuerlangen.
Doktor Brown will dir helfen.
Er wird dir nicht schaden.
Obwohl ich mich nach wenigen Minuten beruhigt hatte, schoss mein Puls in die Höhe, als die Tür sich öffnete und mein Psychiater eintrat.
»Bereit für Phase zwei?«
Ehrlich gesagt nicht.
Ich nickte, trotz meiner Bedenken.
Doktor Brown nahm seinen gewohnten Platz mir gegenüber ein und öffnete den Aktenkoffer, den er stets an seiner Seite führte. Papier raschelte, als er durch die Tasche wühlte. Schließlich brachte er eine Akte ans Tageslicht, auf deren Vorderseite mein Name geschrieben stand.
»In diesem Ordner befinden sich Bilder, Stella. Familienporträts, die die Polizei in eurem Haus gefunden hat, ebenso wie Tatortfotos. Sie sind in einer bestimmten Reihenfolge sortiert und ich möchte, dass du sie dir einfach nur ansiehst. Nichts weiter.«
Ich hielt inne.
Tatortfotos?
»Aber es werden keine Bilder von …« Ich wagte es nicht einmal, den Satz zu beenden.
»Deine Eltern sind nur auf den Familienfotos zu sehen, keine Sorge.« Er reichte mir die Akte hinüber.
Einen quälend langen Augenblick ließ ich den Arzt mit dem ausgestreckten Arm ausharren. Ich fixierte die Mappe und spürte, wie sich mein Magen zusammenzog.
Was wird mich erwarten?
Welche Bilder werden sich darin befinden?
Werden sie mir mehr schaden als helfen?
Es gab nur einen Weg, um das herauszufinden. Meine Finger schlossen sich um die beigefarbene Pappe, als ich die Akte an mich nahm. Vorsichtig legte ich sie auf meinen Schoß. Zögernd schwebte meine Hand über dem Ordner.
Soll ich das wirklich durchziehen?
Doktor Brown nickte mir zu. Solange er bei mir blieb, war alles in Ordnung. Hier war ich sicher. Er würde auf mich aufpassen. Ich zwang mich, die Luft, die ich in meinem Brustkorb gefangen gehalten hatte, auszustoßen. Dann öffnete ich die Akte.
Das erste Bild zeigte unser Haus von draußen. Der Bungalow mit dem niedrigen Dach war umgeben von gigantischen Tannen, die sich wie zum Schutz um ihn herum angeordnet hatten. Ein schmerzhaftes Ziehen zuckte wie ein Blitz durch meinen Körper. Meine Füße begannen zu wippen.
Das ist mein Zuhause.
Nein!
Das war es einmal.
Einerseits wollte ich zu dem Ort auf dem Foto zurückkehren, andererseits ergriff mich eine solche Unruhe bei dessen Anblick, dass ich mir möglichst viel Distanz zu dem Haus wünschte.
Ich versuchte, meine Gefühle für Doktor Brown in Worte zu fassen, woraufhin er sich eifrig Notizen machte und einige verständnisvolle Worte an mich richtete. Schnell legte ich das Bild zur Seite, nur um mit dem nächsten Foto konfrontiert zu werden. Es war eine Collage von unserem Wohnzimmer. Auf der linken Seite befand es sich im normalen Zustand, während die rechte Seite den Tatort von vor einigen Monaten abbildete.
Verzweifelt versuchte ich meinen Blick von den Blutspuren am Boden und den Wänden loszueisen, allerdings versagte ich kläglich. So lange hatten mich diese Bilder in meinen Träumen heimgesucht. Ich konnte sie nie vollständig aus meinem Gedächtnis verbannen und nun, da ich sie wieder vor mir sah, erkannte ich, dass man vor der Realität nicht davonlaufen konnte. Sie holte einen immer wieder ein. Zielstrebig und erbarmungslos.
Ich strich mit dem Zeigefinger über das fotografierte Blut und erkannte den Handabdruck. Für einen Wimpernschlag befand ich mich in der Vergangenheit und spürte, wie der schwarze Nebel mich umwogte. Verzweiflung strömte durch meine Adern, vertrieb jeglichen Gedanken an die Entspannungstechniken, die Doktor Brown mir beigebracht hatte. Ich war wieder dort. Konnte das Blut sehen und riechen. Der kupferne Geruch verbiss sich in meiner Nase. Ich wollte schreien, doch die Vergangenheit hielt mich in ihrer eisernen Faust.
Erst als ich mehrmals blinzelte, verblasste das Bild der blutverschmierten Wand und das Behandlungszimmer meines Arztes kehrte zurück. Ein Schauder jagte meinen Rücken hinab, als ich die Collage zur Seite legte und Doktor Brown eine vage Antwort über mein Empfinden gab.
Als ich meine Augen wieder auf die Akte richtete, war nur noch ein einziges Bild zu sehen. Ein Familienfoto. Es war das schlimmste von allen.
Ich konnte den heiseren Laut, der meiner Kehle entwich, unmöglich unterdrücken. Lächelnd schauten meine Eltern in die Kamera. Sie hatten ihre Arme um mich gelegt. Das Bild war vor weniger als einem Jahr entstanden, als mein Vater seine neue Kamera austesten wollte.
Das Echo ihres Lachens klingelte in meinen Ohren und plötzlich meinte ich, die Wärme ihrer Umarmung an meinen Oberarmen zu spüren. Ich strich mir über die Stelle, an der die Hand meiner Mom geruht hatte. Sie wirkten so glücklich und lebendig. Tränen brannten in meinen Augenwinkeln und tropften auf das Sofa. Meine Hände verkrampften sich um das Foto, sodass es an den Kanten verknitterte.
Ich wagte es nicht, meinen Blick von den vor Leben sprühenden Augen meiner Mutter und meines Vaters zu wenden. In meiner Erinnerung waren sie trüb und blass, doch auf diesem Bild strahlten sie so stark, dass ich das Universum hinter ihrer Regenbogenhaut erahnen konnte. Ich musste nur genauer hinsehen.
»Stella?« Doktor Browns Stimme riss mich aus den Gedanken, sodass ich unweigerlich von dem Foto aufsah. »Ich möchte, dass du dieses Bild behältst. Du sollst dich an deine Eltern so erinnern, wie sie wirklich waren. Nicht auf die Art und Weise, wie du sie damals gefunden hast.«
Ich schluckte den Kloß in meinem Hals hinunter, um dem Arzt zu danken. Als ich jedoch den Mund öffnete, kam kein Laut heraus. Stattdessen liefen mir immer noch unaufhörlich Tränen über die Wangen. Sie sickerten in meine Haut, bis hinab auf den Grund meiner Seele. Sie füllten und versiegelten die Risse, die in den vergangenen Monaten entstanden waren, bis mich statt Trauer und Angst nur noch Dankbarkeit erfüllte.
Doktor Brown setzte sich neben mich auf die Couch und wartete geduldig, bis ich mich beruhigte. Als die letzte Träne geweint worden war, lächelte er mich an.
»Ich denke, du wirst schon sehr bald bereit für die dritte Phase sein. Integration. Die Akzeptanz der Vergangenheit und der Aufbau einer neuen Zukunft.« Die Sterne in seinen Augen funkelten heller als jemals zuvor. Hoffnung. Er glaubte daran, dass ich das schaffen würde. Ich strich ein letztes Mal über die Gesichter meiner Eltern. Für sie wollte ich das erreichen. Ein neues Leben beginnen.
In dieser Nacht träumte ich nach langer Zeit von meinen Eltern. Sie suchten mich nicht heim, sondern spendeten mir Wärme und Zuspruch.
»Wir sind so stolz auf dich, kleine Sternenseele«, flüsterte meine Mutter mir zu, woraufhin ich die Augen aufschlug und hellwach im Bett lag. Das Mondlicht fiel durch mein Fenster und tauchte die Tränen, die mir über das Gesicht flossen, in einen silbrigen Schein. Ich lächelte.
Mondlichttränen.
Mom hätte diese Vorstellung gefallen.
Kurz nach der zweiten Phase und einigen Besprechungen bezüglich meiner Zukunft wagte ich es zum ersten Mal, gemeinsam mit Doktor Brown durch die Parkanlage der Klinik zu wandern. Trotz des bitterkalten Winters tat die frische Luft unheimlich gut. Sie klärte die Gedanken und reinigte meinen Kopf von schädlichen Erinnerungen. Für den Moment war ich den weißen Wänden entkommen. Die letzten Wochen lang hatten sie mich beschützt und mir einen Rahmen gespendet. Allerdings kam es mir, je besser es mir ging, mehr vor wie ein Gefängnis. Sosehr ich die Zeit mit meinem Arzt auch nutzte, die Wände meines Zimmers machten mir immerzu deutlich, dass ich eines war: krank.
Meine oberste Priorität galt deswegen dem Verlassen der Klinik. Ich wollte endlich das echte Leben außerhalb dieser Mauern erleben. Umso mehr genoss ich den kurzen Ausflug in die Natur. In mir lauerte allerdings noch eine viel stärkere Empfindung. Ich hatte den Mörder meiner Eltern nicht vergessen und meine Heilung würde seine Taten nicht ungeschehen machen. Stattdessen wäre ich stärker als jemals zuvor. Ich hatte nichts zu verlieren und ich brannte geradezu darauf, die Psychiatrie hinter mir zu lassen und ihn ausfindig zu machen. Doch dazu musste ich erst einmal hier rauskommen.
Im Park, dessen Büsche, Bäume und Gräser von schimmerndem Raureif überdeckt waren, glaubte ich, das Leben außerhalb der Klinik meistern zu können.
Eine Welle neuer Leichtigkeit umwogte mich und hüllte mich in wärmende Zuversicht, trotz der klirrenden Kälte des Winters. Ich legte meinen Kopf in den Nacken und streckte die Zunge raus, um eine Schneeflocke aufzufangen. Sobald der Kristall auf meine Zunge traf und zerschmolz, musste ich lachen. Zum ersten Mal seit so langer Zeit.
Natürlich entging mir der glückliche Seitenblick meines Psychiaters nicht, der schließlich meinte: »Und damit hast du Phase drei bewältigt.«
Es dauerte noch ungefähr eine Woche, bis Doktor Brown alles geklärt hatte und die Entlassungspapiere bereitlagen. Am Tag meiner Abreise war ich dermaßen zappelig, dass ich kaum in der Lage war, den Reißverschluss des Koffers zu schließen.
Ich schmeckte die neu gewonnene Freiheit auf meiner Zunge. Einerseits süß wie Zucker und andererseits so bitter wie Lakritz.
Diesem Tag hatte ich so lange entgegengefiebert und nun war er endlich gekommen. Begreifen konnte ich es immer noch nicht.
Um zu überprüfen, ob das hier die Realität war, zwickte ich mich in den Arm. Ich träumte nicht, sondern durfte tatsächlich gehen!
Als ich mich zur Tür umdrehen wollte, stand dort bereits Doktor Brown und beobachtete mich amüsiert.
»Nun ist es also endlich so weit, hm?«
Ich nickte schnell und zwang mich dazu, meinen Koffer für einen Moment ruhen zu lassen.
»Ich wollte mich noch bei Ihnen bedanken«, fing ich an. »Ohne Ihre Hilfe wäre ich niemals in der Lage gewesen, das alles zu bewältigen.«
Er lächelte sanft. Ein letztes Mal ließ ich mich von dem Schein seiner inneren Sonne wärmen. Von seiner Zuversicht und der Hoffnung, die ihn wie zwei Monde stets umkreiste.
»Du bist hier immer willkommen, Stella. Falls du mal Probleme haben solltest. Wir, unser Klinikteam, sind immer für dich da.«
Ein erleichtertes Seufzen entfuhr mir. »Das ist gut zu wissen. Ich danke Ihnen.«
»Du wirst entlassen, weil du bereit dazu bist, vergiss das nicht. Dir droht keine Gefahr mehr.«
Ich nickte gedankenverloren, als ich an ein Gespräch kurz vor meiner Entlassung zurückdachte. Ein Polizeibeamter hatte sich dazu bereit erklärt, mir Auskunft über den Fall meiner Familie zu geben. Er meinte, dass die Beweise auf einen Raubdiebstahl hindeuteten und dass in meiner ehemaligen Nachbarschaft noch zwei weitere Male auf dieselbe Weise eingebrochen worden war. Allerdings ohne Todesopfer.
Ich konnte es einfach nicht fassen. Die Polizei hatte die Ermittlungen zwar nicht eingestellt, aber ihre Anstrengungen, den Mörder meiner Eltern zu finden, waren geradezu lächerlich.
Sie haben doch den Tatort gesehen!
Das war etwas Persönliches, nicht nur ein dummer Raubüberfall!
Es steckt garantiert mehr hinter dem Ereignis, und sobald ich hier raus bin, werde ich herausfinden, wer und was genau.
Ein Gutes hatte die Sache allerdings: Ich schwebte laut den Beamten nicht mehr in direkter Gefahr, da die Täter es offenbar nur auf die Beute abgesehen hatten. Das Wissen erleichterte mich keineswegs, aber es schien meinen Arzt zu beruhigen, also beließ ich es dabei.
Ich konnte nicht aufhören, daran zu denken, dass meine Eltern vielleicht einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen waren. Wären sie möglicherweise noch am Leben, wenn sie früher zur Arbeit aufgebrochen wären?
Ich schüttelte den Kopf und damit die Vergangenheit von mir. Diese ganzen Überlegungen änderten nichts an der Wirklichkeit, an der Realität. Was jetzt zählte, war die Gegenwart und meine Entlassung. Mein Start in eine neue Zukunft. Meine Suche nach dem Mörder.
»Ich wünsche dir viel Glück. Erinner dich immer daran, dass Licht und Dunkelheit nie allein existieren können. Sie finden ihre Balance und erschaffen so das Leben. Die dunklen Zeiten gehören genauso dazu wie die hellen. Nur du allein entscheidest, was du mit diesem Wissen anfängst. Nutze es weise.« Zwinkernd kehrte Doktor Brown mir den Rücken zu und verließ mein Zimmer. Ich schaute ihm lange hinterher, bis mir einfiel, warum ich vorhin so in Eile gewesen war.
Neuer Tatendrang packte mich, weshalb ich meinen Koffer eilig vom Bett hob und ihn hinter mir her durch den Gang zog. Das Klackern der Rollen zerriss die allgegenwärtige Stille der Klinik und trieb mich dazu an, das Tempo zu erhöhen. Ich schwebte geradezu auf den Ausgang zu und musste mich zurückhalten, um nicht durch die Vordertür hinauszusprinten.
Eine Schwester erwartete mich und übergab mir die Entlassungspapiere, während sie betonte, was für einen beachtlichen Fortschritt ich geleistet hatte. Meine Vorfreude steigerte sich bei jedem ihrer Worte mehr, da ich mich tatsächlich gewappnet für die Welt da draußen fühlte.
»Dein Onkel und deine Tante erwarten dich. Sie konnten dich leider nicht persönlich abholen, haben aber ihr Einverständnis gegeben, dass wir uns um die Angelegenheit kümmern. Die Klinik stellt dir den Transport zu deinem neuen Zuhause selbstverständlich bereit. Sie übernehmen die Haftung für alles, was auf der Fahrt passieren könnte, schließlich bist du noch minderjährig.« Das Lächeln der Schwester wirkte plötzlich ein wenig matter und auch ich spürte die Zweifel in mir aufkeimen.
Die Klinik hatte mich vor Wochen darüber informiert, dass sie nahe Verwandte von mir ausgemacht hatten, die nicht allzu weit von meinem ehemaligen Wohnort entfernt lebten. Einen Onkel und eine Tante.
Die Fremden hatten zugestimmt, mich aufzunehmen, und, soweit ich wusste, das Sorgerecht für mich beantragt. Sie hatten mich mehrmals in der Klinik besucht, nachdem ich die zweite Phase meiner Rehabilitation absolviert hatte. Da das Ehepaar hauptsächlich mit meinem Psychiater gesprochen hatte, konnte ich sie währenddessen in Ruhe beobachten und einschätzen.
Die fremden Gesichter sahen keinem meiner Elternteile besonders ähnlich, worüber ich sehr froh war. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn allein der Anblick meiner Verwandten mich zurück in eine Schockstarre versetzt hätte. Während der Treffen hatte ich es allerdings nicht gewagt, ihnen in die Augen zu sehen und ihre Universen zu untersuchen.
Obwohl die beiden einen netten Eindruck gemacht hatten und gewillt waren, mir ein neues Zuhause zu bieten, nagte die Unsicherheit an mir. Ich kannte sie nicht.
Was, wenn sie sich kurzfristig umentscheiden würden?
Was, wenn sie mich plötzlich nicht mehr in ihrem Leben haben wollen?
Was, wenn sie realisieren, dass ich einen ganzen Berg Probleme in ihren zuvor sicher unkomplizierten Alltag schleppen würde?
Also presste ich die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen und sprach mir Mut zu, indem ich behauptete, dass alles besser war als eine Welt aus weißen Wänden. Ich ließ mein Gefängnis hinter mir, als ich durch die gläsernen Türen trat und auf den Krankenwagenfahrer zuging, der mich mürrisch erwartete. Er hievte mein Gepäck in den Wagen und wartete darauf, dass ich einstieg. Meine Hand umfasste den Türgriff, bevor ich ein letztes Mal zurückschaute und mein Blick die Fassade der Klinik emporkroch.
Wehmut erfasste mich, als ich das Gebäude so betrachtete. Dieser Ort hatte mich vor meinem seelischen Untergang bewahrt. Die Menschen hier hatten mir geholfen, über die schwierigste Zeit in meinem Leben hinwegzukommen. Ich hatte das Gefühl, dass dankbare Worte nicht ausreichten, um zu empfinden, wie sehr ich in ihrer Schuld stand. Dank ihnen habe ich begriffen, dass mein Leiden keine Schwäche war, die mich beherrschte, sondern ein Kampf, an dem ich wachsen konnte.
So kehrte ich schließlich dem Gebäude den Rücken zu und stieg in den Krankenwagen, der in gemächlichem Tempo in Richtung Hauptstraße fuhr. Im Rückspiegel wurde die Klinik immer kleiner und verschwand schließlich gänzlich.
Lediglich zwei Stunden Fahrzeit trennten mich von meinem Onkel und meiner Tante, meinem neuen Zuhause.
Vorfreude glühte in meinem Inneren und entwickelte sich zu einer schwachen Flamme.
Ich wollte die neu gewonnene Freiheit genießen. Zwei unendlich lange Monate hatte ich in der Spezialklinik verbracht und kaum etwas ohne Begleitung oder Erlaubnis getan. Meine Hände ballten sich zu Fäusten. Aus der Flamme wurde ein schwelendes Feuer, das mich in Brand setzte und meine Gedanken befeuerte.
Nun war die Zeit der Einsamkeit vorbei und ich schwelgte in bisher unerfüllten Hoffnungen. Ich würde wieder Luft zum Atmen haben und nicht mehr durch die Wände der Klinik eingeengt werden. Mein Alltag würde eine 180-Grad-Wende vollführen. Ein vollkommen neues Leben lag vor mir. Eines, das ich neu kreieren und gestalten konnte.
Ein Lächeln zuckte an meinen Mundwinkeln. Ich konnte es in der Spiegelung der Scheibe erkennen und spürte eine kleine Welle des Stolzes über mich schwappen. Ein ehrliches Lächeln. Das war mir lange Zeit unglaublich schwergefallen.
Allerdings wurde mir in diesem Moment eine bittere Tatsache klar:
Ich muss meine Fähigkeiten für mich behalten.
Einzig und allein meine Eltern haben davon gewusst und sie haben dieses Geheimnis mit ins Grab genommen. Dieses Wissen könnte auch meine Tante und meinen Onkel in Gefahr bringen.
Bis ich den Mörder meiner Eltern nicht ausfindig gemacht habe, darf niemand von dem Seelenlesen erfahren.
Ich konnte ja nicht ahnen, wie meine Verwandtschaft auf meine Gabe reagieren würde. Sie würden mich garantiert unter Verschluss halten. Oder noch schlimmer: Sie schickten mich vielleicht zurück in die Psychiatrie, weil sie nicht verstanden, was mit mir los war. So weit würde ich es nicht kommen lassen. Ich lächelte verschwörerisch vor mich hin, während das Auto mich in die Richtung meines neuen Lebens lenkte.
Mein Blick schweifte über die Landschaft, das kleinwüchsige Gebirge vor uns und den Nadelwald, der von dichten Nebelschwaden umwabert wurde.
Ich kurbelte das Autofenster hinunter, um die frische Waldluft in mich aufzusaugen und die angenehme Kühle des Winters über die Haut streichen zu lassen. Die Kälte wusch die Erinnerungen an die letzten Monate für einen Moment hinfort.
Währenddessen fuhren wir quälend langsam eine steile Piste hinauf, deren Fahrbahn sich wie eine Schlange aus der Stadt hinaus wand. Ich fieberte dem Moment entgegen, in dem wir die Kuppe erreichten und auf dem höchsten Punkt des winzigen Berges angelangt sein würden. Sobald ich spürte, dass die Steigung des Hügels nachließ, stemmte ich mich von meinem Sitz ab und reckte den Hals.
Wir hatten die Nebelwand durchbrochen. In der Senke vor uns sammelte sich ein Meer aus dunklem Dampf und tauchte alles in einen undurchdringlichen Dunst. Irgendwo dort unten, zwischen den Schwaden versteckte sich mein neues Heim und somit auch meine Zukunft.
Ich fiel in den harten, unbequemen Ledersitz zurück und wartete gespannt auf das, was auf mich zukommen würde. Meine Handflächen begannen zu jucken und ich knetete die Finger durch, allerdings half nichts gegen meine Nervosität. Der Fahrer quittierte mein Verhalten lediglich mit einer hochgezogenen Augenbraue. Er fixierte mich im Rückspiegel, weshalb ich unruhig auf meinem Sitz herumrutschte. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass er wusste, wie es in meinem Inneren aussah.
In Wahrheit weiß er nichts über mich.
Er hat keine Ahnung von meiner Gabe oder meiner Vergangenheit. Er vermutet, aber weiß nichts. Und das ist mein Vorteil.
Ich hatte die Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld schon immer in dem Glauben leben lassen, mich zu kennen, damit sie nicht tiefer bohrten und Geheimnisse ans Tageslicht beförderten, die sie nicht verkraften würden. Fremde mochten zwar ahnen, dass ich anders war, wie sehr ich mich allerdings von ihnen unterschied, war ihnen nicht klar.
Ich seufzte in mich hinein. Die einzigen beiden Personen, die mich wirklich kannten, befanden sich leblos und bis in alle Ewigkeiten verstummt unter der Erde.
Ich war nicht bei der Beerdigung meiner Eltern aufgetaucht. Abgesehen davon, dass mir nie jemand erlaubt hätte, die Klinik zu verlassen, lastete ihr Verlust immer noch auf meinen Schultern. Zu groß war die Furcht gewesen, sie lediglich als Körperhüllen in Erinnerung zu behalten. Ich wollte stattdessen die strahlenden Sterne, Sonnen und Galaxien hinter ihren Augen im Gedächtnis bewahren. Nichts und niemand würde dieses friedliche, liebende Bild von ihnen vertreiben.
Ein sanftes Lächeln schlich sich auf meine Lippen. Ich hatte genug geweint und getrauert. Es wurde Zeit, das Zepter in die Hand zu nehmen und dem Universum zu zeigen, wozu ich fähig war.
Die Welt hat das wahre Antlitz von Stella Marks noch nicht gesehen.
Ich streckte den Rücken durch und hob mein Kinn an, bevor ich mit überraschend selbstsicherer Stimme fragte: »Wann werden wir ankommen?«
Dem Fahrer entfuhr ein Lachen, das einem kehligen Brummen glich. »Wir sind fast da, am Ende dieser Sackgasse befindet sich dein neues Zuhause.«
Ich schluckte und nickte. Nur eine weitere Straße trennte mich von dem neuen Zuhause, den unbekannten Verwandten und einer hoffentlich sorgenfreien Zukunft.
In mir duellierten sich Vorfreude und Nervosität.
Ich befürchtete jeden Moment, einen mittelschweren Herzinfarkt zu erleiden. Die Nervosität gewann gegen ihre nicht ernst zu nehmende Konkurrenz.
Kapitel Drei
Neuanfang
Das Fahrzeug kam stotternd zum Stehen. Ich konzentrierte mich darauf, meine unkontrolliert wippenden Füße still zu halten. Als der Krankenwagenfahrer die Tür öffnete, durchfuhr mich ein unangenehmer Schauder.
Ich atmete tief durch und vertrieb auf diese Weise das Gefühl der Enge in meiner Brust. Schließlich kraxelte ich ein wenig benommen aus dem Auto.
Das läuft doch bis jetzt gar nicht so übel …
Der Mann schaute mich fragend an, als wollte er sich erkundigen, ob ich Hilfe benötigte. Ich lehnte diese entschieden ab. Ich würde schon zurechtkommen. Sein Bedauern und die Hilfestellungen erinnerten mich daran, was ich verloren hatte und warum ich hier war.
Ich würde nicht hadern, nicht zweifeln, wollte nicht länger als schwach angesehen werden.
Diese Zeiten sind ein für alle Mal vorbei.
Unsicheren Schrittes bewegte ich mich auf das Haus zu. Aufgrund seines viktorianischen Baustils wirkte es geradewegs einem Märchen entsprungen. Schnörkel und Ornamente verzierten die Giebel und Balken, die Holzfassade war in einem sanften Grün gestrichen und ein winziges Vordach schützte die Veranda vor Regen. Eine steinige Treppe führte die Erhebung hinauf, auf der das Domizil erbaut worden war. Ein gusseisernes Geländer half mir dabei, das Gleichgewicht zu bewahren. Als ich ein wenig um die Hausecke spähte, erkannte ich, dass in das Haus eine Art Turm eingebaut worden war, der perfekt mit dem Rest des Gebäudes harmonierte. Mir fehlten die Worte. Ich öffnete den Mund und schloss ihn schnell wieder, als ich mir dessen bewusst wurde. Am Rande des Grundstücks erhoben sich mehrere schätzungsweise zehn Meter hohe Tannen, die die Sicht der Nachbarn auf das Haus verhinderten. Kurz stellte ich mir vor, das Anwesen wäre inmitten eines Waldes erbaut worden.
Der Fahrer schien im Gegensatz zu mir sichtlich desinteressiert am Wohnsitz meiner Verwandten und verschwendete keine Sekunde. Er trug den Koffer die Steintreppe hinauf zur Tür, sodass ich mich gezwungen sah, ihm zu folgen.
Als ich vor der Haustür stand, war ich einen Moment lang unschlüssig, was ich tun sollte. Schließlich seufzte der Fahrer auf und presste den Daumen auf die kleine Messingklingel, woraufhin man ein sanftes Klingeln aus dem Inneren des Gebäudes vernahm. Gleich darauf öffnete eine freundlich wirkende Frau die Tür.
Ihre aschblonden Haare lagen ihr in weichen Wellen über den Schultern und die blauen Augen strahlten erfreut. Mir blieb kaum Zeit, das sich darin spiegelnde Universum genauer unter die Lupe zu nehmen, da sie im nächsten Moment mit wehender Schürze auf mich zukam und mich, ohne zu zögern, in die Arme schloss.
Ich war vollkommen überrumpelt. Mit so viel Wärme und Zuneigung hatte ich nicht gerechnet. Schließlich hatten meine Tante und ich uns nur kurz in Gegenwart meines Psychologen gesehen. Ich hatte währenddessen kaum gewagt, sie anzusehen, und nun umarmte sie mich.
Es kam mir vor, als hätte ich in den vergangenen Monaten verlernt, menschlichen Kontakt auszuüben. Das höchste der Gefühle war gewesen, als ich Doktor Brown zu Beginn unserer ersten Sitzung zur Begrüßung die Hand geschüttelt hatte. Jetzt war ich gerade einmal in der Lage, meine Hände unbeholfen hinter dem Rücken der Fremden zu umfassen.
Als die Frau sich eine Armlänge von mir entfernte, vermied ich zunächst aus einem Reflex heraus den Augenkontakt zu ihr.
Sie befeuerte mich ihrerseits sofort mit Phrasen: »Stella! Ich bin so froh, dass du endlich zu uns kommen darfst. Dein Onkel und ich freuen uns schon seit Wochen auf deine Ankunft!«
Die freundliche Stimme umwogte mich wie eine Wolke aus Sternen. Sie klimperte und blinkte in meinem Kopf, als wäre sie eine Melodie aus glänzendem Licht. Ich ertrug es nicht länger, ihre Herzlichkeit abzuweisen, indem ich sie nicht ansah. Deshalb hob ich zögernd die Lider, bis unsere Blicke sich ineinander verhakten. Zum ersten Mal, seitdem wir uns im Behandlungszimmer meines Arztes kennengelernt hatten. Ihr überraschter Gesichtsausdruck entging mir nicht, aber daran war ich gewöhnt. Sie musste meine seltsame Augenfarbe bemerkt haben.
Jeder Gedanke an meine eigenen Augen rückte in den Hintergrund, als ich die ihren ansah. In ihren Pupillen strahlte jeweils eine gigantische Sonne. Sie leuchteten so stark, dass ich mich von ihrer Wärme ohne Gegenwehr ummanteln ließ.