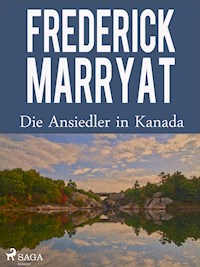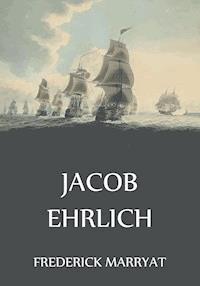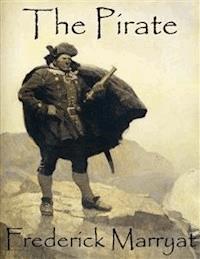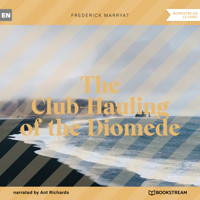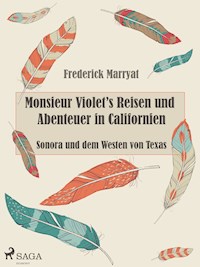
Monsieur Violet's Reisen und Abenteuer in Californien, Sonora und dem Westen von Texas E-Book
Frederick Marryat
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der wohlhabende Fürst Seravalle gelangt bei seiner Weltreise an die amerikanische Westküste und lernt die Indianer des Stammes der Shoshonen kennen. Beeindruckt von ihrer Lebensweise und ihrem angeborenen Adel beschließt er, sein Vermögen dem Wohle der Indianer zu widmen. Sein Freund Violet schließt sich ihm an, und an dessen Seite reist auch sein zwölfjähriger Sohn, der Ich-Erzähler, von Frankreich in das unerschlossene Amerika. Dort wächst er heran und erlebt zahlreiche Abenteuer unter den Indianerstämmen der Rocky Mountains und von Kalifornien bis Texas. Er lebt unter Comanchen und Apachen, kämpft mit Pumas, hat Auseinandersetzungen mit spanischen Siedlern, erlebt Kriege der Texaner gegen die Indianer hautnah mit, jagt Büffel und Bären und erlebt zahllose weitere Abenteuer. Der in den 1830er Jahren spielende Abenteuerroman ist ein früher Vertreter der Wildwestliteratur und eine echte Entdeckung nicht nur für Western- und Indianerfans.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 732
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frederick Marryat
M. Violet’s Reisen und Abenteuer
Californien, Sonora und dem Westen von Texas
Neu aus dem EnglischenvonDr. Carl Kolb
Saga
Vorwort.
Es ist unnöthig, dem Leser mitzutheilen, in welcher Weise ich mit dem Manne bekannt wurde, aus dessen Notizen und Bemerkungen ich das vorliegende Werk zusammengetragen habe. Ueber die Richtigkeit und Glaubwürdigkeit dessen, was mein Berichterstatter behauptet, unterhalte ich keinen Zweifel, da ich ihn während der ganzen Zeit, die ich auf gegenwärtige Schrift verwendete, zur Seite hatte und mir somit Gelegenheit gegeben war, Erläuterungen einzuholen und Verbesserungen vorzunehmen.
Wir besitzen viele Werke über die Indianerstämme im Norden von Amerika, ihre frühere Geschichte und ihre gegenwärtigen Verhältnisse; die Stämme des Westens sind aber nur sehr unvollkommen bekannt. Letztere bestehen hauptsächlich aus den Pawnees, Schwarzfüssen, Krähen, Comanches, Apaches, Arrapahoes, Wakoes und Shoshones, von denen nur die drei ersteren bis jetzt besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Die Comanches wurden zwar von Mr. Catlin besucht, über ihre Sitten oder ihre Geschichte ist jedoch wenig bekannt. Auch über die Apaches und Arrapahoes fehlen Beschreibungen, obschon man mit ihnen bereits in Berührung gekommen ist, während man dagegen von Wakoes gar nichts weiss und die Shoshonen bloss von Ross Cox und Mr. Catlin als ein mächtiger Stamm bezeichnet werden, ohne dass jedoch diese Berichterstatter aus eigener Einsichtnahme sprechen könnten.
Die Pawnees, Schwarzfüsse und Krähen gehören zu der Algonquin-Raçe, während die übrigen Stämme, welche man füglich die Beduinen der grossen westlichen Wüsten nennen kann, unserer Erzählung zufolge ursprünglich von den Shoshones oder — wie sie gewöhnlich genannt werden — Schlangenindianern abstammen.
Diese Schrift enthält, wie man finden wird, viele werthvolle Belehrungen, nicht bloss über die Indianerstämme, sondern auch über Californien, das westliche Texas und die wüsten Prärien im mittleren Amerika, deren Gebiete und Bewohner wir bisher gleich wenig kannten.
Wenn der Leser einen romanhaften Anflug in dieser Erzählung entdeckt, so darf er dies nicht mir zur Last legen. Die vorkommenden Abenteuer sind allerdings romantisch und müssen es schon ihrer Natur nach seyn; indess habe ich den Ton derselben sogar noch gemildert.
Einige Schilderungen, die Naturgeschichte dieser Gegenden betreffend, könnten auffallend erscheinen, aber in unbekannten Ländern muss man sich darauf gefasst machen, auch unbekannten Geschöpfen zu begegnen. Ich kann nur sagen, dass die betreffenden Berichte der strengsten Prüfung unterworfen wurden und dass ich sie nicht nur deshalb, sondern auch um der Achtbarkeit des Mannes willen, der mir die Details lieferte, für vollkommen richtig halte.
Die Ansichten und Bemerkungen, auf welche der Leser gelegentlich treffen wird, rühren gleichfalls nicht von mir her. Ich habe das Werk bloss geschrieben und es für passend erachtet, dieses kurze Vorwort beizufügen, damit man ermessen möge, in wie weit ich für den Inhalt verantwortlich bin oder nicht.
Erstes Kapitel.
Die Revolution von 1830, welche Carl den Zehnten des französischen Thrones beraubte und so viele andere grosse plötzliche Veränderungen herbeiführte, wurde für Viele verderblich, namentlich aber für manche alte Familien, welche dem Hofe zugethan waren und den verbannten Monarchen in seinem Unglücke nicht verlassen wollten. Unter den Wenigen, welchen es gestattet war, Carl des Zehnten Geschick persönlich zu theilen, befand sich mein Vater, ein edler Burgunder, der schon in einer früheren Verbannungsperiode der königlichen Familie von seiner unwandelbaren Treue und Anhänglichkeit an die legitimen Eigenthümer der Krone von Frankreich Beweise abgelegt hatte.
Als der unglückliche König in dem alten Residenzschlosse von Holyrood eine Zuflucht gefunden hatte, sagte mein Vater der Heimath für immer Lebewohl, schloss sich mit mir, seinem einzigen, erst neunjährigen Sohne, dem Gefolge des Monarchen an und liess sich in Edinburg nieder.
Wir weilten nicht lange in Schottland. Carl der Zehnte entschloss sich, seinen Aufenthalt in Prag zu nehmen. Mein Vater reiste voraus, um die nöthigen Vorkehrungen zu treffen, und sobald sich sein Gebieter in der alten Königsstadt niedergelassen hatte, suchte er seinen Schmerz auf Reisen zu vergessen. Trotz meiner Jugend war ich sein Begleiter. Im Laufe von drei Jahren besuchten wir Italien, Sicilien, Griechenland, die Türkei, Aegypten und das heilige Land, worauf wir nach Italien zurückkehrten und ich als zwölfjähriger Knabe dem Erziehungsinstitute der Propaganda zu Rom übergeben wurde.
Für einen Verbannten, der mit glühender Liebe an seinem Vaterlande hängt, gibt es keine Ruhe. Von dem theuren Frankreich ausgeschlossen, konnte mein Vater nirgends einen Ort finden, der ihn seinen Kummer vergessen liess, und er blieb so rastlos und unglücklich, als nur je.
Kurz nach meiner Aufnahme in die Propaganda traf er mit einem alten Jugendfreunde zusammen, den er seit einer Reihe von Jahren nicht mehr gesehen hatte: einst waren beide froh und glücklich gewesen, auf ihrem gegenwärtigen Geschicke lasteten jedoch in gleicher Weise Leiden und Ruhelosigkeit. Dieser Freund war der italienische Fürst Seravalle, den ein nicht minder bitterer Kelch zu Theil geworden. Als Jüngling hatte er tief den moralischen und physischen Zerfall seines Vaterlandes gefühlt und einen Streich zu führen versucht, um es wieder zu seinem früheren Glanze zu erheben. Er trat an die Spitze einer Verschwörung, verwandte einen grossen Theil seiner Reichthümer auf die Verfolgung seines Zieles, wurde von seinen Bundesbrüdern verrathen und fand ein vieljähriges Gefängniss in dem Schlosse San Angelo.
Wie lange seine Gefangenschaft währte, weiss ich nicht anzugeben; wahrscheinlich war sie aber von sehr langer Dauer, denn wenn er in späteren Zeiten hin und wieder von seinem früheren Leben sprach, so bezog er alle Ereignisse auf die Jahre „während welcher er in seinem Kerker oder in dem Hofgefängnisse des Capitols sass,“ auf dem viele seiner Vorfahren ganzen Nationen Gesetze vorgeschrieben hatten.
Endlich wurde der Fürst wieder in Freiheit gesetzt, aber die Gefangenschaft hatte keine Aenderung in seinen Gesinnungen oder Gefühlen hervorgebracht. Seine Liebe zum Vaterlande und der Wunsch einer Wiedergeburt desselben waren noch so kräftig, als je; er trat daher bald an die Spitze der Carbonaris, einer Verbindung, welche in späteren Jahren durch die Beharrlichkeit und die Leiden eines Maroncelli, eines Silvio Pellico und vieler Anderer berühmt geworden ist.
Er wurde abermals entdeckt und festgenommen, diesmal aber nicht dem Gefängnisse überantwortet. Die Regierung fühlte sich zu schwach, und die bekannten freisinnigen Ansichten des Fürsten hatten ihn bei den Trasteverini oder den Bewohnern der nördlich von der Tiber gelegenen Gegenden so beliebt gemacht, dass schon aus Politik weder Gefängnissstrafe noch Todesurtheil erkannt werden konnte. Soviel ich mich erinnere, wurde er auf zehn Jahre verbannt.
Während dieses langen Exils wandelte der Fürst Seravalle über verschiedene Theile des Erdballs und kam endlich nach Mexico. Er verweilte in Verakruz und reiste dann in’s Innere, um die Trümmer der alten Städte in der westlichen Welt zu untersuchen. Von dem Durste nach Wissen und der Liebe zu Abenteuern getrieben, erreichte er endlich die Westküste von Amerika, zog durch Californien und traf endlich auf die Shoshonen oder Schlangenindianer, deren grosses Gebiet sich von dem stillen Weltmeere an bis fast an den Fuss der Rocky Mountains erstreckt. Die Lebensweise und der angeborene Adel dieser Indianerstämme gefielen ihm so sehr, dass er geraume Zeit unter ihnen verweilte und sich zuletzt entschloss, nach Ablauf seiner Verbannung zwar wieder in die Heimath zurückzukehren, ohne sich jedoch in jenem undankbaren Lande niederlassen zu wollen; denn er hatte bloss die Absicht, sein Vermögen zu holen und es zu Nutz und Frommen den Shoshonen zu verwenden. Vielleicht veranlasste den Fürsten Seravalle noch ein anderes gewaltigeres Gefühl, wieder zu den Indianern zurückzukehren, unter denen er so lange gelebt hatte — ich meine den Zauber, welcher ein naturgemässes Leben besonders dann dem Manne der Civilisation bietet, wenn er entdeckt hat, wie hohl und herzlos wir durch die sogenannte Bildung werden.
Kein einziger Indianer, der an einer Schule und unter den üppigen Freuden einer Stadt erzogen wurde, hat je gewünscht, unter den Blassgesichtern seine bleibende Wohnstätte zu nehmen, während im Gegentheile viele Tausende von Weissen, von der höchsten bis zu der niedersten Civilisationsstufe, das Leben unter den Wilden lieb gewannen, unter ihnen weilten und in ihrem Kreise starben, obgleich sie vielleicht hätten Schätze sammeln und wieder in ihre Heimath zurückkehren können.
Dies mag sonderbar erscheinen, ist aber dennoch wahr. Jeder einsichtsvolle Reisende, der einige Wochen in den Wigwams gutmüthiger Indianer zubrachte, wird zugeben, dass er sich sogar während dieses kurzen Aufenthaltes ungemein angezogen fühlte. Wie mag es erst denen ergehen, die Jahre lang unter den Indianern gelebt haben?
Kurz nachdem der Fürst in Italien angelangt war, um seine wohlwollenden Absichten zur Ausführung zu bringen, erneuerte er mit meinem Vater die alte Freundschaft — eine Freundschaft, in früher Jugend geschlossen und so kräftig, dass sie nicht einmal durch ihre entgegengesetzten politischen Ansichten geschwächt werden konnte. Der Fürst befand sich damals zu Leghorn; er hatte ein Schiff gekauft und es mit Ackerbaugeräthen und unterschiedlichen Werkzeugen für häusliche Künste beladen; desgleichen nahm er einige alte Kanonen, eine grosse Anzahl Lütticher Karabiner, Schiesspulver und so weiter, Materialien für Erbauung eines guten Hauses und einige Artikel zur Zierde an Bord. Um diesen ausserordentlichen Aufwand zu bestreiten, hatte er alle seine grossen Besitzungen veräussert. Ausserdem warb er noch Maurer, Schmiede und Zimmerleute an und nahm auch einige seiner früheren Pächter mit sich, die sich gut auf die Kultur des Oelbaumes und des Weines verstanden.
Er war fast ganz zum Aufbruche vorbereitet, als er im Herbst 1833 mit meinem Vater zusammentraf, ihm seine Erlebnisse und künftigen Plane mittheilte und ihn fragte, ob er ihn nicht begleiten wolle. Mein Vater, den als blasé au fond die ganze Welt anwiderte, kam dem Fürsten auf mehr als halbem Wege entgegen.
Unsere Güter in Frankreich waren zur Zeit der Revolution unter grossen Opfern veräussert worden, und so bestand meines Vaters gegenwärtige Habe nur aus Geld und Juwelen. Er beschloss, Alles zu wagen und sich mit dem Fürsten in jenem fernen Lande niederzulassen. Die Ladung, wie auch die Theilnehmer an der Expedition erhielten demnach eine entsprechende Erweiterung.
Der Fürst hatte bereits zwei Priester vermocht, ihn in der Eigenschaft von Missionären zu begleiten. Mein Vater, dem meine Erziehung sehr am Herzen lag, versah sich mit einer grossen Bibliothek und zahlte dem Prior eines Dominikanerklosters eine grosse Summe, dass er einem weiteren würdigen Ordensmanne, der sich gut für die Leitung meiner Erziehung eignete, mitzugehen erlaubte. Zwei von den drei Religiösen, welche an unserer Expedition Theil nahmen, hatten bereits grosse Reisen gemacht und das Zeichen des Kreuzes östlich vom Ganges im Reiche der Birmanen und in Thibet aufgepflanzt.
Um alle Schwierigkeiten zu umgehen, die vielleicht von der Regierung erhoben worden wären, hatte sich Fürst Seravalle der Vorsicht bedient, das Ziel seiner Reise als Guatemala zu bezeichnen, und die Bewohner von Leghorn glaubten seiner Angabe. Guatemala und Acapulco lagen jedoch weit südlich, als wir an dem Orte unserer Bestimmung anlangten.
Endlich war Alles vorbereitet. Mein Vater berief mich von der Propaganda ab — man schiffte zuletzt noch die Rebstöcke und so weiter ein und die Esmeralda trat ihre langweilige, keineswegs sichere Fahrt an.
Zweites Kapitel.
Ich war damals noch nicht dreizehn Jahre alt; aber trotz meiner Jugend hatte ich doch schon viele Reisen gemacht und jene Kenntnisse erworben, die man durch das Auge erlangt — vielleicht die beste Erziehung in den früheren Lebensperioden. Ich übergehe die Einförmigkeit einer Reise, bei der man fast eine Ewigkeit nichts als Himmel und Wasser sieht; sie ging glücklich von statten, denn ich kann mich nicht erinnern, dass wir je in irgend einer bedeutenden Gefahr geschwebt hätten.
Nach fünf Monaten erreichten wir die Küste und gelangten mit einiger Schwierigkeit in die Mündung eines Flusses, der in die Mündung der Trinity-Bay fällt, 41° nördlicher Breite und 124° 28′ Länge.
Wir ankerten ungefähr vier Meilen über der Mündung. Der Fluss liegt dort in der Mitte der Shoshonen-Küste und die Eingebornen besuchen ihn an jener Stelle bei ihren jährlichen Fischerstreifzügen. Zum Gedächtniss unserer Landung erhielt er von den Indianern den Namen: „Nu elejé sha wako“ oder Wegweiser der Fremden.
Die Landungsstelle bildete mehrere Wochen den Schauplatz einer seltsamen Rührigkeit. Der Fürst Seravalle war während seines früheren Aufenthalts als Krieger und Häuptling unter die Shoshonen aufgenommen worden, und jetzt kamen die Indianer schaarenweise aus dem Innern, um den Blassgesichts-Häuptling zu bewillkommnen, der seine rothen Kinder nicht vergessen hatte. Sie halfen uns das Schiff ausladen, versahen uns mit allen Arten von Wild und hatten unter Anweisung des Zimmermanns bald ein grosses Magazin erbaut, in welchem wir unsere Güter und Werkzeuge gegen die Einwirkungen des Wetters schützen konnten.
Sobald wir unsere Ladung untergebracht hatten, machten sich der Fürst und mein Vater, von den Häuptlingen und Aeltesten des Stammes begleitet, auf den Weg, um einen Ort für die Ansiedelung auszuwählen. Während ihrer Abwesenheit wurde ich der Obhut einer Häuptlings-Squaw anvertraut, deren drei hübsche Kinder meine Spielgefährten waren. Nach drei Wochen kehrte die Spähpartie wieder zurück; sie hatte an den westlichen Ufern des Buona-Ventura-Flusses einen Platz ausgelesen, der an dem Fusse eines hohen, kreisförmigen Gebirges lag, wo die verhärtete Lava und der verwitterte Schwefel, der das Gestein bedeckte, auf frühere vulkanische Ausbrüche hindeutete. Längs des Flusses standen hohe, als Bauholz taugliche Bäume, und ganz in der Nähe befanden sich ungeheure Kalksteinbrüche, während die kleineren Ströme einen Thon lieferten, aus welchem sich treffliche Ziegel fertigen liessen.
Die Spanier hatten schon früher diesen Ort besucht und dem Gebirge den Namen „St. Salvador“ gegeben; unsere Niederlassung erhielt jedoch ihre Benennung nach dem indianischen Namen des Fürsten und hiess „Nanawa ashta jueri ê,“ oder Wohnung des grossen Kriegers. Da unser Landungsplatz zur Zeit des Fischens von den Indianern häufig besucht wird, so beschloss man, auch hier ein viereckiges Fort, ein Magazin und ein Bootshaus zu errichten. Sechs oder sieben Monate war Alles in grosser Thätigkeit, als mit einemmal ein Umstand sich ereignete, der unsere Anstrengungen entmuthigte.
Obgleich es im ganzen Lande von Vieh wimmelt und einzelne Stämme, deren ich später erwähnen werde, grosse Heerden besitzen, so wissen die Shoshonen doch durchaus nichts von Viehzucht, deren sie auch recht wohl entrathen können, da ihr ausgebreitetes Gebiet alte Arten von Wild in grosser Menge birgt. Dies war jedoch dem Fürsten nicht genehm, da er einen Ehrgeiz darin suchte, unter dem Stamme Ackerbau und häuslichere Gewohnheiten einzuführen. Er schickte deshalb die Esmeralda ab, um von Monterey oder Santa Barbara Vieh beizuschaffen. Von dem Schiff wurde jedoch nichts mehr gehört. Die Mexikaner gaben an, sie hätten das Wrack eines Schiffes in der Nähe von Cap Mendocino bemerkt, was uns natürlich auf die Vermuthung brachte, dass die Trümmer unserer verunglückten Brigg angehörten.
Ihre Mannschaft war also gleichfalls zu Grunde gegangen, und wir empfanden den Verlust schwer. Sie hatte aus dem Kapitän, seinem Sohn und zwölf Matrosen bestanden; zugleich hatte man auch fünf Personen, die zu unserem Haushalt gehörten, mitgeschickt, um verschiedene Aufträge zu besorgen. Diese waren Giuseppe Polidori, der jüngste unserer Missionäre, einer unserer Büchsenmacher, ein Maurer und zwei italienische Bauern. So traurig übrigens auch diese Schickung war, war sie doch nicht im Stande, die Thätigkeit der Zurückgebliebenen zu mindern. Die Felder wurden gelichtet, Gärten angelegt, und mit der Zeit verwischte sich die Erinnerung an das schmerzliche Ereigniss in der Aussicht einer glücklichen Zukunft.
Sobald wir uns völlig eingerichtet hatten, wurde das Werk meiner Erziehung nach einem neuen Plane wieder aufgenommen, der übrigens viele Aehnlichkeit mit der Erziehungsmethode der Militärschulen in Frankreich hatte, sofern alle meine Freistunden auf Leibesübungen verwendet wurden. Den beiden trefflichen Missionären habe ich viel zu danken, und ich verbrachte mit ihnen manche angenehme Stunde.
Wir waren im Besitze einer sehr grossen und auserlesenen Bibliothek, und unter ihrer Leitung wurde ich bald mit den Künsten und Wissenschaften der civilisirten Welt vertraut. Ich studirte die allgemeine Geschichte, erhielt Unterricht im Lateinischen und Griechischen, und lernte auch bald mehrere neue Sprachen. Meine Lehrer behandelten mit mir vorzugsweise die Geschichte der alten Völker Asiens, um mich in den Stand zu setzen, ihre Theorien zu verstehen und ihren Lieblingsuntersuchungen über den Ursprung der grossen Ruinen im westlichen und mittleren Amerika folgen zu können, wobei meine geringen Kenntnisse, welche ich in der Propaganda vom Arabischen und der Sanscrit-Sprache gewonnen hatte, mit jedem Tage erweitert wurden..
Soviel über die Studien, die ich unter der Anleitung der guten Väter betrieb; der übrige Theil meiner Erziehung war ganz indianisch. Ich wurde der Obhut eines gefeierten alten Kriegers übergeben, der mich den Bogen, den Tomahawk und die Büchse brauchen, den Lasso werfen, das wildeste Pferd lenken und das unbändigste Fohlen zähmen lehrte. Hin und wieder erhielt ich auch Erlaubniss, die Eingebornen auf ihren Jagd- und Fischereiausflügen zu begleiten.
In dieser Weise fuhr ich mehr als drei Jahre lang fort, mich mit Kenntnissen der verschiedensten Art zu bereichern. In der Zwischenzeit erweiterte sich die Colonie allmählig, und es schien alle Aussicht vorhanden zu seyn, die wilden Shoshonen zu einem civilisirteren Leben heranzubilden.
Doch der Mensch denkt, Gott lenkt. Ein weiterer schwerer Schlag betraf den Fürsten, der alle seine Hoffnungen vernichtete. Nach dem Verlust des Schiffes hatten wir ausser den Missionären und uns selbst nur noch acht Weisse in der Colonie, und der Fürst beschloss, sieben davon auszuschicken, um den Einkauf des sehnlich erwünschten Viehes zu besorgen, indem er nur den alten Diener meines Vaters zurück behielt.
Sie traten ihre Sendung an, kehrten aber nicht wieder zurück. Wahrscheinlich wurden sie von Apaches-Indianern erschlagen, obgleich auch der Fall denkbar ist, dass sie uns, der bisherigen einfachen und gleichförmigen Lebensweise müde, verliessen, um sich in den entlegenen Städten Mexiko’s niederzulassen.
Diese zweite Katastrophe drückte schwer auf den Geist des guten alten Fürsten. Alle seine schönen Hoffnungen waren zu Grabe getragen und die Bilder, die er sich für den Abend seines Lebens ausgemalt hatte, für immer zernichtet. Er hatte seinen Stolz darein gesetzt, seine indianischen Freunde von ihrer wilden Lebensweise abzubringen, und dieses Ziel liess sich nur durch Handel und Ackerbau erringen.
Die Felder um die Ansiedlung herum waren nun bereits seit vier Jahren unter Anleitung der Weissen von den Weibern und jungen Indianern bebaut worden. Die Beschäftigung sagte ihnen zwar durchaus nicht zu, aber der Fürst gab die Hoffnung nicht auf, dass die Shoshonen, mit der Zeit durch das gute Beispiel belehrt, die Vortheile des Feldbaues einsehen und veranlasst werden dürften, das Land für sich selbst urbar zu machen.
Vor unserer Ankunft war der Winter für denjenigen Theil der Indianer, welcher nicht mit nach den Jagdgründen ziehen konnte, von grossen Entbehrungen begleitet gewesen, während es jetzt Mais, Kartoffeln und andere Vegetabilien in Fülle gab — wenigstens für die Umwohner der Ansiedelung. Sobald wir aber alle unsere weissen Ackerbauer und Werkleute verloren hatten, mussten wir die Entdeckung machen, dass die Indianer sich vor der Arbeit scheuten.
Alle unsere Bemühungen waren also nutzlos, denn ihre Vortheile zeigten sich noch nicht augenfällig genug, und die versuchte Umwandlung hatte zu kurz gedauert, so dass die guten, aber auch stolzen und trägen Shoshonen das Grabscheit wieder verliessen und in ihre alte Gleichgültigkeit zurückversanken.
Aergerlich über diesen Wechsel, beschlossen der Fürst und mein Vater, einen Aufruf an die ganze Nation ergehen zu lassen, ob man sie nicht vielleicht überzeugen könne, wie weit glücklicher sie seyn würden, wenn sie für ihren Unterhalt auch den Boden bebauten. Es wurde ein grosses Fest gegeben und das Calumet geraucht, worauf sich der Fürst erhob und die Indianer nach ihrer eigenen Weise anredete. Da ich kurze Zeit zuvor als Häuptling und Krieger anerkannt worden war, wohnte ich natürlich gleichfalls der Versammlung bei. Der Fürst sprach:
„Wollt ihr nicht die mächtigste Nation des Westens werden? Ihr wollt es. Wenn nun dies der Fall ist, so müsst ihr die Erde, eure Mutter, um ihren Beistand anflehen. Es ist wahr, dass eure Prairieen von Wild wimmeln, aber die Weiber und Kinder können euch nicht folgen auf dem Jagdpfade.
„Müssen nicht die Krähen, die Bonnaxes, die Flachköpfe und die Umbiquas den Winter über hungern? Sie haben keine Büffel in ihrem Lande und nur wenige Hirsche. Was haben sie zu essen? Ein paar magere Pferde, vielleicht einen Bären und das stinkende Fleisch der Fischotter oder Biber, welche sie in der geeigneten Jahreszeit mit Schlingen fangen.
„Würden sie sich nicht überglücklich schätzen, ihr Pelzwerk gegen den Mais, den Tabak und die guten getrockneten Fische der Shoshonen auszutauschen? Jetzt verkaufen sie ihre Felle an die Yankees, aber die Yankees bringen ihnen keine Nahrungsmittel. Die Flachköpfe nehmen das Feuerwasser und die Decken von Händlern, aber sie thun es nur deshalb, weil sie nichts Anderes bekommen können und ihre Felle verderben würden, wenn sie dieselben für sich behielten.
„Würden sie nicht lieber mit euch tauschen, da ihr ihnen viel näher seyd? Ihr würdet ihnen gute Nahrung geben, damit sie mit ihren Kindern den Winter über leben und während des langen Schnees, während der traurigen Monate der Dunkelheit ihre Weiber und Greise erhalten könnten.
„Wenn nun die Shoshonen für die Pelze Mais und Tabak geben könnten, so würden sie reich werden; sie erhielten die besten Sättel von Mexiko, die besten Büchsen von den Yankees, die besten Tomahawks und Decken von den Kanadiern. Wer könnte dann den Shoshonen widerstehen? Wenn sie jagen wollten, würden hunderte von den übrigeu Eingeborenen den Waldpfad für sie lichten oder mit ihren Händen das Gras ausraufen zu einem Weg in der Prairie. Ich habe gesprochen.“
Alle Indianer erkannten an, dass seine Rede gut sey und voll Weisheit; aber sie waren zu stolz, um zu arbeiten. Ein alter Häuptling antwortete daher für den ganzen Stamm:
„Nanawa Ashta ist ein grosser Häuptling; er ist tapfer! der Manitou spricht sanft zu seinen Ohren und lehrt ihn das Geheimniss, welches das Herz eines Kriegers gross oder klein macht. Aber Nanawa hat ein blasses Gesicht — sein Blut ist fremdes Blut, obgleich sein Herz stets ist bei seinen rothen Freunden. Doch nur der weisse Manitou spricht mit ihm, und wie vermöchte der weisse Manitou die Natur der Indianer zu kennen? Er hat sie nicht geschaffen, ruft sie nicht zu sich, gibt ihnen nichts, lässt sie arm und elend, und behält Alles für die Blassgesichter.
„Es ist auch ganz Recht, dass er so handelt. Der Panther wird nicht säugen das Junge der Hirschkuh, noch wird der Falke sitzen auf den Eiern der Taube. Es ist Leben, es ist Ordnung, es ist Natur. Jeder hat für die Seinigen zu sorgen, für weiter nicht. Mais ist gut, Tabak ist gut, er erfreut das Herz der alten Männer, wenn sie betrübt sind. Tabak ist das Geschenk der Häuptlinge an die Häuptlinge. Das Calumet spricht von Krieg und Tod; es spricht aber auch von Frieden und Freundschaft. Der Manitou machte den Tabak ausdrücklich für den Menschen — er ist gut.
„Aber Mais und Tabak müssen von der Erde genommen werden; man muss sie bewachen viele Monde, und sie pflegen wie Kinder. Dies ist eine Arbeit, die nur für Weiber und Sklaven passt. Die Shoshonen sind Krieger und frei. Wollten sie in der Erde graben, so würde ihr Gesicht schwach werden, und ihre Feinde würden sagen, sie seyen Maulwürfe und Dächse.
„Wünscht der gerechte Nanawa, dass die Shoshonen verachtet werden von den Krähen oder den Reitern im Süden? Nein! er hat gefochten für sie, ehe er hinging, um zu sehen, ob die Gebeine seiner Bäter wohlbehalten seyen; und gab er ihnen nicht nach seiner Rückkehr Büchsen und Pulver, lange Netze, um den Salm zu fangen, und Eisen in Menge, um ihre Pfeile für die Büffel ebenso fruchtbar zu machen, als für die Umbiquas?
„Nanawa spricht gut, denn er liebt seine Kinder; aber der Geist, der zu ihm flüstert, ist ein Blassgesichtsgeist, der nicht zu sehen vermag unter die Haut eines rothen Kriegers, denn sie ist zu zäh: auch nicht in sein Blut, denn es ist zu dunkel.
„Und doch ist der Tabak gut, desgleichen auch der Mais. Die Jäger der Flachköpfe und der durchbohrten Nasen würden im Winter kommen und darum betteln. Ihre Felle würden die Hütten der Shoshonen erwärmen und mein Volk würde reich werden und mächtig; sie könnten sich zu Herren machen über das ganze Land, von dem Salzwasser bis zu dem grossen Gebirge, und die Hirsche kämen, um ihre Hände zu lecken, und die wilden Pferde würden weiden um ihre Wigwams. Dies ist die Weise, wie die Blassgesichter reich und stark werden; sie pflanzen Mais, Tabak und süsse Melonen; sie haben Bäume, die Feigen und Pfirsiche tragen; sie mästen Schweine und Ziegen und zahme Büffel. Sie sind ein grosses Volk.
„Ein Rothhautkrieger ist nichts als ein Krieger; er ist stark, aber arm; er ist kein Murmelthier, kein Dachs oder ein Präriehund; er kann nicht den Boden aufgraben; er ist ein Krieger und weiter nichts. Ich habe gesprochen.“
Natürlich stand der Ton, in welchem diese Rede gehalten war, zu sehr im Einklange mit den Vorstellungen der Indianer, um nicht mit Bewunderung aufgenommen zu werden. Der alte Mann setzte sich nieder, worauf sich ein Anderer erhob, um gleichfalls zu sprechen:
„Der grosse Häuptling hat gesprochen; sein Haar ist weiss wie der Flaum des Schwans; seiner Winter sind viele gewesen; er ist weise. Warum sollte ich nach ihm sprechen, da seine Worte wahr sind? Der Manitou hat meine Ohren und meine Augen berührt, als er redete (und er redete wie ein Krieger); ich hörte sein Kriegsgeschrei. Ich sah die Umbiquas in die Sümpfe eilen und wie schwarze Schlangen sich unter das Gebüsch verkriechen. Ich erspähte dreissig Skalps an seinem Gürtel; seine Beinkleider und Moccassins waren genäht mit dem Haar der Wallah Wallahs.1)
„Ich sollte nicht sprechen; ich bin noch jung und habe keine Weisheit; meine Worte sind wenig, ich sollte nicht sprechen. Aber in meinem Gesichte hörte ich einen Geist; er kam herauf mit den Lüften und drang in mein Inneres.
„Nanawa ist mein Vater, der Vater von uns Allen; er liebt uns, wir sind seine Kinder. Er hat einen grossen Krieger der Blassgesichter mit sich gebracht, der ein mächtiger Häuptling war in seinem Stamme; er hat uns einen jungen Häuptling gegeben, der ein grosser Jäger ist; in wenigen Jahren wird er ein grosser Krieger seyn und unsere Jünglinge in den Kriegspfad führen auf die Ebenen der Wachinangoes.2) Der Owato Wanisha3) ist ein Shoshone, obgleich seine Haut blässer ist, als die Blüthe der Magnolie.
„Nanawa hat uns auch zwei Makota Konayas4) gegeben, unsere Jünglinge Weisheit zu lehren; ihre Worte sind süss, sie sprechen zum Herzen; sie wissen Alles und machen die Menschen besser.
„Nanawa ist ein grosser Häuptling und sehr weise; was er sagt, ist recht — was er wünscht, muss geschehen, denn er ist unser Vater und gab uns Kraft, unsere Feinde zu bekämpfen.
„Er hat Recht: die Shoshonen müssen ihre Wohnungen gefüllt haben mit Mais und Tabak. Die Shoshonen müssen stets bleiben, was sie sind und was sie waren — ein grosses Volk. Doch der Häuptling von vielen Wintern hat es gesagt; die Igel und die Füchse mögen die Erde aufwühlen, aber die Augen der Shoshonen sind immer ihren Feinden zugekehrt in den Wäldern oder den Büffeln in den Ebenen.
„Dennoch soll der Wille von Nanawa geschehen, aber nicht durch einen Shoshonen. Wir wollen ihm geben genug Weiber und Hunde; wir wollen ihm Sklaven bringen von den Umbiquas, den Cayusen und den Wallah Wallahs. Sie sollen den Mais und den Tabak pflegen, während wir jagen oder weitere Sklaven holen, sogar bis in den grossen Gebirgen, oder bei den Hunden des Südens, den Wachinangoes. Ich will die Cochenille5) schicken meinen jungen Kriegern; sie werden ihr Gesicht bemalen und mir folgen auf den Kriegspfad. Ich habe gesprochen!“
Ein solches Ende hatten die Hoffnungen, das wilde Volk, unter dem wir lebten, zum Ackerbau heranzubilden; es nahm mich übrigens nicht Wunder; denn so, wie sie waren, fühlten sie sich glücklich. Was hatten sie auch sonst noch nöthig ausser ihren reinlichen, kegelförmigen Hütten aus Fellen, ihrem guten, gemächlichen und hübschen Anzug, und ihren hübschen, tugendhaften und treuen Weibern? Hattten sie nicht ein unbegränztes Feld auf den Prairieen vor sich? Waren sie nicht die Herren über Millionen von Elendthieren und Büffeln? — Sie bedurften nichts, als Tabak. Und doch war es Schade, dass es uns nicht gelang, ihnen Geschmack an der Civilisation beizubringen. Sie waren von Natur Gentlemen — wie überhaupt fast alle Indianer, wenn sie nicht dem Trinken ergeben sind, hatten eine sehr gute Erziehung und trugen das unzweideutige Siegel des Adels auf ihrer Stirne.
Die Berathung wurde abgebrochen, da sowohl die christlichen als politischen Grundsätze des Fürsten Seravalle unmöglich dem Gedanken Raum geben konnten, die Sklaverei auszudehnen. Er beugte sich demüthig unter den Willen der Vorsehung und bemühte sich, durch andere Mittel das hohe Ziel zu erreichen, den Geist dieser reinen, edlen Wilden zu erleuchten.
Drittes Kapitel.
Diese zeitweilige Auflösung unserer landwirtschaftlichen Niederlassung fiel in’s Jahr 1838. Bis dahin hatte ich, die letzten paar Monate ausgenommen, meine Zeit ausschliesslich unter meine civilisirten und uncivilisirten Lehrer getheilt. Trotz meiner besseren Bildung war ich aber doch ein Indianer, nicht nur in meinem Anzuge, sondern auch in meinem Herzen.
Ich habe bereits erwähnt, dass ich bei der von dem Fürsten zusammenberufenen Berathung anwesend war, da ich bereits unter die Häuplinge gehörte, obgleich ich erst siebenzehn Jahre zählte. Meine Aufnahme wurde durch folgenden Fall veranlasst.
Als wir Kunde von der Ermordung oder dem Verschwinden der sieben Weissen erhielten, welche der Fürst zu Beischaffung von Vieh nach Monterey geschickt hatte, wurde ein Haufen abgesandt, um der Spur der Vermissten zu folgen und auszukundschaften, was aus ihnen geworden sey. Auf meine Bitte wurde der Befehl über diesen Streifzug mir anvertraut.
Wir setzten über die Buona-Ventura und verfolgten die Fährte unserer Weissen zweihundert Meilen weit aufwärts; nun aber verloren wir dieselbe und fanden mit einemmale unser nur aus fünfzehn Mann bestehendes Häuflein von ungefähr achtzig Krähen, unsern unversöhnlichen Feinden, umringt.
Durch List gelang es uns, nicht nur durchzubrechen, sondern auch sieben der Gegner zu überrumpeln. Meine Begleiter wollten sie auf der Stelle tödten, was ich aber nicht zugab; wir banden sie daher auf ihre eigenen Pferde fest und beeilten uns, so gut wir konnten, obschon die Krähen uns entdeckt hatten und Jagd auf uns machten. Wir hatten fünfzehn Tage zu reisen, bis wir wieder in der Heimath anlangten, und wurden von einem Feinde verfolgt, der uns an Zahl sieben- oder achtmal überlegen war. Durch listige Wendungen, bei denen ich nicht verweilen will, und die Güte unserer Pferde gelang es uns, ihnen zu entwischen und unsere Gefangenen wohlbehalten in die Ansiedelung zu bringen. Zum Kampfe war es nun allerdings nicht gekommen, aber Gewandtheit gilt gleichfalls als eine gute Eigenschaft. Ich wurde daher bei meiner Rückkehr unter die Häuptlinge aufgenommen und erhielt den indianischen Namen Owato Wanisha oder Geist des Bibers, durch den meine Schlauheit und Hurtigkeit angedeutet werden sollte. Damit jedoch der Rang eines Kriegerhäuptlings auf mich übertragen werden könne, war es durchaus nöthig, dass ich mich auf dem Schlachtfelde ausgezeichnet hatte.
Ehe ich in meiner Erzählung fortfahre, muss ich Einiges über meine Lehrer, die Missionäre, bemerken. Der Jüngste davon, Polidori, ging mit der Esmeralda zu Grunde, als er von Monterey Vieh holen wollte; die Anderen waren der Padre Marini und Padre Antonio — beide sehr talentvolle und gelehrte Männer. In den asiatischen Sprachen waren sie ungemein bewandert, und mit Entzücken folgte ich ihren Untersuchungen und den verschiedenen Theorien, welche sie in Betreff einer frühen Auswanderung der Indianer über das stille Weltmeer aufstellten.
Beide waren geborene Italiener. Sie hatten viele Jahre unter den westlich vom Ganges wohnenden Völkern zugebracht und waren in ihrem vorgerückten Lebensalter nach dem sonnigen Italien zurückgekommen, um in der Nähe des Ortes zu sterben, wo sie einst als Kinder spielten. Als sie jedoch mit dem Fürsten Seravalle zusammentrafen und von den wilden Stämmen hörten, unter denen er gelebt hatte, so hielten sie es für ihre Pflicht, denselben das Evangelium zu bringen und sie zu unterrichten.
So traten diese edlen Männer — alt, hinfällig und mit einem Fusse schon im Grabe — auf’s Neue der Mühesal und Gefahr entgegen, um unter den Indianern die Religien der Liebe und des Erbarmens zu verbreiten, deren Dienste sie sich geweiht hatten.
Bei den Shoshonen waren jedoch ihre Bekehrungsversuche vergeblich, denn die Indianer haben einen ganz eigenen Charakter. Falls sie nicht leidend sind oder unterdrückt werden, mögen sie auf das nicht hören, was sie „die glatten Honigworte der Blassgesichtweisen“ nennen, und wenn es doch einmal geschieht, so fechten sie jedes Dogma, jeden Glaubenspunkt an und bleiben unüberzeugt. Die Missionäre beschränkten sich deshalb mit der Zeit darauf, Werke der Barmherzigkeit zu üben, indem sie durch ihre ärztlichen Kenntnisse den Kranken Beistand leisteten und durch moralische Lehren den ungestümen, bisweilen grausamen Charakter dieses wilden, ununterrichteten Volkes milderten.
Zu den Vortheilen, welche die Shoshonen unseren Missionären verdankten, gehörte auch die Einführung der Vaccination. Anfangs waren sie freilich sehr misstrauisch dagegen und leisteten sogar heftigen Widerstand; endlich gewann aber doch die Einsicht der Indianer die Oberhand, und ich glaube nicht, dass nach unserer Ansiedelung auch nur Ein Shoshone geboren wurde, ohne dass ihm die Kuhpocken eingeimpft worden wären. Die Padres Marini und Polidori unterwiesen die eingebornen Heilkünstler in dem Verfahren, das jetzt allenthalben geübt wird.
Ich kann hierorts die Geschichte der wackern Missionäre zu Ende bringen. Als ich einen Streifzug nach Monterey machte, dessen Einzelnheiten ich demnächst angeben werde, wurde ich von Padre Marini begleitet; denn da ihm sein Bekehrungsgeschäft unter den Shoshonen nicht glücken wollte, so glaubte er in den spanifchen Ansiedelungen von Californien nützlich werden zu können. Bald nach unserer Ankunft zu Monterey trennten wir uns, und ich habe seither nichts mehr von ihm gesehen oder gehört, obgleich ich noch Gelegenheit haben werde, aus Anlass unserer Reise nach dieser Stadt und unseres dortigen Aufenthalts von ihm zu sprechen.
Der Andere, Padre Antonio, starb in der Ansiedelung vor meinem Zuge nach Monterey, und die Indianer bewahren noch jetzt seine Kleidung, sein Messbuch und ein Cruzifix als die Reliquien eines edeln Mannes. Der arme Padre Antonio! Ich hätte wohl die Geschichte seines früheren Lebens kennen mögen. Auf seinen Zügen lag der Stempel einer tiefen Schwermuth; es mochte ihr wohl irgend ein herzbrechender Kummer zu Grunde liegen, den die Religion zwar zu mildern, aber nicht zu beseitigen im Stande war.
Nach seinem Tode nahm ich Einsicht von seinem Messbuch. Die weissen Blätter waren vorn und hinten mit frommen Betrachtungen beschrieben, enthielten aber ausserdem noch ein paar Worte, welche über eine gewisse Periode seines Lebens mehr sagten, als ganze Bände. Die ersten Worte lauteten: „Julia, obiit, A. D. 1799. Virgo purissima, Maris stella. Ora pro me.“ Auf dem folgenden Blatte stand: „Antonio de Campestrina, Convient. Dominicum. In Roma, A. D. 1800.“
Er war alfo nach dem Tode eines ihm theuren Wesens in’s Kloster gegangeu — vielleicht seine erste und einzige Liebe. Der arme Mann! wie oft habe ich nicht grosse Thränen über seine welken Wangen niederrinnen sehen! Doch er ist heimgegangen und sein Kummer ruht im Grabe. Auf der letzten Seite des Messbuches befanden sich ebenfalls zwei Linien von zitternder Hand — wahrscheinlich kurz vor seinem Tode geschrieben: „J, nunc anima anceps; sitque tibi Deus misericors.“
Trotz des bisherigen Fehlschlagens gab der Fürst Seravalle seine Plane dennoch nicht auf. Dem Rathe meines Vaters zufolge wollte man nun versuchen, einige Mexikaner und Canadier herbeizuziehen, damit sie dem Feldbau neuen Aufschwung gäben; denn ich darf hier wohl bemerken, dass sowohl der Fürst, als mein Vater, längst den Entschluss gefasst hatten, unter den Indianern zu leben und zu sterben.
Dieser Auftrag sollte durch mich zur Ausführung gebracht werden. Es stand mir ein langer Ausflug bevor, denn wenn es mir in Monterey nicht gelang, meinen Zweck zu erreichen, so sollte ich entweder mit einer Partie von Apaches-Indianern, die mit den Shoshonen stets im Frieden lebten, oder mit einer der mexikanischen Karavanen nach Santa Fé gehen.
In Santa Fé gab es stets eine grosse Anzahl von Franzosen oder Canadiern, die alljährlich im Auftrage der Pelzwerk-Kompagnien von Saint Louis herkamen, so dass wir einige Aussicht hatten, Leute für uns zu gewinnen. Wären meine Bemühungen jedoch fruchtlos, so sollte ich, da ich dann bereits zu weit gegangen sey, um allein zurückkehren zu können, mit den Pelzhändlern von Santa Fé auf dem Mississippi nach St. Louis ziehen, dort einige werthvolle Juwelen verkaufen, Leute zu Bildung einer starken Karavane miethen und auf der Astoria-Fährte unsere Ansiedelung wieder aufsuchen.
Da übrigens meine Abenteuer so zu sagen erst mit dem Antreten dieser Sendung beginnen, so will ich, ehe ich die Geschichte derselben gebe, den Leser einen Blick in die Geschichte und Ueberlieferungen der Shoshonen oder Schlangenindianer thun lassen, unter denen ich trotz meiner Jugend doch schon zu Rang und Würden gelangt war.
Viertes Kapitel.
Die Shoshonen oder Schlangenindianer sind ein tapferes und zahlreiches Volk; sie bewohnen einen grossen und schönen Landstrich, der von Osteu nach Westen fünfhundertundvierzig und von Norden nach Süden beinahe dreihundert Meilen breit ist. Ihr Gebiet liegt zwischen 38° und 43° nördlicher Breite und erstreckt sich von 116° westlich von Greenwich bis zu den Küsten des stillen Meltmeers, also nahe bis zu 125° westlicher Länge. Das Land ist reich und fruchtbar, namentlich in der Nähe der zahlreichen Ströme, wo der Boden bisweilen eine tiefrothe, an andern Stellen aber eine ganz schwarze Farbe hat. An Abwechslung fehlt es nicht, und obgleich der grösste Theil unter die Klasse der sogenannten wellenförmigen Prairieen gehört, so gibt es doch auch sehr viel Waldung, namentlich an den Flüssen und in den Niederungen, während die Landschaft überhaupt malerisch wird durch die zahlreichen, phantastisch gestalteten Gebirge, die durchaus nicht mit einander zusammenhängen und schon vermöge ihrer ursprünglichen Formationen grosse Verschiedenheit bieten.
Fast überall findet man Massen von gediegenem Kupfer, und zwischen zwei Bergketten, die sich parallel von den Flüssen Buona-Ventura und Calumet in westlicher Richtung hinziehen, sind nur zwei oder drei Fuss unter der Oberfläche reiche Lagen von Bleiglanz. Schwefel und Magnesia liefern die nördlichen Districte in Fülle, während in dem Sand der südlichen Flüsse Goldstaub vorkömmt, der gelegentlich von den Indianern gesammelt wird. Das Land wird von drei edlen Strömen durchzogen — der Buona-Ventura, dem Calumet und dem Nu-elije-sha-wako oder Fremdenfluss, während zwanzig kleinere Flüsse mit ungestümem Geräusch von den Gebirgen herabstürzen, bis sie in die Prairieen eintreten, wo sie glatt in langen Schlangenlinien zwischen blumigten Ufern und unter dem dichten Laubwerk der westlichen Magnolie hingleiten. Die Ebenen sind, wie bereits bemerkt, sanft wellenförmig und bilden vortreffliche, natürliche Weiden von Moskitogras, blauem Gras und Klee, auf welchen sich zahlreiche Heerden von Büffeln und Mustangs oder wilden Pferden in ruhiger Sicherheit nähren, aus der sie nur zur Jagdjahreszeit aufgeschreckt werden.
Die Shoshonen6) sind ohne Frage ein sehr altes Volk. Es würde unmöglich seyn, zu sagen, wie lange sie sich schon in diesem Theile des Festlandes niedergelassen haben. Der Schnitt ihres Gesichtes deutet auf asiatischen Ursprung und ihre zierliche, bilderreiche Redeweise erinnert an die anmuthige Abwechslung von Sadis herrlichsten Gedichten.
Ein Beleg von ihrem Alter und fremden Ursprunge gibt der Umstand, dass nur wenige ihrer Ueberlieferungen sich auf ihre dermaligen Wohnplätze beziehen, sondern auf Länder jenseits des Meeres hindeuten, wo ewiger Sommer herrscht, die Bevölkerung zahllos ist und die Städte aus grossen Palästen bestehen, die, ähnlich den Ueberlieferungen der Hindus, „lange vor der Schöpfung des Menschen von guten Geistern gebaut wurden“.
Es unterliegt keinem Zweifel, und ist auch von den übrigen Stämmen zugegeben, dass die Shoshonen den Urstamm der Comanches, Arrapahoes und Apaches, dieser Beduinen der mexikanischen Wüsten, bilden. Sie sprechen alle dieselbe schöne und harmonische Sprache, haben die gleichen Ueberlieferungen und zerfielen erst so kürzlich in ihre Unterabtheilungen, dass sie die Perioden der Trennung mit verschiedenen Ereignissen der spanischen Binnenland-Eroberungen im nördlichen Theile von Sonora in Verbindung bringen können.
Es ist nicht meine Absicht, lange bei speculativen Theorien zu verweilen; indess muss ich doch bemerken, dass Ueberlieferungen, denen man Vertrauen schenken darf, von Nationen oder Stämmen ausgehen müssen, welche durch unvordenkliche Zeiten feste Wohnsitze gehabt haben. Dass das nördliche Festland Amerikas zuerst von Asien aus bevölkert wurde, kann wohl nur wenig beanstandet werden, und wenn dies der Fall ist, so liegt die Voraussetzung nahe, dass diejenigen, welche zuerst herüberkamen, die vordersten und passendsten Gebiete einnahmen. Die Einwanderer, welche nach ihrer Landung auf ein Clima und einen Strich, wie in Californien, trafen, brachen wahrscheinlich nicht wieder auf, um einen besseren zu suchen. Dass ein Aehnliches auch bei den Shoshonen der Fall war, dass sie Abkömmlinge der frühestesten Einwanderer sind und dass sie nie das Gebiet verliessen, wo sich ihre Vorfahren angesiedelt hatten, wird durch alle ihre Traditionen bestätigt.
Gegen die Berichte, welche Missionäre und Reisende über eine wenig bekannte Volksraçe erstatten, müssen wir vorsichtig seyn, da sie selten mit den besseren und höheren Classen, welche geeignete Auskunft zu ertheilen wissen, in Berührung kommen. Sichere Kenntnisse werden weniger dadurch, dass man ihren Stamm aufgenommen, sondern vornehmlich durch den Umstand gewonnen, dass man als Häuptling in ihre Aristokratie eintritt.
Setzen wir den Fall, dass ein Fremder nach Wapping oder an einen andern englischen Ort käme und die nächsten Besten über die Religion, die Gesetze und die Geschäfte von England ausfragen wollte, so würde er nur sehr ungenügende Berichte erhalten; in ähnlicher Weise verhält es sich mit den Missionären und Reisenden unter diesen Nationen, die nur selten weiteren Zutritt erhalten. Unter den besseren Classen der Indianer müssen wir also Auskunft über ihre Geschichte, ihre Ueberlieferungen und ihre Gesetze suchen, und was ihre Religion betrifft, so wird ein Fremder nie in ihre Lehrsätze eingeweiht werden, wenn er nicht in früher Jugend unter das Volk selbst geräth und ein Angehöriger desselben wird.
Mögen die Missionäre in den Berichten an ihre Gesellschaften sagen, was sie wollen, so machen sie doch keine Bekehrungen, etwa die geheuchelte eines landstreicherischen Trunkenboldes ausgenommen, und derartige Menschen gehören ohnehin schon zu den Auswürflingen ihrer Stämme.
Die Ueberlieferungen der Shoshonen bestätigen vollkommen meine Annahme, dass ihre Altvorderen zu den frühesten asiatischen Einwanderern gehörten; sie berühren die Geschichte späterer Wanderzüge, gegen welchen die ersten Ansiedler einen schweren Kampf zu bestehen hatten, um ihre Gebiete zu behaupten, sprechen von der Zerstreuung der neuen Emigranten nach Norden und Süden und geben Bericht über die Ausbreitung der Bevölkerung, wodurch einzelne Theile der Stämme veranlasst wurden, weiter im Osten ihr Auskommen zu suchen.
Wie sich erwarten lässt, finden wir, dass die Traditionen der östlichen Stämme, welche hin und wieder vor ihrem Erlöschen gesammelt wurden, unbedeutend und abgeschmackt sind. Der Grund liegt darin, dass sie nach dem Osten gedrängt wurden und dort auf andere Indianerstämme trafen, welche vor ihnen nach diesen Gegenden vertrieben wurden und sich bereits dort angesiedelt hatten; so begann denn alsbald ein Leben voll anhaltender Feindseligkeit und beharrlichen Wechsels der Wohnstätte. Wenn aber ein Volk durch viele Generationen hindurch unausgesetzt Krieg führt und wandert, so liegt die Annahme ganz nahe, dass ein so bewegtes Leben der Fortpflanzung von Volkssagen keinen Raum gibt und letztere am Ende für den Stamm verloren gehen müssen.
Wenn wir also nach zuverlässigen Berichten forschen wollen, müssen wir sie dort suchen, wo die Bevölkerung seit unvordenklichen Zeiten ihre Wohnstätte nicht gewechselt hat, und um eine wahrscheinliche Geschichte dieser grossen, kriegerischen Völker, ihrer Erhebung und ihres Falles zu schreiben, hat man die Thatsachen im Südwesten des Oregon, desgleichen in den nördlichen Theilen von Californien und Sonora zu sammeln. Die westlichen Apachen oder die Shoshonen bieten mit ihren Alterthümern und den Trümmern eines entschwundenen Ruhmes dem forschenden Geiste ein ergreifendes Interesse, während in ihrer bilderreichen Ausdrucksweise derjenige, welcher in den asiatischen Sprachen bewandert ist, leicht den alten Ursprung entdecken wird.
Es ist merkwürdig, wie allgemein sich Ueberlieferungen unter Nationen verbreiten, welche die Wohlthat der Buchdruckerkunst entbehren. Auch in Europa war zuverlässig vor dieser grossen Entdeckung die grosse Masse weit besser mit ihrer alten Geschichte vertraut, als es in unsern Tagen der Fall ist, denn damals gingen die Ueberlieferungen von Familie zu Familie über; es war die geheiligte Pflicht eines jeden Hausvaters, sie ebenso unverfälscht seinem Sohne mitzutheilen, als sie von seinen Vorfahren auf ihn gekommen waren. Ebenso verhält sich’s bei den Indianern, welche in einer langen Periode ihre Heimath nicht gewechselt haben. Während der Jagdjahreszeit, in den langen Abenden des Februars, theileu die Stammältesten den jungen Kriegern alle ihre geschichtlichen Ueberlieferungen mit, und würde ein Gelehrter einer derartigen „Vorlesung über die Vergangenheit“ anwohnen, so müsste er zugeben, dass in Harmonie, Beredtsamkeit und logischem Vortrage ein Rothhautredner nicht leicht zu übertreffen ist.
Die Shoshonen besitzen klare Hindeutungen auf die fernen Länder, aus denen sie eingewandert sind. Ueber die Zeit dieses Ereignisses schweigen sie; indess müssen sie doch unter die ersten Ankömmlinge gehört haben, denn sie schildern mit grosser topograpischer Genauigkeit all’ die blutigen Kämpfe, welche sie gegen spätere Einwanderer zu bestehen hatten. Oft geschlagen, wurden sie dennoch nie erobert und haben stets den Boden behauptet, den sie von Anfang an für sich ausgelesen.
Ungleich den grossen Familien der Dahcotahs und Algonquins, welche noch die vorherrschenden Züge der wandernden Nationen im südwestlichen Asien bewahren, scheinen die Shoshonen in allen Perioden ein kriegerisches Volk gewesen zu seyn, das jedoch nie seinen Wohnsitz wechselte. Reich waren sie nie, und ebenso wenig befanden sie sich je im Besitz sonderlicher Kenntniss von Künsten und Wissenschaften. Ihre Traditionen über die frühere Heimath sprechen von reichen, gebirgigen Gegenden mit balsamischen Lüften und Bäumen, welche schöne und süsse Früchte trugen; wenn sie aber grosse Städte, Paläste, Tempel und Gärten berühren, so geschieht es stets in Beziehung auf andere Nationen, mit welchen sie in beharrlichem Kriege lebten; daraus möchten wir schliessen, dass sie Abkömmlinge der Mantschu-Tartaren sind.
Zu beiden Seiten der Buona-Ventura liegen auf ihrem Gebiete viele grossartige Ueberreste zerstörter Städte; obgleich nun diese mit einer früheren Periode ihrer Geschichte im Zusammenhange stehen, wurden sie doch nicht von den Shoshonen erbaut.
Die Fontainen, die Aquäducte, die grossen Kuppelgebäude und die langen anmuthigen Obelisken, die an dem Fusse massenhafter Pyramiden in die Höhe steigen, deuten unzweifelhaft auf die lange Anwesenheit eines sehr civilisirten Volkes; auch mögen die Berichte der Shoshonen über diese geheimnissvollen Ueberreste dem Forscher als Schlüssel zu der merkwürdigen Thatsache dienen, dass tausend ähnliche Ruinen überall auf dem ganzen amerikanischen Festlande gefunden werden. Ich gebe im Nachstehenden eine Schilderung von Ereignissen aus einer sehr ferneren Periode, wie sie von einem alten, weisen Shoshonen während der Jagdjahreszeit in den Prairie-Abendlagern erzählt wurde:
„Es ist schon lange, lange her — als die Pferde noch unbekannt waren in Lande7) und bloss der Büffel die weiten Ebenen durchstreifte; damals gab es noch riesige, schreckliche Ungeheuer. Die Zugänge zu den Bergen und Forsten wurden von den bösen Geistern gehütet,8) während die Seeküste, von ungeheuren Eideren bewohnt,9) oft der Schauplatz schrecklicher Kämpfe war zwischem dem Menschen, dem ältesten Sohne des Lichts, und den gewaltigen Kindern der Nacht und der Finsterniss. Damals hatte auch das Land, in dem wir jetzt leben, eine andere Gestalt. Funkelnde Steine wurden in den Flüssen gefunden; die Gebirge hatten noch nicht ausgespieen ihre glühenden Eingeweide und der grosse Herr des Lebens zürnte noch nicht mit seinen rothen Kindern.
„In einem Sommer — und es war ein schrecklicher — blieb der Mond (das heisst die Sonne) lange Zeit stehen; er war von rother Blutfarbe und gab weder Nacht noch Tag. Takwantona, der Geist des Bösen, hatte die Natur überwunden und die weisen Männer der Shoshonen sagten viel schweres Unglück voraus. Die grossen Aerzte erklärten, dass das Land bald getränkt werden würde mit dem Blute seines Volkes. Sie baten umsonst und opferten, gleichfalls ohne Erfolg, zweihundert ihrer schönsten Jungfrauen auf den Altären des Takwantona. Der böse Geist lachte und antwortete ihnen nur mit seinem zerstörenden Donner. Die Erde bebte und riss entzwei; die Wasser hörten auf, in den Flussbetten zu strömen, und grosse Massen von Feuer und brennendem Schwefel wälzten sich von den Gebirgen herunter, Tod und Entsetzen mit sich bringend. Wie lange dies währte, welcher Lebende vermöchte es zu sagen? Da stand der blutige Mond — es war weder Licht noch Dunkel, und wie hätte der Mensch Zeit und Jahreszeit unterscheiden können? Es dauerte vielleicht nur das Leben eines Wurms, vielleicht aber auch das lange Alter einer Schlange.
„Der Kampf war furchtbar, aber endlich zerbrach der gute Herr des Lebens seine Fesseln. Die Sonne schien wieder. Es war zu spät! Die Shoshonen lagen im Staube und ihr Herz war klein geworden. Sie waren arm und hatten keine Wohnungen; sie waren wie der Hirsch in den Prairieen, gehetzt von dem hungrigen Panther.
„Und ein fremdes, zahlreiches Volk landete an den Ufern des Meeres. Es war reich und stark, deshalb machte es die Shoshonen zu seinen Sklaven und baute grosse Städte, wo es seine ganze Zeit zubrachte. Menschenalter verschwanden. Die Shoshonen waren Weiber — sie jagten für die mächtigen Fremden; sie waren Lastvieh, denn sie schleppten Holz und Wasser zu ihren grossen Wigwams; sie mussten fischen für ihre Herren, während sie selbst hungerten in der Mitte des Ueberflusses. Wieder entschwanden Menschenalter. Die Shoshonen konnten es nicht mehr ertragen, sondern entliefen in die Wälder, auf’s Gebirge und an die Küsten des Meeres. Und siehe! der grosse Vater des Lebens lächelte ihnen wieder; die bösen Geister wurden alle zerstört und die Ungeheuer in den Sand begraben.
„Sie wurden bald stark und grosse Krieger; sie griffen die Fremden an, zerstörten ihre Städte und trieben sie wie Büffel, weit nach dem Süden, wo die Sonne immer brennt, und von wo aus sie nicht mehr zurückkehrten.
„Seit dieser Zeit sind die Shoshonen ein grosses Volk gewesen. Oft und vielmal sind wieder Fremde gekommen, aber sie waren arm und klein an Zahl, konnten also leicht getrieben werden nach dem Osten und Norden in die Länder der Krähen, der Flachköpfe, der Wallah-Wallahs und der Jal-Alla-Pujees (der Calapusen).“
Ich habe diese Tradition aus Vielen gewählt, da sie, die bildliche Ausschmückung abgerechnet, einen sehr richtigen Leitfaden für die Geschichte der Shoshonen in früheren Perioden zu geben scheint. Sogar der Umstand des Zugeständnisses, dass sie eine Zeit lang Sklaven jener Volksraçe waren, welche die Städte bauten, deren Trümmer noch jetzt Zeugniss ablegen von ihrer Grösse — bildet einen kräftigen Beweis für die Verlässlichkeit der Angabe im Allgemeinen. Auf die gegenwärtigen Shoshonen und ihre Gebräuche werde ich in einem spätern Theile meiner Erzählung zurückkommen
Fünftes Kapitel.
Sobald Alles vorbereitet war, erhielt ich meine schliesslichen Weisungen, nebst Briefen an den Gouverneur von Monterey, denen noch ein schwerer Beutel von Dublonen für meine Ausgaben beigefügt war. Ich verabschiedete mich von dem Fürsten und meinem Vater, schiffte mich mit sechs wohlbewaffneten Indianern und dem Padre Marini in einem langen Kanoe auf der Buona-Ventura ein, wurde von der Strömung fortgetragen und verlor bald unsere einsame Ansiedelung aus dem Gesichte.
Wir mussten dem Strome folgen bis zu den südlichen Seen der Buona Ventura, wo wir unsere Indianer entliessen und uns einigen Halbzucht-Wachinangoes anschlossen, welche in den Prairieen Mustangs, oder wilde Pferde, gefangen hatten und nun mit denselben nach Monterey zürückkehrten.
Der Ausflug war wunderschön. Der Frühling hatte eben begonnen und beide Flussufer waren mit Immergrün bekleidet; das Gras wuchs üppig und in allen Richtungen sahen wir ungeheure Heerden von Büffeln und wilden Pferden weiden. Bisweilen galoppirte ein edler Hengst mit fliegender Mähne und wehendem Schweife bis an’s Wasser herunter und sah uns nach, als sey er neugierig, unsere Absichten zu erfahren; hatte er uns dann zur Genüge beaugenscheinigt, so kehrte er langsam wieder zurück, aber dennoch von Zeit zu Zeit nach uns hinsehend, wie wenn er doch noch nicht ganz überzeugt wäre, ob uns zu trauen sey.
In der dritten Nacht lagerten wir an dem Fusse eines Obelisken in der Mitte einiger edlen Ruinen. Sie waren für die Shoshonen ein geheiligter Ort. Ihre Traditionen erzählten ihnen von einer andern Raçe, welche früher hier gelebt hatte, von ihnen aber nach dem Süden getrieben worden war. Dieses letztere Ereigniss muss schon vor Jahrhunderten stattgefunden haben, denn die Hand der Zeit, so mild in diesem Klima, und die Hand des Menschen, wie wenig sie auch hier nach Beute begierig ist, hatte diese Stadt schwer heimgesucht.
Wir verweilten noch am folgenden Tage an der Stelle, da Padre Marini nach Schnitzwerk oder Hieroglyphen spähen wollte, aus denen er Folgerungen ziehen könnte; aber unsere Bemühungen waren vergeblich und wir konnten nicht länger zögern, da wir fürchteten, die Pferdejäger würden vor unserer Ankunft ihr Lager aufbrechen. Wir nahmen daher unsere Reise wieder auf, und unterwegs erging ich mich mit dem heiligen Vater in langen Gesprächen über den hohen Grad von Civilisation, der unter der verloren gegangenen Raçe geherrscht haben musste, da sie so schöne Gebäude zu errichten im Stande war.
In weiteren vier Tagen gelangten wir an das südliche Ufer des St. Jago-Sees. Wir kamen noch in guter Zeit an, entliessen unsere Indianer und setzten, nachdem wir zwei vortreffliche Maulthiere gekauft hatten, unsere Reise in Gesellschaft der Pferdejäger fort, mitten unter Hunderten ihrer Gefangenen, welche laut ihre Bestimmung beklagten und ihre Entrüstung über die Ungerechtigkeit des ganzen gegen sie geübten Verfahrens dadurch ausdrückten, dass sie von hinten und von vorn nach Allem schlugen, was in das Bereich ihrer Hufe kam. Aber trotz diesem sehr unmanierlichen Benehmen unserer Arrestanten langten wir doch am sechsten Abend zu Monterey an.
Der Leser wird im Verlaufe entdecken, dass meine Abenteuer mit dieser Reise nach Monterey ihren Anfang nahmen; ich will ihn daher nur noch erinnern, dass ich um diese Zeit mein achtzehntes Jahr noch nicht erreicht hatte. Ich konnte mich noch des civilsirten Zustandes erinnern, unter dem ich vor meiner Ankunft unter den Indianern geweilt hatte, und da wir auch in der Ansiedelung keiner Gemächlichkeit und Bequemlichkeit entbehrten, so schwebte mir auch noch dunkel vor, was in Italien und anderswo vorgegangen war. Aber ich war ein Indianer geworden und blickte bis zu der Zeit, in welcher mir diese Reise aufgetragen wurde, auf die Schauplätze meiner Jugend nur mit Verachtung zurück.
Dass dieses Gefühl durch den Gedanken, ich werde wohl nie wieder zu denselben zurückkehren, bedeutend genährt wurde, ist mehr als wahrscheinlich; denn von dem Augenblick an, als ich gehört hatte, dass ich nach Monterey gehen sollte, klopfte mein Herz ungestüm und mein Puls verdoppelte seine Schläge. Ich weiss kaum, was ich mir eigentlich dabei vorstellte; soviel ist jedoch gewiss, dass ich mir die Idee von einem irdischen Paradies gebildet hatte.
Nun, wenn auch nicht gerade ein Paradies, so ist Monterey doch gewiss ein sehr angenehmer Ort. Ja sogar jetzt noch gewinnt er in meiner Erinnerung eine Art seltsamen Zaubers, obgleich ich seitdem nüchterner und, wie ich glaube, auch ein wenig weiser geworden bin. Es unterliegt keinem Zweifel, dass ein gewisser Nimbus von Glück sich über diese kleine Stadt verbreitet. Jedermann fühlt sich wohl, Alles singt und lächelt, und jede Stunde ist dem Vergnügen oder der Ruhe geweiht.
Da sieht man nichts von schmutzigen Strassen und einem holperigten Pflaster — keine Fabriken mit ihrem ewigen Rauch — keine Polizeidiener, die sich wie eben so viele Kreuzbuben ausnehmen — keine Cabs oder Omnibus, welche rechts und links den Koth um sich spritzen — vor Allem aber nichts von jenen pünktlichen Geschäftsmännern, die ihren Bestellungen nacheilen, wie Dampfmaschinen pustend, Jedermann mit ihren Ellenbogen imkommodirend und die Apfelstände umwerfend. Nein, von alle dem trifft man nichts zu Monterey.
Man hat dort eine endlos tiefe Bay von schönstem Blau, deren Ufer mit hohen, prachtvollen Bäumen bewachsen sind. Ein Prairierasen breitet sich wie ein Teppich aus, dessen Dessin aus allerliebsten wilden Blumen besteht. Darauf befinden sich Hunderte von Hütten, von den Ranken des Weinstocks überwachsen. Im Mittelpunkte steht das Präsidio oder Gouvernementgebäude, auf der einen Seite ein anmuthiger Kirchthurm, auf der andern die starken Mauern eines Klosters. Ueber das Ganze breitet sich ein Himmel vom tiefsten Kobaltblau, einen angenehmen Gegensatz bildend gegen das dunkle Grün der hohen Fichten und die unbestimmten, nicht zu schildernden Tinten an dem Horizont der Prairieen im Westen.
Selbst die Hunde sind zu Monterey höflich, und die Pferde, welche allenthalben umherweiden, laufen auf den Reisenden zu, als wollten sie seine Ankunft bewillkommnen. Der Grund davon liegt jedoch in dem Umstande, dass man in jener Gegend einen Beutel Salz am Sattelknopf mitzuführen pflegt, an dem die Thiere ihre Nasen reiben, und es ist klar, dass sie kommen, um sich etwas von dem Inhalte des gedachten Beutels zu erbetteln, von dem sie sehr grosse Liebhaber sind. Mit Menschen und Thieren steht man schnell auf einem vertraulichen Fusse; auch die dort wohnenden Engländer sind, was doch gewiss viel heissen will, zufrieden und sogar die Amerikaner — eine noch wunderbarere Erscheinung — beinahe ehrlich. Welch’ eiu herrliches Klima muss nicht dieses Monterey seyn!
Die dort herrschende Gastfreundschaft ist unbegränzt. „Die heilige Jungfrau segne Dich,“ sagte ein alter Mann zu uns, als wir anlangten; „weile hier und beehre mein Dach.“ Ein Anderer eilte herzu und drückte uns mit vor Wohlwollen funkelnden Augen die Hände. Ein Dritter nahm unsere Maulesel beim Zügel und führte uns nach seiner Thüre, aus der ein halb Dutzend hübscher Mädchen mit blitzenden, dunkeln Augen und langen dünnen Fingern herauskamen, um uns die Sporen und Moccassins abzunehmen.
Königin der Städte in Californien! Schon in deinem Namen liegt Poesie für mich, und so muss es Allen ergehen, welche Ehrlichkeit, Bonhommie, Einfachheit und das dolce far niente lieben.
Ungeachtet der vielen dringenden Einladungen, die wir erhielten, begab sich Padre Marini nach dem Kloster, während ich bei dem alten Gouverneur mein Quartier nahm.
Alles war mir neu und entzückend; denn ich zählte noch nicht achtzehn Jahre, und in diesem Lebensalter hat man seltsame Träume und Vorstellungen von schlanken Taillen und hübschen, schalkhaft lächelnden Gesichtern. Mein Geist war hin und wieder zurückgekehrt zu den Auftritten der Vergangenheit, als ich noch eine Mutter und eine Schwester hatte. Dann seufzte ich nach einer Gespielin, mit der ich tanzen und walzen konnte auf dem Rasen, während unser grauhaariger Diener auf seiner Violine einige veraltete en avant deux spielte.
Jetzt hatte ich Alles dies gefunden, und es war eine fröhliche Zeit. Allerdings half der Beutel mit Dublonen wunderbar mit. Eine Woche nach meiner Ankunft hatte ich mir einen prächtigen, mit Silber ausgelegten Sattel, statt meiner Tuchbeinbekleidung Sammthosen, einen Federhut, glänzende Schuhe, einen rothen Sammtgürtel und den grossen Kapuzenmantel angeschafft, der bisweilen für Sommer und Winter, für Tag und Nacht das einzige Gewand eines west-mexikanischen Grand ausmacht. Ich sage, es war eine fröhliche Zeit, und ich wusste mich trefflich darein zu schicken.
Ich tanzte, sang und machte den Hof. Mein alter Reisegefährte, der Missionär, machte mir zwar Vorstellungen, aber die Mädchen lachten über ihn, und ich setzte ihm klärlich aus einander, dass er Unrecht habe. Wenn meine englischen Leser nur wüssten, welch’ ein süsses, allerliebstes kleines Ding ein Mädchen in Monterey ist, so würden Alle ihre Bündel schnüren, nach Californien gehen und dort heirathen. Und doch wäre es Schade, denn mit ihren falschen Begriffen von Camfort, mit ihrer Vorliebe für Kohlenfeuer und ungare Beefsteaks, zugleich mit ihren finsteren Ansichten von Schicklichkeit, würden sie den Ort bald verderben und ihn so steif und düster machen, als nur ein sektirerisches Dorf in den vereinigten Staaten seyn kann, das neben seinen neun Banken, seinen achtzehn Kapellen und seiner einzigen ABC-Schule ein so ungeheures, steinernes Gefängniss hat, dass es die ganze Einwohnerschaft beherbergen könnte.
Der Gouverneur war der General Morreno, ein alter Soldat von ächt castilischem Stamme — stolz auf sein Blut, auf seine Töchter, auf sich selbst, auf seine Würden, kurz auf Alles, aber demungeachtet voll Wohlwollen und Gastfreundlichkeit. Sein Haus stand Allen offen (das heisst, so fern sie sich weissen Blutes rühmen konnten) und die Zeit entschwand mir wie ein ununterbrochener Festtag, indem ein Vergnügen dem anderen folgte — die Musik dem Tanze und das Augenspiel dem Kusse, ebenso wie die Limonade dem Wein oder die Crêmes den Trauben und Pfirsichen. Unglücklicherweise hat aber die Natur in unserer Bildung einen Missgriff begangen, und leider muss der Mensch nach dem Vergnügen eben so gut ausruhen, als nach der Arbeit. Das ist recht Schade, denn das Leben ist kurz, und durch den Schlaf wird so viele Zeit verloren; so dachte ich wenigstens, als ich achtzehn Jahre alt war.
Monterey ist eine sehr alte Stadt und wurde im siebenzehnten Jahrhuudert von einigen portugiesischen Jesuiten gegründet, welche hier einen Missionsposten anlegten. Den Jesuiten folgten die Franziskaner, gute, milde, träge und freundliche Leute, die den Scherz liebten, ohne der Sittlichkeit nahe zu treten, gegen Laster und Liebe donnerten, aber doch völlige Absolution ertheilten und leichte Bussen auflegten. Diese Mönche wurden von der mexikanischen Regierung verjagt, weil sie ihren Reichthum zu besitzen wünschte. Es war ein Unglück für Monterey, denn statt der gütigen, gastfreundlichen und edelmüthigen Ordensgeistlichen erschienen Agenten und Beamte der Regierung aus dem Innern, welche durch nichts an ihren neuen Aufenthalt geknüpft waren und sich wenig um das Glück der Bewohner kümmerten. Die Folge davon ist, dass die Californier dieser Bedrücker herzlich müde sind; sie haben einen natürlichen Widerwillen gegen Zollbeamte und können sich namentlich nicht mit dem Gedanken versöhnen, zu Führung der mexikanischen Könige, die für sie kein Interrsse haben, ihre Dollars herzugeben. Eines Morgens — es wäre ihnen beinahe schon einmal gelungen — werden sie die mexikanische Flagge von dem Präsidio herunternehmen, Kommissarien und Zollbeamte fortjagen, sich von Mexiko unabhängig erklären und ihre Hafen allen Nationen öffnen.